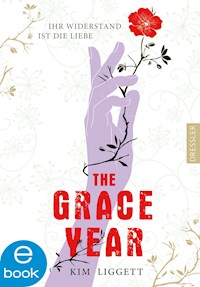
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Niemand spricht über das Gnadenjahr. Es ist verboten." In Garner County heißt es, dass junge Frauen die Macht besitzen, Ehemänner aus ihren Betten zu locken und Jungen in den Wahnsinn zu treiben. Um diese Kräfte zu verlieren, werden sie für ein Jahr in die Wildnis verbannt. Wer zurückkommt, wird verheiratet oder ins Arbeitshaus geschickt. Aber es kommen nie alle lebend zurück. Nur in ihren Träumen ist Tierney James frei, umgeben von Rebellinnen. Doch als ihr Gnadenjahr beginnt, spürt sie erst, wie tief verwurzelt der Hass ist. Denn nicht die Natur oder die tödlichen Wilderer, die ihnen auflauern, sind die größte Gefahr. Es sind die Mädchen selbst. Der sofortige New York Times Bestseller! Absolut fesselnd! TRIBUTE VON PANEM trifft auf THE HANDMAID'S TALE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
In Garner County heißt es, dass junge Frauen die Macht besitzen, Ehemänner aus ihren Betten zu locken und Jungen in den Wahnsinn zu treiben. Um diese Kräfte zu verlieren, werden sie für ein Jahr in die Wildnis verbannt. Wer zurückkommt, wird verheiratet oder ins Arbeitshaus geschickt. Aber es kommen nie alle zurück.
Nur in ihren Träumen ist Tierney James frei, umgeben von Rebellinnen. Doch als ihr Gnadenjahr beginnt, spürt sie erst, wie tief verwurzelt der Hassist. Denn nicht die Natur oder die tödlichen Wilderer, die ihnen auflauern, sind die größte Gefahr. Es sind die Mädchen selbst.
Für die Töchter dieser Welt.
Und für diejenigen, die sie achten.
Eine Ratte in einem Labyrinth kann überall hingehen
solange sie im Labyrinth bleibt.
Margaret Atwood: Der Report der Magd
Vielleicht gibt’s doch ein wildes Tier ...
Vielleicht sind wir’s selbst.
William Golding: Der Herr der Fliegen
Niemand spricht über das Gnadenjahr.
Es ist verboten.
Angeblich besitzen wir die Macht, Männer aus ihren Betten zu locken, Jungen in den Wahnsinn zu treiben und Ehefrauen vor Eifersucht zum Rasen zu bringen. Sie glauben, unsere Haut verströme ein starkes Aphrodisiakum: das wirksame Elixier der Jugend eines Mädchens im Übergang zur Frau. Deshalb werden wir während unseres sechzehnten Lebensjahres verbannt. Wir sollen unsere magischen Kräfte in die Wildnis entlassen, bevor man uns erlaubt, in die Zivilisation zurückzukehren.
Aber ich fühle mich nicht mächtig.
Ich spüre keine Magie.
Über das Gnadenjahr zu sprechen, ist zwar verboten, das hält mich jedoch nicht davon ab, auf Hinweise zu achten.
Ein versehentliches Wort zwischen Liebenden auf der Wiese, eine Furcht einflößende Gutenachtgeschichte, die gar nicht wie eine Geschichte klingt, vielsagende Blicke, eingebettet in die eisigen Lücken zwischen den Plaudereien der Frauen auf dem Markt. Doch sie geben nichts preis.
Die Wahrheit über das Gnadenjahr, über das, was in diesen dunklen zwölf Monaten geschieht, verbirgt sich in den winzigen Teilchen der Staubfäden, die um sie herumschweben, wenn sie sich unbeobachtet glauben.
Aber mir entgeht nichts.
Kein verrutschter Umhang, nicht die vernarbten Schultern, unter dem Herbstmond entblößt.
Ruhelose Fingerspitzen, die über den Teich streichen. Verharren, bis die kleinen Wellen wieder im Dunkel verebben.
Ihre Blicke Tausende Kilometer weit weg. Voller Staunen. Voller Schrecken.
Früher glaubte ich, das sei meine Magie – Dinge sehen zu können, die andere nicht sahen, Dinge, die sie gar nicht wahrhaben wollten. Aber man muss nur die Augen aufmachen.
Meine Augen sind weit offen.
Ich folge ihr durch den Wald. Ein ausgetretener Pfad, den ich schon Hunderte Male gesehen habe. Farn, Frauenschuh, Disteln und auch die geheimnisvolle rote Blume sprenkeln den Weg. Fünf Blütenblätter, perfekt geformt, als wären sie genau für uns gemacht. Eins für die Mädchen im Gnadenjahr, eins für die Ehefrauen, eins für die Arbeiterinnen, eins für die Frauen in den Außenbezirken und eins für sie selbst.
Das Mädchen blickt über die Schulter zu mir zurück, zeigt mir dieses selbstsichere Lächeln. Sie erinnert mich an jemanden, aber weder Gesicht noch Name sind mir präsent. Vielleicht ist es jemand aus einer lang vergessenen Zeit, einem vergangenen Leben, eine jüngere Schwester womöglich, die ich nie kannte. Ein herzförmiges Gesicht, ein kleines rotes Muttermal unter dem rechten Auge. Zarte Gesichtszüge wie ich, dabei ist nichts Zartes an ihr. Im Blick ihrer stahlgrauen Augen liegt wilde Entschlossenheit. Ihre dunklen Haare sind kurz geschoren. Eine Bestrafung vielleicht oder ein Aufbegehren, ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht, aber seltsamerweise weiß ich, dass ich sie liebe. Es ist nicht die Art Liebe, wie mein Vater sie für meine Mutter empfindet – sie ist beschützend und rein wie meine Liebe zu den Drosseln, die ich letzten Winter gepflegt habe.
Wir erreichen die Lichtung, auf der Frauen aus allen sozialen Schichten versammelt sind – die kleine rote Blüte über die Herzen gesteckt. Nirgendwo Zank oder böse Blicke; alle sind in Frieden zusammengekommen. In Eintracht. Wir sind Schwestern, Töchter, Mütter, Großmütter, wir stehen zusammen für eine gemeinsame Sehnsucht, die größer ist als wir selbst.
»Wir sind seit jeher das schwache Geschlecht, aber damit ist Schluss«, sagt das Mädchen.
Die Frauen antworten mit einem urtümlichen Gebrüll.
Doch ich habe keine Angst. Ich spüre nur Stolz. Das ist sie. Das ist das Mädchen, das alles verändern wird, und irgendwie bin ich Teil des Ganzen.
»Dieser Pfad wurde mit Blut getränkt, und zwar mit unserem Blut, aber es war nicht umsonst. Mit dem heutigen Abend endet das Gnadenjahr für immer.«
Während ich den Atem aus der Lunge stoße, merke ich, dass ich nicht im Wald bin, nicht bei dem Mädchen, sondern hier, in diesem stickigen Zimmer, in meinem Bett, wo meine Schwestern mich erwartungsvoll ansehen.
»Was hat sie gesagt?«, fragt Ivy mit glühenden Wangen.
»Nichts«, antwortet June und drückt Ivys Handgelenk. »Wir haben nichts gehört.«
Als meine Mutter ins Zimmer kommt, schubsen mich meine kleinen Schwestern Clara und Penny aus dem Bett. Ich will June stumm dafür danken, dass sie die Situation gerettet hat, aber sie lässt nicht zu, dass unsere Blicke sich treffen. Sie will nicht oder sie kann nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Wir dürfen nicht träumen. Die Männer glauben, wir könnten auf diese Weise unsere Magie verbergen. Allein diese Träume zu haben, würde schon reichen, um bestraft zu werden, aber wenn irgendwer davon erführe, was ich da träume, hieße das den Galgen.
Meine Schwestern führen mich ins Nähzimmer und schwirren um mich herum wie ein Schwarm Spatzen. Drängeln. Zerren.
»Vorsichtig«, keuche ich, als sie gar zu übermütig an meinen Korsettschnüren ziehen. Für sie ist das alles nur Spaß. Sie begreifen nicht, dass schon in ein paar kurzen Jahren sie selbst an der Reihe sein werden. Ich schlage nach ihnen. »Habt ihr denn sonst niemanden, den ihr ärgern könnt?«
»Stell dich nicht so an«, sagt meine Mutter und lässt ihren Ärger an meiner Kopfhaut aus, während sie meinen Zopf zu Ende flicht. »Dein Vater hat dir in den letzten Jahren alles durchgehen lassen – dein Ungestüm, deine schmutzigen Kleider, den Dreck unter den Fingernägeln. Jetzt erlebst du einmal, wie es ist, eine Dame zu sein.«
»Wozu die Mühe?« Ivy präsentiert uns ihren immer runder werdenden Bauch im Spiegel. »Niemand bei klarem Verstand würde Tierney einen Schleier geben.«
»Mag sein«, antwortet meine Mutter, während sie die Korsettschnüre packt und noch fester zuzieht. »Aber wenigstens das ist sie mir schuldig.«
Ich war ein eigensinniges Kind, neugieriger, als es gut für mich war, nichts als Flausen im Kopf, ohne jeden Anstand … um nur einiges zu nennen. Und ich werde das erste Mädchen in unserer Familie sein, das ohne einen Schleier ins Gnadenjahr zieht.
Meine Mutter muss es nicht aussprechen. Jedes Mal, wenn sie mich ansieht, spüre ich ihre Verbitterung. Ihre stille Wut.
»Hier ist es.« Meine älteste Schwester June kommt ins Zimmer zurück. Sie trägt ein leuchtend blaues Kleid aus Rohseide in den Händen, dessen Schalkragen mit Süßwasserperlen besetzt ist. Genau dieses Kleid hatte sie selbst an ihrem Schleiertag vor vier Jahren an. Es riecht nach Flieder und nach Furcht. Weißer Flieder, das waren die Blüten, die ihr Freier für sie ausgesucht hatte – Symbol der jugendlichen Liebe und der Unschuld. Es ist großzügig von ihr, dass sie es mir borgt, aber so ist June. Nicht einmal das Gnadenjahr konnte ihr das nehmen.
Alle anderen Mädchen meines Jahrgangs werden heute neue Kleider tragen, mit Rüschen und Stickereien, nach der neuesten Mode, aber meine Eltern waren nicht so dumm, ihr Geld für mich zu verschwenden. Ich habe keine Chance. Dafür habe ich auf jeden Fall gesorgt.
In diesem Jahr gibt es zwölf heiratsfähige Jungen in Garner County – Jungen, die in eine Familie von Stand und Ansehen geboren wurden. Und es gibt dreiunddreißig Mädchen.
Heute werden wir durch die Stadt ziehen und uns den Jungen ein letztes Mal präsentieren, bevor sie sich zu den Männern in der Hauptscheune begeben, um dort über unsere Schicksale zu verhandeln, als wären wir Vieh. Was der Wahrheit ziemlich nah kommt, wenn man bedenkt, dass wir kurz nach unserer Geburt tatsächlich auf der Fußsohle mit dem Siegel unseres Vaters gebrandmarkt werden. Wenn alle Ansprüche geltend gemacht sind, überbringen unsere Väter den wartenden Mädchen in der Kirche die Schleier, setzen den Auserwählten die durchscheinenden Ungetüme wortlos auf. Und morgen früh, wenn wir alle auf dem Marktplatz aufgereiht stehen, um in unser Gnadenjahr aufzubrechen, wird jeder Junge den Schleier des Mädchens seiner Wahl lüften, als Eheversprechen, während der Rest von uns komplett überflüssig ist.
»Ich wusste, dass du eine gute Figur darin machst.« Meine Mutter schürzt die Lippen, was die feinen Linien um ihren Mund in tiefe Furchen verwandelt. Wenn sie wüsste, wie alt sie dadurch wirkt, würde sie es lassen. Das Einzige, was in Garner County schlimmer ist, als alt zu sein, ist, unfruchtbar zu sein. »Ich werde nie verstehen, warum du deine Schönheit so vergeudest, warum du deine Chance verspielt hast, einen eigenen Haushalt zu führen«, sagt sie, während sie mir das Kleid über den Kopf zieht.
Mein Arm bleibt stecken und ich fange an zu zerren.
»Hör auf, so zu zappeln, sonst wird es noch –«
Das Geräusch reißenden Stoffes sorgt dafür, dass meiner Mutter sichtbar die Hitze den Hals hinaufsteigt und erst an ihrem Kinn haltmacht. »Nadel und Faden!«, blafft sie meine Schwestern an, und die hüpfen schnell davon.
Ich versuche, mich zu beherrschen, aber je mehr ich mich bemühe, umso schlimmer wird es, bis ich laut lospruste. Nicht mal ein Kleid kann ich richtig anziehen.
»Nur zu, lach, soviel du willst, aber wenn dir niemand einen Schleier gibt und du aus dem Gnadenjahr zurückkehrst und direkt ins Arbeitshaus wanderst, um dir die Finger wund zu schufften, vergeht dir noch das Lachen.«
»Besser, als die Ehefrau von irgendwem zu sein«, murmele ich.
»Sag das nicht.« Sie nimmt mein Gesicht zwischen die Hände und meine Schwestern zerstreuen sich in alle Winde. »Sollen sie dich etwa für eine Rebellin halten? Und dich verstoßen? Die Wilderer würden dich liebend gern in die Finger kriegen.« Sie senkt die Stimme. »Du darfst keine Schande über die Familie bringen.«
»Worum geht es denn?« Mein Vater steckt seine Pfeife in die Brusttasche, während er zu einem seiner seltenen Besuche im Nähzimmer auftaucht. Meine Mutter fasst sich rasch wieder und fängt an, den Riss zu flicken.
»Harte Arbeit ist keine Schande«, sagt er und duckt sich, um sie auf die Wange zu küssen. Er riecht nach Jod und süßem Tabak. »Sie kann in der Molkerei oder in der Mühle arbeiten, wenn sie zurückkommt. Das ist völlig respektabel. Du weißt doch, dass unsere Tierney schon immer ein freier Geist war.« Er zwinkert mir verschwörerisch zu.
Ich schaue weg, tue so, als wäre ich von den Tupfen des diffusen Lichts fasziniert, das durch die Vorhänge fällt. Früher waren mein Vater und ich ein Herz und eine Seele. Die Leute sagten immer, er hätte ein gewisses Funkeln in den Augen, wenn er von mir sprach. Bei fünf Töchtern bin ich vermutlich das, was dem heiß ersehnten Sohn am nächsten kommt. Er brachte mir heimlich bei, wie man angelt, wie man mit einem Messer umgeht, wie man auf sich aufpasst. Aber jetzt ist alles anders. Nach dem Abend, an dem ich ihn in der Apotheke dabei überraschte, wie er das Unaussprechliche tat, ist er für mich nicht mehr derselbe. Zweifellos bemüht er sich noch immer um den heiß ersehnten Sohn, dabei hatte ich immer geglaubt, er stünde darüber. Offensichtlich ist er aber genau wie alle anderen.
»Donnerwetter …«, sagt er jetzt in dem Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. »Vielleicht bekommst du doch noch einen Schleier.«
Ich presse die Lippen zusammen, dabei würde ich am liebsten losschreien. Verheiratet zu werden, ist kein Privileg für mich. Annehmlichkeit hat mit Freiheit nichts zu tun. Es ist ein goldener Käfig, sicher, aber immer noch ein Käfig. Im Arbeitshaus gehört mein Leben wenigstens noch mir. Gehört mein Körper noch mir. Aber solche Gedanken bringen mich in Schwierigkeiten, auch wenn ich sie nicht einmal laut ausspreche. Als ich noch klein war, konnte man mir jeden Gedanken vom Gesicht ablesen. Inzwischen habe ich gelernt, mich hinter einem freundlichen Lächeln zu verstecken, aber manchmal, wenn ich mein Spiegelbild anschaue, sehe ich die Wut in meinem Blick aufflackern. Je näher ich dem Gnadenjahr komme, umso heißer lodert das Feuer. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Augen brennen sich direkt durch meinen Schädel.
Als meine Mutter nach dem roten Seidenband greift, um meinen Zopf zusammenzubinden, überkommt mich ein Anfall von Panik. Das ist er. Der Augenblick, in dem ich mit der Signalfarbe markiert werde … mit der Farbe der Sünde.
Alle Frauen in Garner County müssen dieselbe Frisur tragen, die Haare streng aus dem Gesicht gekämmt und am Rücken zu einem Zopf geflochten. Auf diese Weise können sie, so glauben die Männer, nichts vor ihnen verbergen. Keinen spöttischen Gesichtsausdruck, keinen unkeuschen Blick, kein Aufblitzen von Magie. Weiße Bänder für die kleinen Mädchen, rote für die Gnadenjahr-Mädchen und schwarze für die Ehefrauen.
Unschuld. Blut. Tod.
»Perfekt«, sagt meine Mutter und zupft die Schleife zurecht.
Obwohl ich den roten Stoffstreifen nicht sehen kann, spüre ich sein Gewicht und alles, was er symbolisiert, wie einen Anker, der mich in dieser Welt hält.
»Kann ich jetzt gehen?«, frage ich und weiche vor ihren nestelnden Fingern zurück.
»Ohne Begleitung?«
»Ich brauche keine Begleitung«, antworte ich und zwänge meine kräftigen Füße in die feinen Lederschuhe. »Ich komme allein zurecht.«
»Und was ist mit den Fallenstellern aus den Wäldern? Kommst du mit denen auch zurecht?«
»Das war ein einziges Mädchen und es ist schon eine Ewigkeit her.« Ich stöhne genervt.
»Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Anna Berglund«, erwidert meine Mutter und bekommt feuchte Augen. »Es war unser Schleiertag. Als sie durch die Stadt lief, packte er sie einfach, warf sie über sein Pferd und verschwand auf Nimmerwiedersehen in der Wildnis.«
Merkwürdig, am meisten ist mir von dieser Geschichte in Erinnerung geblieben, dass die Männer fanden, sie hätte sich nicht genug gewehrt, obwohl sie quer durch die Stadt geschrien hatte, und dass sie an ihrer Stelle ihre jüngere Schwester bestraften, indem sie sie zu lebenslanger Prostitution in die Außenbezirke schickten. Über diesen Teil des Geschehens spricht bloß niemand mehr.
»Lass sie gehen. Es ist doch ihr letzter Tag«, bittet mein Vater und tut so, als hätte meine Mutter das letzte Wort. »Sie ist es gewohnt, alleine unterwegs zu sein. Außerdem möchte ich ein bisschen Zeit mit meiner schönen Frau verbringen. Ganz ungestört.«
Sie sind offenbar immer noch verliebt, auch wenn mein Vater in den letzten Jahren immer mehr Zeit in den Außenbezirken verbringt. Was mir allerdings ziemlich viel Freiheit verschafft – und dafür sollte ich dankbar sein.
Meine Mutter lächelt ihn an. »Na ja, vielleicht kann es nicht schaden … solange sie nicht vorhat, sich mit diesem Michael Welk in den Wald zu schleichen.«
Während ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen, wird mein Mund plötzlich ganz trocken. Ich hatte keine Ahnung, dass sie davon wusste.
Sie zieht das Mieder meines Kleides herunter, um ihm den richtigen Sitz zu verpassen. »Wenn er morgen Kiersten Jenkins’ Schleier lüftet, wirst du merken, wie dumm das von dir war.«
»Das ist nicht … deshalb haben wir uns nicht … wir sind nur Freunde«, stammele ich.
Die Spur eines Lächelns gleitet in ihre Mundwinkel. »Na gut, wenn du so wild darauf bist, aus dem Haus zu kommen, kannst du ein paar Maulbeeren für das Treffen heute Abend besorgen.«
Sie weiß genau, wie ungern ich zum Markt gehe, vor allem am Schleiertag, wenn ganz Garner County unterwegs ist – aber genau darum geht es ihr scheinbar.
Als sie den Fingerhut abnimmt, um eine Münze aus ihrem Lederbeutel zu nehmen, fällt mein Blick auf ihren Daumen mit der fehlenden Spitze. Sie hat es nie ausgesprochen, aber ich weiß, dass es ein Andenken aus ihrem Gnadenjahr ist. Sie bemerkt meinen Blick und stülpt sich den Fingerhut schnell wieder über.
»Entschuldige«, sage ich und schaue nach unten auf die verblasste Maserung im Holz zwischen meinen Füßen. »Ich hole die Beeren.« Ich würde allem zustimmen, um aus diesem Zimmer zu entkommen.
Als spürte er meine Verzweiflung, nickt mein Vater kaum merklich in Richtung Tür, und blitzschnell verschwinde ich nach draußen.
»Aber bleib in der Stadt!«, ruft meine Mutter mir nach.
Ich weiche Stapeln von Büchern, auf dem Geländer trocknenden Strümpfen und dem Arztkoffer meines Vaters aus und stürme die drei Treppenfluchten hinunter, vorbei an den missbilligenden Blicken der Mägde und endlich aus unserem Reihenhaus hinaus ins Freie. Aber der frische Herbstwind fühlt sich fremd auf meiner nackten Haut an – auf meinem Hals, meinem Schlüsselbein, meiner Brust, meinen Waden. Es ist doch bloß ein bisschen Haut, sage ich mir. Nichts, was sie nicht schon mal gesehen hätten. Aber ich fühle mich entblößt … verletzlich.
Gertrude Fenton, ein Mädchen aus meinem Jahrgang, geht mit ihrer Mutter vorbei. Ich muss unwillkürlich auf ihre Hände schauen, die sich unter zarten weißen Spitzenhandschuhen verbergen. Es lässt mich fast vergessen, was ihr passiert ist. Fast. Trotz ihres Unglücks scheint sogar Gertie auf einen Schleier zu hoffen, darauf, einen eigenen Haushalt zu führen, mit Söhnen gesegnet zu sein.
Ich wünschte, auch ich wollte all das, ich wünschte, es wäre so einfach.
»Frohen Schleiertag!« Mrs Barton mustert mich von der anderen Straßenseite aus und umklammert den Arm ihres Mannes ein bisschen fester.
»Wer ist das?«, fragt Mr Barton.
»Eins der James-Mädchen«, antwortet sie widerwillig. »Die Mittlere.«
Mr Bartons Blick streicht über meine Haut. »Wie ich sehe, setzt ihre Magie langsam ein.«
»Oder sie hat sie bis jetzt gut versteckt.« Mrs Barton fixiert mich wie ein Geier, der an einem Kadaver pickt.
Ich wünsche mir nichts mehr, als mich irgendwie zu bedecken, aber ich gehe nicht zurück ins Haus.
Ich muss es mir wieder in Erinnerung rufen: Die Kleider, die roten Bänder, die Schleier, die Zeremonien – all das dient nur dazu, uns von dem eigentlichen Ereignis abzulenken, das bevorsteht. Dem Gnadenjahr.
Mein Kinn beginnt zu zittern, wenn ich an die zwölf Monate denke, die jetzt kommen, an all das Unbekannte. Aber ich setze ein ausdrucksloses Lächeln auf, als wäre ich froh, meine Rolle zu spielen, damit ich zurückkehren und heiraten und gebären und sterben kann.
Doch nicht alle von uns werden es wieder nach Hause schaffen … nicht in einem Stück jedenfalls.
Während ich versuche, mich zusammenzureißen, überquere ich den Marktplatz, auf dem die Mädchen meines Jahrgangs morgen in einer Reihe aufgestellt werden. Es bedarf weder der Magie noch genauen Hinsehens, um zu begreifen, dass während des Gnadenjahres etwas Tiefgreifendes passiert. Wir haben sie jedes Jahr beobachtet, wenn sie zu ihrem Lager aufbrachen. Obwohl einige von ihnen verschleiert waren, verrieten ihre Hände mir, was ich wissen musste – vor Anspannung wund geknibbelte Nagelhaut, nervös zuckende, kalte Fingerspitzen –, aber sie waren voller Zuversicht … voller Leben. Und bei ihrer Rückkehr waren diejenigen, die überhaupt heimkehrten, abgemagert, schwach … innerlich gebrochen.
Die Kinder machten sich einen Spaß daraus, Wetten abzuschließen, wer es heim schaffen würde, aber je näher mein eigenes Gnadenjahr rückte, umso weniger lustig fand ich es.
»Einen frohen Schleiertag.« Mr Fallow tippt sich höflich an den Hut, doch sein Blick verweilt unangenehm lang auf meiner Haut und auf dem roten Band, das meinen Zopf ziert. Tattergreis Fallow wird er hinter seinem Rücken genannt, weil niemand weiß, wie alt er eigentlich ist. Jedenfalls ist er eindeutig zu alt, um mich so zu mustern.
Sie nennen uns das schwache Geschlecht. Jeden Sonntag wird uns in der Kirche eingebläut, dass Eva an allem schuld sei, weil sie ihre Magie nicht ausgetrieben hat, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Trotzdem kann ich noch immer nicht verstehen, warum die Mädchen nie etwas zu sagen haben. Sicher, es gibt geheime Absprachen, Flüstern im Dunkeln, aber warum dürfen die Jungen alles allein entscheiden? Schließlich haben wir alle ein Herz. Wir haben alle Verstand. Ich sehe nur einen winzigen Unterschied und die meisten Männer denken offenbar sowieso nur mit diesem Körperteil.
Eigenartig, dass sie glauben, Anspruch auf uns zu erheben, unseren Schleier zu lüften, lieferte uns etwas, für das wir während unseres Gnadenjahres leben wollten. Wenn ich während dieser Zeit wüsste, dass ich mich nach meiner Heimkehr jemandem wie Tommy Pearson hingeben muss, würde ich wahrscheinlich lieber gleich zu Beginn der zwölf Monate den Wilderern mit offenen Armen ins Messer rennen.
Eine Amsel landet auf einem Zweig des Bestrafungsbaums in der Mitte des Marktplatzes. Das Kratzen ihrer Krallen auf dem matten Metall jagt mir einen eiskalten Schauer über den Rücken. Angeblich war es früher einmal ein echter Baum, doch als Eva wegen Ketzerei verbrannt wurde, verbrannte er mit ihr, also errichtete man einen Baum aus Stahl. Ein ewiges Symbol für unsere Sünden.
Eine Gruppe Männer geht vorbei, umhüllt von Getuschel. Seit Monaten kursieren Gerüchte … von einer Revolte. Anscheinend haben die Wächter im Wald Spuren geheimer Versammlungen entdeckt. Ausgestopfte Männerkleider, die von Ästen hingen wie Effigien. Anfangs dachten sie, der Aufrührer könnte ein Fallensteller sein, der versucht, die Leute aufzuhetzen, oder eine sitzen gelassene Frau aus den Außenbezirken, die mit jemandem abrechnen wollte, doch dann verbreitete sich Argwohn. Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um eine von uns handeln könnte, aber Garner County ist voller Geheimnisse, einige davon so durchschaubar wie Kristallglas, doch man zieht es vor wegzuschauen. Das werde ich nie verstehen. Ich wüsste lieber die Wahrheit, ganz egal, wie schmerzhaft die Folgen wären.
»Um Gottes willen, Tierney, steh aufrecht!«, schimpft eine Frau im Vorbeigehen. Tante Linny. »Und ohne Begleitung. Mein armer Bruder«, flüstert sie ihren Töchtern zu, laut genug, dass ich jede Silbe verstehe. »Wie die Mutter, so die Tochter.« Sie hält sich einen Stechpalmenzweig vor die erhobene Nase. In der alten Sprache bedeutete er Schutz. Dabei rutscht ihr der Ärmel vom Handgelenk und entblößt einen schrumpeligen rosa Hautstreifen auf ihrem Unterarm. Meine Schwester Ivy hat diese Narbe einmal gesehen, als Tante Linny Husten hatte und Ivy meinen Vater bei seinem Arztbesuch begleitete – sie reicht von ihrer Hand bis hinauf zum Schulterblatt.
Tante Linny zieht rasch den Ärmel wieder herunter. »Sie will sich bestimmt wieder im Wald herumtreiben. Da passt sie auch hin.«
Woher sollte sie wissen, was ich vorhabe, wenn sie mir nicht nachspioniert hat? Schon seit meiner ersten Blutung bekomme ich alle möglichen unerwünschten Ratschläge von ihr. Die meisten davon bestenfalls dämlich. Aber das hier ist schlichtweg gemein.
Tante Linny sieht mich eindringlich an, bevor sie den Zweig fallen lässt und ihren Weg fortsetzt. »Wie schon gesagt, es gibt sehr viel zu bedenken, wenn man einen Schleier vergibt. Ist sie hübsch? Ist sie fügsam? Wird sie Söhne gebären? Ist sie zäh genug, um das Gnadenjahr zu überleben? Ich beneide die Männer nicht. Es ist wirklich ein schwieriger Tag.«
Wenn sie nur wüsste. Ich zertrampele die Stechpalme.
Die Frauen glauben, die Schleier-Versammlung der Männer in der Scheune wäre eine ehrwürdige Sache. Aber ich weiß, dass sie sich täuschen. Die letzten sechs Jahre war ich nämlich mit dabei – ich habe mich auf dem Speicher hinter den Getreidesäcken versteckt. Sie tun nichts anderes, als Bier zu trinken, verdorbene Sprüche loszulassen und sich hin und wieder um eins der Mädchen zu prügeln, aber seltsamerweise ist niemals von unserer »gefährlichen Magie« die Rede.
Die ist eigentlich nur dann ein Thema, wenn es ihnen gelegen kommt. Als zum Beispiel Mrs Pinters Mann starb und Mr Coffey seine Frau plötzlich beschuldigte, ihre Magie seit fünfundzwanzig Jahren heimlich im Schlaf ausgeübt zu haben und durch die Luft geschwebt zu sein. Mrs Coffey war die Demut in Person – kaum jemand, der heimlich durch die Luft schwebt –, trotzdem wurde sie verstoßen. Ohne viele Fragen. Und, Überraschung, tags darauf heiratete Mr Coffey Mrs Pinter.
Brächte ich jedoch jemals eine solche Beschuldigung vor oder käme ich ungebrochen aus meinem Gnadenjahr zurück, würde man mich in die Außenbezirke schicken, um bei den Prostituierten zu leben.
»Sieh einer an, Tierney«, sagt Kiersten und nähert sich mit ein paar ihrer Anhängerinnen im Schlepptau. Ihr Schleiertagskleid ist wahrscheinlich das schönste, das ich je gesehen habe, mit eingewebten Goldstreifen, die in der Sonne glänzen, genau wie ihr Haar. Sie streckt die Hand aus und streicht mit einer Vertrautheit über die Perlen nahe meinem Schlüsselbein, die wir gar nicht teilen. »Dir steht das Kleid deutlich besser als June«, sagt sie und blickt mich durch ihre dichten Wimpern an. »Aber lass sie nicht wissen, dass ich das gesagt habe.« Die Gefolgschaft hinter ihr unterdrückt ein fieses Gekicher.
Die Mädchen in Garner County halten immer Ausschau nach einer Möglichkeit, eine kaum verhohlene Beleidigung auszuteilen – und meine Mutter würde sich wahrscheinlich zu Tode schämen, wenn sie wüsste, dass sie bemerkt haben, dass ich etwas Geerbtes trage.
Ich versuche, das Ganze mit einem Lachen abzutun, aber mein Unterkleid ist so eng geschnürt, dass ich nicht die Luft dazu habe. Es spielt sowieso keine Rolle. Der einzige Grund dafür, dass Kiersten mich überhaupt wahrnimmt, ist Michael. Michael Welk ist schon seit frühester Kindheit mein bester Freund. Früher verbrachten wir unsere ganze Zeit damit, den Leuten nachzuspionieren und irgendwelche Hinweise auf das Gnadenjahr zu suchen, aber irgendwann wurde Michael dieses Spiel leid. Für mich war es jedoch kein Spiel.
Die meisten Mädchen gehen um ihren zehnten Geburtstag herum, wenn ihre Schulausbildung zu Ende ist, auf Abstand zu den Jungen, aber irgendwie hatten Michael und ich es geschafft, Freunde zu bleiben. Vielleicht lag es daran, dass ich nichts von ihm wollte und er nichts von mir. So einfach war das. Natürlich konnten wir nicht mehr in der Stadt umherziehen wie früher, aber wir fanden einen Weg. Kiersten glaubt wahrscheinlich, er würde sich von mir beeinflussen lassen, aber ich mische mich nicht in Michaels Liebesleben ein. Meistens lagen wir abends nur zusammen auf der Lichtung, blickten hinauf zu den Sternen und versanken in unserer eigenen Welt. Das genügte uns offenbar beiden.
Kiersten sorgt dafür, dass die Mädchen hinter ihr still sind. »Ich drücke die Daumen, dass du heute Abend einen Schleier bekommst, Tierney«, sagt sie dann mit einem Lächeln, bei dem mir ganz anders wird.
Ich kenne dieses Lächeln. Es ist dasselbe, mit dem sie letzten Sonntag Pfarrer Edmonds angeschaut hat, als sie merkte, dass seine Hände zitterten, während er die Hostie auf ihre erwartungsvolle rosa Zunge legte. Ihre Magie hat früh eingesetzt und das wusste sie. Sie konnte schon früher grausam sein – auch wenn sie das hinter dem sorgsam aufgesetzten Gesichtsausdruck und den geschickt figurbetonten Kleidern verbarg. Einmal habe ich sie dabei beobachtet, wie sie einen Schmetterling ertränkte und dabei die ganze Zeit mit seinen Flügeln spielte. Trotz ihrer gemeinen Ader ist sie aber eine passende Frau für den zukünftigen Vorsitzenden des Rates. Sie wird sich Michael hingebungsvoll widmen, ihre gemeinsamen Söhne vergöttern und ihm grausame, aber schöne Töchter schenken.
Ich sehe den Mädchen nach, die in perfekter Formation die Straße hinunterschwirren wie ein Schwarm Wespen. Ich frage mich unwillkürlich, wie sie wohl sein werden, fern des Countys. Was wird wohl aus ihrem falschen Lächeln und ihrem eitlen Gehabe? Werden sie verwahrlosen, sich im Schlamm wälzen und den Mond anheulen? Ich frage mich, ob man sieht, wie die Magie deinen Körper verlässt, ob sie blitzartig wie ein Wetterleuchten aus dir verschwindet oder langsam aus dir heraussickert wie ein nach und nach entweichendes Gift. Aber noch ein anderer Gedanke schleicht sich in mein Bewusstsein. Was, wenn überhaupt nichts passiert?
»Das Mädchen … die Versammlung … es ist nur ein Traum«, flüstere ich und grabe mir die frisch polierten Fingernägel in die Handflächen. Zu solchen Gedanken darf ich mich nicht hinreißen lassen. Ich kann es mir nicht leisten, irgendwelchen Kindheitsfantasien nachzuhängen, denn selbst wenn das mit der Magie eine Lüge ist, die Wilderer sind sehr real. Uneheliche Söhne der Frauen in den Außenbezirken – der Verschmähten. Jeder weiß, dass sie da draußen lauern, um sich die Mädchen im Gnadenjahr zu schnappen; dann, wenn ihre Magie angeblich am stärksten ist, um ihr Extrakt als Aphrodisiakum und Jugendelixier auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
Ich blicke auf das gewaltige Holztor, das uns von den Außenbezirken trennt, und frage mich, ob sie wohl schon da sind … und auf uns warten.
Wie zur Antwort streicht der Wind mir über die nackte Haut und ich laufe ein bisschen schneller.
Die Bewohner des Countys haben sich vor dem Gewächshaus versammelt und versuchen zu raten, welche Blume die Freier für welches Gnadenjahrmädchen gewählt haben. Ich bin froh, dass niemand meinen Namen nennt.
Als sich unsere Familien hier ansiedelten, wurden so viele verschiedene Sprachen gesprochen, dass die Sprache der Blumen die einzige gemeinsame war. Ein Mittel, um jemandem Tut mir leid, Viel Glück, Ich vertraue dir, Ich mag dich zu sagen, oder auch, um ihm Schlechtes zu wünschen. Beinah für jede Gefühlslage gibt es eine Blume, dabei sprechen wir inzwischen alle eine gemeinsame Sprache, und man sollte annehmen, niemand würde sich mehr auf diese Weise ausdrücken. Aber nein, noch immer hängen wir an den alten Sitten. Deshalb bezweifle ich auch, dass sich je etwas ändern wird … egal was.
»Auf welche hoffen Sie, Miss?«, erkundigt sich eine Arbeiterin und wischt sich mit der schwieligen Hand über die Braue.
»Nein … das ist nichts für mich«, antworte ich verlegen. »Ich schaue nur, was gerade blüht.« Mein Blick fällt auf einen kleinen Korb unter einer Bank, durch dessen Ritzen rote Blütenblätter schimmern. »Welche Sorte ist das?«, frage ich.
»Bloß Unkraut«, erklärt die Frau. »Früher wuchs es überall. Konntest kaum einen Fuß vor die Tür setzen, ohne draufzutreten. Hier in der Gegend haben sie es ausgerottet, aber das ist das Verrückte am Unkraut: Du kannst es an der Wurzel ausreißen, den Boden verbrennen, auf dem es stand, ihn jahrelang brachliegen lassen, aber es findet immer wieder seinen Weg.«
Ich beuge mich vor, um den Korb näher zu betrachten. »Mach dir keine Sorgen, wenn du keinen Schleier kriegst, Tierney«, sagt sie dann.
»W-woher weißt du meinen Namen?«, stammele ich.
Sie schenkt mir ein freundliches Lächeln. »Eines Tages schenkt dir jemand eine Blume. Vielleicht ein bisschen welk an den Rändern, aber ihre Bedeutung bleibt dieselbe. Liebe ist nicht nur für die Verheirateten, weißt du, Liebe ist für alle«, sagt sie und schiebt mir eine Blüte in die Hand.
Verwirrt drehe ich mich auf dem Absatz um und verschwinde schnurstracks Richtung Markthalle.
Ich öffne die Faust. In meiner Hand liegt eine dunkellila Iris, die Blütenblätter perfekt geformt. »Hoffnung«, murmele ich, während mir Tränen in die Augen steigen. Ich hoffe nicht auf die Blume eines Jungen, ich hoffe auf ein besseres Leben. Ein wahrhaftiges Leben. Normalerweise bin ich nicht sentimental, aber irgendwie kommt es mir vor wie ein Zeichen. Wie eine ganz eigene Magie.
Vorsichtig stecke ich die Blüte in mein Kleid, um sie sicher über dem Herzen zu verwahren. Unterdessen komme ich an einer Reihe Wächter vorbei, die angestrengt versuchen, die Blicke abzuwenden.
Ein paar Fallensteller aus den Wäldern schnalzen mit der Zunge, als ich vorbeigehe. Sie sind ordinär und abstoßend, aber in gewisser Hinsicht scheint es so ehrlicher. Ich würde ihnen gerne in die Augen schauen. Vielleicht würde ich etwas von dem erkennen, was sie erlebt und gesehen haben – etwas von den Abenteuern, der gewaltigen nördlichen Wildnis, aber ich sollte es lieber lassen.
Alles, was ich zu tun habe, ist, die Beeren zu kaufen. Und je schneller ich das hinter mich bringe, umso schneller kann ich mich mit Michael treffen.
Als ich die Markthalle betrete, durchdringt ein unangenehmer Lärm die Luft. Normalerweise laufe ich unbemerkt durch die Stände, schlüpfe zwischen Knoblauchsträngen und Speckscheiben hindurch wie ein Geisterhauch, aber heute blitzen die Frauen mich böse an, und die Männer starren auf eine Art, dass ich mich am liebsten verstecken möchte.
»Das ist das James-Mädchen«, flüstert eine Frau.
»Der Wildfang?«
»Der würde ich einen Schleier geben und noch einiges mehr.« Ein Mann stößt seinen jugendlichen Sohn mit dem Ellbogen an.
Hitze steigt mir in die Wangen. Ich schäme mich und weiß nicht einmal, warum.
Ich bin noch dieselbe wie gestern, aber jetzt, sauber geschrubbt, in dieses alberne Kleid gezwängt und mit einem roten Band markiert, bin ich plötzlich sichtbar geworden für die Männer und Frauen von Garner County – wie irgendein exotisches Tier, das zur Schau gestellt wird.
Ihre Blicke und ihr Getuschel fühlen sich wie die scharfe Schneide eines Messers an, die mir über die Haut streicht.
Und einer sorgt ganz besonders dafür, dass ich ein bisschen schneller gehe. Tommy Pearson. Er scheint mir zu folgen. Ich brauche ihn nicht zu sehen, um zu wissen, dass er da ist. Ich höre das Flügelschlagen seines neuesten Haustiers. Er hat eine Vorliebe für Falken. Das klingt beeindruckend, heißt aber nicht, dass er irgendein Geschick dafür hätte. Er gewinnt nicht ihr Vertrauen und ihren Respekt. Er bricht nur ihren Willen.
Ich löse die Münze von meiner schweißnassen Handfläche, lasse sie in das Gefäß am Obststand fallen und schnappe mir den nächstbesten Korb Maulbeeren.
Mit gesenktem Kopf manövriere ich mich durch die Menschenmenge, deren Getuschel mir in den Ohren schwirrt. Ich bin schon fast unter den Markisen der Einkaufsstände hindurch und will den Markt gerade verlassen, da laufe ich plötzlich direkt in Pfarrer Edmonds hinein, und die Beeren prasseln überall um mich herum auf den Boden. Er will schon losschimpfen, hält aber inne, als er mich näher ansieht. »Meine Liebe, Miss James, warum so eilig?«
»Ist sie das wirklich?«, ruft Tommy Pearson hinter mir. »Tierney die Schreckliche?«
»Ich kann immer noch fest treten«, antworte ich und fange an, die Beeren aufzulesen.
»Das will ich hoffen«, antwortet Tommy und sieht mich mit seinen fahlen Augen an. »Ich hab’s gern feurig.«
Als ich aufstehe, sehe ich, dass Pfarrer Edmonds Blick auf meine Brust fixiert ist. »Wenn du etwas brauchst … irgendetwas, mein Kind.« Als ich nach dem Korb greife, streichelt er meine Hand. »Deine Haut ist so zart«, flüstert er.
Ich lasse die Beeren stehen und renne davon. Hinter mir höre ich Gelächter, Pfarrer Edmonds’ schweres Atmen und den Vogel, der heftig die Flügel gegen seine Kette schlägt.
Ich schlüpfe zum Luftholen hinter eine Eiche und ziehe die Iris aus meinem Kleid. Sie ist vom Korsett ganz zerdrückt. Ich umschließe die kaputte Blüte mit den Fingern.
Die vertraute Hitze überkommt mich. Statt den Drang zu ersticken, atme ich ihn ein, beschwöre ihn herauf. Denn in diesem Moment, ach, wie sehr wünsche ich mir da, von gefährlicher Magie erfüllt zu sein.
Am liebsten würde ich sofort zu Michael laufen, an unseren geheimen Ort, aber ich muss mich erst beruhigen. Er darf nicht erfahren, dass mich das so mitnimmt. Ich pflücke einen Grashalm ab, ziehe ihn an den Zaunbrettern entlang, während ich am Obstgarten vorbeigehe, und gleiche meinen Atem meinen gemäßigten Schritten an. Früher konnte ich Michael alles erzählen, aber inzwischen sind wir einander gegenüber vorsichtiger.
Nachdem ich meinen Vater in der Apotheke ertappt hatte, stand ich monatelang unter Schock, und so rutschte mir letzten Sommer eine spitze Bemerkung über Michaels Vater heraus, den Apotheker und Vorsitzenden des Rates. Michael hat sich schrecklich aufgeregt. Ich müsste aufpassen, was ich sage, sonst hielte man mich für eine Rebellin. Und wenn sie von meinen Träumen erführen, würden sie mich womöglich bei lebendigem Leib verbrennen. Wahrscheinlich sollte das keine Drohung sein, aber es fühlte sich so an.
Eigentlich hätte unsere Freundschaft auf der Stelle vorbei sein können, aber wir trafen uns am nächsten Tag wieder, als wäre nichts passiert. In Wahrheit hatten wir uns wahrscheinlich schon eine ganze Weile auseinanderentwickelt, aber wir wollten wohl beide noch so lange wie möglich an einem Stück unserer Kindheit festhalten, an unserer Unschuld. Und heute wird es das letzte Mal sein, dass wir uns so treffen.
Wenn ich aus dem Gnadenjahr zurückkehre, falls ich zurückkehre, wird er heiraten, und mich wird man einem der Arbeitshäuser zuteilen. Meine Tage werden ausgefüllt sein und er wird genug mit Kiersten und den abendlichen Ratsversammlungen zu tun haben. Vielleicht kommt er manchmal unter dem Vorwand irgendeines offiziellen Geschäfts vorbei, aber nach einer Weile wird er aufhören, mich zu besuchen, bis wir uns irgendwann nur noch an Weihnachten in der Kirche zunicken.
An den morschen Zaun gelehnt, blicke ich hinüber zu den Arbeitshäusern. Mein Plan sieht vor, mich möglichst unauffällig zu verhalten, irgendwie durch dieses Jahr zu kommen und dann zurückzukehren, um meinen Platz auf den Feldern einzunehmen. Die meisten der Mädchen, die keinen Schleier bekommen, wollen als Magd in einem ehrbaren Haushalt arbeiten oder wenigstens in der Molkerei oder der Mühle, aber für mich hat es etwas Verlockendes, die Hände in die Erde zu graben, mich mit etwas Realem verbunden zu fühlen. June, meine älteste Schwester, liebte es, Pflanzen zu ziehen. Früher erzählte sie uns immer Gutenachtgeschichten über ihre gärtnerischen Erfolge. Jetzt, als Ehefrau, darf sie nicht mehr gärtnern, aber hin und wieder ertappe ich sie dabei, wie sie den Erdboden berührt oder sich unauffällig eine Klette vom Saum entfernt. Ich schätze, wenn es gut genug für June ist, dann ist es auch gut genug für mich. Feldarbeit ist die einzige Arbeit, die Männer und Frauen Seite an Seite erledigen, aber ich schaffe das sicher besser als die meisten. Ich bin vielleicht zierlich, aber ich bin stark. Stark genug, um auf Bäume zu klettern und mich nicht so leicht von Michael unterkriegen zu lassen.
Auf dem Weg zu dem abgeschiedenen Wäldchen hinter der Mühle höre ich, wie sich Wächter nähern. Was machen die wohl so weit hier draußen? Um Ärger zu vermeiden, ducke ich mich zwischen die Büsche.
Ich krieche gerade durchs Brombeergestrüpp, da grinst Michael von der anderen Seite aus auf mich herunter. »Du siehst –«
»Sag nichts«, falle ich ihm ins Wort und versuche, mich aus den dornigen Zweigen zu befreien. Aber eine Perle vom Kragen meines Kleides verfängt sich darin, reißt ab und rollt auf die Lichtung.
»Welch eine Anmut.« Michael lacht und fährt sich mit der Hand durch die blonden Haare. »Wenn du nicht aufpasst, schnappen sie dich noch heute Abend weg.«
»Sehr witzig«, antworte ich und krieche weiter. »Das spielt dann sowieso keine Rolle mehr, weil meine Mutter mich im Schlaf erstickt, wenn ich diese Perle nicht finde.«
Michael kniet sich auf den Waldboden, um mir beim Suchen zu helfen. »Aber wenn es jemand Annehmbares wäre … jemand, der dir ein richtiges Zuhause bieten kann? Ein Leben?«
»Wie Tommy Pearson zum Beispiel?« Ich schlinge mir einen nicht vorhandenen Strick um den Hals, als wollte ich mich erhängen.
Michael schmunzelt. »Er ist nicht so übel, wie er scheint.«
»Nicht so übel, wie er scheint? Der Typ, der zum Spaß Falken quält?«
»Er kann wirklich gut mit ihnen umgehen.«
»Wir haben doch schon oft genug darüber gesprochen.« Ungeduldig taste ich in den herabgefallenen Ahornblättern herum. »Das ist kein Leben für mich.«
Er setzt sich auf die Fersen, und ich schwöre, ich kann ihn nachdenken hören. Er denkt zu viel.
»Ist es wegen dieses Mädchens? Des Mädchens aus deinen Träumen?«
Ich erstarre.
»Hattest du noch mal welche?«
»Nein.« Ich zwinge meine Schultern, sich zu entspannen. »Damit bin ich durch, das hab ich dir doch gesagt.«
Während wir weitersuchen, beobachte ich ihn aus dem Augenwinkel. Ich hätte ihm das nie anvertrauen sollen. Ich hätte die Träume überhaupt nicht haben dürfen. Nur noch ein Tag, dann kann ich diese Magie für immer loswerden.
»Ich habe Wächter auf dem Weg gesehen«, sage ich und versuche, mir möglichst nicht anmerken zu lassen, dass ich ihn aushorchen will. »Was machen die wohl hier draußen?«
Er beugt sich vor und sein Arm streift meinen. »Sie hätten beinah die Rebellin erwischt«, flüstert er.
»Wie denn?«, frage ich etwas zu aufgeregt und zügele mich schnell ein wenig. »Du musst es mir nicht sagen, wenn –«
»Sie haben letzte Nacht nahe der Grenze zwischen dem County und den Außenbezirken eine Bärenfalle aufgestellt. Sie ist zugeschnappt, aber sie haben nur einen hellblauen Streifen Wollstoff gefunden … und jede Menge Blut.«
»Woher weißt du das?« Ich hüte mich, allzu neugierig zu klingen.
»Die Wächter sind heute Morgen zu meinem Vater gekommen und haben sich erkundigt, ob jemand in der Apotheke war und Medikamente wollte. Ich glaube, bei deinem Vater waren sie auch, um in Erfahrung zu bringen, ob er letzte Nacht irgendwelche Verletzungen behandelt hat. Aber er war … verhindert.«
Ich weiß sehr genau, was das heißt. Es ist eine freundliche Umschreibung dafür, dass er wieder einmal in den Außenbezirken war.
»Jetzt durchsuchen sie das County. Wer immer es ist, wird nicht lange überleben, wenn sich niemand um die Wunde kümmert. Diese Fallen sind wirklich übel.« Sein Blick gleitet meine Beine hinunter, verweilt auf meinen Knöcheln. Instinktiv verstecke ich sie unter dem Kleid. Glaubt er etwa, ich könnte die Rebellin sein … fragt er mich deshalb nach meinen Träumen?
»Hab sie«, sagt er da und liest die Perle von einem Stück Moos.
Ich wische mir die Erde von den Händen. »Ich will es ja nicht schlecht machen … diese ganze Sache mit dem Heiraten«, sage ich, um möglichst schnell das Thema zu wechseln. »Kiersten wird dich bestimmt anbeten und dir viele Söhne schenken.« Ich greife nach der Perle. Aber er zieht seine Hand zurück.
»Wie kommst du darauf?«
»Ach, komm schon. Das weiß doch jeder. Außerdem habe ich euch zusammen auf der Wiese gesehen.«
Eine tiefe Röte kriecht ihm über den Kragen, während er so tut, als säubere er die Perle mit seinem Hemdsaum. Er ist nervös. Noch nie habe ich ihn so nervös gesehen. »Unsere Väter haben alles bis ins letzte Detail geplant«, erklärt er. »Wie viele Kinder wir haben werden … sogar ihre Namen.«
Ich sehe ihn an und muss unwillkürlich lächeln. Ich hatte gedacht, es wäre merkwürdig, ihn sich so vorzustellen, aber es fühlt sich richtig an. So, wie es sein sollte. Ich glaube, für ihn waren all die Jahre mit mir nur ein Spaß, ein Zeitvertreib, fernab von den Zwängen seiner Familie und dem bevorstehenden Gnadenjahr, aber für mich war es immer mehr. Ich werfe ihm nicht vor, dass er so geworden ist, wie es den Erwartungen entspricht. Auf gewisse Weise hat er Glück. Mit sich selbst zu hadern und mit der Rolle, die für einen vorgesehen ist, ist ein lebenslanger Kampf.
»Ich freue mich für dich«, sage ich und lese mir ein rotes Blatt vom Knie. »Ehrlich.«
Er hebt das Blatt vorsichtig auf und fährt mit dem Daumen über die Adern. »Stellst du dir jemals vor, dass da draußen noch etwas anderes ist … mehr als all das?«
Ich sehe ihn an, versuche abzuschätzen, was er meint, aber ich darf mich nicht wieder davon einholen lassen. Es ist zu gefährlich. »Na ja, du kannst den Außenbezirken jederzeit einen Besuch abstatten.« Ich boxe ihn gegen die Schulter.
»Du weißt, was ich meine.« Er holt tief Luft. »Du musst es wissen.«
Ich schnappe mir die Perle aus seiner Hand und lasse sie in meinen Ärmelsaum gleiten. »Jetzt gerate nicht ins Schwärmen, Michael«, antworte ich und stehe auf. »Bald schon hast du eine der begehrtesten Stellungen im County, führst die Apotheke, nimmst deinen Platz als Vorsitzender des Rates ein. Die Leute werden auf dich hören. Du wirst wirklich Einfluss haben.« Ich versuche, ein unschuldiges Lächeln aufzusetzen. »Was mich an einen kleinen Gefallen erinnert, um den ich dich bitten wollte.«
»Was immer du willst«, antwortet er und erhebt sich.
»Falls ich lebend zurückkomme …«
»Natürlich kommst du zurück, du bist klug und stark und –«
»Wenn ich es schaffe, lebend zurückzukommen«, unterbreche ich ihn und wische mein Kleid, so gut es geht, sauber, »möchte ich auf den Feldern arbeiten, und ich habe gehofft, du könntest deine Stellung im Rat vielleicht dazu nutzen, ein paar Strippen zu ziehen.«
»Warum solltest du das wollen?« Er runzelt die Stirn. »Das ist die niedrigste Arbeit von allen.«
»Es ist gute, ehrliche Arbeit. Und ich kann hinauf in den Himmel blicken, wann immer ich will. Wenn du dein Abendessen isst, kannst du auf deinen Teller schauen und ›Sieh an, was für eine schöne Karotte‹ sagen und dabei an mich denken.«
»Ich will nicht an dich denken, wenn ich auf eine verfluchte Karotte schaue.«
Sein Tonfall verblüfft mich. »Was ist denn in dich gefahren?«
»Niemand wird da sein, um dich zu beschützen.« Er sieht mich aufgebracht an. »Du bist den Elementen hilflos ausgeliefert, und nicht nur ihnen. Ich habe Schlimmes gehört. Auf den Feldern sind überall Männer … üble Kerle, kaum besser als Wilderer. Sie könnten jederzeit über dich herfallen.«
»Das sollen sie erst mal versuchen.« Ich hebe lachend einen Stock auf und lasse ihn durch die Luft sausen.
»Ich mein’s ernst.« Er packt mitten im Schwung meine Hand und zwingt mich, den Stock fallen zu lassen. Aber er lässt meine Hand nicht los. »Ich mache mir Sorgen um dich«, sagt er sanft.
»Lass das.« Ich reiße mich los. Wie seltsam es sich anfühlt, dass er mich so berührt. Über all die Jahre haben wir uns schon hemmungslos geprügelt, gemeinsam im Dreck herumgewälzt, gegenseitig im Fluss untergetaucht, aber das hier ist irgendwie anders. Ich tue ihm leid.
»Du denkst nicht klar«, sagt er, sieht auf den Stock hinunter, die Trennlinie zwischen uns, und schüttelt den Kopf. »Du hörst nicht darauf, was ich dir zu sagen versuche. Ich will dir helfen –«
»Warum denn?« Ich kicke den Stock aus dem Weg. »Weil ich dumm bin … weil ich ein Mädchen bin … weil ich gar nicht wissen kann, was ich will … wegen dieses roten Bandes in meinen Haaren … wegen meiner gefährlichen Magie?«
»Nein«, flüstert er. »Weil die Tierney, die ich kenne, das nie von mir denken würde … das nie von mir verlangen würde … nicht jetzt … nicht, wo ich sie …« Er schiebt sich enttäuscht die Haare aus dem Gesicht. »Ich will nur dein Bestes«, sagt er, langsam vor mir zurückweichend, und stürzt durch den Wald davon.
Ich überlege, ihm zu folgen, mich zu entschuldigen – was auch immer ihn verletzt haben mag –, meine Bitte an ihn zurückzunehmen, damit wir als Freunde auseinandergehen können, aber vielleicht ist es besser so. Denn wie soll man sich von seiner Kindheit verabschieden?
Innerlich aufgewühlt laufe ich durch die Stadt zurück und gebe mir die größte Mühe, die Blicke und das Getuschel nicht zu beachten. An der Koppel bleibe ich stehen und beobachte, wie die Pferde von den Wächtern für den Weg zum Lager gestriegelt werden. Ihre Mähnen und Schweife sind zu Zöpfen mit roten Bändern darin geflochten. Genau wie unsere Haare. Und mir kommt der Gedanke, dass alle genau so über uns denken … wir sind nichts weiter als rossige Stuten zur Vermehrung.
Hans bringt eins der Pferde herüber, damit ich das aufwendige Flechtwerk der Mähne bewundern kann, aber wir sprechen nicht miteinander. Es ist mir nicht erlaubt, ihn in der Öffentlichkeit bei seinem Namen zu nennen, nur »Wächter«, aber ich kenne ihn schon, seit ich sieben war. Nie werde ich vergessen, wie ich an jenem Nachmittag zum Genesungshaus ging, um Vater zu suchen, und stattdessen Hans vorfand. Er lag ganz alleine da und hatte einen Beutel blutiges Eis zwischen den Beinen. Damals verstand ich das nicht. Ich hielt es für irgendeinen Unfall. Aber er war sechzehn, der Sohn einer Frau aus dem Arbeitshaus. Man hatte ihn vor die Wahl gestellt, Wächter zu werden oder für den Rest seines Lebens auf den Feldern zu arbeiten. Wächter haben eine angesehene Stellung im County – sie dürfen in der Stadt wohnen, in einem Haus mit Dienstmägden. Es wird ihnen sogar erlaubt, Duftwasser aus Kräutern und exotischen Zitruspflanzen zu kaufen, ein Privileg, das Hans voll ausnutzt. Ihre Pflichten sind im Vergleich zur Feldarbeit leicht – den Galgen instand halten, ab und zu ein paar rauflustige Besucher aus dem Norden mäßigen, die Gnadenjahrmädchen zum Lager und wieder zurück begleiten – und trotzdem entscheiden sich die meisten für die Felder.
Vater sagt, es sei ein einfacher Eingriff, ein kleiner Schnitt, um sie von ihren Trieben zu befreien, und vielleicht stimmt das auch. Aber der Schmerz liegt woanders. Er besteht darin, unter uns leben zu müssen und tagein, tagaus daran erinnert zu werden, was ihnen genommen wurde.
Ich weiß nicht, warum ich keine Angst hatte, mich ihm zu nähern, aber als ich mich an jenem Tag im Genesungshaus neben ihn setzte und seine Hand hielt, fing er plötzlich an zu weinen. Noch nie zuvor hatte ich einen Mann weinen sehen.
Ich fragte ihn, was denn passiert sei, und er antwortete, das sei ein Geheimnis.
Ich sei gut im Geheimnisse-Bewahren, antwortete ich.
Und das stimmt.
»Ich habe mich in ein Mädchen verliebt, Olga Vetrone«, sagte er. »Aber wir können niemals zusammen sein.«
»Warum nicht?«, fragte ich. »Wenn man jemanden liebt, sollte man auch mit ihm zusammen sein.«
Er erklärte mir, dass sie ein Gnadenjahrmädchen sei. Am Tag zuvor hatte sie einen Schleier von einem Jungen bekommen und nun keine andere Wahl, als ihn zu heiraten.
Er sagte mir, er hätte eigentlich immer vorgehabt, auf den Feldern zu arbeiten, aber er könne den Gedanken nicht ertragen, von ihr getrennt zu werden. Wenn er sich den Wächtern anschließen würde, könnte er wenigstens in ihrer Nähe bleiben. Sie beschützen. Sehen, wie ihre Kinder aufwuchsen, ja sogar so tun, als wären es seine eigenen.
Ich weiß noch, dass ich das für das Romantischste hielt, was ich je gehört hatte.
Als Hans Richtung Lager aufbrach, dachte ich, sie würden vielleicht zusammen weglaufen, wenn sie sich wiedersähen, ihre Gelöbnisse brechen, doch als der Konvoi mit den Mädchen zurückkehrte, war Hans totenbleich. Seine Liebste hatte es nicht nach Hause geschafft. Ihre Leiche galt als vermisst. Nicht einmal ihr Band wurde gefunden. Ihre kleine Schwester wurde noch am selben Tag in die Außenbezirke verbannt. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade einmal ein Jahr älter als ich. Daraufhin hatte ich noch viel mehr Angst um meine Schwestern, aber auch davor, was mit mir passieren würde, wenn sie es nicht zurück nach Hause schafften.
Als ich Hans im darauffolgenden Winter allein im Stall traf, wo er Zöpfe flechten übte und mit geschickten Fingern das Band durch den kastanienbraunen Pferdeschweif schlang, fragte ich ihn nach Olga. Was ihr denn passiert sei. Ein Schatten glitt über sein Gesicht. Und er strich sich mit der Hand übers Herz, wieder und wieder, als könnte er es dadurch wieder zusammenfügen – eine Zwangshandlung, die ihn bis heute verfolgt. Ein paar der Mädchen machen sich deshalb über ihn lustig, belachen das merkwürdige Streichgeräusch, das dabei entsteht, aber ich hatte schon immer Mitleid mit ihm.
»Es sollte einfach nicht sein«, antwortete er leise.
»Kommst du drüber weg?«, fragte ich.
»Ich kann ja jetzt auf dich aufpassen«, antwortete er mit dem Hauch eines Lächelns im Gesicht.
Und das tat er.
Er stellte sich auf dem Marktplatz vor mich, um mir die Sicht auf die grausamsten Bestrafungen zu ersparen. Er half mir, mich ins Versammlungshaus zu schleichen, um die Männer zu belauschen. Er verriet mir sogar, wann die Wächter ihre Runden drehten, damit ich ihnen aus dem Weg gehen konnte, wenn ich mich aus der Stadt schlich. Abgesehen von Michael und dem Mädchen aus meinen Träumen war Hans mein einziger Freund.
»Hast du Angst?«, flüstert er in diesem Moment.
Ich bin überrascht, seine Stimme zu hören. Normalerweise ist er nicht so dreist, mich in der Öffentlichkeit anzusprechen. Aber ich gehe bald fort.
»Sollte ich das?«, flüstere ich zurück.
Er will gerade etwas antworten, als mich jemand am Kleid zieht. Entschlossen, Tommy Pearson oder wer auch immer mich angefasst hatte, eine zu kleben, wirbele ich herum; aber da stehen nur meine beiden kleinen Schwestern Clara und Penny, über und über mit Gänsefedern bedeckt.
»Ich will es gar nicht wissen«, sage ich und unterdrücke das Lachen.
»Du musst uns helfen.« Penny leckt sich etwas Klebriges von den Fingern. Ich rieche es sofort: Ahornsirup. »Wir sollten Vaters Päckchen in der Apotheke abholen, aber … aber –«
»Jemand hat uns aufgelauert«, rettet Clara sie und grinst mich hoffnungsvoll an. »Kannst du es vielleicht abholen, damit wir uns sauber machen können, bevor Mutter nach Hause kommt?«
»Bitte, bitte«, schaltet Penny sich wieder ein. »Du bist Vaters Lieblingstochter. Tu uns diesen einen Gefallen, bevor du uns ein ganzes Jahr verlässt.«
»Na gut«, stimme ich zu, damit sie aufhören zu quengeln. »Aber beeilt euch lieber. Mutter ist heute nicht gut aufgelegt.«
Lachend und schubsend rennen sie davon, und ich würde ihnen am liebsten sagen, sie sollten das Leben so lange wie möglich genießen, aber sie würden es nicht verstehen. Und wozu das letzte bisschen Freiheit verderben, das sie haben?
Als ich mich wieder umdrehe, ist Hans schon bei den Ställen. Ich wollte mich noch verabschieden, aber Abschiede fallen ihm wahrscheinlich schwerer als den meisten.
Ich hole tief Luft und mache mich auf den Weg zur Apotheke. Seit jenem heißen Juliabend bin ich nicht mehr dort gewesen, aber irgendwie will ich der grausamen Wahrheit auch ins Auge sehen – um mir in Erinnerung zu rufen, wie ich enden könnte, wenn ich nicht aufpasse. Als ich die Tür öffne, bimmelt die Ladenglocke. Der blecherne Laut geht mir durch Mark und Bein.
»Tierney, was für eine nette Überraschung.« Michaels Vater riskiert einen Blick, und als ich weder rot werde noch stammele oder mich abwende, räuspert er sich. »Du willst sicher das Päckchen für deinen Vater abholen?«, fragt er und fingert an den Paketen herum, die hinter ihm im Regal aufgereiht sind.
Unwillkürlich blicke ich zum Vitrinenschrank und mir steigt die Erinnerung wie Galle den Hals hinauf.
Ich hatte mich wie fast jeden Abend aus dem Haus geschlichen, um mich mit Michael zu treffen, und auf dem Heimweg das sanfte Flackern von Kerzenschein in der Apotheke bemerkt. Als ich näher kam, sah ich, wie Mr Welk ein Geheimfach hinter dem Schrank mit den Haarwassern und Rasiergeräten öffnete. Das Herz pochte mir gegen die Rippen, als ich plötzlich meinen Vater aus der Dunkelheit treten sah, um die ordentlich aufgereihten Glasfläschchen darin zu inspizieren. Einige waren mit etwas gefüllt, das aussah wie kleine Stückchen Dörrfleisch, andere mit einer dunkelroten Flüssigkeit, aber eines interessierte ihn offenbar besonders. Als ich die Stirn an die warme Fensterscheibe presste, um besser sehen zu können, erkannte ich ein Ohr, das mit kleinen Pusteln übersät war und in einer trüben Flüssigkeit schwamm. Ich schlug mir erschrocken die Hand vor den Mund, kam dabei jedoch versehentlich an die Scheibe und erweckte ihre Aufmerksamkeit.
Obwohl ich bestritt, irgendetwas gesehen zu haben, bestand Mr Welk darauf, dass ich auf der Stelle bestraft würde. »Ein Mangel an Respekt ist der Anfang vom Ende«, sagte er. Und die heißen Gertenschläge auf meinem Rücken verfestigten das grausige Bild, das sich mir geboten hatte, in meinem Kopf nur noch mehr.
Ich habe niemandem etwas davon erzählt. Nicht einmal Michael. Aber ich wusste, dass dies die Überreste der Mädchen waren, die die Wilderer während ihres Gnadenjahres getötet haben, ihre Einzelteile, die auf dem Schwarzmarkt als Aphrodisiakum und Jugendelixier verkauft wurden.
Vater ist ein Mann der Medizin, er stellt Forschungen an, um Krankheiten zu heilen. Ich habe immer geglaubt, er würde diese Sache für Aberglauben halten, für nichts weiter als eine Rückkehr ins finstere Mittelalter. Deshalb hätte ich nie von ihm erwartet, dass er so eitel, so erbärmlich, so verzweifelt sein könnte, hier Kunde zu sein. Wozu denn? Um das Stehvermögen zu erlangen, einen kostbaren Sohn zu zeugen?
Dieses Ohr gehörte der Tochter von jemandem. Einem Mädchen, das mein Vater vielleicht schon einmal behandelt hatte, als es krank war, oder dem er bei einer Begegnung in der Kirche den Kopf getätschelt hat. Was würde er wohl tun, wenn ich diejenige in diesen Glasflaschen wäre? Würde er dann auch meine Haut essen wollen, mein Blut trinken, das Mark aus meinen Knochen saugen?
»Ach, beinah hätte ich es vergessen«, sagt Mr Welk, während er mir das in grobem braunem Papier eingeschlagene Päckchen in die Hand drückt. »Frohen Schleiertag.«
Ich löse den Blick vom Vitrinenschrank, von Vaters und Mr Welks schmutzigem kleinem Geheimnis, und schenke ihm ein freundliches Lächeln.
Denn bald schon wird meine Magie mich erfüllen, und er sollte lieber beten, dass ich sie vollständig losgeworden bin, bis ich wieder zurückkomme.
Als die Kirchenglocke läutet, eilen Männer, Frauen und Kinder zum Marktplatz.
»Es ist noch zu früh für die Versammlung«, flüstert jemand.
»Angeblich findet eine Bestrafung statt«, erklärt ein Mann seiner Frau.
»Aber es ist doch kein Vollmond«, antwortet sie.
»Haben sie etwa die Rebellin gefasst?« Ein kleiner Junge zieht seine Mutter am Rock.
Ich recke den Kopf, um auf den Platz sehen zu können, und tatsächlich, sie rollen die Treppe für den Galgen heran. Die quietschenden Räder lassen mir fast das Blut in den Adern gefrieren.
Während wir uns um den Baum der Bestrafung scharen, halte ich Ausschau nach einem Hinweis darauf, was passieren wird, aber alle starren nur stur geradeaus, wie gelähmt vom verblassenden Licht, das auf den kalten Stahlzweigen glänzt.
Ich frage mich, ob es das war, was Hans mir sagen wollte. Ob er vorhatte, mich zu warnen.
Pfarrer Edwards, dessen weißes Gewand sich eng an seine pralle Figur schmiegt, tritt vor und wendet sich an die Zuschauer. »An diesem ehrwürdigen Tag wurde der Rat auf eine schwerwiegende Angelegenheit aufmerksam gemacht.«
Ich weiß nicht, ob ich mir das bloß einbilde, aber der Blick meiner Mutter scheint in meine Richtung zu zucken.
Die Träume. Ich schlucke so heftig, dass es bestimmt jeder hören kann.
Ich suche Michael in der Menge und entdecke ihn ziemlich weit vorne. Könnte er mich verraten haben? War er so wütend auf mich, dass er dem Rat von dem Mädchen in meinen Träumen erzählt hat?
»Clint Welk wird für den Rat sprechen«, verkündet Pfarrer Edmonds.
Michaels Vater tritt vor, und ich habe das Gefühl, mir birst gleich der Brustkorb. Meine Handflächen sind schweißnass, mein Mund ist staubtrocken. Penny und Clara spüren meine Not offenbar, denn sie drücken sich jede ein wenig dichter an mich.
In perfekter Linie mit dem Baum der Bestrafung steht Mr Welk vor uns und senkt den Kopf wie zum Beten, und ich schwöre, ich sehe, wie sich seine Wangenknochen einen Tick heben – die Spur eines Lächelns.
Mir wird übel. Alle Sünden, die ich je begangen habe, schießen mir durch den Kopf, aber es sind zu viele zum Zählen. Ich bin zu sorglos geworden, zu leichtsinnig. Ich hätte nie über die Träume sprechen dürfen … ich hätte sie gar nicht erst haben dürfen. Vielleicht wollte ich ja insgeheim, dass das passiert. Vielleicht wollte ich erwischt werden. Gerade als ich mich darauf vorbereite, etwas zu sagen, zu versprechen, Buße zu tun, zu schwören, mich von dieser Magie zu befreien und von jetzt an gehorsam zu sein, teilen sich Mr Welks Lippen. Ich beobachte seine Zunge, warte darauf, dass sie sich an seinen Gaumen bewegt, um ein T zu bilden, doch stattdessen presst er die Lippen zusammen und formt ein M. »Mare Fallow, tritt vor.«
Ich stoße einen Atemzug angehaltene Luft aus, aber keiner scheint Notiz davon zu nehmen. Vielleicht hat jedes Mädchen auf dem Platz dasselbe getan. Trotz all unserer Unterschiede – dies ist etwas, was wir miteinander teilen. Die Angst, dass unser Name genannt wird.
Als Mrs Fallow nach vorne geht, drängen sich die Frauen hinter ihr zusammen, um sie zu bespucken und zu verhöhnen, meine Mutter mitten darunter. Ich weiß nicht, warum sie den Drang verspürt, die arme Frau noch zusätzlich zu quälen. Mrs Fallow war einmal sehr freundlich zu mir. Mit ungefähr vier Jahren hatte ich mich im Wald verirrt. Sie fand mich, nahm mich bei der Hand und brachte mich nach Hause. Sie machte meiner Mutter keine Vorwürfe, sie erzählte nicht herum, dass ich da draußen war, wo ich nicht hätte sein dürfen. Und so dankt meine Mutter es ihr? Ich schäme mich, ihre Tochter zu sein.
Indem ich mich auf das große Holztor konzentriere, das hinter dem Marktplatz aufragt, versuche ich, innerlich zu fliehen, aber Mrs Fallows verhaltene Schritte, das Rascheln ihrer Unterröcke bahnen sich einen Weg in mein Bewusstsein wie leise Totenglöckchen.
Ich will sie nicht ansehen. Nicht etwa aus Abscheu oder Scham – ich habe nur das Gefühl, es könnte genauso gut ich sein. Michael weiß es. Hans weiß es. Meine Mutter weiß es. Vielleicht wissen es alle. Aber ich schulde ihr meine ganze Aufmerksamkeit. Sie muss wissen, dass ich sie in Erinnerung … dass ich sie nicht vergessen werde.
Sie sieht aus wie ein Geist, als sie vorbeigeht. Fahle, dünne Haut, der grau melierte Zopf schlaff auf ihrem krummen Rücken hängend, ihren Ehemann hinter sich wie ein böses Omen. Ich frage mich, ob sie wusste, dass ihre Zeit vorbei war. Ob sie es wohl kommen spürte.
»Mare Fallow. Du wirst angeklagt, dich deiner Magie hingegeben zu haben. Im Schlaf Unzüchtiges geschrien, mit des Teufels Zunge gesprochen zu haben.«
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mrs Fallow je die Stimme zu mehr als einem Flüstern erhebt oder gar Unzüchtiges schreit, aber ihre Zeit ist abgelaufen. Sie hat keine Söhne geboren. Ihr Schoß ist kalte, leere Einöde. Sie ist zu nichts nutze.
»Also … was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?«, fragt Mr Welk.
Bis auf das dünne Rinnsal Flüssigkeit, das über die Spitze ihres ausgetretenen Lederstiefels sickert, gibt sie nichts von sich. Am liebsten würde ich sie schütteln. Sie soll ihnen sagen, dass es ihr leidtut, um Gnade bitten, damit man sie in die Außenbezirke schickt, aber sie steht nur schweigend da.
»Nun gut«, verkündet Mr Welk. »Im Namen Gottes und der auserwählten Männer verurteile ich dich hiermit zum Tod durch den Strang.«















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













