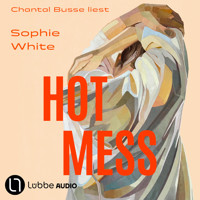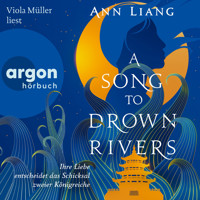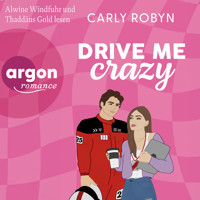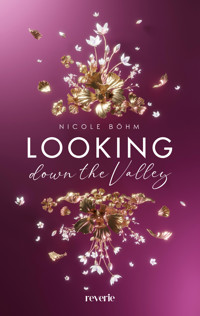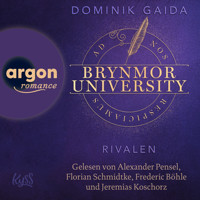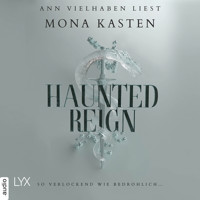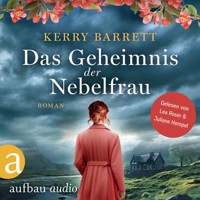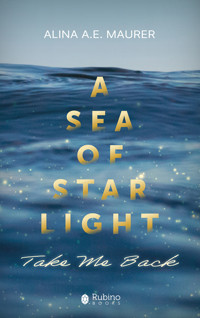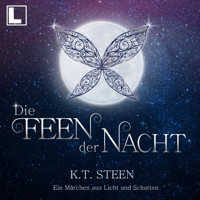The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989 E-Book
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Reinhard Ibler is Professor for Slavic Literature at the University Giessen. He has published widely on Russian, Czech, and Polish literature as well as on comparative Slavic literature and literary theory. Prof. Dr. Reinhard Ibler ist Inhaber eines Lehrstuhls für Slavische Philologie mit den Schwerpunkten russische, tschechische und polnische Literaturwissenschaft und Literaturtheorie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er hat sich u.a. mit Fragen der literarischen Zyklisierung, der Typologie und Entwicklung ausgewählter Gattungen (z.B. Komödie, Elegie, Sonett) und der literarisch-künstlerischen Kommunikation befasst. Aktuell ist er Leiter des Forschungskreises Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europa und arbeitet darüber hinaus an Projekten zur Balladengeschichte und zur Aktualität funktionalistischer Modelle in den Literatur- und Kulturwissenschaften. Weitere Informationen unter:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Reinhard Ibler:
Vorwort
Entwicklungen und Trends
Anja Golebiowski:
Die Geister der Vergangenheit. Trauma und Psychoanalyse in der
polnischen Gegenwartskunst und -literatur
Hans-Christian Trepte:
Kinder und Enkel des Holocaust erzählen. Neue Perspektiven in
der polnischen Holocaustliteratur
Markus Roth:
Fiktionalisierung und Dokumentation: Die Shoah im deutsch-
sprachigen Gegenwartsdrama
Katharina Bauer:
Representations of the Holocaust in Recent Youth Literature
Vergleichende Studien
Marija Sruk:
Weiter leben – weiter schreiben: Ruth Klügers Still Alive. A Holo-
caust Girlhood Remembered und Imre Kertész’ Dossier K.
Eine Ermittlung im Vergleich
Sascha Feuchert:
Das Getto Łódź/Litzmannstadt in fiktionalen Texten. Ein Versuch
Krystyna Radziszewska:
Das Bild des Łódźer Gettos in der Literatur im 21. Jahrhundert.
Rezeption in Polen
Agnieszka Izdebska – Danuta Szajnert:
The Holocaust – Postmemory – Postmodern Novel: The Flytrap
Factory by Andrzej Bart, Tworki by Marek Bieńczyk and Skaza
by Magdalena Tulli
Wolfgang F. Schwarz:
Holocaust und KZ im Fokus tschechischer Literatur nach 2000.
Zu Arnošt Goldflams Doma u Hitlerů und Radka Denemarkovás
Peníze od Hitlera
Späte Zeugnisse der Erlebnisgeneration
Grzegorz Gazda:
Literature of the Holocaust and Genre Theory (on Leon Weliczker’s
Book Brygada śmierci)
Aleksandra Bąk-Zawalski:
Trauma-Verarbeitung in Das Mädchen im roten Mantel und Dobre
dziecko (Gutes Kind) von Roma Ligocka
HanaHříbková:
Ota B. Kraus’s Life and his Novel Můj bratr dým (The Painted
Wall)
FilipTomáš:
Family – an Unpredictable Joke: Milan Uhde’s Family Plays
Die Generation der Kinder und Enkel
Jiří Holý:
Willy Mahler’s Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam’s Play
Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt)
Reinhard Ibler:
Zwischen Traumidylle und realem Horror: Zur Darstellung des
Holocaust in Arnošt Goldflams Drama Sladký Theresienstadt
(1996)
Valentina Kaptayn:
Another Way to Remember: Jáchym Topol’s Works Sestra (1994)
and Chladnou zemí (2009) in the Context of Czech Cultural
Memory of the Holocaust
Štěpán Balík:
Biological and Other Ways of Surviving the Shoah in Irena
Dousková’s Work
TerezaTomášová:
Trauma in Denemarkovás Buch Peníze od Hitlera
Olga Zitová:
Holocaust und Indien: Zu Hana Andronikovas Roman Zvuk
slunečních hodin
Elisa-Maria Hiemer:
Outrageous Taboo Breaking or Ingenious Narrative Strategy?
About Zyta Rudzka’s Ślicznotka doktora Josefa and its Perception
in German and Polish Reviews
Šárka Vlasáková:
The Tale of Sir Nicholas Winton in Matej Mináč’s Movies
Nicky’s Family and The Power of Good
Małgorzata Leyko:
Szpera ’42 – Theater im Raum der Geschichte
Vorwort
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbands sind aus dem Internationalen WorkshopThe Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989hervorgegangen, der vom 21. bis 23. November 2012 an der Justus-Liebig-Universität Gießen stattfand.Veranstalter waren das Gießener Zentrum östliches Europa (GiZo), das Institut für Slavistik und der Forschungskreis Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europa.Dieser Workshop war derinsgesamtfünfteund letzteim Rahmeneines2010 ins Leben gerufenenProjekts, an dem Vertreterinnen und Vertreter ausLiteratur-, Kultur- und Medienwissenschaftender Universitäten Gießen,Łódźund Pragbeteiligt waren.Erstmals sollte hier im Rahmen einer breiten, internationalen Kooperation vergleichend untersucht werden, wie derVölkermord der Nationalsozialistenin Literatur, Theater und Filmder Länder Mittel- und Ostmitteleuropas, d.h. ineinermit dem Geschehen in besonderer Weise verbundenenRegion, dargestellt und künstlerischverarbeitet wurde.Im Zentrum des Interesses stand dabei der polnische, tschechische (bzw. tschechoslowakische) und deutsche Kontext.
Das Projekt startete mit einemin Gießen durchgeführtenImpulsworkshop zum ThemaAusgewählte Probleme der polnischen, tschechischen und deutschen Holocaustliteratur und -kultur(27./28. Mai 2010)mit zehnaktivenTeilnehmerinnen und Teilnehmern.Ziel dieser Veranstaltung war esauch,die Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeitabzustecken und die weiteren Aktivitäten zu planen.Konkret wurde dabei vor allemdie Organisation eines Zyklus vonWorkshopsbeschlossen, die sich thematisch jeweils einer bestimmten Phase in derEntwicklung der Holocaustliteratur und-kulturvom Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart widmen sollten. Da die Finanzierung dieser Workshops über das Programm Projektbezogener Personenaustausch (PPP) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und seiner polnischen und tschechischen Partnerinstitutionen sowieergänzendu.a.durchMittel desDeutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, des Gießener Zentrumsöstliches Europaabgesichert werden konnte, fanden in den Jahren 2011 und 2012 je zweiVeranstaltungenzur Thematik anwechselndenOrten statt.
So ging es inŁódź(19.-21. Mai 2011; 15 Referate) um dieliterarische und kulturelle Aufarbeitung des Holocaustinder unmittelbaren Nachkriegszeit. In den beidendarauffolgenden, jeweils in PragabgehaltenenWorkshopsstanddie Zeit der späten fünfziger und der sechziger Jahre (21./22. November 2011; 15 Referate)sowie dersiebziger und achtziger Jahre (21./22. Juni 2012; 15 Referate) auf dem Programm. Die Materialien des Gießener Impulsworkshops[1]sowie der beiden Prager Workshops[2]liegenbereitsals Sammelbändevor, derŁódźerBand[3]stehtnach Angaben der Herausgeberunmittelbarvor der Fertigstellungund soll in etwa zeitgleich mit der vorliegenden Publikation erscheinen.
DerGießener Workshop vom November 2012umfasste24 Beiträge,von denen 22Eingangin den vorliegenden Bandgefunden haben.[4]Diese vergleichsweise hohe Zahl istnicht zuletztBeleg dafür,dassder Holocaustauch in der jüngsten literarisch-kulturellen Entwicklung einThema von hoher Aktualität und Relevanz bildet.Das ist insofern bemerkenswert, als die Erlebnisgeneration unweigerlich im Aussterben begriffen ist.Zwar gab es in denletztenJahrennochBerichte vonZeitzeugen,von deneneinigesichüberhauptzum ersten MalzuihrenHolocaust-Erfahrungengeäußert haben.Im Fokus stehtnunmehraberdie GenerationderNachgeborenen – derKindersowie bereits auchder Enkel.Mit demHolocaustbefassen sich freilich nicht nur diejenigen,die ihreeigene Familiengeschichte aufarbeiten wollen. Auch Autoren und Künstler ohnesolchefamiliärenBindungen haben in jüngster Zeit miteindrucksvollen Werken zurHolocaust-Thematikauf sich aufmerksam gemacht.Da die Generation der Nachgeborenensich mit Ereignissen auseinandersetzenmuss, diesie nur vom Hörensagen kennt, rücken die daraus zwangsläufig hervorgegangenenverändertenSichtweisenund neuen künstlerischen Lösungen, diein verstärktem Maßeauch Provokation und Tabubruch implizieren, in den Fokus.
DieDokumentation, Beschreibung, Beurteilungund Einordnung diesesaktuellenliterarisch-kulturellen Umgangs mit dem Holocaustnamentlich bei den Polen, Tschechen und DeutschenistHauptanliegendieses Buchs.Angesichts derimmensen Fülle des vorhandenen Materialskann diesfreilich nur selektiv und exemplarisch vonstattengehen. Gleichwohlvermag die in den Beiträgen repräsentierte thematische und methodische Bandbreite eine Vorstellungvom Umfang der Problematik und damitvonden vielfältigen Aufgabenzuvermitteln, dieheutevor der Forschung liegen.
Den Beginn machen Untersuchungen, die größere Entwicklungszusammenhänge in den Blick zu nehmen. So verbindet die Beiträge vonAnja GolebiowskiundHans-Christian Treptedas Bemühen um einen systematischen Zugang zu den mannigfaltigenFormen undErscheinungen derjüngstenmit dem Holocaust befasstenpolnischen Literatur und Kunst.Demgegenüberkonzentrieren sichMarkus Roth, der dieEntwicklung derThematikim deutschen Dramaseit den siebziger Jahren verfolgt, undKatharina Bauerin ihrer vergleichenden Studie zur aktuellen deutschen, polnischen und amerikanischen Kinder- und Jugendliteratur überdenHolocaust aufgattungsspezifischeFragestellungen.
Vergleichend angelegt sind auchdieArbeiten derfolgendenAbteilung, von denen sich zwei (Sascha Feuchert,Krystyna Radziszewska) mit der Darstellung des GettosŁódź/Litzmannstadt inderzeitgenössischen polnischen und internationalen Literaturbeschäftigen.Ein weiterer Beitrag (Agnieszka Izdebskau.Danuta Szajnert) stellt am Beispiel dreier polnischerGegenwartsromane die Frage nachderFunktion postmoderner Verfahren in der Holocaustliteratur.Wolfgang F. SchwarzbetrachtetzweiWerkederneuestentschechischen Literatur, die denHolocaustthematisieren, im Lichte der ‚possible-worlds‘-Theorie.Einige in den vergangenen Jahren erschienene Werke zweierbekannterHolocaustüberlebender,Ruth Klügerund Imre Kertész, stelltMarija Srukin ihrer Studiegegenüber.
DieweiterenBeiträge sindjeweilseinzelnen Autorinnen und Autoren gewidmet. Zunächst geht es umVertreterinnen und Vertreterder Erlebnisgeneration wie die Polen Leon Weliczker (Grzegorz Gazda) und Roma Ligocka (Aleksandra Bąk-Zawalski)sowiedie Tschechen Ota B. Kraus (Hana Hříbková) und Milan Uhde (Filip Tomáš).Schriftstellerinnen und Schriftstelleraus derGeneration derKinder und Enkelstehen im Zentrum der letzten Abteilung des Bandes. Eshandelt sich hierbeiin der polnischen LiteraturumZyta Rudzka (Elisa-Maria Hiemer)undin der tschechischen Literatur umArnoštGoldflam (Jiří Holý,Reinhard Ibler), Jáchym Topol (Valentina Kaptayn), Irena Dousková (Štěpán Balík), Radka Denemarková (Tereza Tomášová) und Hana Andronikova(Olga Zitová).Neben den Untersuchungen mit literarischem Schwerpunkt finden sich indieserAbteilungzudemeinBeitragzu den Filmen des slowakischen Regisseurs Matej Mináčmit Holocaust-Bezug (Šárka Vlasáková) sowie der Bericht vonMałgorzata Leykoüber ein inŁódżrealisiertes szenisches Projekt zumGetto Litzmannstadt.
Mit demGießener Workshop vom November 2012endetedas erstegemeinsamepolnisch-tschechisch-deutsche Projekt zur Holocaustliteratur und-kultur.Daringinges primär um eineBestandsaufnahmeder bisherigen Forschung zur Thematik, um die Eruierung relevantenMaterials und dieErarbeitungkonkreterAufgaben für diekünftigewissenschaftlicheKooperation.Besonders die weitere Stärkung deskomparatistischen Blickwinkelserscheint uns der Mühen wert. Auf dieser Grundlage sollu.a.ein monographisches Projekt in Angriff genommen werden, in dem eine repräsentative Auswahl von Werken der polnischen, tschechischen, slowakischen und deutschen Holocaustliteraturnähervorgestelltund ihrewechselseitigeRezeption erfasst werden soll.Dies soll dazu beitragen, dasVerständnisfür den besonderentransnationalenCharakter derHolocaustliteratur und -kulturzu schärfen. Ein weiteres, parallelesVorhaben soll die RelevanzvonGattungen undgenerischen Prozesseninnerhalb dieses Problemkomplexesunter die Lupe nehmen.
Mein Dank giltzunächstallen,die mit ihrenkompetentenBeiträgendiesen Band und damit den Blick aufdie anhaltende Aktualität der Holocaust-Thematikin der literarisch-kulturellen Sphäre Mittel- und Ostmitteleuropasermöglicht haben. Besonders verbunden bin ich meinen Kolleginnen vomGießenerForschungskreis Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europa,Katharina Bauer, Anja Golebiowski und Elisa-Maria Hiemer, die sich sowohl bei der Organisation des Workshops als auch bei der Vorbereitung des vorliegenden Materialienbandesin hohem Maße engagiert haben.Die Durchführung des Workshops wäre ohne dievielfältigeUnterstützungdurch unsereSekretariatsmitarbeiterinnen Magda Szych und Christine Bilynicht möglich gewesen. Auch ihnenseiherzlich gedankt!Namentlich erwähnenmöchteichnochFriedrich von Petersdorff, der uns dankenswerterweise beim Korrekturlesen, insbesondereder englischsprachigenBeiträge,inuneigennütziger Weiseunterstützt hat.
Ichfreue mich auf die Weiterführung derKooperation zur Problematik der Holocaustliteratur und -kultur in einer ebenso freundschaftlichen und arbeitsintensiven Atmosphäre, wie dies bisher der Fall war.
Gießen, im Dezember 2013
Der Herausgeber
[1]Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur. Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.-28. Mai 2010. Hrsg. v. Reinhard Ibler unter der Mitarbeit von Anja Golebiowski.München – Berlin 2012.
[2]JiříHolý(ed.): The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Filmin Central Europe: 1950s and 1960s.Praha 2012. –JiříHolý(ed.): The Representation ofthe Shoah in Literatureand Filmin Central Europe: 1970s and 1980s.Praha 2012.
[3]Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz (red.): The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: the Post-War Period.Łódź[im Druck]
[4]Folgende Beiträge wurden nicht zur Publikation eingereicht: Tomasz Majewski (Łódź),City’s Space as Mnemotechnic Theatre of Forgetting.Traces, Memorials and Representations of the Łódź Ghetto, und Lisa Peschel (York),Post-1989 Survivor Testimony onTheatrical Culture in the Terezín Ghetto.
Entwicklungenund Trends
Developments and Trends
Die Geister der Vergangenheit.Trauma und Psychoanalysein der polnischen Gegenwartskunst und-literatur
Anja Golebiowski, Gießen
DerZweite Weltkrieghatim kollektiven Gedächtnis der Polen tiefe Narben hinterlassen, weshalbdie historische Erfahrung des Opferseinsals nationalesTraumabisin die Gegenwartnachwirkt.Auf diein einem Interview gestellteFrage nach dem Grund für dieanhaltendeseelische Erschütterung, die sich ebenfalls beidenNachkriegsgeborenenbemerkbar mache,antwortet diepolnischeSchriftstellerinMagdalena Tulli:
Es ist leichter, Schuld zu tragen als Leid, das einem zugefügt wurde. […] Neben dem Zorn gab es die Scham. Meine Mutter schämte sich vor sich selbst dafür, wie man sie behandelt hatte. Wenn das Leid wirklich groß ist, will das Opfer nur eines: vergessen. Aber das kann es nicht. Und so geht das Trauma auf die nächste Generation über und dauert fort, solange diese nichts damit anfängt. Die Geschädigten haben immer eine schwere Arbeit zu leisten. Sie müssen ihr Leid akzeptieren. Wenn sie es nicht tun, werden sie bis zu ihrem Tode leiden und hinterlassen diesen Salat ihren Nachfahren.(Gnauck2012)
Durch den ZweitenWeltkriegistnicht nurdie staatlicheSouveränitätPolensverletztworden, sondern diepolnische Bevölkerungistdurch die Menschenverachtende Rassenpolitik des nationalsozialistischen Okkupanten zudem zutiefst gedemütigtworden,wodurcheinnicht zu unterschätzenderOpferkomplexentstanden ist.In diesem Kontext muss man sichvergegenwärtigen, dassnahezu jede polnische Familie in der einen oder anderen Art vom Terror betroffen gewesen ist.Hinzu kommt, dass der auf polnischem Boden stattgefundene Holocaust das polnische Selbstbildnis von einem Land der Freiheitskämpfer und Verteidigerchristlich-europäischer Wertein Frage stellt, da sich neben der eigenen Machtlosigkeit auch die Frage nach dereigenen Schuld stellt.In den letzten Jahrenist jedoch eine sehr frische und selbstbewusste polnische Literatur- und Kulturszene zu beobachten,welchediegesellschaftliche AuseinandersetzungmitdiesemKomplexanzustoßen versucht.DieErschütterungder nationalen Psyche,die tief sitzendeÄngste und Komplexehervorgebrachtund das Verhältnis zu Deutschlandnachhaltigbeeinträchtigthat,bildet denzentralenGegenstandvonAndrzej Stasiuks BuchDojczland(2007), das alseine ArtTherapieversuchverstanden werden kann.ImMittelpunkt des Textes steht der Ich-Erzähler, ein„literarischer Gastarbeiter“und dasvermeintlicheAlter Ego des Autors,dervon seinen Lesereisen nach Deutschlanderzählt, die er jedocheinzigim betrunkenen Zustanderträgt:
Nie da się na trzeźwo pojechać z Polski do Niemiec. Nie oszukujmy się. To jednak jest trauma. W równym stopniu dotyka specjalistów od uprawy szparagów i pisarzy. Nie da się do Niemiec pojechać na luzie. [...] Jazda do Niemiec to jest psychoanaliza.(Stasiuk 2007,27)
Man kann nicht nüchtern von Polen nach Deutschland fahren. Machen wir uns nichts vor.Das ist schließlich ein Trauma.Gleichermaßen betrifft es dieFachleutefür den SpargelbauwieauchdieSchriftsteller. Man kann nicht relaxt nach Deutschland fahren. […]Eine Fahrt nach Deutschland, das istPsychoanalyse.[1]
DieReflexionendes Ich-ErzählersüberDeutschland und dasWesen der Deutschensind durchzogen mit Kommentaren und Anspielungen zumZweitenWeltkrieg, daerzwangsläufigden Dreh- und Angelpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen bildet.Obwohlbereits über ein halbes Jahrhundertvergangen ist,habensich dieausdemTraumaresultierendennegativen Gefühleaufdie nachfolgenden Generationenübertragen,was auchdie bereits zitierteTulli in ihremjüngstenErzählbandWłoskie szpilki(2011;Italienische Stöckelschuhe)thematisiert.DerübermäßigeAlkoholkonsumvon StasiuksIch-Erzählerist daher zum einen eineden TextzusammenhaltendeErzählstrategieals aucheinKrankheitssymptomdestransgenerativenTraumas.
Die Erschütterung der nationalen Psychestelltjedoch nicht nur eine Angelegenheit zwischen Polen und Deutschendar, sondernsieist aufs Engste mit dem Leid verbunden, dasdie Juden auf polnischem Boden erfahren haben.Obgleich das zentraleThemades Buches das deutsch-polnische Verhältnisbildet,weitetStasiukdie Problematiksubtilaus, indem er am Anfang seinesEssayssymbolträchtigeinebeinahe surrealistisch anmutendeBegegnung mit Henryk Grynberg beschreibt, die er während seines ersten Aufenthalts in Deutschlandhatte.Derjüdische Schriftsteller, dessen Familie zumOpfer der Deutschen und Polen geworden ist unddersich so unvermitteltimLeipzigerAuerbachs Kellerinmitten eines opulentenFestessens befindetund dennoch isoliert ist, wirdvomIch-Erzählerals ein Mahnmal wahrgenommen.Obwohl sich die Zeiten geändert haben und nach der Wende von 1989 anscheinend eine Normalisierung eingetreten ist,Deutsche, Polen und Judenin Deutschland zusammentreffen können, kann dieVergangenheit nicht so klanglos übergangen werden. Derzu einerSymbolfigurfür das Leid der polnischen Juden gewordeneGrynbergsowieStasiuks Alter Ego, dem die Szenerie wie ein Abbild der Hölle vorkommt,bleibenin dieser deutschen UmgebungAußenseiter:
Patrzyłem naciemny piwniczny karnawał. Enerde odreagowywało przeszłość.Tak sobie powtarzałem, ponieważ pierwszy raz w życiu widziałem tyle żarcia. To miało coś wspólnego z piekłem. Szło się przez te piwnice i po bokach otwierały się jakieś nisze, boczne nawy, piwniczne kaplice z dębowymi stołami i sklepieniami z czerwonej cegły. I w jednej z nich, przy długim opustoszałym stole, zobaczyłem Henryka Grynberga. […] Był absolutnie sam. Wokół kłebiło się lipskie Enerde, a on powoli podnosił coś na widelcu i w głebi tej ceglanej niszy połyskiwały jego okulary. Niemcy wymordowali mu rodzinę. Cudem ocalała matka ocaliła jego. W czasie niemieckij okupacji Polacy zamordowali mu ojca. Siedział w środku tego teutońsko-enerdowskiego karnawału i patrzył. Patrzył, żeby zapamiętać i zabrać ten obraz ze sobą, nieważne dokąd się wybierze.
To był mój niemiecki początek. Samotność, Enerde, skini, pijaństwo, literatura i Holokaust.Do Niemiec nie można pojechać bezkarnie. [...](Stasiuk 2007,14, 16f.)
Ich schaute mir den dunklen Kellerkarneval an. Die DDRentlud sich derVergangenheit. Das sagte ich mir, da ich zum ersten Mal im Leben so viele Fressalien gesehen habe. Das hatte etwas von der Hölle. Man ging durch die Keller,und an den Seiten öffneten sich irgendwelche Nischen, Seitenschiffe, Kellerkapellen mit Eichentischen und Gewölben aus roten Ziegeln.Und in einer von ihnen, an einem langen, verlassenen Tisch, sah ich Henryk Grynberg […] Er war vollkommen allein. Drum herum ballte sich die Leipziger DDR, und erhob langsamseine Gabel und in der Tiefe dieser Ziegelnische schimmerte seine Brille. Die Deutschen haben seine Familie umgebracht. Die wie durch ein Wunder gerettete Mutter rettete ihn. In der Zeit der deutschen Besetzung Polens ist sein Vater ermordet worden. Er saß inmitten dieses DDR-Teutonen-Karnevalsund schaute. Er schaute, um sich alles zu merken und dieses Bild mit sich zu nehmen, egal wohin er sich aufmacht.
Das war mein deutscher Anfang. Einsamkeit, die DDR, Skins, Trinkerei, Literatur und Holocaust. Nach Deutschland fährt man nicht ungestraft. […]
Diese Szene bildet den Ausgangspunkt von StasiuksReiseberichten, die ausaneinandergereihten verbalenVorurteilenund Klischeesbestehenundvon der gegenseitigen Distanzder Völkerzeugen. StasiuksBuchendetjedochmit einem Hoffnungsschimmer, der in Richtung einerlangsamenAnnäherung deutet.WährendderIch-ErzähleraufdemStuttgarterFlughafenauf seinen Rückflug wartet, verfolgt er im Fernsehen den Besuch Benedikts XVI. in Auschwitz.Der deutsche Papst wirdfür den polnischenIch-ErzählerzummoralischenVorbild, daerim Gegensatz zu ihmdie Kraft und Courage aufgebrachthat, sich der Vergangenheit zu stellenund die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk zu suchen:
To był ten dzień, gdy niemiecki papież modlił się w Auschwitz.[...]Patrzyłem na obóz, na baraki, na druty kolczaste, krematoria, na to wszystko, co telewizja jest w stanie pokazać. Patrzyłem, jak papież klęczy i się modli, a za nim w sporej odległości stoi nieporuszony tłum, jakby czekał, że ta modlitwa coś w końcu zmieni, że nareszcie coś się dzięki niej stanie.[...]Właściwie to się nawet cieszyłem, że on tam jest i robi to za mnie i za całą resztę. Sam kiedyś dojechałem pod bramę, ale wymiękłem. Stchórzyłem i tyle. […] Na stuttgarskim lotnisku było ze dwanaście monitorów i cierpliwie chodziłem od jednego do drugiego, jakbym z tym klęczącym starym Niemcem mówiącym po polsku drogę krzyżową odprawiał.(ebd.,109f.)
Das war der Tag, an dem der deutsche Papst in Auschwitz gebetet hatte[...].Ich sah das Lager, die Baracken,denStacheldraht,dieKrematorien, alles das, was das Fernsehen zu zeigen im Stande ist. Ichsah, wie der Papst kniete und betete, und hinter ihm stand in einiger Entfernung die sich nicht bewegende Masse, als würde sie darauf warten, dass das Gebet endlich etwas ändere, dass dank dem Gebet endlich etwas passieren würde.[...]Eigentlich habe ich mich sogar gefreut,dass er dort ist unddasserdas für mich und den ganzen Rest macht.Ich bin selber einmal bis zum Tor gekommen,aberdann binicheingeknickt.Ich habe gekniffen und daswar’s.[…] Auf dem Stuttgarter Flughafen befanden sich etwa zwölf Monitore und geduldig ging ich von einem zumanderen, alswäre ich zusammen mit dem polnisch sprechenden, knienden, alten Deutschen den Kreuzweg abgegangen.
Im Anschlussan dieses ErlebnisfühltsichStasiuks Alter Egoerleichtert und entspannter. Dennochlässt der AutordenLeser mit einem offenen Endezurück.Auf seinem Rückflug entdeckt der Ich-Erzählereinen roten, pulsierendenRissam schwarzen Horizont, dessen Symboliknicht eindeutig ist:
Tamtego dnia, gdy papież był w Auschwitz, wystartowaliśmy o zmierzchu. Nad Bawarią zapadała mokra ciemność. Lecz potem, gdy znaleźliśmy się już wysoko, wysoko, na zachodzie otworzyła się długa, pozioma, świetlista szczelina. Lecieliśmy wzdłuż niej. Tutaj było ciemno, ale tam, w tym pęknięciu cienkim jak włos, jak rana po najostrzejszym ostrzu, płonął złocisty ogień, pulsowała purpurowa krew.KONIEC (ebd., 112)
An jenem Tag, an dem der Papst in Auschwitzgewesen ist, starteten wir bei Abenddämmerung. Über Bayern kam eine feuchte Dunkelheit auf. Später jedoch, als wir bereits weit, weit oben waren, öffnete sich im Westen eine lange, waagerechte, leuchtendeSpalte. Wir flogen an ihr entlang. Hier war es dunkel, doch dort, in diesem Riss, der so fein wie ein Haar war, wie eine Wunde nacheinem Schnitt mit dem allerschärfsten Messer, brannte ein goldenes Feuer, pulsierte purpurnes Blut. ENDE
Diesich am Himmel manifestierendeWundespiegelt wider, dasssich zwischenden VölkernNormalitätnur schwerlich wieder einstellt. Doch in diesem Schnittpulsierenkraftvolldas Blut unddamitdas Leben.Die Zukunft wird zeigen,ob dieoffeneWunde zuheilenwird.
Stasiuks provokativesBuch ist nur einesin einer Reihe vonAufsehen erregenden Projekten, die in den letzten Jahren entstandensindund sich explizit mit dem kollektiven Traumaauseinandersetzen, indem siedieKunst und Kultur alseine ArtpsychoanalytischesVerfahrenerproben.Eine Gemeinsamkeitdieser Werkebestehtdarin, dasssievielfachmitden Verfahren desmagischenRealismus operierenunddieLebendenmitden Verstorbenenkonfrontieren, die plötzlich wieder lebendig werden. Dabei zeigt sich, dass diese Geister keine Schreckgespenster sind, sondern an den gleichen Traumata wie die Lebendenleidenund dieselben Bedürfnissenach innerem Friedenbesitzen.
Eines der prominentesten undbemerkenswertestenProjekteist aus den Aktivitäten derisraelischenKünstlerinYael Bartana hervorgegangen.In Zusammenarbeit mitAngehörigender linken KulturszenePolenshat siedasFilmprojektThe Polish Trilogyrealisiert,dasdie Erinnerungsmaschinerie des Holocaustdekonstruiert(vgl.Bartana 2011)und eine produktiveDiskussion anzustoßenbeabsichtigt. DerText zumerstenTeil der Trilogie, der den TitelMary Koszmary/Nightmares(2007)trägt,stammtvonder Autorin und SoziologinKinga Duninsowie vonSławomirSierakowski, dem Gründerund Chefredakteur derlinks-intellektuellenZeitschriftKrytyka Polityczna(gegr. 2002;Politische Kritik)sowie des gleichnamigen Verlags,welche die Basis einermittlerweile breit aufgestelltengesellschaftspolitischenBewegungbilden.Sierakowski verkörpertzudemdenzentralen Charakter der Trilogie, der im Laufe der Zeitden Status einergesellschaftspolitischenSymbolfigurannimmt.
Der politisch aufgeladene Film spieltmit derPropagandaästhetik, die derNationalsozialismus,derSozialismusund Zionismus miteinander teilten(vgl.Zemel 2011, 50).ImStiledernationalsozialistischenPropagandamaschinerieundinsbesondereder Ästhetik von Leni RiefenstahlsPropagandafilmTriumph des Willens(1935)(vgl. Petrowskaja 2012)hält Sierakowski im WarschauerStadionDziesięciolecia Manifestu Lipcowego(Stadion des 10. Jahrestages des Juli-Manifestes)eineemphatischeAnsprache, in der er 3.300.000ermordeteund vertriebenepolnischeJudendazu auffordert,in ihrpolnischesVaterlandzurückzukehren, da mannur vereint eine Zukunftaufbauenkönne:
Jews! Fellow coutrymen! People,PeeeeeeopleReturn! Weneed you!You think the old woman who still sleeps under Rifke’s quilt doesn’t want to see you? Has forgotten about you? You’re wrong. She dreams about you every night. Dreams and trembles with fear.Since the night you were gone and her mother reached for your quilt, she has had nightmares.Bad dreams. Only you can chase them away. Let the three millions Jews that Poland has missed stand by her bed and finally chase away the demons.Return to Poland, to Your country![…] Return and we shall finally become Europeans.[…]Return not as shadows of the past but as a hope for the future.Heal our wounds, and you’ll heal yours. And we’ll be together again.(Bartana 2007)
Das heutigePolen wirdin dem Filmals einmelancholischer Raumkonstruiert,in dem diemonokulturelleBevölkerung von den Geistern der Vergangenheit geplagt wirdund nicht den Weg indieGegenwart findet.Dieser Eindruckeines„haunted space“(Zemel 2011, 50)und des kulturellen Niedergangs wirddurch die Lokalitätverstärkt. Sierakowskisteht zusammen mit einer Gruppe polnischer Pfadfinderinmitten des leeren, dem Verfall Preis gegebenenWarschauerStadions, dasim SozialismusgroßenPartei-Kundgebungen und derVeranstaltung vonFeierlichkeitengedient hatte.Doch nun ist das Gemäuer verwittert und die Rängesindmenschenleer.Und dennochspricht Sierakowski nicht ins Leere. Denn durchdie Kameraführung entsteht der Eindruck, dassdie Geisterder Toten und Vertriebenenzugegenseienund ihmvon den Rängen auszuhörten. Die 3.300.000 Juden, an die sich der fiktionalisierte Sierakowski wendet,bilden einen metaphysischenBestandteil des Stadions,dasaus demSchutt des Warschauer Aufstands erbaut worden ist.
Der zweite Teil der Trilogie,Mur i wieża/Wall and Tower(2009),ist als Antwort aufSierakowskisRede konzipiert, diesich leitmotivisch durch den Zykluszieht.Zu Beginn desFilms, der u.a. Kritik an der zionistischen Politikübt,wirdseine Ansprache eingespielt, derdiesmalallerdingseine Gruppe von jüdischen Siedlern zuhört.NunbeginntdieUtopie Gestalt anzunehmen.Diejungen, enthusiastischenFrauen und Männer, die im Übrigenjüdische und polnischeStatistensindundklischeehaftdemzionistischenIdealder 1930er Jahreentsprechen(vgl.Anonymus 2009), machensich nach Warschau auf, umdortim öffentlichen Raum einen Kibbuz zu errichten.Entsprechend derwährend des Arabischen Aufstandsin den 1930erJahrenpraktiziertenjüdischenTurm-und-Palisaden-Siedlungspraxis,Homa U’Migdal(dt.Mauer und Turm),okkupierensie ein Stück Land, auf dem sie innerhalb von 24 Stunden eine befestigte Siedlung bauen.DerGebäudekomplex wird zum Schlussmit Stacheldraht gesichert, so dass sichunweigerlichder Vergleich mit einemKonzentrationslager aufdrängt.AnzusätzlicherBrisanz gewinnt die Kunstaktiondurch dieSymbolik desOrtes.Der Kibbuzbefindet sichim StadtteilMuranów, der nach dem Krieg buchstäblich auf den Trümmern des Gettoserbaut worden ist(zur Geschichte dieses Stadtteils s. Chomatowska 2012).Zum Zeitpunkt der Aktion war der Platz zudem bereits als Baugrund fürdasMuzeum Historii Żydów Polskich(Museum der Geschichte der polnischen Juden)ausgewiesen, waswie einAugenzwinkernwirkt, denn mit der Realisierung des Museumssollein Ort der polnisch-jüdischen Begegnungentstehenunddie Grundlage für ein neuesjüdischesLebeninPolengeschaffen werden:
Muzeum ma stać się punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem dokonującego się przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków iŻydów.[...]Istnienie Muzeum powinno wspomóc rozwój tożsamości żydowskiej, wśród odradzającej się wspólnoty Żydów polskich,[…]Program Muzeum będzie swego rodzaju portalem, dającym ogólną orientację ikierującym wszystkich zainteresowanych do miejsc, wktórych przypominane są zarówno jasne jak iciemne karty polsko-żydowskiej przeszłości.
Muzeum powinno jednak nade wszystko stać się miejscem spotkań idyskusji ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość iwspółczesną kulturę żydowską, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami iograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia inacjonalistyczne uprzedzenia.(Muzeum Historii Żydów Polskich)
Das MuseumsollzueinerAnlaufstellefür allewerden, dieam Erbe der polnischen Judeninteressiertsind,und es solleinSymbolfür diesichabzeichnende Wendein den polnisch-jüdischenBeziehungen darstellen.[…]Die Existenz des Museums sollte dabei helfen,jüdische Identität unter dererneutauflebendenGemeinschaft polnischer Judenwiederauszubilden, […]Das Museumsprogrammistalseine Art Portalgedacht, das allen InteressiertenallgemeineOrientierung bieten undihnen die Richtung zu Orten weisen soll, an denen sowohlandie weißen als auchan diedunklen Flecken der jüdisch-polnischen Vergangenheit erinnert wird.
Zuallererst soll das Museum jedochzu einemOrt der Begegnung und der Diskussion für diejenigenwerden,diedieVergangenheitunddiegegenwärtigejüdische Kultur besser kennenlernensowie sich den Vorurteilen stellen undgegenErscheinungen wie Fremdenfeindlichkeit und nationalistische Vorurteile angehen möchten, die eine Bedrohung für die moderne Welt darstellen.
Am Eingang des Kibbuzistauf Hebräisch die Aufschrift„Willkommen im Kibbuz Muranów“angebracht. Für denZuschauerstellt sich jedoch die Frage, wie die Bewohner des Viertels auf dieses irritierende, so plötzlich aufgetauchte Konstruktreagieren sollen, das die schwierige Vergangenheit wieder aufleben lässt.Schließlichstelltder Kibbuz in dieser UmgebungeinenFremdkörperdar(vgl.Anonymus 2009), der mit seinem Schutzwall keineswegs einladend wirkt. Auf dieKluft zwischenden Gruppenweist Bartana mitkurzenFilmsequenzenhin, in denenverblüffte, zumeist ältere Einwohner des Viertels gezeigtwerden,die einenstarkenKontrast zu den Siedlern bilden,dieunbedacht, fast schon naiv den Platz okkupieren und ihr Projekt ausführen.
Im dritten Teil,Zamach/Assassination(2011),treibtBartanaihrGedankenexperimentauf den Höhepunkt.So bildet den Ausgangspunkt der Handlung die Beerdigung Sierakowskis, der von einem unbekannten Attentäter ermordet worden ist und im Warschauer Kulturpalast aufgebahrt wird. Um von ihm Abschied zu nehmen,zieht an dem Katafalk der Strom seiner Anhängerin einer pathetisch aufgeladenen Atmosphärevorbei.InMary Koszmaryhattelediglich eine kleine Gruppe von einigen wenigen PfadfindernseineIdeengeteilt.In der Zwischenzeitisthierausjedoch eine Massenbewegungerwachsen, dasJewish Renaissance Movement in Poland(JRMiP), dessen Emblemeine Verschmelzung des polnischen Adlers mit dem Davidsternist.Im Anschlussan die Trauerfeierlichkeitenversammeln sich seine Anhänger zu einerKundgebungauf demsymbolträchtigenPiłsudski-Platz,auf der mahnende Redengehaltenwerden.[2]Wie sohäufigin der Geschichtewird dieser Märtyrermord nicht als Rückschlagempfunden, sondern er gibtder BewegungzusätzlichenAntrieb. Die übersteigertpathetische Stimmung des Filmes und der mythisierende Personenkult, der rasch in Fanatismus umschlagen kann,lassenden Zuschauer diese Entwicklunghinterfragen und werfeneinen ironischen Blicku.a.aufdie Politik Israels(vgl.Sieńkiewicz 2011).Die Szeneriewirddurch diebereits im erstenTeil erwähnte Ryfkaunterbrochen, dieim Zweiten Weltkrieg ermordetwurdeunddiesich nunstellvertretendfür alledenverschiedenenVölkermorden zum Opfer gefallenenjüdischen, aber auch anderenSeelenäußert. Ungesehenvon den Teilnehmern derKundgebungwandelt sie mit ihrem Köfferchen zwischen denDemonstrantenumher und klagt an, da sie die sich ewig gleichenden und rückwärtsgerichteten Erinnerungsrituale nicht mehr ertragen kann:
Jestem duchem powrotu, powrotem wracającym do siebie. Zatopiony wgrobie żalu, którego nie można wyrazić słowami, mój martwy język kryje coś, co zostało żywcem pogrzebane.Jestem tu, by odsłonić zniszczenie rozumienia dokonywanego za pomocą języka[...].Tak mnie zmęczyły upamiętniające ceremonie, powtarzające się rytuały przemysłu wspomnienia [...].Zgubiłam się w limbo, zapadającym się w siebie, gdy tylko znikają wyjaśnienie, perspektywa i refleksja; straciłam i ciągłość, i wieczność. Skazana na wieczne przeżywanie pamięci, pojmana w pułapkę luster, niezdolna do oddzielenia refleksji od doświadczenia, niezdolna odróżnić duchy od żywych.(Bartana 2011)
Ich bin der Geist der Wiederkehr, derRückkehr, die zu sich selberführt. Versenkt im Grab der Trauer, dieman mit Worten nicht ausdrücken kann,verbirgtmeine tote Zunge etwas, das lebendig begraben worden ist.Ich bin hier, um diemit Hilfe der Sprache vollzogene Zerstörung des Verstehens zu enthüllen […].Mich haben dieGedenk-Zeremonien,die sich wiederholenden Rituale der Erinnerungsindustrie,dermaßenermüdet[…].Ich habe mich im Limbus verloren,der sofort in sich einstürzt,sobalddieErklärungen, Perspektiven und Reflexionen verschwinden; ich habe die Kontinuität und die Ewigkeit verloren. Ich bin zum ewigen Durchleben der Erinnerung verurteilt, ich bin gefangen in der Falle der Spiegel, unfähig,dieReflexionvon der Erfahrung zutrennen, unfähig,die Geister von den Lebenden zu unterscheiden.
BartanasTrilogiehat weltweitBeachtung erfahren.DasProjektist nicht nurin führenden Kulturinstitutionengezeigt worden, sondern2011wurde es ebenfallsim polnischen Pavillonauf der Biennalein Venedigals erstes Kunstwerk einernichtpolnischenKünstlerinpräsentiert.DasFaszinierendeandiesemjüdisch-polnischenProjekt ist jedoch nicht alleinseinegroße Resonanzund Vielschichtigkeit, sonderndass es die Grenzen zwischen Kunst und Realität verwischt.Aus demfiktivenJRMiPisteine internationale Bewegungerwachsen, dieeinepolitischeBotschaftverfolgt, wobei nicht eindeutig ersichtlich ist,wasin der TatAusdruck eines politischen Aktionismus undwasTeil eines Kunstprojektsist(vgl. hierzu Stokfiszewski/Żmijewski 2012).Wie jede ernstzunehmende Organisationunserer TagebesitztdieJRMiPeine eigeneHomepagemit Kontaktadressen, ein Manifest undeineFacebook-Seite mitüber 1.400 I-like-it-Bewertungen(vgl.Facebook 2010). Im Mai 2012 hat auf der BerlinerBiennale zudem ein erster Kongress mit Delegierten aus der ganzen Welt stattgefunden, die darüber diskutiert haben, was sich an der Politik Europas und Israels ändern müsste, damitJuden wieder in Polen resp.Europa leben könnten.Die Forderung nach der Rückkehr von 3.300.000 Juden nach Polen ist selbstredend nicht wörtlich zu nehmen, sondern sollvielmehrden Anstoß zu gesellschaftlichenDiskussionen undVeränderungen geben.DennBartana vertritt die Ansicht, dass diejüdische und polnischeGesellschaft dasHolocausttraumaeinzig durch die Konfrontationwird verarbeitenkönnen:
Ich will die Vorstellungskraft in Schwung bringen. Ich bin doch keine Faschistin, die Menschen davon überzeugen möchte, aus ihrer Heimat in ein anderes Land umzusiedeln! Es handelt sich ja um ein symbolisches Projekt, bei dem es nicht um Lösungen geht, sondern um Fragen der Identität. Man versteht das Eigene besser durch solche Bewegungen. Wenn wir unser Trauma überwinden wollen, müssen wir nach Polen. In Israel sind die Menschen besessen vom Holocaust, auch diejenigen, die ihn nicht erlebt haben. Ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl. (Petrowskaja 2012)
DasMotiv der durch polnische Städte wandelndenjüdischenGeister findet sich auch in der jüngsten polnischen Holocaustliteratur wieder.In einer etwas leiseren, intimerenVariante taucht esim KapitelŁączniczki(Verbindungsfrauen) vonSylwia ChutniksDebütwerkKieszonkowy atlas kobiet(2008;dt. u.d.T.Weibskram) auf, das vomSchicksal der Warschauerin Mariahandelt.Diemittlerweilegreise Frau,hatteihrgesamtesLeben unter ihren Kriegstraumatagelitten.EinLebenlanghattesie ihre Erlebnisseverschweigenundihre jüdische Identitätvor ihren Mitmenschenverheimlichenmüssen.Dietief verborgenenseelischen Qualen sind auch der Grunddafür, warum siekeine eigene Familiegründenund glücklich werdenkonnte.Nach dem Krieghatte sieein Kindzur Weltgebracht, dassie– wievon der Erzählerinstanzangedeutetwird–vermutlich jedochselbergetötethat,da der psychische Druck zu groß gewesen ist.Enttäuscht von der Weltund den Anfeindungen, denen sie als Jüdin ausgesetzt ist,zieht sie sich zum Sterben in denKeller ihres Wohnhauseszurück. Durch diesen symbolischen Aktteilt siedas Los des schmerzhaften, einsamen Todes mit all den Menschen und insbesondere jüdischen Mitbürgern, die im Krieg in so vielen Warschauer Kellern den Tod gefunden haben:
Piwnica w kamienicy na Opaczewskij. Nie mogła już normalniesłużyć ludziom, mimo generalnego remontu i dokładnego zdrapania zwłok ze ścian. Mury piwnicy widziały sceny, po których nie mogą już przechowywać rowerów, leżaków i przetworów na zimę. Takie miejsca to pomniki. Co jednak robić w chwili, kiedy pomnik jest elementem teraźniejszości: bloku zamieszkałego przez żywych. Zasypać piwnicę, udawać, że nic nigdy się tu nie wydarzało.(Chutnik2009, 102)
Der Keller im Wohnhaus in der Opaczewska-Straße. Er konntedenMenschen keinen normalen Dienst mehr leisten,obwohler grundrenoviertworden istunddie Leichengründlich von den Wändenabgekratzt worden sind. Die Kellermauern haben Szenen gesehen, nach denen sie keine Fahrräder, Liegen und Eingemachtes für den Winter aufbewahren konnten. Solche Orte sind Grabmäler. Doch was soll man in solchen Momenten machen, in denen der Grabstein ein Bestandteil der Gegenwart ist: Ein von lebenden Menschen bewohnter Block. Den Keller zuschütten, vorgeben, dass hier nie etwas passiert ist.
Der Keller wird bei Chutnik zum plakativen Symbol des verdrängtenHolocausttraumas.Die überlebenden polnischen Judenwarennach dem Kriegnichtnur vomNaziterrorgezeichnet, sondernsie wurdenauchweiterhin stigmatisiert.Soschafft Maria eserst durch die Aussprache mit ihrer Mutter, die im Zweiten Weltkrieg von einem Nazi erschossenwurdeund Marianunals Geist erscheint, Frieden zu finden:„Nikt ducha zmarłej nie wywołał, sama przylazła i mówi do córki: ,A chodź, na spacer pójdziemy, dzień taki ładny, co będziemy tak siedzić w murach‘“(ebd., 109; „Niemand hatte den Geist derVerstorbenen gerufen, von selbstist sie hergekommen und sagt zu der Tochter: ‚Ach lass uns gehen, wir machen einen Spaziergang, der Tag ist so schön, was sollen wir hier in diesenMauern sitzen‘“).Seit dem Tod ihrer Mutter hatte Mariastetsdas Gefühl der Schuld mit sich getragen, doch nunempfindetsieanihrerSeite zum ersten Mal wiederGeborgenheit.Zusammenspazierensie zum letzten Malüber den Warschauer Bazar,was allerdings erneutdieNichtzugehörigkeit Marias zur polnischen Gesellschaft zum Ausdruck bringt.Erschöpftscheidetsie schließlich dahin: „Zamykam oczy.Czuję, że zaraz będzie po wszystkim. Czuję ulgę, nareszcie. Czy to boli? Nie bój się, córeczko, jestem przy tobie“(ebd., 110; „Ich schließe die Augen.Ich fühle, dass gleich alles vorüber sein wird.Ich fühle Erleichterung, endlich. Wird es schmerzen?Hab keine Angst, Töchterchen, ich bin bei dir“).Obzwarsie Erleichterung verspürt, bleibt doch derfahleBeigeschmack eines vergeudeten Lebens. Den Holocaust hatte Maria zwar überlebt, doch innerlich ist sie schon damals gestorben.
Sehr viel prominenter als ChutnikbautAndrzej Barth das Geistermotivin seinenRomanFabryka muchołapek(2008;Die Fliegenfängerfabrik) ein, dereine großeAufmerksamkeitin der Öffentlichkeit erfahren hat(vgl.Kijowska 2011)undu.a.2011 ins Deutsche übersetzt worden ist. Im Zentrum desBuchesstehtein fiktiverProzess, derin der Gegenwart, und zwarim Jahr2007,gegenMordechai ChaimRumkowskigeführt wird. Rumkowski, derehemaligeVorsitzendedesJudenrats im Getto Litzmannstadt,gilt als historisch umstrittene Persönlichkeit, da zum einen das Łódźer Getto–und damit das Leben der Getto-Bewohner–dankseinerLeitungund Kooperationspolitikam längstenvon allen Gettosüberdauern konnte.ZudemhatteRumkowskiversucht,diestädtischeInfrastruktur und dieLebensmittelversorgung im Getto bestmöglich aufrecht zu erhalten, um das Leid so gering wie möglich zu halten.Dem gegenüber stehenjedochseinautoritärer, selbstherrlicherFührungsstilsowieseinekontroversenEntscheidungenüber Lebenund Todim Getto(vgl. hierzuUnger 2004).
Die Handlung des Romans beginnt mit der Zusammenkunft der unterschiedlichsten Personenin einer ehemaligen Łódźer Fabrik, der sogenannten Fliegenfängerfabrik, anlässlicheines Prozessverfahrens gegen Rumkowski.Der Ich-Erzähler,einSchriftsteller und BarthsAlterEgo, wirdvon einem geheimnisvollen Fremdenzu diesemProzesseingeladen, ohne dass erim Vorfelderfährt, um wen es sich bei dem Angeklagten handelt.Als er amOrtdes Prozesseseintrifft,stellter fest, dassdieAnwesendenallesamtVerstorbenesind, dieeinzigzum Anlass desVerfahrenswiederzum Lebenerwecktwurden. Im Laufe des Prozesseslernt Andrzejdietschechische JüdinDorakennen,mit dererverbotenerweise einen Spaziergang durchŁódźunternimmt.Zusammen mitihrund ihren Erinnerungen erkundet er seine Heimatstadt, die noch voller Spuren der jüdischen Vergangenheit ist.Dabeiist sich der Ich-Erzählernichtsicher, ob er träumt, temporär geisteskrank ist oder ob es sich um einetatsächlich stattfindendeBegebenheit handelt.
Ausgehend von derGerichtsverhandlung, die den Dreh- und Angelpunkt des Romans bildet,verwebt Barth kongenialdie Ebenen des Fiktiven,Phantastischen undAußertextuell-Realenmiteinander.Dies gelingt ihm u.a., indem erzwei derbelangreichstenGerichtsprozesseder Menschheits- bzw. Literaturgeschichte, und zwardenEichmann-Prozess(1961)sowie Franz Kafkas fiktiven RomanDer Process(1925),in den Text miteinfließen lässt.Dank dieseraußer- undintertextuellenReferenzengewinnt der Text sowohl an ästhetischemReizals auch anAussagegehalt.
DieReferenz auf denEichmann-Prozesswird unverkennbar durchdie Anwesenheit Hannah Arendtsmarkiert, die seinerzeit zu den prominenten Prozessbeobachtern in Jerusalemgehörte. Hinter beidenspektakulären Prozessensteht der Versuch,sichin das Wesen des Angeklagten hineinzuversetzen und die persönliche Schuldzuermitteln, um das Grauen der Holocaust-Maschinerie besser verstehen zu können.Doch trotz der zahlreichen Zeugenaussagenbleibt dem Leser die Persönlichkeit des Angeklagtenfremd, da Barth keinerlei Einblicke indessenInnenlebengewährt. Die Verhandlungdemonstriert, dass es nicht möglich ist, sich in Rumkowski hineinzuversetzen und zurhistorischenWahrheit durchzudringen (vgl. Polit 2011, 378f.).Dennoch bringt das Gerichtsverfahren die erschreckende Erkenntnis zu Tage, dass es sich bei Rumkowski ebenso wie bei Adolf Eichmannum ganz normale Menschen gehandelt hat.[3]DerberüchtigteGetto-Königistam Endelediglicheingebrechlicher, alter Mann,sowie EichmannäußerlicheinvollkommenunscheinbarerMenschgewesen ist.In Anlehnung an Arendts Formulierungvon der „Banalität des Bösen“ lautet daherdas emotionaleSchlussplädoyervon Rumkowskis VerteidigerBornstein,der in seiner Rage und Hilflosigkeit angesichts des geschehenen Grauens plötzlichdie Funktion desAnklägersübernimmt:
Powtarzam pytanie: czy warto było tracić czas na mojego klienta? Po trzykroć tak. Trzeba bowiem surowo ukarać próżność, która pozwoliła mu uwierzyć we własną wyjątkowość. Trzeba było wybić mu z głowy fałszywe przekonanie, że był dobrym, opiekuńczym Żydem, bo był tylko nadętym głupcem. Wnoszę zatem o wyrok najsurowszy ... Niechże naszą karą będzie wieczne zapamiętanie go takim, jakim był!(Barth 2008, 251)
Ich wiederhole die Frage: Hat es sich gelohnt, für meinen Mandanten Zeit zu vergeuden?Dreimal ja. DieEitelkeit, die es ihm erlaubthat, an seine eigeneAußergewöhnlichkeit zu glauben, muss nämlich strengstens bestraft werden. Man musste ihm die falsche Überzeugung aus dem Kopf schlagen, dass er ein guter, fürsorglicher Jude gewesen sei, denn er ist lediglicheinaufgeblasener Dummkopf gewesen. Daher fordere ich das härteste Urteil … Soll unsere Strafe darin bestehen, dassman ihnfür alle Zeiten alsden in Erinnerung behält, der erwar!
Obwohldiehistorische PersönlichkeitRumkowskisdie Folieder Handlungbildet,fungierternichtalsHauptprotagonist.Das Augenmerk des Leserswird vielmehr auf die derVerhandlungbeiwohnenden Personen gelenkt.Mit demProzess wirddenvielfach namenlosen OpferndesŁódźer Gettoseine Stimme verliehen,mit der sievon Angesicht zu Angesichtzum ersten MalAnklage erheben und sich zum Geschehenenäußernkönnen.Im Mittelpunkt des Buches stehtinsbesondereBarths Alter Ego, dassich urplötzlich in einer kafkaeskenWeltwiederfindet.Wie auch die übrigen AnwesendenwirdderpolnischeSchriftstellerunversehens in dasGescheheninvolviert, ohne zu wissen, wer dieses Gericht überhaupt einberufen hat.Hinterdiesem mysteriösen,an KafkasProcesserinnerndenGerichtsverfahrenverbirgt sicheine dem Menschen nicht begreifbare,höhereInstanz,diedurch denVorsitzenden Richter repräsentiert wird, der vermutlichGott selbstist.
Das kafkaeske Momentwird zusätzlichdurchden literarischen Raumder Fabrikunterstrichen, der sich aus labyrinthartigen Gängen und unzähligen Türen und Räumen zusammensetzt,die den Protagonisten ihre Kleinheit undMachtlosigkeit angesichts der Geschehnissevor Augen halten.Andrzej schafft es allerdings, diese Umgebung zuverlassen undzusammenmit Dora, von der er sichsehrangezogen fühlt,in den städtischen Raum des heutigen Łódź zu gelangen.Dies gibt dem Polen und dem jüdischen Geist die Möglichkeit, sich einandersowie der Vergangenheitanzunähern.
Mit dem Prozessendetrittwiederdie altevermeintliche‚Normalität‘ein. Die für die kurzeZeitzum LebenwiedererwecktenToten werdensymbolträchtigin Güterwagons dorthin zurückgebracht,vonwoher sie gekommenund vor so vielen Jahrzehnten ermordet worden sind.Und Andrzej kehrt in seinaltes Lebenzurück. AmLauf der Geschichtehat sichnichtsgeändert.Der Schriftstellerbeendetseinen RomanFabryka muchołapekund damitauchseinepersönlicheAuseinandersetzung mit der Vergangenheit seiner Heimatstadt.
DerRomanspiegelteineninneren Prozessdes Hauptprotagonistenwider,der – analog zuKafkaoderStasiuksBeschreibung des verwinkelten Kellers –durch den verschlungenen Raumversinnbildlichtwird. Barths Alter Egoversuchtdie GeschehnissemiteinergeistigenErkrankungzu erklären,denn selbstseine Tagebuchaufzeichnungen weisen keinerleiHinweiseaufseine Erlebnisse in der Fabrik auf.Allerdingsfindeterin seinem Besitzden Füller, der einst Dora gehört hat, was eine tiefeIrritationin ihmauslöst:
Czuję się świetnie, czas zapomnieć o zwidach, a przede wszystkim postawić ostanią kropkę. Irytuje tylko pióro z zielonego szylkretu, w pudełku wyłożonym aksamitem, ze złotym napisem „Pramen & Sohn“.Patrzę na nie, raz nawet próbowałem napisać nim słowo, a przecież to nie moje.(Barth 2008, 275)
Ich fühle mich großartig, es ist Zeit, die Traumgespinste zu vergessen, und vor allem den letzten Punkt zu setzen. Lediglich der Füllfederhalter aus grünem Schildpatt in diesem mit Samt ausgelegten Schächtelchenundder goldenen Aufschrift „Pramen & Sohn“ auf dem Deckelirritiert.Ich schaue ihn an, einmal habe ich sogar versucht, ein Wort mit ihm zu schreiben, dabei gehört er nicht mir.
DieunmittelbareKonfrontation mit der VergangenheitscheinteinenGenesungsprozessinderPsyche deszu Beginnmissmutig gestimmtenSchriftstellerseingeleitetzu haben.Seitjeher hatihn der Holocaust an den Juden belastet,weshalber bereits als Kind Albträume gehabt hat.Obwohl er sichaktuellwohler fühlt, istder Prozesskeineswegsbeendetunderwird es wahrscheinlichauchniewerden, wodurch sich der Kreis zum ergebniskargen Gerichtsverfahren schließt.DerHolocausthat unsere Realität und unser Bewusstsein dermaßen geprägt, dasssichseine Präsenz nichtabschwächen lässt.DurchdieExistenzdes Füllfederhalters ergibtsichabschließenddie Frage, ob der polnische Schriftstellertatsächlich im Stande ist,mitseinem Romanden jüdischen Holocaust der Nachwelt angemessenzuvermitteln.
Eine Art PersiflagevonFabryka muchołapekstellt derRomanNoc żywychŻydów(2012;Die Nacht der lebenden Juden) vonIgor Ostachowicz dar, hinter dessen skurriler Handlung sichderewige Kampf zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle verbirgt.DerTextorientiert sich an derÄsthetik derPopkulturund zeichnet sich durch einenhumoristischenSchreibstil aus. Dennoch besitztder Romaneine der Thematik gebührendeTiefeundrepräsentierteinenneuenundunverkrampften Umgang mit der Holocaustthematikin Polen.[4]
Der Heldoder vielmehrAntihelddesBuchesist ein sich in den Dreißigern befindenderFliesenleger„mit höherer Bildung“,derklischeehaftdiein derNachwendezeit sozialisierteund von der Popkultur geprägteGenerationpolnischer Großstädterrepräsentiert.[5]Seiner Umwelt begegnet er mit Gleichmut und trotzHochschulabschlussgenügt ihmseineTätigkeitals Handwerker. Zusammen mit seiner arbeitslosenundmagersüchtigen, jedoch– im Gegensatz zu ihm–idealistischenFreundinChudawohnter in einem Plattenbau in Muranów. Eines Tages wirddas Paardamit konfrontiert, dass in ihrem Kellereine nicht überschaubare Anzahl anjüdischenSeelen herumgeistert. Diese habenim KriegschwereTraumata erlitten. Da bei ihnen–imUnterschiedzu den polnischen Toten–niemand übriggebliebenist, der sie betrauern könnte,könnensie die irdische Welt nicht verlassen.
Das Paarfreundet sich mit derimTeenageralterverstorbenenRachelan, dieunter einem Trauma leidet,weshalbihre Seelekeine Ruhe findet.Siewird erstdannerlöst werden, wenn sieihrTrauma überwindet und wieder zu lachen beginnt.UmRachel bzw. Rejczel – wie sie selber genannt werden will –zuhelfen,beschließtdas Paarmitihrin dieWarschauerShopping Mallmit dem bezeichnenden NamenArkadia(Arkadien)zu gehen, woderGeist–ähnlich wie Dora inFabryka muchołapek–neu eingekleidet wird. Am nächsten Tag steht eine Horde vonverstorbenenjüdischenKindern vor der Tür des Fliesenlegers, diesichnunallesamtim Konsumtempelvergnügenwollen.Alsbald ist die Warschauer Innenstadt vondenGeistern bevölkert,und der Fliesenleger, der sichEliza Szybowicz(2012)zufolge zum Anti-Szmalcownikentwickelt,ist damit beschäftigt, auf dieRasselbandeaufzupassenund ihren Konsum zu finanzieren.Erschwert wird dies dadurch, dass in der Stadt eineauf die Geister Jagd machendeGruppe von polnischen Neonazis ihr Unwesentreibt, wodurch sich eine weitere ParallelezuFabryka muchołapekergibt,woBarth Andrzejs und Doras Spaziergang durchŁódźnutzt, um den gegenwärtigen polnischen Antisemitismus zu problematisieren.Einer vonden Neonazis,Ktoś Złybzw.KZ(Jemand Böses), ist vom Teufel besessen und mutiert zudem WesenZupełnie Zły(Vollkommen Böse),dersichalseine große Bedrohung für Rejczel und die übrigen jüdischen Seelen entpuppt.In der Shopping Mallkommt es schließlich zu einem finalen Entscheidungskampf.Mit HilfeeinerListgelingtesdem Fliesenlieger,seine Schützlingezu retten, doch er selbstverliertdabeisein Lebenundwird von dem EngelUrielabgeholtundzumJüngstenGerichtbegleitet, vor dem ja auch schon Rumkowski gestanden hat.
Der vorgestellteRoman spielt selbstironisch mit denKonventionen derverschiedenenGattungen und Filmgenres.Der AutorverwendetZitate, KlischeesundAnspielungen,dievom Zombiefilm über den Abenteuerfilmbis zurLiebeskomödiereichen. Dochzu allererstist der Textein zeitgenössischer Bildungsroman (vgl.Sokalska 2012), indem der Antiheld Verantwortungsgefühl und moralisches Handeln erlernt.
Mit seinemRoman, der in Polen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und die Kritiker in zwei Lager gespalten hat(vgl. Anonymus 2012),versucht Ostachowiczeinen Impuls zurAufarbeitungdesHolocaustzu geben,wofür ereinen großen Bedarf in der polnischen Gesellschaftsieht:
Mimo debaty wokół„Sąsiadów“i Jedwabnego temat nie został społecznie przepracowany, więc każdy sobie z nim radzi, jak potrafi. Większość spycha, część brnie w antysemityzm, a niektórzy przyjmują na siebie żydowskie pochodzenie. Jest wyrwa, ciemna plama i trauma [...].Nie wiedzą nawet, jak się nazywa ta rzecz, którą Żydzi przyczepiają na drzwiach, a więc jak mają rozprawiać o Holocauście. A prawda jest taka, że nie trzeba dużo wiedzieć, by umieć odróżnić dobro od zła. Każdy człowiek, łącznie z moim bohaterem, jest w stanie to rozpoznać. Oczywiście, można przeżyć życie bez takiego wyboru, ale warto podjąć ten wysiłek, tym bardziej że i tak trudno od niego uciec.(Wodecka 2012)
Trotz der Debattenrund um die „Nachbarn“ und Jedwabneist dasThemanoch nicht gesellschaftlich aufgearbeitet worden, so dass jederauf seineeigeneArt damitfertig wird. Die meistenweisen es von sich, einigetraben in RichtungAntisemitismus, und einigenehmendie jüdische Abstammungauf sich.Es gibt einen Riss, einen dunklenFleck undeinTrauma [...].Sie wissen noch nicht einmal, wie diesesDingheißt, dasdieJuden an der Tür befestigen,alsowie sollen sie sich mit demHolocaustauseinandersetzen. Und die Wahrheit ist, dassman nichtviel wissenmuss, umzwischenGutundBöseunterscheiden zu können.Alle,samt meinemHelden,sindin der Lage,dieszu erkennen.Selbstverständlich kann man auchohneeine derartigeWahl leben, aber es lohnt sich,die Müheauf sich zu nehmen,umso mehr, da es eh schwierig ist,vorihrwegzulaufen.
Das Holocaust-Themaist auf dempolnischenBuchmarkt undinderKulturszenenoch nie sopräsent gewesen.Ein Grund hierfürist,dass sich die Kulturschaffendenauf einer internationalen Bühnebewegen und von Warschau bis New York zuhause sind. Dabei empfindensie den nationalen Komplex und den nicht aufgearbeiteten Holocaust als ein starkes Hemmnis für die Entwicklung Polens. Soerklärtzum BeispielBarths Alter Ego seinen schizophrenen Zustand mit demauf Polen lastendenMakel:
Wiedziałem już, skąd wziął się atak choroby. Jako młody chłopak kazałem sobie opowiadać historię, jak to ludzie z wielkiego świata przyjechali do mojego miasta i co się z nimi potem stało. [...] To nic, że umierali w zatruwanych spalinami ciężarówkach czy komorach gazowych Chełmna czy Auschwitzu. Dla ich przyjaciół w Pradze, w Wiedniu czy Berlinie to Łódź była miejscem, z którego dali ostatni znak życia.Zawsze mnie to obrażało.(Barth2008, 92f.)
Ich wusste schon, woher dieser Krankheitsschubstammte. Als Junge hatte ich mir erzählen lassen, wie die Menschen aus der großen Welt in meine Stadt gekommensindund was dann mit ihnen passiert ist.[…] Es macht nichts, dasssiein den Gaskammern von Kulmhof oder Auschwitz gestorben sind. Für ihre Freunde aus Prag, Wien oder Berlin war Łódź der Ort, von dem aus sie das letzte Lebenszeichen gegeben haben. Das hatte mich immer schon gekränkt.
Die Kulturschaffendenbedienen sich desGeistermotivs,umzuzeigen, dass sich derHolocaust nicht verdrängenlässt:
Popkultura sięga po duchy, zmory, zombi. Pojawiają się wśród żywych, bo ich spokój został zakłócony. W każdym siedzi strach przed miejscem, w którym dokonała się zbrodnia. Mamy też wewnętrzne przekonanie, że prędzej czy później sprawiedliwość musi zwyciężyć. Dlatego w tylu opowieściach zjawy tak długo nękają żyjących, aż ich krzywda zostanie nazwana i zrozumiana.(Wodecka 2012)
Die Popkultur benutzt Geister, Gespenster, Zombies. Sie erscheinen zwischen den Lebenden, da ihr Frieden gestört worden ist. Jeder besitzt eine Angst vor dem Ort, an dem ein Verbrechen begangen worden ist. Wir besitzen auch eine innere Überzeugung, dass früher oder später die Gerechtigkeit siegen muss. Aus diesem Grund plagen die Spukgestalten die Lebenden so lange, bis das ihnen angetane Unrecht ausgesprochen und verstanden wird.
Die Geister der Vergangenheitbilden eine Bürde fürdasHier und Heute,undnur durch diedirekte Konfrontation und Aufarbeitung des begangenen Unrechtskönnen die Fragen der Gegenwart angegangen werden.Die Aufarbeitung ist dabei nicht nur für die jüdischen Opfer von Bedeutung, sondern ebenso für die polnische Gesellschaft.Daherlautet Sierakowskis Appell:„Return and we shall finally become Europeans.[…] Return not as shadows of the past but as a hope for the future.Heal our wounds, and you’ll heal yours“ (Bartana 2007).
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Barth, Andrzej 2008: Fabryka muchołapek.Warszawa.
Chutnik,Sylwia 2009: Kieszonkowy atlas kobiet.4. Aufl. Kraków.
Stasiuk,Andrzej 2007: Dojczland.Wołowiec.
Ostachowicz, Igor 2012: Noc żywychŻydów. Warszawa.
Filme
Bartana,Yael (R)2007: Mary Koszmary/Nightmares.HD video.11Min27 Sek.(abrufbarunter:http://www.artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=200).
ders.(R) 2009: Mur i wieża/Wall and Tower.35mm.15Min 56 Sek.(abrufbar unter:http://www.artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=199).
Sekundärliteratur
Anonymus2009: „Mur iwieża“ projekt Yael Bartana. In:Culture.pl vom25.6.2009.http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/mur-i-wieza-projekt-yael-bartany(letzter Abruf1.4.2013).
Anonymus2012:Doradca Tuska napisał skandalizującą książkę„Noc żywych Żydów“.In: Gazeta.pl vom 11.4.2012.http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11518832,Doradca_Tuska_napisal_skandalizujaca_ksiazke__Noc.html(letzter Abruf 1.4.2013).
Arendt,Hannah 2006: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. 15. Aufl.München[u.a.].
Bartana,Yael 2011: Duch powrotu.In: Krytyka polityczna,Nr. 26: Duchy.Pomysł Yael Bartana, o.S.
Chomatowska,Beata2012: Stacja Muranów. Wołowiec.
Gnauck, Gerhard2012: Vom Trauma, Opfer zu sein.Die polnische Schriftstellerin Magdalena Tulli über die Erinnerung der zweiten Generation nach Krieg und Holocaust. In:Die Welt,Nr. 23v. 27.1.2012, S. 26.
Johannes Paul II.Apostolische Reise nach Polen. Predigt.Siegerplatz in Warschau, 2.Juni 1979.http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790602_polonia-varsavia_ge.html(letzter Abruf1.4.2013).
JRMiP:Facebook-Eintrag seit23.1.2010.https://www.facebook.com/jrmip(letzter Abruf 1.4.2013).
Kijowska,Marta 2011: Anklage des Gettokönigs.In: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.15.2.2011.
Muzeum Historii Żydów Polskich:O muzeum.http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/cms/muzeum/(letzter Abruf1.4.2013).
Petrowskaja,Katja 2012: Interview mit Yael Bartana v.11.5.2012.http://blog.interview.de/Interview-Yael-Bartana(letzter Abruf1.4.2013).
Polit,Monika 2011: Punkty widzenia. Mordechaj Chaim Rumkowski – literackie oceny i interpretacje. In:Zagłada Żydów. Studia i materiały7, S. 373-392.
Sienkiewicz, Karol2011:Ryfka przychodzi i odchodzi.In: Dwutygodnik,Nr. 59.http://www.dwutygodnik.com/artykul/2332-ryfka-przychodzi-i-odchodzi.html(letzter Abruf1.4.2013).
Sokalska, Arlena 2012: „Noc żywych Żydów“Ostachowicza.Zamiast „szokującego horroru“niezła postmodernistyczna powieść.In: Polskatimes.pl v. 13.4.2012.http://www.polskatimes.pl/artykul/552459,noc-zywych-zydow-ostachowicza-zamiast-szokujacego-horroru,2,id,t,sa.html(letzter Abruf1.4.2013).
Stokfiszewski,Igor–Żmijewski,Artur 2012: Nie będziemy żołnierzami.Z Yael Bartaną rozmawiają i Igor Stokfiszewski iArtur Żmijewski.In: Krytyka polityczna,Nr.30, S. 200-208.
Szybowicz, Eliza 2012: Resident Good. W Warszawie.In: Dwutygodnik,Nr. 81.http://www.dwutygodnik.com/artykul/3483-resident-good-w-warszawie.html(letzter Abruf1.4.2013).
Unger, Michael2004:Reassessment of the Image of Mordechai Chaim Rumkowski.Jerusalem.
Wodecka,Dorota 2012: No dobra, jest Polska, i super. A co z Żydami?In: Wyborczav. 15.7.2012.http://wyborcza.pl/2029020,76842,12115704.html(letzter Abruf 1.4.2013).
Zemel,Carol 2011:Yael Bartana’sMary KoszmaryandGalut Melancholy.In:Association for Jewish Studies (AJS). Spring, S. 49-50.http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=12018(letzter Abruf1.4.2013).
Summary
The Holocausttheme hasnever beenmorepresent inPolandthanintherecent years. Theissueisbeingdebated innovels,diaries, interviews,filmsandartworks,whereuponthe discourseisparticularlycharacterised by the termstrauma,psychoanalysisandghosts.Byconfronting the main charactersof their workswithJewishghosts, awhole range ofartiststriesto come to termwith thetremorofthe nationalpsychethat has beencaused bythe Holocaust.Thoseghostsarenospectres,buttheysufferfromthesametraumaasthe livingpeopleandtheyhavethe same needsfor inner peace.Themotifof theJewish ghoststhatcomebackinto the middle of Polish societyunderlines that it is not possible torepressthememories of theHolocaust.Thedemons of the pastarea burden tothe here and nowand only by a direct confrontationwith the injusticesofthe pasttheissues of the presentcanbe approached.Coming to terms with the pastis not onlyofimportanceforthe Jewish victims,but alsofor Polish society.An outstandingcharacteristicofthosesensationaland aestheticallyinterestingworks thathave achieved anew quality inPolishHolocaustliteratureistheblurring ofthe linebetweenfiction and reality.
Streszczenie
Temat Holokaustu nigdy dotąd nie byłtak obecnyw Polscejak w ostatnich latach. Debata podejmowana jest w książkach, wspomnieniach, wywiadach, filmach i dziełach sztuki. Szczególną rolę w dyskursie zajmująduchy,traumaipsychoanaliza.Liczni twórcy podjęli próbę reakcji na wstrząs na psychice narodowej wywołany Holokaustem, który wywołał głęboko tkwiące strachy i kompleksy,poprzez konfrontację w swoich dziełach żywych z żydowskimi duchami. Te duchynie straszą,leczcierpiątę samą traumęcożyjący ikierują się tą samąpotrzebąwewnętrznego spokoju.Duchyprzeszłościsąobciążeniem dlateraźniejszościitylko poprzez bezpośrednia konfrontacjai rozliczenie się zdawnychniesprawiedliwościumożliwiają rozwiązanie teraźniejszych problemów. Rozliczenie się jest równie ważne dlażydowskichofiar,co dlapolskiego społeczeństwa.Tegłośnei ciekaweze względu na ich estetykępracwniosły nową jakośćdopolskiej literaturyHolokaustu. Ich szczególną cechąjest zatarcie granicy między fikcją a rzeczywistością.
[1]Hier und im Folgenden, wenn nicht anders vermerkt, Übersetzung A.G.
[2]Der Piłsudski-Platz steht im kollektiven Gedächtnis nicht nur als Erinnerungsort für den Führerkult um Józef Piłsudski. Am2.6.1979 hatte Johannes Paul II. hier eine Messe abgehalten, der über 500.000 Menschen beiwohnten. Mit den Worten „und ich rufe, ich, ein Sohn polnischer Erde und zugleich Papst Johannes Paul II., ich rufe aus der ganzen Tiefe dieses Jahrhunderts, rufe am Vorabend des Pfingstfestes: Sende aus deinen Geist! Sende aus deinen Geist! Und erneuere das Angesicht der Erde!“ (Johannes Paul II. 1979)hatte er damals die Menschen dazu aufgerufen, sich gegen das Regime zu erheben. 1999 sprach er hier zudem 108 polnische Märtyrer selig. 2005 fand auf dem Platz daher die Warschauer Trauermesse für ihn und 2010 für den verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński statt.
[3]„Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind. Vom Standpunkt unserer Rechtsinstitutionen und an unseren moralischen Urteilsmaßstäben gemessen, war diese Normalität viel erschreckender als die Gräuel zusammengenommen“ (Arendt 2006, 400).
[4]Erst nach drei Jahren konnte der Autor, der zum Beraterstab des polnischen Premierministers Donald Tuskgehört, einen Verlag für seinen Roman gewinnen(vgl.Wodecka 2012).
[5]Über die Figur des Fliesenlegers schreibt Joanna Tokarska-Bakir (2012):„Chwila wysiłku i każdyz nas rozpozna się w Glazurniku”(„Ein Moment der Anstrengung und jeder von uns erkennt sich in dem Fliesenlegerwieder“).