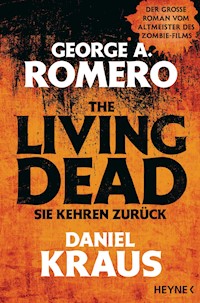
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit einem Toten, der sich plötzlich von der Bahre erhebt und zwei Pathologen angreift. Schnell breitet sich das Phänomen über das ganze Land aus: In einer Wohnwagensiedlung im Mittleren Westen müssen eine junge Schwarze und ein muslimischer Einwanderer gegen ihre toten Freunde kämpfen, die aus ihren Gräbern hervorgekrochen sind. Auf einem Flugzeugträger der US Navy verstecken sich die überlebenden Seeleute vor ihren untoten Kameraden. Ein einsamer Nachrichtensprecher sendet weiter, bis seine wiederauferstandenen Kollegen kommen, um ihn zu zerfleischen. In Washington, D.C., dokumentiert eine autistische Bundesbeamtin die Ausbrüche für eine Nachwelt, die es vielleicht nie geben wird. Im ganzen Land kämpfen die Lebenden gegen die Toten.
Wir dachten, wir wüssten, wie diese Geschichte endet.
Wir haben uns geirrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Es beginnt mit einem Toten, der sich plötzlich von der Bahre erhebt und zwei Pathologen angreift. Schnell breitet sich das Phänomen über das ganze Land aus: In einer Wohnwagensiedlung im Mittleren Westen müssen eine junge Schwarze und ein muslimischer Einwanderer gegen ihre toten Freunde kämpfen, die aus ihren Gräbern hervorgekrochen sind. Auf einem Flugzeugträger der US Navy verstecken sich die überlebenden Seeleute vor ihren untoten Kameraden. Ein einsamer Nachrichtensprecher sendet weiter, bis seine wiederauferstandenen Kollegen kommen, um ihn zu zerfleischen. In Washington, D.C., dokumentiert eine autistische Bundesbeamtin die Ausbrüche für eine Nachwelt, die es vielleicht nie geben wird. Im ganzen Land kämpfen die Lebenden gegen die Toten.
Wir dachten, wir wüssten, wie diese Geschichte endet.
Wir haben uns geirrt.
Die Autoren
George A. Romero (1940–2017) gilt als einer der einflussreichsten Vertreter des modernen Horrorfilms. Viele seiner Filme, vor allem aber sein Zombiefilm-Zyklus um Night of the Living Dead – Die Nacht der lebenden Toten (1968) und Dawn of the Dead (1978), denen vier Fortsetzungen folgten, haben Kultstatus erreicht. Er stammte aus New York City und begann bereits während seiner Schulzeit mit dem Drehen von Filmen. Nach seinem Abschluss besuchte er die Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Er lebte mit seiner Frau Suzanne in Toronto, bis er 2017 starb.
Daniel Kraus wurde am 7. Juni 1975 in Midland, Michigan, geboren und wuchs in Iowa auf. Zusammen mit Guillermo del Toro verfasste er den Roman zum oscarprämierten Film The Shape of Water sowie die Romane zur Netflix-Serie Trollhunters, die mit dem Emmy ausgezeichnet wurde. Daniel Kraus lebt mit seiner Familie in Chicago.
GEORGE A. ROMERO
DANIEL KRAUS
SIE KEHREN ZURÜCK
Aus dem Englischen vonJulian Haefs
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
THE LIVING DEAD
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2021
Copyright © 2020 by New Romero Ltd.
Copyright © 2021 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com(Nataliia K, Milan M)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-24659-4V001
www.heyne.de
Für George.
Ich hatte nie Gelegenheit, Dir zu danken.
– DK
Ach, nun hat der Geier die Taube gefressen, der Wolf das Lamm gerissen, der Löwe den scharfhörnigen Büffel verschlungen, der Mann den Löwen mit dem Pfeil erlegt, mit Schwert und mit Schießpulver; der Horla aber wird aus dem Mann machen, was der Mann aus dem Pferd und dem Rind gemacht hat: sein Eigen, seinen Diener und seine Nahrung, durch die schiere Kraft seines Willens. Wehe uns!
– Guy de Maupassant, Der Horla
Und stirbt auch die Nacht / Möge der Tag fortdauern!
– Hoffmanns Erzählungen
ERSTER AKT
DIE GEBURT DES TODES
2 Wochen
SPRICH MICH BITE FREI, WENN DU KANST
In den ersten Monaten des einundzwanzigsten Jahrhunderts, noch vor den Terroranschlägen des 11. September, erhielten alle Alten- und Pflegeheime, alle Krankenhäuser und alle Polizeiwachen der Vereinigten Staaten – bis auf jene ländlichen Außenposten, die so unwichtig waren, dass sie nicht einmal über Computer verfügten – die Anordnung, Teil des Netzwerks zur »Erfassung wichtiger statistischer Daten«, kurz EWSD, zu werden. Dieses Cybersystem lud sämtliche eingespeisten Daten in Echtzeit auf die Server einer Abteilung des statistischen Bundesamtes namens »Amerikanisches Modell für Datenherkunft und Bemaßungen« oder kurz AMDB, von denen, die sich in jenen Tagen noch schwarzen Humor leisten konnten, oft scherzhaft als »Apokalyptische Menschendatenbank« bezeichnet. Ob Geburt oder Tod, jedes Ereignis wurde von einer Ärztin, einem Assistenzarzt oder einer Krankenschwester eingetragen und mit einem Klick auf den entsprechenden Link ins EWSD hochgeladen.
In der Nacht, als John Doe starb, wurde sein EWSD-Eintrag mit der Nummer 129-46-9875 vom System doppelt registriert. John Doe war der Name, den man einem Toten gab, den man nicht identifizieren konnte. Es war der 23. Oktober. Zum ersten Mal wurde sie im katholischen Erzengel-Sankt-Michael-Krankenhaus in San Diego, Kalifornien, eingegeben, ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Der zweite Eintrag, der den Vorfall überhaupt erst bemerkenswert machte, folgte dreieinhalb Stunden später aus dem Büro des Gerichtsmediziners von San Diego County. Er ging um 22:36 Uhr im Zentralrechner des EWSD ein, blieb aber weitere achtundvierzig Stunden unbemerkt, bis eine stille, unnahbare EWSD-Statistikerin namens Etta Hoffmann auf der Suche nach Unregelmäßigkeiten in den jüngeren Datensätzen darüber stolperte.
Hoffmann druckte den ganzen Eintrag aus. Vielleicht hatte sie eine dunkle Vorahnung bezüglich der Verlässlichkeit der Systeme, von denen die Menschheit inzwischen abhängig war.
Unabhängig von Ausgangsprogramm, Schriftart und -größe des ursprünglichen Eintrags wurden alle eingehenden Daten vom EWSD-System in ein eigenes Standardformat umgewandelt. John Does Eintrag wurde vom Drucker in einer Schriftart namens »Vereinfachte Arabesque« ausgespuckt. Jahre nach dem Start des EWSD hatte es im Senat eine hitzige Debatte zur Frage gegeben, ob es für eine Bundesbehörde angemessen sei, eine so »arabisch« klingende Schriftart zu benutzen. Die demokratische Mehrheit bezwang die republikanische Minderheit, die sich für »Franklin Gothic« eingesetzt hatte. Nach diesem großen Sieg gab man sich bei den Demokraten ausgiebig befriedigtem Zuzwinkern und jovialem Rückenklopfen hin.
Niemand, der die Wochen nach John Doe überlebte, erinnerte sich noch an diese kleinliche Schlammschlacht. Sie war nur eine von Abermillionen Streitereien gewesen, die das Land seit Generationen entzweiten. In den dunklen Tagen, die folgen sollten, gab es immerhin einige wenige Kongressabgeordnete, die sich fragten, ob sie nicht, hätten sie nur genauer hingehört, vielleicht rechtzeitig bemerkt hätten, dass die Sehnen der USA wie gespannte Klaviersaiten gerissen waren, und eventuell in der Lage gewesen wären, die Wunden zu heilen, bevor das ganze Gemeinwesen auseinandergerissen wurde.
In den drei Tagen nach John Does Tod gingen Tausende Datensätze ein, die Ähnlichkeiten mit dem Fall Nummer 129-46-9875 aufwiesen. Etta Hoffmann entdeckte John Does Eintrag, als sie versuchte, den Ausgangspunkt des Phänomens zu finden. Da die ursprünglichen Programmierer diese Funktion nicht für notwendig gehalten hatten, war das EWSD nicht nach Datum und Uhrzeit sortiert. Hoffmann und ihre Kollegen mussten das System manuell durchsuchen, und erst später, als sie ihre Funde, die sie in einem Ordner namens »Ursprung« gesammelt hatten, miteinander verglichen, legte der Zeitstempel in John Does Eintrag nahe, dass dieser Fall der erste seiner Art gewesen war. Bis zum Ende war sie sich dessen nicht hundertprozentig sicher, aber selbst Hoffmann musste irgendwann die Suche einstellen.
Es gab andere, dringendere Aufgaben.
Am Ende der dritten Nacht nach John Does Tod saßen in der Washingtoner EWSD-Zentrale nur noch zwei Männer und zwei Frauen, die klickten, sich Notizen machten und sortierten. Das Quartett hatte mehrere Schreibtische in der Mitte des Raums zusammengeschoben und arbeitete in überlappenden, nicht genau abgestimmten Schichten; und niemand von ihnen so unermüdlich und mit solch beneidenswerter Gemütsruhe wie Etta Hoffmann.
Hoffmann war schon immer die Exzentrikerin beim EWSD gewesen. Alle anderen Statistiker, die sich gezwungen sahen, mit ihr zusammenzuarbeiten, gingen davon aus, dass ihr Privatleben ganz wie ihr Arbeitsalltag hauptsächlich aus bleischweren Interaktionen und leeren Blicken bestand.
Anders als Hoffmann hatten die drei übrigen Verweilenden nachvollziehbare Gründe, um zu bleiben. John Campbells Leben war in den letzten Jahren sehr traumatisch verlaufen – ein Kindstod und eine seinerseits ungewollte Scheidung –, und er hatte schlicht niemanden, zu dem er sich hätte flüchten können. Terry McAllister hatte sich einst entschlossen, für die Regierung zu arbeiten, um ganz persönlich die Welt zu retten; er würde die Stellung halten. Elizabeth O’Toole hatte gelernt, ihren Ehemann vor allem in stressreichen Zeiten zu fürchten, und hoffte, durch diese Ereignisse womöglich von ihm loszukommen.
Außerdem waren Terry McAllister und Elizabeth O’Toole ineinander verliebt. Das hatte Etta Hoffmann schon einige Zeit vor Beginn dieser Krise bemerkt. Verstehen konnte sie es nicht. Beide waren mit anderen Leuten verheiratet. Das immerhin war eine Sache, die Hoffmann verstand. Beim Heiraten ging es um rechtlich verbindliche Dokumente, um Besitzteilung und gemeinsame Steuererklärungen. Liebe und Lust aber waren für Hoffmann immer schon unlogische Rätsel gewesen. Sie machten die Betroffenen unberechenbar. Daher war sie den beiden gegenüber misstrauisch und gab ihnen so viel Freiraum wie möglich.
Und warum blieb Etta Hoffmann? Die anderen konnten nur Vermutungen anstellen. Manch einer beim EWSD hielt sie aufgrund ihrer fehlenden Emotionen für dumm. Jene, denen bewusst war, welch gewaltiges Arbeitspensum sie erledigte, hielten sie für eine Autistin. Andere hielten sie schlicht für eine blöde Kuh, obwohl selbst diese geschlechtliche Zuordnung zweifelhaft schien. Abgesehen von ihrem Vornamen und der Toilettenwahl gab es kaum Belege dafür, wie sie sich selbst verortete. Ihre Gesichtszüge und Körperform ließen keinen eindeutigen Schluss zu, ebenso wenig ihre schlabbrige Unisex-Garderobe. Der Tratsch im Büro sortierte sie also irgendwo zwischen trans, intersex und nichtbinär ein.
Ein Zeitarbeiter hatte sie unter Einfluss seines Literaturstudiums einmal schlicht als »die Poetin« bezeichnet, weil sie ihn an Emily Dickinson erinnerte, da sie so blass und ernst in die Tiefen ihres Computermonitors starrte wie Dickinson aus ihrem abgeschiedenen Schlafzimmer in die Welt. Vielleicht fand Hoffmann in der Monotonie des Alltags dieselben weltbewegenden Nebensächlichkeiten wie Dickinson.
Dieser Spitzname erklärte Hoffmanns Distanziertheit und Reserviertheit. So etwas war schließlich das Privileg der Poetin! Wer wollte auch den Geist der Poetin begreifen? Es war ein Spaß für das ganze Büro. So wurde der androgynen Mitarbeiterin in Jogginghose ein dramatisch romantischer Unterbau angedichtet, während sie freudlos Daten in die Tastatur hämmerte, Wasser auf Zimmertemperatur trank und uninspirierte Sandwiches verzehrte, die in der wohl nichtssagendsten Küche von ganz D.C. zusammengeschustert worden waren.
In den drei Tagen nach John Doe bewies die Poetin, dass sie die Beste von ihnen war. Ihre Miene blieb unbewegt, während andere zusammenbrachen, ihr Blick scharf und ihre Finger flink, als anderen schon die Lider zufielen und die Hände vor Erschöpfung zitterten. Hoffmann, die uninspirierendste Person, die man sich nur vorstellen konnte, inspirierte die übrigen drei Verbliebenen. Sie spritzten sich kaltes Wasser in die Gesichter und klatschten sich auf die Wangen. Von billigem Kaffee und Adrenalin angetrieben, verzeichneten sie die Ereignisse, auf dass zukünftige Generationen Beweise für die großartige, komplizierte, mangelhafte-aber-doch-manchmal-wunderbare Welt finden würden, die vor dem Untergang bestanden hatte.
Achtundvierzig Stunden später, fünf Tage nach Eingang von John Does Dokument Nummer 129-46-9875, waren sich John Campbell, Terry McAllister und Elizabeth O’Toole einig, dass sie alles Menschenmögliche getan hatten. Obwohl die EWSD-Zentrale dank des Notaggregats weiterhin mit Strom versorgt wurde, befand sich das Netzwerk selbst bereits im Zusammenbruch. Die wenigen Berichte, die noch eingingen, waren kaum mehr als unerfüllbare Hilfeschreie. John Campbell schaltete seinen Rechner aus – der schwarze Bildschirm erinnerte ihn an das tote Kind und die verlorene Frau –, fuhr nach Hause und tötete sich durch einen Kopfschuss. Elizabeth O’Toole fing an, wie besessen Liegestütze und Sit-ups zu machen, um sich auf eine ungewisse Zukunft vorzubereiten. Terry McAllister, dessen heldenhafte Träume verblasst waren, nahm einen letzten Eintrag in seinem Arbeitsprotokoll vor, der von den üblichen Fakten und Zahlen abwich und, sollte ihn jemals jemand lesen, eine gewisse Prise Galgenhumor verströmen würde: »Fröhliches Halloween.«
Es blieben noch drei Tage bis zu diesem gruseligen Festtag, drei Wochen bis Thanksgiving, zwei Monate bis Weihnachten. Millionen Süßigkeiten würden, statt an umherziehende Kinder verteilt zu werden, die Notrationen für jene darstellen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauten. Wer bereits einen Truthahn zum Erntedankfest organisiert hatte, würde ihn sorgfältig hüten, statt seine Liebsten einzuladen, um ihn mit ihnen zu teilen. Tausende Flugtickets, gekauft, um die Verwandten über Weihnachten zu besuchen, würden in Posteingängen versauern.
Anders als John Campbell ließen Terry McAllister und Elizabeth O’Toole ihre Computer eingeschaltet; das überhitzte Surren klang für sie wie Atmen, wenngleich es an das angestrengte Keuchen von Beatmungsgeräten in Hospizbetten erinnerte. Ehe sie sich zu Terry McAllisters Wohnung in Georgetown aufmachten, fragte Elizabeth O’Toole Etta Hoffmann, ob sie mit ihnen kommen wolle. Terry McAllister hatte Elizabeth O’Toole zwar gesagt, sie könne sich die Mühe sparen, aber Elizabeth O’Toole wollte ihre Kollegin nicht im Stich lassen. Terry McAllister behielt recht. Hoffmann starrte ihre Kollegin an, als spräche sie vietnamesisch. Auch bei dieser letzten Interaktion zeigte die Poetin nicht mehr Gefühle, als wenn man ihr bei einer Geburtstagsfeier im Büro ein Stück Kuchen reichte.
Während sich Terry McAllister und Elizabeth O’Toole zum Aufbruch fertig machten, hörten sie das stumpfe Klack, klack, klack von Hoffmanns roboterhaftem Tippen. Elizabeth O’Toole fühlte sich durch Hoffmanns leblose, verbissene Arbeitsmoral an die massenhaft eingetroffenen Berichte über leblose, verbissene Angreifer erinnert. Vielleicht hatte Hoffmann bereits so viel mit Denen gemeinsam, dass sie die perfekte Wahl war, um die Bedrohung zu verstehen, zu verarbeiten und zu bekämpfen. Bereits in diesen frühen Tagen hatte sich Die und Deren als Bezeichnung etabliert.
Am siebten Tag saß Elizabeth O’Toole in Terry McAllisters Wohnung und schrieb auf ihrem Handy, das sich tapfer an einen letzten Signalbalken klammerte, ihrem Cousin, einem Priester in Indianapolis, eine Nachricht. Sie wollte ihre Sünden beichten. Sie fügte hinzu, dass sie zusammen mit ihrem Liebhaber, der nicht ihr Ehemann sei, versuchen wolle, Washington zu verlassen. Da sie nur wenig Lebenszeit und Akkuladung zu entbehren hatte, wimmelte der Text von Rechtschreibfehlern. Als ihr Telefon den Geist aufgab, schaute sie gerade nicht hin, würde also nie erfahren, ob die Beichte abgeschickt worden war oder nur als eine weitere der unzähligen Stimmen in den Chor des ungehörten Winselns am Ende der Welt einging. Als sie und Terry McAllister mit dem schlichten Plan, seiner Eingebung zu folgen und sich »irgendwie Richtung Norden« durchzuschlagen, aus der blutverschmierten Lobby des Mietshauses auf den von Schießpulver rußbefleckten Bürgersteig traten, sah Elizabeth O’Toole die Worte ihrer letzten Nachricht überall – wie Aasvögel, die den Novemberhimmel durchlöcherten.
Wir sehn uns wahrschienlich nie mer wider, also sprich mich bite frei, wenn du kanst, da, wo du jeztbisst, wen dass legal ist. Ich hab vesuht, ein Bussgebet zu sprechen, aber ich kan mich nicht mer an die Worte erinnnen, und is dass nicht das erschrekenste von Allem, das ich schonn kaum noch etwas weiss von diser Welt, als ob das Ales nie passsirt ist? Als ob unsr ganzzes Leben nur ein Traum war?
GRAUE MASSE
Luis Acocella schubste gerade weiße Bohnen durch seine galizische Gemüsesuppe, als die Frontscheibe von Fabi’s Spanish Palace barst. Als Assistent des Gerichtsmediziners von San Diego war Luis mit allen Arten von Verletzungen durch Glas vertraut. Er kannte die fleischig aufgerauten Pocken, die das Sicherheitsglas von Windschutzscheiben auf Wangen hinterließ, er kannte die abschreckend schwanenhafte Schönheit eines von einer Spiegelscherbe in selbstmörderischer Absicht aufgeschlitzten Handgelenks. Die Frontscheibe von Fabi’s mit ihrem Taifun aus durchsichtigen Lanzetten, die im Licht der billigen Kronleuchter funkelten, ehe sie sich wie ein Hornissenschwarm auf ihn stürzten, versprach eher Letzteres.
Bei jeder anderen Mahlzeit an jedem anderen Ort hätte Luis kaum etwas von seiner Umgebung mitbekommen, weil er beim Essen meist durch Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat oder Reddit scrollte. Aber galizische Gemüsesuppe war zu kompliziert, sodass er sein Telefon daher ausnahmsweise in der Tasche behielt. Zunächst entfachte die Abwesenheit des kleinen Bildschirms fast so etwas wie Panik in ihm. Sein Blick flackerte immer wieder zu der Stelle auf der Tischplatte, die das Handy normalerweise eingenommen hätte, und seine Finger zuckten. Aber nach fünf Minuten hatte er sich gesammelt und empfand das Fehlen sensorischen Inputs beinahe als faszinierend. Die Mariachi-Musik aus der Konserve hatte geendet, die Bedienung war noch nicht dazu gekommen, etwas Neues aufzulegen, und im Kielwasser des Lärms machten sich die Geräusche des echten Lebens bemerkbar: schlurfende Füße, Seufzen, Gelächter, Atmen.
Wenn er allein war, saß Luis gerne in Nähe der Küche. Er genoss es, zum beruhigenden Zischen der Küchengeräusche zu scrollen, zu liken, zu kommentieren und zu posten. Wann immer er eine knappe Bemerkung auf Spanisch machte, schien das muttersprachlich spanische Personal zu neuen Menschen zu werden. Die Kellnerin entspannte Nacken und Hüften, die Köche strahlten ihn aus der Küche an, sodass er dachte Aha, jetzt krieg ich das gute Zeug. Das alles wärmte sein Herz ebenso wie die irdene Schüssel voll galizischer Gemüsesuppe. Sprache brachte Menschen zusammen. Er fragte sich, ob sein geliebtes Handy am Ende gar kontraproduktiv sein könnte.
Aus all diesen Gründen saß Luis zu weit von der Frontscheibe entfernt, um von der Glasexplosion verletzt zu werden. Trotzdem schlug er die Hände vors Gesicht und ließ sich vom Stuhl fallen. Seine Instinkte hatten ganze Arbeit geleistet – zeitgleich mit dem dröhnenden Splittern ertönte das inbrünstige Bellen eines Schusses.
Es war gerade 17:54 Uhr, noch früh für Fabi’s an einem Donnerstag, und die wenigen anderen Gäste wurden von den hohen Rücklehnen der Sitzecken abgeschirmt. Niemand wurde verletzt. Das wusste Luis sofort. Er lebte aber lange genug in San Diego und hatte schon mehr als genug Projektile aus Körpern geholt, um zu wissen, dass ein Schuss nur selten allein kam.
Er hockte unter seinem Tisch, starrte die Zuckertütchen an, die das wackeligste Bein stützten, und hörte eine ganze Salve an Schüssen, gefolgt vom Schrei eines Mannes. Eine kurze Pause, dann antwortete das knallfroschartige Feuer der Polizisten draußen – es waren zu viele Schüsse, um noch mitzuzählen. Er hörte ein feuchtes Knirschen – den verchromten Knall eines Autos, das ein anderes rammte. Dann nichts mehr.
Luis blieb bei seinen Zuckertütchen. Er wusste nicht, wie lange. Zeit fließt anders, wenn man in Lebensgefahr schwebt; die Sekunden waren wie kleine Messerschnitte in seinem Fleisch.
Irgendwann sprang er auf und rannte zur Tür. Die Glassplitter knirschten unter seinen Sohlen, als er in den kühlvioletten kalifornischen Sonnenuntergang hinaustrat. Er schloss sein Auto auf und zog den Verbandskasten hervor. Er hatte einen Mann schreien gehört, vielleicht war er noch am Leben. Luis rannte an einer Reihe parkender Autos vorbei, bis er den Mission Bay Drive erreichte und die altbekannte Szenerie nach einem Schusswechsel vor sich sah. Verbranntes Plastik auf Asphalt, im Schein der Polizeilichter rot und blau wabernde Abgase, ein plötzlicher Verkehrskollaps unter den von all der Gewalt völlig unbeeindruckten Ampeln.
Vielleicht lag es an seinem telefonfreien Essen, dass Luis sofort das völlige Ausbleiben einer Reaktion seitens der Passanten auffiel. Erst vor wenigen Minuten waren hier Schüsse gefallen. Mindestens ein Auto war getroffen worden. Trotzdem hingen die meisten Leute an ihren Geräten. Offenbar bevorzugten sie die Informationssalven, die sie mit ihren Daumen bändigen konnten. Manche machten Schnappschüsse von den übertrieben vielen Streifenwagen, einige nutzten sie gar als Hintergrund für Selfies. Sie würden all diese Bilder sofort hochladen, wie auch Luis schon so viele hochgeladen hatte – Lebenszeichen in untertitelten Kästchen.
Er trat auf die Straße und sah das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters, einen alten Kastenwagen mit mexikanischem Nummernschild, der sich mit dem vorderen Kotflügel in einen Kombi gebohrt hatte. Die Beifahrertür des Kastenwagens stand sperrangelweit offen, ein Mann saß zusammengesunken auf der Sitzkante. Luis sah sofort, dass er tot war. Der Schaft einer rostigen Uzi klebte an der blutgeschwärzten Brust, aber der Leichnam klammerte sich an das Magazin, als wollte er die Verhaltensmuster noch nicht loslassen, die ihn als Lebenden umgetrieben hatten.
Die Passanten hatten ihre Apparate, der Schütze seine Uzi. Luis fragte sich, warum heute Abend beide Geräte so ähnlich aussahen.
Im Führerhaus des Kastenwagens bewegte sich etwas, aber die Streifenpolizisten hatten den Kleinlaster umstellt. Überall lugten Pistolenläufe hinter den SDPD-Wagen hervor. Luis wandte sich ab und hielt nach Leuten Ausschau, die nicht auf ihr Handy starrten. Die Sirenen der Krankenwagen waren schon näher gekommen, als er endlich jemanden entdeckte. Luis trabte in den Schatten der Straßenüberführung, wo ein Mann im nassdreckigen Glitzern zwischen Snacktüten und zerbrochenen Flaschen lag.
Der Mann war Mitte sechzig. Der säuerliche Geruch seiner feuchten Klamotten ließ vermuten, dass er obdachlos war, auch wenn Luis den Eindruck hatte, er lebe noch nicht allzu lange auf der Straße. Schultern und Nacken hatten noch Muskeln, die langjährig Bedürftige nur selten vorweisen konnten. Die Lippen unter dem Stoppelbart verbargen eindeutig ein vollzähliges Gebiss. Selbst die verwilderten Haare erinnerten noch ungefähr an eine Frisur. Noch eindeutiger war allerdings die beschmutzte Kleidung des Mannes: Maßanzug, Lederschuhe und ein feines Hemd, das an einer Seite sogar noch einen Manschettenknopf aufwies. Dieser Mann, dachte Luis, musste einmal reich gewesen sein. Er hatte alles gehabt, was Amerika zu bieten hatte.
Luis fühlte nichts von der Ruhe, die sonst mit seiner Laborarbeit einherging, als er den Verbandskasten abstellte, das Handgelenk des Mannes ergriff und vorsichtig die Glieder bewegte, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er sah vier Einschusslöcher, alle in der rechten Körperhälfte. Eins oben im Oberschenkel, eins im oberen Teil des Rumpfs, eins in der Schulter und eins im Hals. Er schob den Kragen beiseite und drückte seine Finger in das glitschige Blut, um nach einem Puls zu suchen. Die Temperatur der Haut verriet ihm bereits, dass es zu spät sein könnte. Er schaute auf die Uhr. 18:07 Uhr. Der Körpertemperatur nach musste der Mann vor wenigen Minuten gestorben sein. Müsste er jetzt die üblichen Dokumente ausfüllen, würde er die geschätzte Sterbezeit mit 18:05 Uhr angeben.
Fuck – nun bedauerte er die wenigen Minuten, die er unter seinem Tisch gekauert hatte.
Hinter ihm tauchte ein Kriminalbeamter auf, der sich schroff als Detective Walker vorstellte. Er hatte das glatte sandfarbene Haar eines Märchenprinzen und schien genauso wenig hier sein zu wollen wie die Passanten und Autofahrer ringsum. Er bellte einen Untergebenen an, alles mit Absperrband zu sichern, erfragte Luis’ Namen und Fachkompetenz, riss ein Formular von seinem Klemmbrett ab und hielt es ihm hin.
»Erklären Sie ihn für tot«, sagte Walker. »Er gehört zu meinem Tatort.«
Luis starrte das weiße Papier an und spürte kalte Wut im Bauch. In ein paar Stunden würde dieser Tote nur noch eine einzeilige Nachricht sein, an der die Leute ohne einen Hauch von Emotion vorbeiscrollten.
Er hob seine blutigen Hände. »Noch nicht.«
Detective Walker streckte den Arm aus. »Sehen Sie das da drüben? Ich hab drei Krankenwagen, die versuchen, sich einen Weg durch dieses Chaos zu bahnen. Bis die hier sind, ist der Kerl eiskalt. Wenn Sie ihn jetzt ins Krankenhaus verfrachten lassen, kostet mich das eine ganze Nacht. Und dann kriege ich Kopfschmerzen, Amigo. Lassen Sie ihn hier liegen, da kann er sich wenigstens noch ein bisschen nützlich machen, ja?«
»Das sind nicht notwendigerweise tödliche Treffer«, sagte Luis. »Wenn wir ihn rechtzeitig ins Krankenhaus bringen, können wir ihn vielleicht noch wiederbeleben …«
»Verstehen Sie Englisch? Hier staut sich alles, hab ich gesagt. Jedes Auto, das Sie da sehen, ist voller Leute, die nach Hause wollen, um sich vor den Fernseher zu hängen. Also helfen Sie mir. Das ist doch auch in Ihrem Interesse, oder? Es war schließlich einer von euch, der ihn umgelegt hat.«
Luis drehte sich um. Seine Sohlen machten ein matschiges Geräusch in der Blutlache.
»Einer von uns?«
Detective Walker schien es mit seinen Vorurteilen genauso unverblümt zu halten wie mit seiner Arbeitsweise.
»Da können Sie einen drauf lassen, Amigo. Gangmitglieder aus Mexicali waren das. Wir verlassen uns darauf, dass Sie das später noch beweisen. Also wischen Sie sich die Kirschmarmelade ab und füllen Sie das verfickte Formular aus.«
Der Knoten in Luis’ Magen verhärtete sich. »Was soll das heißen, Sie verlassen sich auf mich?«
Der Kriminalbeamte baute sich über ihm auf. Seine Gesichtszüge waren grob, wie mit dem Daumen aus Teig geformt. Der gestärkte Kragen schnitt so tief in den Nackenspeck, dass er ihn fast zu enthaupten drohte. In den Mundwinkeln bildeten sich Speichelbläschen.
»Wenn wir diesen schmierigen Gangstern eine Mordanklage anhängen können, ist der Fall so gut wie erledigt.«
»Wollen Sie damit sagen, Sie wollen, dass der Mann hier stirbt? Weil es Ihrem Fall helfen würde?«
Detective Walker zuckte mit den Schultern. »Das hab ich nicht gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Kein Wort hab ich gesagt über irgendeinen wertlosen verfickten Penner, den kein Schwein vermisst.«
Allein mit seinem Verbandskasten würde Luis diesen Mann nicht retten können, der, von Schüssen durchsiebt, dalag. Zum Verstümmeln dieses beschissenen Polizisten würde sich der Inhalt aber ganz gut eignen, dachte er. Der Druckverband könnte als schönes Schleifchen seinen fetten Hals verschönern. Die Verbandschere wäre ein stylisches Accessoire in seiner Halsschlagader. Luis rang seinen Zorn nieder. Er hatte sich im Lauf seiner Karriere schon vieles gefallen lassen müssen. Er schaute nach links in die Frontscheinwerfer des nächsten Krankenwagens.
Jefferson Talbot, der Oberste Gerichtsmediziner von San Diego und Luis’ Chef, war gerade auf einer Konferenz in Las Vegas. Ihm konnte er den Schwarzen Peter nicht zuschieben. Luis hatte den Fall wohl oder übel am Hals. Wenn er nicht alles richtig machte, drohten ihm von JT schlimmere Konsequenzen als von Detective Walker. Er stand auf und winkte mit dem Verbandskasten nach dem Krankenwagen, der noch einen Block entfernt war, in der Hoffnung, einer der Rettungssanitäter würde ihn sehen und herbeigelaufen kommen. Dann wandte er sich wieder Walker zu. Er gab sich keine Mühe, weder Abscheu noch Hoffnung zu verbergen.
»Ich glaube, dieser Mann kann noch gerettet werden, wenn wir jetzt den Arsch hochkriegen. Ich mache das auch ohne Sie. Aber es wäre leichter, wenn Sie mir helfen. Na los. Nehmen Sie seine Beine. Bringen wir ihn rüber zum Krankenwagen. Sie und ich. Jetzt sofort. Also?«
Die ganze Menschheit war eine formlos graue Masse, diese schwer erträgliche Lektion hatte Luis im Zuge seiner Arbeit gelernt. Angeberische Arschgeigen retteten mit Erster Hilfe anderer Leute Leben, verachtenswerte Politiker zogen Kinder aus Autowracks, wegen Kinderpornografie vorbestrafte Ex-Knackis holten Menschen aus brennenden Häusern. Detective Walker war so einer – und tief im Innern nicht anders als Luis Acocella. Der Polizist stieß einen Schwall hässlicher Schimpfwörter aus, warf sein Klemmbrett beiseite und packte die dreckigen Fußgelenke des Obdachlosen. Gemeinsam eilten sie mit dem toten oder zumindest schwer verletzten Mann den Bürgersteig entlang, bis sie von zwei Rettungssanitätern abgefangen wurden, die gerade das Fahrgestell ihrer Bahre ausklappten.
Luis blieb danach nicht mehr lange. Weitere Krankenwagen trafen ein. Seine Arbeit hier war erledigt. Was nicht hieß, dass ihm nicht noch ein langer Abend bevorstand. Falls die Weißkittel im St. Mike’s den Mann für tot erklärten, was wahrscheinlich der Fall sein würde, wartete in dieser Nacht noch eine forensische Untersuchung auf ihn. Aber er wollte verdammt sein, wenn ihn das von seinem geplanten Wochenendtrip zu seiner Familie in La Paz abhielt. Er würde die Autopsie also auf jeden Fall noch diese Nacht vornehmen. Er zückte sein Telefon und schickte Rosa eine Nachricht. Danach blieb ihm nichts anderes übrig, als zur Rechtsmedizin zu fahren und auf den Anruf zu warten. Falls Charlene Zeit hatte, würde er die Autopsie mit ihr durchführen, zur Not aber auch allein. Nur ein weiterer Körper zum Zerhacken, sagte er sich. Nur eine weitere Meldung ans EWSD. Nur ein weiterer John Doe.
HIER IST DER ORT
Die Plakette hing schon so lange in seinem Büro, dass Luis sie eigentlich längst nicht mehr hätte wahrnehmen sollen. Trotzdem wusste er nicht, wie oft schon eine andernfalls völlig nichtssagende Mittagspause, die er mit der Lektüre politischer Panikmache im Netz verbrachte, von der stoischen Anwesenheit dieser Plakette gestört worden war. Sie ging ihm richtig auf den Sack. Der Satz war kürzer als die meisten Social-Media-Updates, zog seine trockenen, an Kurznachrichten gewöhnten Augen aber immer wieder auf sich, weil er sich nicht einfach wegklicken ließ, sondern auf einem Schild stand, das fest in der Wand über der Tür verschraubt war.
HIC LOCUS EST UBI MORS GAUDET
SUCCURRERE VITAE
Kaum eine Tat als stellvertretender Chef der Gerichtsmedizin bedauerte er so sehr, wie etwa sechs Monate nach seinem Amtsantritt die Übersetzung schließlich gegoogelt zu haben. So hatte er sich selbst dazu verdammt, sich zwanghaft damit zu beschäftigen. Es war genau die Sorte von ouroborosartigem Zirkelschluss, die er schon an der Uni gehasst hatte. Ein solcher Satz wurde mit dem expliziten Ziel verfasst, den Leser in den Wahnsinn zu treiben.
HIER IST DER ORT, AN DEM DER TOD
DEM LEBEN MIT FREUDE HILFT
Auf einer grundsätzlichen Ebene verstand er das ja auch. Die Toten halfen den Lebenden, indem sie ihre Leiber für eine Autopsie zur Verfügung stellten. Genau da hätte er den Schlussstrich ziehen, die Plakette von der Wand reißen und in den Mülleimer stopfen sollen. Denn die Toten gaben ihre Körper ja nicht freiwillig her, oder? Man nahm sie sich. Luis kam nicht umhin, an andere Amerikaner zu denken, die man sich ebenfalls als »Hilfe« genommen hatte – Frauen als Gattinnen und Besitz, Afrikaner als Sklaven, Invalide und Behinderte als medizinisches Experimentiermaterial.
Die Vorstellung, dass der Tod sich »freute«, kam ihm da schon plausibler vor. Sie verlieh einem Gedanken Ausdruck, den Luis stets für sich behalten hatte. Wann immer er einer Leiche den Brustkorb öffnete, schienen die lebhaften Farben und Texturen im Innern geradezu begeistert zu sein, sich endlich zeigen zu dürfen. Das Konfetti der Sehnen, die von einer Knochensäge durchtrennt werden; die blendende Helligkeit frischen Blutes; das nasse Zwinkern des Hirns; die blühenden Chrysanthemen der Milchdrüsen; die verknoteten Ballontierchen der Herzkranzgefäße; das Designer-Ledertäschchen des Magens; das überraschende Gold der Bauchspeicheldrüse. Auf rationaler Ebene wusste er wohl, dass es sich bei alledem nicht um eine Party handelte, sondern um die ersten Anzeichen blühender Verderbnis.
Die letzten drei Worte der Plakette machten ihn am wütendsten. Es war eine durchaus bemerkenswerte Formulierung. Nicht »den Lebenden« – da lag die Messlatte sehr niedrig, selbst er als lethargischer Mittagspausen-Bildschirmscroller würde sich dazu zählen –, sondern »dem Leben«. Das war eine viel breitere Formulierung, die für ihn nach einer Bejahung der Existenz selbst klang. Luis fragte sich, ob er sich in seinem zu dunklen Leichenschauhaus im zu hellen San Diego überhaupt als Teil dieses »Lebens« sehen konnte. Die Plakette schien eine Art Gleichwertigkeit zwischen den Toten und den Lebenden zu suggerieren, eine wechselseitige Beziehung, die unter den richtigen Bedingungen fast zu Transzendenz führen konnte.
Luis war froh, als das Festnetztelefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Die ständige Grübelei führte nirgendwohin. Er schloss seinen News-Feed (falls man dieses Potpourri aus Tier-GIFs, Twitter-Gemeinheiten, falscher Bescheidenheit beim Angeben über feines Abendessen und gesponserter Werbung wirklich als »Nachrichten« bezeichnen wollte), schaute auf die Uhr und nahm um exakt 20:22 Uhr den Hörer ans Ohr.
Es war gekommen wie erwartet. War man einmal mit dem Tod vertraut, hielt er nur noch wenige Überraschungen bereit. Das Erzengel-Sankt-Michael-Krankenhaus hatte John Doe um 19:18 Uhr für tot erklärt und den mutmaßlichen Sterbezeitpunkt mit 18:10 Uhr angegeben. Abgegeben hatte diese Erklärung, wie Luis nach ein paar Rückfragen erfuhr, ein Praktikant. Ein verdammter Praktikant. Erst trieb Detective Walker wie ein ungehobelter Türsteher John Doe in Richtung Grab, und dann überließ das Krankenhaus auch noch einem pickligen Idioten, der wohl dringend seinen Lebenslauf aufpolieren wollte, die endgültige Entscheidung. Wäre John Doe kein Obdachloser gewesen, wäre die Sache sicher anders gelaufen.
Immerhin würde Luis Acocella eine zweite Gelegenheit bekommen, John Doe mit Anstand zu behandeln. Seine Leiche war bereits unterwegs zu ihrem traurigen Wiedersehen. Luis begann sich tatsächlich darauf zu freuen. Er würde John Doe notfalls von Kopf bis Fuß auseinandernehmen, wenn er dadurch einen Hinweis entdeckte, dass die Schusswunden nicht tödlich gewesen waren und sein Ableben somit – zumindest teilweise – Detective Walkers Schuld war. Falls er damit Walkers Karriere beendete, gäbe es bei der SDPD immerhin einen Wichser weniger. Dann konnte Luis sich schon eher zum »Leben« zählen.
Er rief seine Laborassistentin Charlene Rutkowski an. Da sie ein normaler Mensch mit einem richtigen Privatleben war, ging sie nicht ran. Er schrieb ihr, dass er eine Leiche mit Schusswunden hatte, dass er die Autopsie noch diese Nacht vornehmen musste und sie absolut das Recht hatte, diese Nachricht zu ignorieren. Kurz zögerte er, dann fügte er einen letzten Satz hinzu. Er kannte Charlie gut genug, um zu wissen, sie würde alles stehen und liegen lassen, wenn er eine persönliche Sache daraus machte. Luis hasste es, eine solche Macht über eine Untergebene zu haben. Trotzdem wollte er den Kerl nicht alleine aufschneiden. Der Tag war schon nervenaufreibend genug gewesen. Immerhin war er beinahe erschossen worden, um Himmels willen.
St. Mike’s hat ihn von einem Praktikanten für tot erklären lassen. VON EINEM VERDAMMTEN PRAKTIKANTEN.
Die Antwort kam fast sofort.
Wichser. Bin in 30 min da.
Die warme Freude in seiner Brust ertrank umgehend in heißer Scham. Charlie kannte seine Stimmungsschwankungen besser als seine eigene Ehefrau, und obwohl er diese Intimität genoss, musste er jedes Mal, wenn er sie vertiefte, mit stechenden Schuldgefühlen ringen.
In der Nacht des 23. Oktober, der Nacht des John Doe, war Luis Acocella vierzig Jahre alt und seit sechzehn Jahren mit Rosa del Gado Acocella verheiratet. Als sie sich kennengelernt hatten, war sie erst sechzehn gewesen, gerade illegal aus El Salvador eingewandert, und er ein mexikanisch-stämmiger Sechsundzwanzigjähriger, seit knapp fünf Jahren US-Bürger. Obwohl sie erst vier Jahre später ein Paar geworden waren, hatte ihn der Altersunterschied immer verfolgt – vor allem, wenn er daran dachte, wie sehr er sich bereits zu ihr hingezogen gefühlt hatte, als sie noch ein Teenager gewesen war. Ihre Beziehung war lange Jahre in mehr als nur einer Hinsicht illegal gewesen.
Rosa hatte damals kurz davor gestanden, zusammen mit ihrer Mutter abgeschoben zu werden. Diese hatte all ihre Ersparnisse Kojoten – Menschenschmugglern – gegeben, damit die ihr Mädchen in die Staaten brachten. Luis konnte sich damit rühmen, wie der große John Wayne zur Rettung herbeigeritten zu sein. Das Medizinstudium war ihm durch Stipendien und Finanzspritzen von den Eltern ermöglicht worden, und obwohl er noch einen Facharzt machen wollte, hatte er Schulden abzubezahlen. Also hatte er eine bescheidene kleine Praxis in der Nähe von Los Peñasquitos eröffnet, nachts gebüffelt und tagsüber als Hausarzt für größtenteils spanischsprachige Patienten gearbeitet. Und er hatte Rosa getroffen, sooft er konnte.
Rosa erzählte ihrer Mutter, Luis sei »muy hombre«, ein »simpático«, der seit Jahren sein Bestes tat, um Menschen ohne Papiere zu helfen. Mama del Gado wollte, dass Luis den Deportationsbeamten mitteilte, Rosa sei krank und könne erst abgeschoben werden, wenn es ihr wieder besser gehe. Ein lächerlicher Plan, auch wenn Luis die Frau für ihren Mumm bewunderte. Stattdessen versuchte er mit allen Mitteln, die Abschiebeanhörung so lange wie möglich zu verzögern. Irgendwann keimte der Gedanke auf, er könnte Rosa am sichersten vor der Abschiebung bewahren, indem er sie heiratete.
Sie war wunderschön. Das half schon mal. Zarte Knochen, honigfarbene Haut, dunkle Augen. Sie behauptete, ihn zu lieben, und bis auf den offensichtlichen Schutz, den er ihr bot, sah er keinen Grund, diese Aussage anzuzweifeln. Ihre Augen aber – es war ihm nie gelungen dahinterzublicken, und ein Teil seiner Scham rührte daher, dass er es irgendwann auch nicht weiter versuchte. Sie passte genau so in sein Leben, wie es eine Ehefrau tun sollte, verschaffte ihm gesellschaftliches Kapital und so weiter.
Aber auch Rosa hatte sein berufliches Dilemma nicht lösen können. Seine chirurgischen Erfahrungen hatten nicht zur erhofften beruflichen Erleuchtung geführt. Mit jeder Enttäuschung auf dem OP-Tisch war ihm weniger klar, was er sich wirklich davon versprach, Menschen zu helfen. Unter anderem deshalb freute er sich so auf den geplanten Wochenendausflug nach La Paz. Da sein Bruder Manolo mittlerweile in Bangor, Maine, wohnte und als Anwaltsgehilfe sämtliche Nächte und Wochenenden durcharbeitete, war Luis gezwungen gewesen, seinen Vater Jeronimo um Rat zu bitten. Der war zum Zeitpunkt seiner Hochzeit mit Rosa fünfundfünfzig gewesen, hatte aber fünfzehn Jahre älter ausgesehen; sechzehn Jahre später sah er noch immer so aus. Irgendwie hatte aber sein generell schlechter gesundheitlicher Zustand manch altertümliches Vorurteil verschwinden lassen und ihn in einen unverblümt redenden Mönch mit weißem Schnäuzer verwandelt, der Antworten wie Tequila-Shots servierte. Und dabei war es ihm scheißegal, ob man mittrank oder nicht.
»Bei keiner Arbeit der Welt fühlt man sich ohnmächtiger«, hatte Luis Jahre zuvor einmal erklärt. »Wenn jemand einfach vor dir auf dem Bürgersteig umfällt, und du kannst ihn nicht retten, ist das nicht deine Schuld, Papa. Aber ich habe die nötige Ausbildung, die Ausrüstung, die Unterstützung. Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Und trotzdem sterben sie mir einfach unter den Händen weg.«
»Die sterben nicht weg«, sagte sein Vater. »Gott nimmt sie zu sich, wenn ihre Zeit gekommen ist.«
»Ein fünfjähriger Junge. Ein dreijähriges Mädchen, beide innerhalb eines Monats, Papa. Wie kann es Zeit für die gewesen sein?«
»Gottes Plan braucht Jahrhunderte, um sich zu entfalten.«
»Wir sind nur Ameisen auf einem Grashalm. Ich weiß, ich weiß.«
»Du hast deine Beziehung zu Gott begriffen. Schöpfe Frieden daraus.«
»Schon möglich, dass ich sie begreife, aber sie gefällt mir nicht. Wenn das der Gott ist, den ich kenne, will ich ihn lieber nicht kennen. Ich sollte den Leuten Leben geben können, Papa. Selbst wenn die Leute sterben – wenn ich meine Arbeit nur gut genug erledige, sollte ich sie zurückholen können.«
Jeronimo Acocella hatte keine Wut mehr in sich, nur noch Überzeugung. »Dafür ist Gott zuständig.«
Unterhaltungen wie diese brachten Luis unbemerkt seinem Fachgebiet näher. Parallel zu seiner Arbeit als Hausarzt belegte er Abendkurse. Mit einer gewaltigen Ausdauer, die er sich niemals zugetraut hätte, zog er ein vierjähriges Berufspraktikum durch und hatte am Ende einen Abschluss in Pathologie in der Tasche. Je mehr Zeit verging, desto mehr sah er sich – nicht zuletzt wegen Rosa – von Latino-Unterstützern umgeben, die sich zum Ziel gesetzt hatten, ihn zum ersten Chef der Gerichtsmedizin von San Diego mit lateinamerikanischen Wurzeln zu machen.
Er bewarb sich. Der Kampfgeist, der ihn auch als Medizinstudent vorwärtsgetrieben hatte, sorgte dafür, dass er mit harten Bandagen um diese Stelle kämpfte. Als er unterlag, war es ein herber Schlag für ihn.
Sieger wurde Jefferson »JT« Talbot, der Luis’ Einschätzung nach auf die Unterstützung der Schwarzen und Schwulen hatte bauen können. Luis hatte natürlich die Stimmen der Latinos auf seiner Seite gehabt. Aber sie hatten nicht gereicht. Luis fühlte sich schrecklich, weil er in Rassekategorien dachte, aber er konnte nicht anders. Amerika war von magischen Demarkationslinien durchzogen, entlang derer sich ethnische Gruppen sammelten, die Reihen schlossen und stur stehen blieben.
JT war ein großmütiger Gewinner. Luis schluckte seinen Stolz herunter und nahm die Stelle als JTs Stellvertreter an. Oberster Gerichtsmediziner war eine geachtete Stellung, die Respekt und Autorität mit sich brachte. Stellvertretender Oberster Gerichtsmediziner war ein Job. JT benötigte eine ganze Batterie feiner Anzüge, Luis dagegen einen weißen Kittel, Kunststoffhandschuhe und ein Plastikvisier, um sein Gesicht von umherspritzenden Eingeweiden abzuschirmen.
Obwohl JT sein Boss war, sah Luis sich außerstande, den Mann in irgendeiner Form als ihm überlegen anzusehen. Dieser Groll kroch ihm unter die Haut und setzte sich dort fest, als hätte er sich mit dem Skalpell aufgeschlitzt und ihn hineingestopft. Wen wunderte es da, dass sich auch seine Beziehung zu Rosa im Lauf der Jahre immer mehr verschlechterte, als wäre die Ehe von einem entzündeten Geschwür befallen? Die Veränderung, die ihr Körper durchmachte, wirkte auf ihn fast wie Verrat. Ihre Honighaut wurde fleckig. Sie legte an Gewicht zu, und zwar eine Menge. Diese tiefen dunklen Augen, die einstmals Geheimnisse zu hüten schienen, konnten ihr nacktes Verlangen nach Fürsorge und Bequemlichkeit nicht länger verbergen.
Es waren die schlimmsten Jahre seines Lebens. War er wirklich so ein Arschloch, dem Äußerlichkeiten wichtiger waren als alles andere? Er diagnostizierte eine klinische Depression bei sich selbst. Statt sich in Behandlung zu begeben, trank er. Dass Rosa die Veränderungen in seinem Verhalten wortlos hinnahm, vertiefte seinen Selbsthass nur noch weiter. Sie hatte damit gerechnet. Die ganze Zeit schon, seit dem Tag, an dem sie ihre Treuegelübde ausgetauscht hatten, hatte sie damit gerechnet, dass er sich zurückziehen und sich von ihr entfremden würde so wie jeder andere Ehemann, dem sie bisher begegnet war.
Luis gestand sich nur ungern ein, dass der Zustand seiner Ehe einer der Gründe für die Bereitwilligkeit sein könnte, sich die Nacht in seiner frostigen Schlachterei um die Ohren zu schlagen. Er nahm die Füße vom Tisch, erhob sich und schaute einmal mehr zu der Plakette auf. HIERISTDERORT, ANDEMDERTODDEMLEBENMITFREUDEHILFT. Sooft er auch über die Morpheme dieses lateinischen Sprichworts nachgegrübelt hatte, hatte er sich merkwürdigerweise noch nie so richtig auf die ersten vier Worte konzentriert. HIERISTDERORT. Irgendwie schwang bei diesem Ausdruck eine Art Vorahnung mit. Als sei es dieser unscheinbaren Leichenhalle in einer nichtssagenden Gegend von San Diego vorherbestimmt, zum Schauplatz eines wundersamen oder fürchterlichen Ereignisses zu werden.
Draußen fiel eine Autotür zu. Entweder hatte Charlie den Weg aus dem Gaslamp Quarter, dem historischen Stadtkern, schon hinter sich, oder St. Mike’s lieferte die Leiche bereits. Die Lebenden und die Toten – wenn man nicht ganz genau hinhörte, klangen sie einander sehr ähnlich.
DIE KLIPPEN SIND DAS PROBLEM
Luis ließ die blauen Latexhandschuhe aus dem Pappspender mit lautem Knall auf seinen Unterarmen schnalzen.
»Ein verfickter Praktikant«, sagte er schon wieder.
»Du«, sagte Charlie, »bist ein alter Nörgler.«
»Das gebe ich freimütig zu.«
»Zugeben? Du genießt es doch richtig.«
»Ja, stimmt.« Er streckte den Finger aus. »Das Skalpell, Frau Diener.«
Es folgte der charakteristische Beckenklang scharfer Gegenstände, die auf ein Metalltablett gelegt werden.
»Nörgeln lässt den Blutdruck steigen, Acocella. Und führt zu Schlaflosigkeit. Meiner medizinischen Expertise nach brauchst du ein neues Hobby.«
»Dem kann ich nicht zustimmen. Wenn man zum Beispiel Kaviar, Foie gras oder Château Latour schätzt, kann man daraus ein, zwei, vielleicht drei Mal im Jahr Vergnügen schöpfen. Ein perfekt zubereitetes Steak, eine handgerollte kubanische Zigarre oder der nackte Oberschenkel einer schönen Frau, sogar der Sex selbst – das sind alles seltene Güter. Das Geheimnis, ein möglichst befriedigendes Leben zu führen, besteht darin, Vergnügen aus etwas zu schöpfen, das man jeden Tag haben kann. Und was könnte das wohl sein, Frau Diener?«
Charlies Stimme war knochentrocken. »Deine mitreißenden Vorträge?«
»Hervorragende Antwort! Ich habe eine noch bessere. Jeden Tag gibt es hundert Situationen, die uns die Laune verderben. Wollen wir also das Beste aus dem Leben machen, müssen wir lernen, daraus einen Vorteil zu ziehen. Den Zustand des Missvergnügens vergnüglich zu finden!«
»Und was missvergnügt dich jetzt gerade?«
»Ein Praktikant. Ein dreckiger Praktikant!«
Luis und Charlie bereiteten Obduktionssaal 1 für John Doe vor. Der quadratische Raum wurde von sechs Autopsietischen mit den benachbarten Arbeitstheken und Organbecken eingenommen. Alles bestand aus rostfreiem Edelstahl, der im Schein der Schwarzlichtlampen schmierig schillerte. Charlie nahm einen Schlauch und spritzte den vorderen Tisch ganz vorsichtig ab, damit sich keine Aerosolwolke bildete. Die Flüssigkeit lief in ein Auffangbecken ab, das an eine gesonderte Wasserleitung für Gefahrenstoffe angeschlossen war. Luis kalibrierte die Organwaage und räumte etwas Platz in dem Trockenschrank frei, in dem den Kleidungsfetzen von Mordopfern für spätere Untersuchungen die Feuchtigkeit entzogen wurde.
Es verschaffte ihm Erleichterung, die Wut auf Detective Walker und all die rassistischen Schweine, für die er stand, zu schwarzhumorigen Dartpfeilen zu formen. Charlie half der Katharsis zusätzlich, indem sie die Pfeile aus der Luft schnappte und auf halbem Weg zurückwarf. Beide waren sich bewusst, dass sie vor dem jeweils anderen eine bestimmte Rolle spielten, aber um keinen Preis der Welt hätte Luis das aufgeben wollen. Wie die Plakette über der Eingangstür sagte, gedieh hier Leben an einem Ort, den es eigentlich schon verlassen haben sollte.
Voller Zuneigung betrachtete er Charlie. Als sie vor zwei Jahren angefangen hatte, hatte er sie falsch eingeschätzt. Ein kleines Flittchen, hatte er gedacht. Charlene Rutkowski, geboren in der Bronx, passte mit ihren wallend blonden Country-Western-Haaren und dem wiegenden Gang so gut in eine Leichenhalle wie ein Toter auf eine Bühne in Nashville. Charlie schien sich an diesem Gegensatz zu erfreuen. Außerhalb der Autopsieräume trug sie fröhlich gemusterte Kleider, die Schenkel und Dekolleté betonten. Im Labor waren Kittel Pflicht, aber Charlene bewirkte Wunder mit den formlosen grünen Säcken – an ihr sahen sie nicht formlos aus.
Es war fester Bestandteil ihrer Routine, derbe Sprüche (an den meisten Arbeitsplätzen verboten, bei Jobs, die mit Leichen zu tun hatten, aber durchaus üblich) und gespielt ernste Boss-zu-Untergebener-Anordnungen zu vermischen, unterstrichen von seiner Angewohnheit, Charlie »Frau Diener« zu nennen – eine altertümliche Bezeichnung für einen Laborassistenten, welcher die Aufgabe hatte, Leichen zu säubern und vorzubereiten, Werkzeuge bereitzuhalten und bei der korrekten Aktenführung zu helfen. Charlie hatte großen Spaß daran, dieses Wort mit einem französischen Akzent zu wiederholen: dee-en-ay. Trotz der netten Hänseleien wusste Luis, wo die Grenzen lagen. Er hatte es nie übers Herz gebracht, ihr zu verraten, dass das Wort aus dem Deutschen kam und eigentlich bloß Angestellter oder Handlanger bedeutete.
»Geh nicht so hart mit den Praktikanten ins Gericht«, sagte Charlie. »Wir waren auch mal welche.«
»Und haben im Praktikum gelernt, unseren jugendlichen Enthusiasmus zu unterdrücken. Und damit sind wir weit gekommen.«
»Sind wir das? Mal überlegen.« Charlene tippte sich mit dem behandschuhten Zeigefinger ans Kinn. »Im Vergleich zu damals bin ich weniger zufrieden, werde weniger respektvoll behandelt und verdiene weniger. Selbst das Kellnern war lukrativer. Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich mit Typen bumse, die gute Jobs haben, kriege ich irgendwann auch ’nen guten Job. Meine Mom sagt solche Sachen! Frau Mae Rutkowski!«
»Hat nicht so gut geklappt, was?«
»Guck dich doch mal um. Ich hab mich ganz nach unten gebumst.«
»Das ist eine Beleidigung für mein Labor.«
»Ah, ja. Dein Labor. Freitagabends. Ich komme mir vor wie eine Prinzessin.«
»Dann schubs mir doch bitte mal eine Pulle Formaldehyd rüber, Hoheit. Und bereite die Scheren vor. Wir müssen uns auf die Jagd nach vier Projektilen begeben.«
»Siehste, sag ich doch. Gib mir dies, hol mir das. Männer wollen immer oben liegen.«
Selbst nach ihren Maßstäben war das arg obszön, weshalb Luis seine Reaktion auf ein unverbindliches »Mmmmm« beschränkte. Er wurde mit Charlies Schmollmund belohnt. Sie hatte ihm bereits direkt gesagt, dass er sich auf ein professorales Mmmmm zurückziehe, wann immer sie die besseren Argumente hatte. Seitdem gab er sich Mühe, das Geräusch so oft wie möglich unterzubringen. Er kicherte, zog das Handy aus der Tasche, um Uhrzeit und News-Feed nachzusehen. Es gelang ihm nicht, das Gerät mit dem Fingerabdrucksensor zu entsperren. Er fluchte. Verdammtes Latex.
»Acocella. Genug ist genug. Such dir endlich Hilfe, du bist ja süchtig.«
Der Akku war fast leer. Luis ging zu dem Tisch, wo er ein Ladegerät aufbewahrte, steckte das Telefon an und schaltete es auf lautlos.
»Süchtig«, wiederholte er bedächtig. »Da fällt mir etwas ein.« Er ging in die Hocke, zog eine Schublade voller Krempel auf und kramte darin herum. »Ich wollte ja nur sagen, dass du und ich, damals als nichtsnutzige Praktikanten, niemals die bowlingkugelgroßen Eier gehabt hätten, so eine Entscheidung zu treffen. Wir reden hier von einem Menschenleben.« Er wühlte immer energischer im Inhalt der Schublade herum. »Diese Schusswunden – du wirst es ja gleich sehen. Zugegeben, sie könnten durchaus tödlich gewesen sein. Halsschlagader, Achselschlagader, Oberschenkelschlagader, vielleicht sogar die Niere. Aber – wie war das Sprichwort? Zwischen Glas und Lippe …«
»… gibt es manche Klippe«, sagte Charlie. »Genau diese Klippen sind dein Problem.«
Als Luis das zerknitterte Marlboropäckchen fand, hatte er gerade wieder den Anblick von John Does blutgetränktem Anzug vor Augen. Sehr viel Blut, aber nicht zu viel, wenn man bedachte, dass der Mann gerade vier Kugeln abbekommen hatte. Die Zigaretten schienen plötzlich Tonnen zu wiegen. War das alles nicht vollkommen sinnlos, dieses ewige Aufbegehren des Arztes gegen den Tod? Wenn er feststellte, dass er Haarspalterei zwischen sehr viel Blut und zu viel Blut betrieb, kam es ihm auf jeden Fall sinnlos vor.
»Sosehr mir deine Handysucht auch auf den Keks geht, ist sie immer noch besser als das Gerauche«, sagte Charlie finster. »JT würde dich feuern, wenn er wüsste, dass du dir hier drin eine anzündest.«
»Es ist nur … Du hättest den Anzug dieses Mannes sehen müssen, Charlie. Wie aus JTs Kleiderschrank. Und seine Haare. Er hatte eine ordentliche Frisur. Und Manschettenknöpfe! Der war mal wer. Bis vor Kurzem war er noch wer.«
»Ach, und die haben eine bessere Behandlung verdient, oder wie? Wärst du genauso am Boden zerstört, wenn es irgendein drogensüchtiger Penner in einer Secondhand-Jogginghose gewesen wäre?«
»Das ist nicht fair.«
»Weißt du, was ein teurer maßgeschneiderter Anzug für mich, eine einfache Laborassistentin, bedeutet? Wirtschaftskriminalität. Das sagt mir: Hier liegt ein Typ, der Säcke voller Geld zu Hause hatte, wahrscheinlich im Aufsichtsrat irgendeiner großen Firma saß und dabei erwischt wurde, wie er die arbeitende Bevölkerung ausgebeutet hat. Ich bitte dich, Luis. Du erzählst doch gerne davon, wie du als Kind armer Eltern in Mexiko im Dreck gespielt hast. Meine Schwester und ich haben früher benutzte Spritzen im Park gesammelt und damit unsere Puppen akupunktiert. Das ist abgefuckt. Das ist nicht fair. Du hast mit den falschen Leuten Mitleid.«
»Wenn wir recht haben und der Kerl wirklich ein hohes Tier irgendwo war, warum weiß dann niemand, wie er heißt?«
Charlie hörte auf, durch leere Totenscheine zu blättern. »Im St. Mike’s haben sie es nicht rausgekriegt?«
»Vorname John«, sagte Luis. »Nachname Doe.«
Charlie verschränkte die Arme vor der Brust. »Weißt du, wer noch einen feschen Anzug anhat?«
»Wer?«
»Ein Toter. Jeder Tote. Im Sarg.«
Luis nahm eine trockene Zigarette heraus, steckte sie sich zwischen die Lippen – oder Klippen, bitte schön, dachte er – und fing an nach Feuer zu kramen. Schließlich entdeckte er eine staubige Streichholzschachtel. Er strich eines an. Es brach entzwei. Er strich ein zweites an. Der Kopf fiel ab. Das dritte hinterließ rötliches Geschmier auf dem Zündstreifen, ging aber auch nicht an.
»Fuck«, murmelte er.
Ein Schatten verhüllte die grellen Oberlichter. Charlie hatte sich neben ihn gestellt. Sie hatte sich bereits die Handschuhe abgestreift und die Hände zu einem Schälchen geformt. Dies war die andere Charlene Rutkowski: vollkommen uneigennützig und sofort bereit, sich zu entschuldigen, sobald sie den Eindruck hatte, seine Gefühle verletzt zu haben. Luis überreichte ihr die Streichholzschachtel. Charlie zog eines hervor und drückte den Phosphorkopf mit größter Sorgfalt an den Zündstreifen. Eine Flamme flackerte auf. Sie schirmte sie mit der Hand ab und führte sie zu seiner Zigarettenspitze.
Er nahm ein paar gierige Züge. Das Nikotin machte ihn benommen, und für einen Moment verwandelte Charlie sich in zwei bis drei Assistentinnen. Das gefiel ihm nicht. Charlie, und nur Charlie, verdiente seine ganze Aufmerksamkeit. Er stand auf, grunzte und versenkte die Zigarette wehmütig im halb vollen gestrigen Kaffeebecher.
»Hätte ich nur nicht so einen dürftigen Verbandskasten dabeigehabt«, sagte er leise.
»Acocella«, sagte Charlie.
Luis seufzte. »Oder wäre ich noch Arzt. Ein richtiger Arzt.«
»Luis.«
Ihre liebevolle Stimme fuhr wie eine sanfte Berührung über seine Wange. Er betrachtete sie durch den Rauch, der wie eine geisterhafte Nachahmung des Brustkorbs, den sie bald aufschneiden würden, in der Luft hing. Aber nicht nur ihre Stimmlage hatte sich verändert, auch ihre Körperhaltung. Vorgebeugt und voller Verlangen, jeder Sarkasmus war vergessen. Aufgrund des Tuckerns der Lüftung und des Summens der Kühlschränke war es niemals still in der Leichenhalle. Aber das hier kam ziemlich nahe an Stille heran.
Beide zogen sich aus dem Augenblick zurück, Blicke und Hände plötzlich sehr beschäftigt.
»Also, wann kommt unsere Leiche denn jetzt?«, fragte sie hastig.
Luis schaute auf eine nicht vorhandene Armbanduhr – sein Handy hatte diese Aufgabe schon lange übernommen.
»Müsste jederzeit so weit sein.«
Charlie rieb sich vehement mit dem Handrücken unter der Nase, als wollte sie absichtlich unattraktiv wirken. Ihre Augen hatten sich gerötet, was der wie üblich reichlichen Mascara ein höllisches Glänzen verlieh.
»Ich muss mal«, murmelte sie.
Luis nickte und schaute seiner Assistentin hinterher, die mit jugendlicher Unbeholfenheit den Saal verließ. Luis schätzte sie dafür nur noch mehr. Sie hatte keine Ahnung, was für ein schönes Geschenk sie ihm gerade gemacht hatte. Objekt ihrer Begierde gewesen zu sein erfüllte ihn mit frischer Energie. Auf einmal fühlte er sich zu diesem Leben gehörig, von dem die Plakette über der Tür kündete. Gleichzeitig spürte er eine Welle der Zuneigung für Rosa. Er konnte es gar nicht erwarten, zu ihr ins Bett zu krabbeln und jedes Detail seines langen Arbeitstags mit ihr durchzuspielen.
Selbst die unsagbar komplexen Details der Systeme im menschlichen Körper konnten nicht mit der prickelnden Empfindlichkeit echter Emotionen mithalten, dachte er verzückt, mit diesen kleinen plötzlichen Klippen, die das Leben so unvorhersehbar machten. Er starrte die Zigarette im Kaffee an, die sich so schnell auflöste, wie es sein Leben tun würde, sollte er hier in diesem Labor die falschen Entscheidungen treffen. Es wäre gut, sich möglichst bald John Doe widmen zu können. Bei den Toten gab es keine Klippen. Tote wollten nichts, verlangten nichts, waren nicht hungrig. Ehrlich gesagt konnte Luis es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.
WHO’S GOT THE LAST LAUGH NOW?
Um 21:42 Uhr klingelte die Lieferglocke. Es war das gleiche digitale Ding-dong wie bei ihrem Friseur, und Charlies Instinkt reagierte entsprechend: Sie kontrollierte ihr Aussehen im Spiegel. Sie hatte die Wimperntusche so gut wie möglich mit Toilettenpapier entfernt, aber ein Teil musste mit ihren Poren verschmolzen sein. Ihre Haut war grau, unter den Augen hatte sie dunkle Ringe. Ein Anblick, den sie fünf Tage die Woche zu sehen bekam: auf den Gesichtern derjenigen, die aus dem Kühlschrank gerollt und aus den Plastiksäcken geholt wurden.
Luis’ Stimme dröhnte durch die geschlossene Klotür.
»Charlie? Sie sind da.«
Sie hatte schon in viel schwierigeren Situationen das Blickduell gegen ihr Spiegelbild gewonnen. Sie kniff sich in die Wangen, einer der vielen Tricks ihrer Mutter. Verheulte Augen wirkten weniger gerötet, wenn die Wangen darunter ebenfalls gerötet waren. Als positiver Nebeneffekt stärkte sie der Schmerz wie ein guter Schluck Whiskey. Sie schluckte die letzten heißen, selbstmitleidigen Tränen hinunter, setzte ein Lächeln aus der Kategorie »entschlossen« auf und rauschte zur Tür hinaus.
»Ich bin auch da«, verkündete sie laut.
Luis hörte auf, zwischen dem dritten und vierten Seziertisch auf und ab zu tigern. Er stellte eine ernste, zaghafte Miene zur Schau, die für ihre geplante nächtliche Obduktion ganz und gar unpassend war. Sie hasste sich dafür, das verursacht zu haben.
»Hey«, sagte er. »Ich krieg das auch alleine hin. Warum fährst du nicht nach Hause? Es war wirklich arschig von mir, dich so spät noch herzuzerren.«
»Nein, ich bin dabei.«
»Ich hab mich unnötig dramatisch verhalten. Das ist eine stinknormale Obduktion. Ich brauche deine Hilfe wirklich nicht.«
»Doch, brauchst du wohl, Acocella.« Sie zückte eine Zange und schnappte nach ihm. »Du weißt es bloß noch nicht.«
Er sah sie zweifelnd an, als überlegte er, welchen seiner Körperteile sie sich wohl im Griff der Zange vorstellte. Dann trottete er zur Frachtrampe. Charlie zog die Schublade mit den Blankoformularen auf und entnahm ihr einen Totenschein und einen Obduktionsbericht. Letzterer wies die Umrisse eines menschlichen Körpers auf, in den sie alle Identifikationsmerkmale einzeichnen würde – Beschneidung, Muttermale, Leberflecken, Tätowierungen, Narben, Abschürfungen und Wunden. Diese Skizze war genauso wichtig wie die tiefergehende Untersuchung. Einmal hatte sie vergessen, die fehlenden Fingerkuppen eines Verstorbenen einzuzeichnen – Erfrierungen, die er sich einst bei der Rettung eines Freundes aus einem zugefrorenen See zugezogen hatte. Es war ein derart charakteristisches Detail, dass die Hinterbliebenen in Zweifel zogen, ob Luis und Charlie auch wirklich die richtige Leiche obduziert hatten. Derlei Beschwerden erreichten auch JT und konnten sehr schnell sehr unangenehme Folgen nach sich ziehen.
Sie platzierte Messer, Meißel, Hammer, Knochensäge und Darmschere so lautstark auf dem Metalltablett, dass der Lärm die entfernte Unterhaltung der Sanitäter vom St. Mike’s übertönte. Ihre Gefühle übertönte er ebenfalls. Sie zückte ihr mit Stickern verziertes PM40, das beste Skalpell auf dem Markt, und platzierte es neben Luis’. Sie legte den Rest ihrer PSA (Persönliche Schutzausrüstung) bereit – die Nylonschürze, die Kunststoffärmel, die vom Handgelenk bis zum Oberarm reichten, sowie das Plastikvisier, das zum Einsatz kam, wenn es wirklich ans Eingemachte ging. Alles sah danach aus, als würde sie es heute brauchen.
Gerade zähmte sie ihre dichte blonde Mähne mit einem Haarnetz, da rollte Luis ihre Glücksbahre in den Saal. Dem Orca-Fiepsen des linken Vorderrads konnte sie das ungefähre Gewicht des Toten entnehmen – irgendwas zwischen 77 und 82 Kilo. Sie packte Luis’ Haarnetz und flitschte es in seine Richtung. Er fing es aus der Luft.
»Keine Schuhüberzieher«, sagte er.
»Ts, ts, ts, Regularien.«
»Wenn ich um diese Uhrzeit hier in Überziehern rumrutschen muss, fang ich an zu heulen.«
»Wow, das ist ein ganz besonderer Anlass, wie?«, deklamierte Charlie. »Hätte ich das gewusst, hätte ich High Heels angezogen.«
Es war eine Freude, sich endlich der Arbeit hinzugeben. Zu dieser späten Stunde schwirrten hier keine Assistenzärzte oder Studentengruppen, vor denen sich Luis und Charlene »professionell verhalten« mussten, herum. Ihre Aufgaben konzertiert, locker und effizient durchzuführen hatte einen beruhigenden Effekt auf Charlie. Mit vierfachem metallischen Klicken die Wegfahrsperren der Bahrenräder einrasten zu lassen. Mit Eins-zwei-drei-hopp den Leichnam auf den Seziertisch zu wuchten. Mit leisem Knistern die schweren blauen Papiertücher auszupacken. Luis’ penible Angewohnheit, alle Kunststoffriemen seiner Schutzausrüstung so gründlich zu kontrollieren, als wäre er Profisportler. Und zu guter Letzt natürlich das lang gezogene, sanfte Schnurren des Reißverschlusses, um den Inhalt des weißen Leichensacks zu enthüllen.
John Doe war nackt. Sein Anzug, den man im St. Mike’s aufgeschnitten hatte, war separat verpackt. Luis und Charlie schälten den Mann aus seiner Tüte und drapierten ihn auf dem stählernen Tisch. Er war noch nicht lange genug tot, um bereits zu riechen. Das war gut. Schlecht hingegen war, dass Charlie die Restwärme des Körpers durch ihre Plastikhandschuhe spüren konnte. Sie hasste es, warme Körper aufzuschneiden. Jedem normalen Menschen konnte das ihrer Ansicht nach nur zuwider sein. Totes Fleisch hatte kalt und tonartig zu sein und musste sich eindeutig von lebendem unterscheiden.
Sie brachte den Gelenkarm, an dem eine Pentax hing, um den Körper aus allen Richtungen fotografieren zu können, über dem Tisch in Position. Luis stand dicht neben ihr und überprüfte John Does Patientenarmbänder, aber die einmal begonnene Routine erlaubte es ihr, ihn trotzdem etwas distanzierter zu betrachten. Sie hatte wirklich noch nie jemanden wie ihn gekannt. Aber war das nicht eher ihre Schuld? Ein Nebeneffekt der Orte, die sie sich zum Arbeiten ausgesucht hatte, und der Leute, die an solchen Orten verkehrten?
Charlie konnte sich in ihrem ganzen Leben an keinen einzigen Mann außer Luis Acocella erinnern, bei dem sie sich nicht irgendwann einmal unwohl gefühlt hatte. Diese Erfahrung hatte sie stets begleitet, vom Kindergarten bis zum Kaffeeholen heute Morgen. Als Teenager hatte sie immer wieder Ärger bekommen, weil sie den Leuten, die ihr hinterherpfiffen, den Stinkefinger gezeigt oder die Freunde ihres Dads angeschrien hatte, sie sollten ihr nicht ständig auf die Brüste glotzen. Das waren wilde Zeiten gewesen, in denen sie mit einer Ladung kreischender Freundinnen im Auto um die Häuser gekurvt war, die Fenster heruntergekurbelt, halb begeistert und halb entsetzt, elektrisiert von der eigenen Verletzlichkeit, jeder Augenblick ein Gefühl, als würde man unbekümmert einen steilen Hügel hinunterrennen. All das war jedoch entschiedener Widerstand gegen übergriffige Männer gewesen.
Sie kam sich vor wie ein dummes Kind, weil sie sich in ihren Vorgesetzten verguckt hatte. Gleichzeitig brachte ihr diese Missachtung gesellschaftlicher Anstandsregeln die Erinnerung an diese stürmischen, anregenden Jugendtage, als es sich noch wie eine definitiv lebensrettende Maßnahme angefühlt hatte, Verbotenes zu tun, zurück. Nur wenige hatten damals ihre Annäherungsversuche verschmäht; auch heute noch taten es die wenigsten – nicht einmal die Verheirateten. Aber Luis war anders. Es tat weh, sich eine mögliche Zurückweisung seinerseits auch nur vorzustellen. Der Tote auf dem Tisch war also eine willkommene Ablenkung.
Sie mussten John Doe umdrehen, damit sie seinen Rücken mit der Kamera ablichten konnte. Charlie beobachtete, wie behutsam Luis den Mann an Schulter und Hüfte berührte. Es wirkte beinahe väterlich – obwohl Charlie sich im Klaren war, dass eine solche Interpretation ihre Gefühle schon wieder unnötig in Wallung brachte. Vorsicht war schlicht ein Bestandteil kluger ärztlicher Arbeit, denn man wusste nie, was man von der Rückseite eines Verstorbenen zu erwarten hatte – klaffende Stichverletzungen, wund gelegene Stellen, in denen schon die ersten Maden nisteten – sie hatte schon alles gesehen. John Does Rücken aber war glatt wie ein Babypopo.
Im Seziertisch war eine Waage integriert. Charlie hatte richtig geschätzt – der Kerl wog 79,8 Kilo. Sie schaltete auf Autopilot. Nahm Messungen vor. Fertigte Röntgenaufnahmen an. Zeichnete in das Schema auf dem Obduktionsbericht Wunden und sonstige Merkmale ein. Alles Tätigkeiten, die sie an die stumpfsinnigen Jobs ihrer Jugend erinnerten. Ausschank in einer Kneipe, Putzen in einem Country Club, die Bedienung einer Blasformmaschine in einer Fabrik. Bei diesen Arbeiten hatte sie sich so tot wie John Doe gefühlt. Sie erinnerte sich noch an eine besonders erschöpfende Nacht, in der sie hätte schwören können, dass alle Fabrikarbeiter um sie herum in Wahrheit Leichen waren, aufrecht neben surrenden Maschinen zu einem grotesken Tableau vivant drapiert.





























