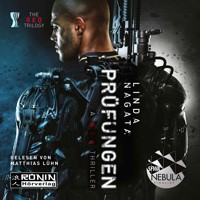Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem ländlichen Gebiet der afrikanischen Sahelzone befehligt Lieutenant James Shelley eine hochtechnisierte Einheit von Soldaten. Jede Nacht jagen sie während grauenvoller Patrouillen Aufständische und befolgen dabei drei simple Ziele: Beschützt Zivilisten, tötet den Feind und bleibt am Leben. Denn in einem von der Verteidigungsindustrie inszenierten, profitorientierten Krieg gibt es keinen Grund, aus dem man sterben sollte. Shelley nutzt sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Hightech-Hilfsmittel, um seine Soldaten am Leben zu halten – aber seine beste Waffe ist sein untrügerisches Gespür, wenn Gefahr droht … als stünde ihm Gott bei, um ihm warnend ins Ohr zu flüstern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1980
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LINDA NAGATA
THE RED
SAMMELBAND
Ins Deutsche übertragen vonHelga Parmiter
Inhalt
THE RED 1: MORGENGRAUEN
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 1: ABGESCHNITTEN
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 2: DURCHGESICKERT
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 3: ERSTES LICHT
VERNETZTE KAMPFGRUPPE ZUSÄTZLICHE SZENEN
DANKSAGUNGEN
THE RED 2: PRÜFUNGEN
GEGEN DIE BESTIE
FOLGE 1: DIE PROZESSE
ZWISCHENSPIEL
NACHWIRKUNGEN
GEGEN DIE BESTIE
FOLGE 2: SCHATTENSPIELE
ZWISCHENSPIEL
GÖTTLICHE GUNST
GEGEN DIE BESTIE
FOLGE 3: SCHWINDELERREGENDE PFORTE
ZUSÄTZLICHE SZENEN
ABSCHLUSS GESPRÄCH
DANKSAGUNGEN
THE RED 3: FUNKSTILLE
LEBEN DANACH
KOMMANDOKETTE
NICHTLINEARER KRIEG
EINSATZREGELN
DIE TRAGISCHE SCHLUSSSZENE
UNFREIWILLIGE TRENNUNG
DANKSAGUNGEN
LINDA NAGATA
THE RED 1
MORGENGRAUEN
Ins Deutsche übertragen vonHelga Parmiter
Inhalt
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 1: ABGESCHNITTEN
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 2: DURCHGESICKERT
VERNETZTE KAMPFGRUPPE FOLGE 3: ERSTES LICHT
VERNETZTE KAMPFGRUPPE ZUSÄTZLICHE SZENEN
DANKSAGUNGEN
VERNETZTE KAMPFGRUPPE
FOLGE 1:ABGESCHNITTEN
»Irgendwo muss immer Krieg herrschen, Sergeant Vasquez. So ist das im Leben. Ohne einen anständigen Konflikt würden zu viele internationale Sicherheitsunternehmen pleitegehen. Wenn sich also kein echter Krieg anbahnt, dann kann man sich darauf verlassen, dass die SUs sich zusammentun, um einen zu erfinden.«
Mein Einführungsvortrag gehört nicht zum üblichen Armeestandard. Ich halte ihn im von Mauern umschlossenen Hof von Fort Dassari, während meine VKG – meine vernetzte Kampfgruppe – sich auf unsere nächtliche Patrouille vorbereitet. Seit Sonnenuntergang ist die Temperatur auf fünfunddreißig Grad gefallen. Dafür sind wir alle dankbar, aber wegen der hartnäckigen Schwüle der Regenzeit fühlt es sich immer noch verdammt heiß an. Warnleuchten werfen Glanzlichter auf die glatten, schwarzen, schweißglänzenden Wangen von Sergeant Jaynie Vasquez, die gemeinsam mit einem Wochenvorrat an Verpflegung erst vor vier Stunden per Hubschrauber eingetroffen ist.
Genau wie alle anderen trägt Jaynie Vasquez einen Kampfanzug, Körperpanzerung und die grauen Titanknochen ihres Exoskeletts. Ihre fein geschwungenen Augenbrauen sind zu einem skeptischen Bogen hochgezogen und sie beäugt mich unter dem Rand ihrer braunen VKG-Schädelkappe hinweg. Ich nehme an, man hat sie vor mir gewarnt … vor dem berüchtigten Lieutenant James Shelley der United States Army, ihrem kommandierenden Offizier hier in Fort Dassari.
Kein Problem. Wissen ist Macht.
»Also wie genau machen die SUs das – einen Krieg erfinden?«, frage ich sie.
Sie antwortet mit dem Pragmatismus eines unerfahrenen Mannschaftsrangs: »Das liegt außerhalb meiner Soldstufe, Sir.«
»Ist dennoch wert, dass man drüber nachdenkt. Ich stelle mir das etwa so vor: Alle großen Sicherheitsunternehmen, die SUs, denen unsere Hassliebe gilt, kommen zusammen … also nicht in natura, sondern in einer virtuellen Besprechung. Zunächst sind sie ein wenig unterkühlt – das liegt in der Natur eines Sicherheitsunternehmens –, aber dann sagt einer von den SUs: ›Na los doch. Wir brauchen jemanden, der den nächsten Krieg abhält. Freiwillige?‹«
»Jawohl, Sir«, sagt Specialist Matthew Ransom grinsend, während er sich zum obligatorischen Ausrüstungscheck bei mir vorstellt.
»Das ist eine ernste Sache, Ransom.«
»Tut mir leid, LT.«
Ich beginne trotzdem mit der Durchführung des Checks, erfasse seine Ausrüstung und stelle sicher, dass jeder Gurt an seinem Exoskelett sicher befestigt ist. Dabei nehme ich den Faden meiner Erzählung wieder auf.
»›Freiwillige.‹ Das ist ein Scherz, verstehen Sie? Denn ein SU wird niemals einen Krieg in seinem eigenen Land zulassen. Regel Nummer eins: Niemals deine Steuerzahler töten. Krieg ist etwas, das man anderen Völkern antut.«
»Wie wahr, Sir«, sagt Jaynie mit bitterem Unterton, während sie einen Ausrüstungscheck für Private First Class Yafiah Yeboah beginnt.
Vielleicht dringe ich ja zu ihr durch.
»Jedenfalls zieht der Scherz, das Eis ist gebrochen und man beginnt, mit Ideen zu jonglieren, bis eins der SUs sagt: ›He, ich hab’s. Fangen wir doch einen Krieg in der Sahelzone an. Das ist gutes, offenes Gelände. Keine fiesen Dschungel. Ist nicht vollkommen verlassen und mit Ahab Matugo haben wir schon einen geeigneten Strohmann.‹ Das finden alle ziemlich gut, also einigt man sich darauf, dass der nächste räumlich begrenzte Krieg, der sie für weitere drei oder vier Jahre im Geschäft halten wird – vielleicht auch für ein Jahrzehnt, wenn alles gut läuft –, genau hier in Afrikas Sahelzone zwischen dem äquatorialen Regenwald und der Sahara stattfinden wird.«
Ich bin beim letzten Punkt der Inspektion angelangt und hocke im Schlamm neben Matt Ransoms linkem Stiefel, wo dieser in der schwebenden Fußplatte des Exoskeletts festgeschnallt ist. Alles sieht gut aus, also gebe ich der Strebe an seinem Oberschenkel einen Klaps und sage zu ihm: »Sie sind sauber.«
Der Rahmen meines eigenen Exoskeletts streckt sich beim Aufstehen. Die mit Stoßdämpfern versehenen Streben entlang meiner Beine richten mich mühelos auf, obwohl ich einen Rucksack mit achtzig Pfund trage. Ein leises Ächzen der mechanischen Gelenke ist zu hören und sie sondern einen schwachen, sterilen Geruch ab, der von einem mineralischen Schmiermittel stammt und wegen des organischen Gestanks von Schlamm und Hunden kaum wahrnehmbar ist.
Ich wende mich wieder Jaynie zu. Sie hält bei ihrem Ausrüstungscheck inne und fragt: »Also müssen die Sicherheitsunternehmen den Krieg jetzt irgendwie anfangen, richtig?«
»Zunächst müssen sie mal Seiten aussuchen, aber dafür reicht eine geworfene Münze. China wird zum größten Befürworter von Ahab Matugo und ein arabisches Bündnis nimmt den Status quo …«
»LT«, unterbricht Ransom, »soll ich die Freigabe für Sie machen?«
»Klar. Machen Sie nur.« Ich streiche mir mit der behandschuhten Hand über meine Schädelkappe, während er damit beginnt, an Gurten und Streben zu rütteln und Energiepegel zu überprüfen. Ich erinnere mich daran, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und wie ich während meines ersten Kampfeinsatzes zum Ende des Bolivien-Konflikts beobachtet habe, wie die Dinge sich entwickelten. Ich bemühe mich redlich, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Also, wir Amerikaner … wir mischen uns nicht sofort ein, denn wir müssen erst einen anderen Krieg abwickeln. Also versprechen wir, dann einzugreifen, wenn es aus humanitären Gründen erforderlich werden sollte. Allerdings sagen wir nicht, auf welcher Seite wir stehen, weil das scheißegal ist. Jeder weiß, dass wir keine Ahnung von der Lokalpolitik haben und dass es uns auch einen Scheiß kümmert. In der Region gibt es nichts Interessantes für uns. Der einzige Grund für uns, in die Bresche zu springen, sind unsere Sicherheitsunternehmen, die ihre Aktionäre bei guter Laune halten wollen. Die amerikanischen Steuerzahler werden sich in den üblichen Medien die Hurra-Propaganda anhören und das Geld lockermachen, dann den Liberalen die Schuld für die miese Wirtschaft geben, während gleichzeitig ein Brain-Drain der Unterschicht in die Army stattfindet – hey, das ist schließlich ein Job –, und selbst die SUs können den Kongress nicht davon überzeugen, zehn Millionen Dollar für jeweils einen Kampfroboter auszugeben, wenn man einen voll ausgebildeten, hochintelligenten Soldaten aus Fleisch und Blut für zweihundertfünfzigtausend bekommen kann.«
Ransom macht einen Schritt rückwärts. »Sie sind sauber, Sir.«
Ich ignoriere ihn. »Und das, Sergeant, ist der Grund, weshalb wir uns hier in Fort Dassari befinden und ein Land besetzen, wo wir nicht willkommen sind und auch nicht hingehören. Deshalb begeben wir uns heute Abend wie jeden Abend auf einen Marsch durch feindliches Gebiet und geben anderen Leuten, die genauso wenig hierher gehören, die Möglichkeit, uns zu töten. Wir sind nicht hier, um Ruhm zu ernten – hier gibt es nämlich keinen –, und es steht auch nichts auf dem Spiel. Unsere Ziele lauten: am Leben zu bleiben, zivile Verluste so gering wie möglich zu halten und alle zu töten, die ein Interesse daran haben, uns zu töten. In neun Monaten ist nicht ein Soldat unter meinem Kommando gestorben und ich würde das gerne beibehalten. Haben wir uns verstanden?«
Jaynie achtet sorgsam darauf, keine Regung zu zeigen. »Ja, Sir, verstanden.« Und da sie nicht die Absicht hat, sich von einem männlichen Lieutenant, der fünf Jahre jünger ist als sie und obendrein nur ein Viertel ihrer Kampferfahrung hat, einschüchtern zu lassen, fügt sie noch hinzu: »Die Leitung hat Sie als durchgeknallten Mistkerl beschrieben, Sir …«
Hinter Jaynie schlägt Yafiah sich die Hand vor den Mund und unterdrückt prustend ihr Gelächter.
»… aber man hat mir versprochen, dass es vollkommen egal ist, was Sie für ein Arschloch sind, Sie werden uns nicht in einen Hinterhalt führen.«
Ich lächle freundlich. »Ein paarmal war es knapp.«
Als das nordöstlichste einer Reihe von entlegenen Grenzforts sind wir noch mehr auf dem Präsentierteller als andere. Das Fort selbst ist unser Zufluchtsort, unsere Operationsbasis. Seine viereinhalb Meter hohen Mauern umschließen die Unterkünfte und einen Hof, der gerade groß genug ist, um zwei Panzer dort zu parken; nicht, dass wir Panzer hätten, aber wir haben drei ATVs – geländetaugliche Fahrzeuge – unter einem Faltdach abgestellt.
Unsere Mission liegt außerhalb dieser Mauern. Wir riegeln das Gebiet ab und jagen Eindringlinge, die von Norden her infiltrieren, und die Eindringlinge jagen uns. Die Leitung entdeckt sie nicht immer rechtzeitig, weshalb wir ein Rudel aus fünf Hunden halten. Sie gehören nicht offiziell zur Army-Ausstattung, aber das Motto der vernetzten Kampfgruppen lautet »Innovation, Koordination, Inspiration« … Das bedeutet, dass man uns als VKG einen gewissen Spielraum für die Entwicklung eigener Strategien gewährt.
»Noch etwas, Sir«, sagt Jaynie, als ich mich abwende. »Stimmt es, dass Sie ein Cyborg sind?«
»Es handelt sich nur um ein Overlay fürs Auge.« Ich berühre mit meinem behandschuhten Finger meinen Augenwinkel. »So ähnlich wie eingebaute Kontaktlinsen, mit denen man Daten empfangen und darstellen kann.«
Die entlang meiner Kieferlinie tätowierte, goldene Linie ist eine Antenne; und in meine Ohren wurden winzige Hörknospen implantiert, aber das erwähne ich nicht.
»Sie sind nicht mit der Außenwelt vernetzt, oder?«
»Aus einem Kriegsgebiet hinaus? Keine Chance. Die einzige mir erlaubte Verbindung ist die zur Leitung.«
»Also sind Sie auch mit der Leitung vernetzt, wenn Sie keinen Helm tragen?«
»So ist es. Alles, was ich sehe und höre, wird direkt nach oben weitergeleitet.«
»Weshalb ist das so, Sir?«
Auf diese Diskussion möchte ich mich jetzt gerade nicht einlassen, also wende ich meine Aufmerksamkeit dem letzten Mitglied unserer kleinen Gruppe zu. Private First Class Dubey Lin steht auf einer Laufplanke knapp drei Meter über dem Boden und späht durch einen Maschinengewehrschlitz hindurch auf die umstehenden Bäume. Dubey verlässt sich ein wenig zu sehr auf organisches Sehvermögen, aber er ist immer pünktlich abmarschbereit und gibt keine Widerworte. Um genau zu sein, sagt er überhaupt nicht viel. »Dubey!«, rufe ich. »Kommen Sie runter.«
»Ja, Sir!«
Er springt herunter und lässt die Stoßdämpfer seines Exoskeletts den Aufprall abfangen. Dabei erschreckt er die Hunde, die in Erwartung des nächtlichen Streifgangs so angespannt sind, dass sie sich gegenseitig anfallen. Sie knurren böse, während sie sich in spielerischen Kämpfen umeinander drehen. Ransom mischt auch mit und lässt ein paar Kung-Fu-Tritte und Handkantenschläge in Dubeys Richtung los. Dabei streckt und beugt er die Arm- und Beinstreben seines Exoskeletts, aber Dubey beachtet ihn nicht. Wie immer.
Intern – in den vernetzten Kampfgruppen – haben wir den Exoskeletten den Spitznamen »tote Schwestern« gegeben, weil alle Teile, bis auf die Fußplatten, dem menschlichen Knochengerüst sehr ähnlich sehen. Federbeine verlaufen an den Außenseiten der Beine bis zu einem beweglichen Kniegelenk und dann weiter bis zur Hüfte hinauf. Am Rücken nimmt die Vorrichtung die Gestalt einer Sanduhr an, um nur ein Minimum an Profil zu bieten, und endet dann in einem die Schultern umspannenden Bogen, der problemlos sowohl das Gewicht eines Kampfrucksacks trägt als auch die von den schmalen Armstreben generierte Hebelwirkung aushält.
Pakete mit Mikroprozessoren registrieren die Bewegung des Soldaten und übersetzen sie für die Vorrichtung in den angepassten Bewegungsalgorithmus. Ein Soldat im Exoskelett kann erschossen werden, ohne auch nur einmal hinzufallen. Das habe ich in Bolivien gesehen. Und wenn in der toten Schwester noch genug Energie übrig ist, kann sie die Leiche zur Bergung in eine sichere Zone bringen. Auch das habe ich gesehen. Manchmal laufen die Toten einfach weiter, quer durch meine Träume. Nicht, dass ich das jemals vor der Leitung zugeben würde.
Jaynie bedrängt mich noch etwas mehr. »Also, wenn die Leitung alles hören kann, was Sie sagen, Sir, wieso labern Sie dann dauernd Scheiße?«
»Wir müssen das Spiel spielen, Sergeant. Aber wir müssen es nicht mögen. Und jetzt Helme auf!«
Wir verschwinden alle hinter den Vollvisieren, die auf undurchsichtiges Schwarz eingestellt sind.
Winzige Ventilatoren blasen mir kühle Luft ins Gesicht, während ich zusehe, wie eine Reihe Symbole auf der Anzeige meines Visiers auftauchen. Sie versichern mir, dass ich mit allem verbunden bin – mit meiner Schädelkappe, mit meinem M-CL1a-Sturmgewehr, mit jedem meiner Soldaten, mit meinem Engel, der unsichtbar hoch am Nachthimmel fliegt, und mit meiner Betreuerin bei der Leitung. »Delphi, sind Sie da?«
Ihre vertraute Stimme antwortet: »Ich hab Sie, Shelley.«
Man nennt uns nicht umsonst vernetzte Kampfgruppe.
Mit einem bestimmten Starren meiner Augen schalte ich mich durch die Anzeigen der anderen Soldaten meiner VKG, damit ich sicher sein kann, dass sie ebenfalls vernetzt sind.
Prinzipiell sollte jede vernetzte Kampfgruppe neun Paar Stiefel auf dem Boden haben, aber in Dassari hatten wir noch nie mehr als sechs – und dank einiger Versetzungen waren wir schon auf vier runter, bis Jaynie hierherkam. Die Armee prahlt ja gerne damit, dass jeder VKG-Soldat ein Elitesoldat ist, der strengste körperliche und geistige Anforderungen erfüllt und die Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, sich neuen Systemen und Umständen anzupassen. Übersetzt heißt das, wir sind chronisch unterbesetzt und keiner bekommt einen freien Abend.
»Lasst uns alle hellwach bleiben«, sage ich über den allgemeinen Kommunikationskanal gen-com. »Es ist die letzten Nächte zu ruhig gewesen. Wir sind fällig.«
»Jawohl, Sir!«, antwortet Ransom, als seien das gute Neuigkeiten. Yafiah flucht leise. Dubey tritt frustriert in den Boden. Nur Jaynie kapiert es nicht.
»Wissen Sie etwas, das wir nicht wissen?«, fragt sie über gen-com.
»Nur so eine Ahnung.«
Ransom sagt: »Manchmal flüstert Gott ihm etwas ins Ohr.«
»LT«, bettelt Yafiah. Sie weiß, was jetzt kommt. Ich weiß es auch, aber ich versuche gar nicht erst, ihn zu bremsen. Ransom ist mein liebster Hinterwäldler aller Zeiten. Er liebt alle, aber er würde trotzdem jeden ohne zu zögern töten, wenn ich es ihm befehle. Seine Art, die Welt zu erklären, mag zwar unüblich sein, aber seine Begeisterung hat uns beide am Leben erhalten.
»Ma’am, das hier ist König David«, informiert er Sergeant Vasquez. »Saul wagt es nicht, diesem Mann auch nur ein Haar zu krümmen, und Goliath schafft es nicht, seine Kugeln geradeaus fliegen zu lassen, wenn der Lieutenant in der Nähe ist, denn James Shelley wird von Gott geliebt. Tu, was der LT dir sagt, und du lebst vielleicht lange genug, um Frankfurt noch einmal zu sehen.«
Ransom ist 1,88 m groß. Er besitzt hundert Pfund reine Muskelkraft mehr als Yafiah und ein Jahr mehr Erfahrung, aber aus ihrer Sicht ist er der dumme kleine Bruder. Sie wendet das leere schwarze Gesicht ihres Visiers Jaynie zu und sagt: »Machen Sie sich keine Sorgen um Ransom, Ma’am. Er ist ein bisschen bekloppt, aber wenn’s drauf ankommt, ist er echt gut.«
Jaynie klingt ehrlich verblüfft, als sie mich fragt: »Wie können Sie denn König David sein, LT? Ich hätte eigentlich schwören können, dass wir Goliath sind.«
»Goliath«, murmele ich und wähle durch ein Augenstarren das Lexikonsymbol auf meinem Overlay an, denn in Wahrheit kenne ich die Bibelgeschichte gar nicht genau.
Doch bevor ich mir die Zusammenfassung über Goliath anhören kann, überrascht Dubey uns alle, indem er tatsächlich spricht. »König David hat sein eigenes Spiel gespielt.« Seine schüchterne Stimme wird über gen-com verstärkt. »Und er hat nicht verloren.«
Das genügt mir.
Ich pfeife nach den Hunden. Die Tore des Forts schwingen auf. Wir begeben uns hinaus ins Mondlicht … alle fünf … die Dassari-VKG. Das Fort wird sich selbst verteidigen, während wir fort sind.
Wir schwärmen aus, damit wir mehr Gelände abdecken können und um zu verhindern, dass eine hochgehende Bombe oder ein Raketeneinschlag uns alle auslöscht. Als Hauptwaffe führen wir die M-CL1a mit, die auch bekannt ist als Harkin Integrated Tactical Rifle – die daraus resultierende Abkürzung weiß nur ein Zocker wirklich zu würdigen. Die HITR verwendet KI-Sight – also durch kognitive Sichtgeräte erfasste Daten –, um entweder Kugeln vom Kaliber 7,62 bis zu einer Entfernung von fünfhundert Metern zielgenau zu verschießen oder programmierbare Granaten aus dem unterbauten Granatwerfer abzufeuern. Außerdem sind wir mit einem nützlichen Arsenal Handgranaten ausgestattet – Splittergranaten, Blendgranaten und Rauchgranaten. Wir sind nicht für unsere Finesse bekannt. Wir schlagen schnell und hart zu. Durch die Antriebskraft der toten Schwestern und dank der Nachtsichtgeräte, die auf Photonenvervielfältigung basieren – wir müssen ja sehen, wo wir entlanglaufen –, schaffen wir es in den meisten Nächten, den gesamten Distrikt abzusuchen.
In der Nähe des Forts ist die Landschaft flach. Zum großen Teil handelt es sich um Anbaugebiete, abgegrenzt durch hohe Zäune, die Hirsefelder und Baumschulen vor streunenden Ziegen und umherziehenden Rindern schützen sollen. Doch nach einigen Kilometern hört das Farmland auf. Dann gibt es nur noch vereinzelt Bäume, die aussehen wie Mesquitebäume, die ich aus Texas kenne. Wir sind mitten in der Regenzeit, also tragen alle Bäume volles Laub und dort, wo sich sonst nackter, roter Boden zwischen ihnen befindet, wächst jetzt wildes Gras beinahe mannshoch. Die Hunde rennen hindurch und jagen nach abtrünnigen Soldaten.
Ein leichter Wind streicht über uns hinweg und lässt das Gras um mich herum wogen. Ich weiß, dass es raschelt, aber der Tonempfang meines Helms ist darauf eingestellt, Hintergrundrauschen herauszufiltern, also kann ich es kaum hören. Spezifische Geräusche hingegen kommen klar und deutlich bei mir an – das Hecheln der Hunde, das Muhen von Rindern, der pfeifende Ruf eines Vogels.
Weil das Gras so hoch ist, kann ich nicht sehr weit sehen, aber ich habe eine Karte auf dem Overlay offen, auf der die Positionen meiner Soldaten markiert sind. Die Karte wird ständig aktualisiert. Die Daten dafür sammelt mein Engel, eine Spielzeugdrohne mit einem Meter Spannweite, die von einer teilautonomen KI gesteuert wird. Der Engel wacht über uns. Alles, was ihm vor die Kameraaugen kommt, wird aufgezeichnet und das Rohmaterial gleichzeitig an die Leitung weitergeleitet. In Büros in Frankfurt, Charleston und Sacramento überfliegen unsere Betreuer das ungeschnittene Material, während Teams vom Geheimdienst Analyseprogramme darüber laufen lassen, um alle Radarechos zu finden, die das menschliche Auge übersehen könnte.
Es gibt immer etwas zu sehen. Das hier ist die Alte Welt. Leute haben sich hier seit Anbeginn der Zeit angesiedelt und sie werden es wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag tun – der vielleicht nicht in so ferner Zukunft liegt, wie wir gerne glauben möchten.
Ja, apokalyptische Gedanken kommen heutzutage viel zu leicht auf.
Wie auch immer, ganz gleich, wie leer dieses Land aussieht, es ist bewohnt. Leute leben hier, ziehen ihre Kinder und ihre Nutztiere groß und die meisten tun so, als ob gerade kein Krieg herrscht. Wir haben nicht vor, sie zu erschießen.
Also haben wir mithilfe des Engels eine Volkszählung durchgeführt. Wir kennen die Namen aller, die im Umkreis von fünfundzwanzig Kilometern um das Fort herum leben. Wir kennen ihre Gesichtszüge, ihre Größe, Gewicht, Geschlecht, Körpersprache und Alter. Wir wissen, wo sie leben, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen und in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zu den Leuten im Umkreis stehen. Der Engel stützt sich auf die Volkszählung und kann so jeden Einzelnen aus einem Kilometer Entfernung von hinten im Dämmerlicht identifizieren. Sobald wir unsere Identifizierung erhalten haben, gehen wir weiter. Es ist selten, dass die Leute hier uns zu Gesicht bekommen, es sei denn, wir sind auf der Straße.
Und wenn der Engel jemanden aufstöbert, der nicht in unserer Volkszählung vorkommt? Dann machen wir uns auf den Weg zu ihm.
Nicht jeder Fremde ist ein Feind. Schmuggler ziehen hier durch und solange sie keine Waffen oder verbotene Technologie mitführen, lassen wir sie laufen. Dasselbe gilt für Flüchtlinge, die von der Sahara nach Süden ziehen. Wir reden mit ihnen und fügen sie unseren Aufzeichnungen hinzu.
Doch was wir wirklich aufspüren müssen, sind die Eindringlinge, und zwar bevor sie uns finden. Das ist wie ein Versteckspiel und je besser der Engel darin ist, Leute zu entdecken, umso besser werden unsere Feinde darin, nach Nichts auszusehen.
Als ich also eine plötzliche Vorahnung von Gefahr bekomme – die von Herzrasen und Muskelanspannung begleitete Gewissheit, dass etwas wirklich Übles unmittelbar bevorsteht –, stelle ich mir ein rotes Licht vor. Meine Schädelkappe fängt das Bild auf und überträgt es auf die Visiere meiner Gruppenmitglieder. Sie bleiben wie angewurzelt stehen. Jaynie und Dubey klinken sich, wie in solchen Fällen vorgesehen, sofort in meine Bildeinspeisung ein. Yafiah und Ransom brauchen etwas länger, doch innerhalb weniger Sekunden starren wir alle geradeaus auf eine der wenigen Felsgruppierungen in unserem Distrikt. Es handelt sich um eine Anomalie in der flachen Landschaft: eine breite, ungleichmäßige Formation, die nur unwesentlich höher ist als die sie umgebenden niedrigen Bäume. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie natürlichen Ursprungs ist, aber es sieht so aus, als ob es sich auch um die Überreste einer uralten Pyramide handeln könnte, die nach Tausenden Regenzeiten zu einem konturlosen Klumpen zusammengeschmolzen ist.
Meine Betreuerin Delphi hat kein Wort gesagt, seit wir uns im Fort mit ihr verbunden haben, doch sobald ich mich nicht routinemäßig verhalte, ergreift sie das Wort. »Was haben Sie, Shelley?«
Ich konzentriere mich auf die Worte »ein Gefühl«. Diesen Begriff habe ich geübt, damit meine Schädelkappe ihn erkennt und für Delphi übersetzt.
Sie sagt mir, was ich bereits weiß: »Der Engel hat nichts. Ich hole ihn heran, damit er sich das genauer ansehen kann.«
»Die befinden sich auf erhöhten Positionen«, hauche ich kaum hörbar und überlasse es dem Helmmikrofon, die Lautstärke anzupassen.
Delphi gefallen meine »Gefühle« nicht, denn sie kann sie sich nicht erklären, doch sie war schon zweimal dabei, als ich einen unmittelbar bevorstehenden Hinterhalt gewittert habe, also diskutiert sie nicht.
Ich klinke mich in die Infrarotleitung des Engels ein, der auf geräuschlosen Flügeln hoch über der Felsformation schwebt. Ich suche nach hellen Wärmepunkten, doch ich sehe nur unsere Soldaten und unsere Hunde, die im Halbkreis östlich des Hügels verteilt sind.
Einer unserer Spürhunde, eine hellbeige Hündin namens Pearl, ist zwei Meter vor mir. Durch meine Körpersprache alarmiert, steht sie unbeweglich da und schnuppert prüfend die Luft. Ich zische sie an, um sie voranzutreiben. Sie trabt bereitwillig weiter, doch dann bleibt sie kurz vor dem Hügel stocksteif stehen. Das Audio meines Helms verstärkt ihr tiefes Knurren.
»Scheiße«, flüstert Yafiah über gen-com. »Ich will ’ne Granate da hoch feuern.«
Ich auch, aber das geht nicht. Wenn da nur ein Bauernjunge herumlungert, könnten wir alle im Knast enden – und ich trage diese Uniform nur aus einem Grund … ich will auf gar keinen Fall ins Gefängnis.
»Ganz ruhig«, warne ich Yafiah.
Ich wünschte, ich könnte den Hunden Schädelkappen anlegen. Dann könnte ich vielleicht ein Bild von dem empfangen, was sie spüren. Doch die Sicherheitsunternehmen weigern sich, Streuner auszurüsten. Sie wollen keine Strafe zahlen, falls ihre Ausrüstung fehlerhafte Ergebnisse liefert, also rüsten sie einen Hund nur dann aus, wenn er speziell gezüchtet und ausgebildet ist. Und diese Hunde kosten doppelt so viel wie ein Soldat. Unsere VKG ist dazu nicht befugt.
Ich zische Pearl noch einmal an, doch sie senkt ihren Kopf und wirft mir einen Blick zu. Sie weigert sich, weiterzulaufen.
Wir müssen wohl selbst reingehen.
Ich stelle mir das Vorrücken vor: Ich und Yafiah gehen geradewegs hinein, Ransom kommt von hinten und Dubey und Jaynie geben uns aus entgegengesetzten Richtungen Deckung. Ransom fängt das alles auf und macht sich eilig auf den Weg. Dabei hält er sicheren Abstand zu dem Hügel, während er um ihn herumläuft. Yafiah und ich gehen gerade darauf zu und halten beim Vorrücken dreißig Meter Abstand zueinander.
»Da ist es, Shelley«, sagt Delphi mit ihrer geschäftsmäßigen Stimme. Sie schickt mir ein Foto. Darauf ist ein roter Kreis um eine schwache Wärmequelle zu sehen, die sie zwischen den Felsen oben auf dem Hügel entdeckt hat.
Es ist nur ein grauer Punkt. Seine Form sagt mir gar nichts, doch die Wärmesignatur ist ein Hinweis auf einen sogenannten Ghost-Soldaten, der vor der Infrarotsicht des Engels zum Teil durch einen mit Thermobeschichtung versehenen Kapuzenanzug geschützt ist.
Ich schalte wieder auf die Engelsicht zurück. Die Wärmesignatur ist so gedämpft, dass ich sie kaum erkennen kann, bis die KI des Engels das Bild vergrößert. Dann sehe ich einen angewinkelten Arm, der den Tod mit seiner rechten Hand umklammert.
»Yafiah!«, brülle ich. »Zurückfallen!«
Angetrieben durch ihre tote Schwester springt sie vier Meter rückwärts und lässt sich an einer dicht mit Gras bewachsenen Stelle flach hinfallen. Die Hündin Pearl wirbelt herum und flüchtet an mir vorbei. Ich lege meine M-CL1a an. Ein glühender, goldener Punkt bewegt sich über den Bildschirm meines Visiers. Mit meinen eigenen Augen hätte ich die Granate auf gar keinen Fall kommen sehen können, doch meine taktische KI, die Daten vom Engel und den Helmkameras verwendet, hat ihre Flugbahn für mich berechnet. Ein offener Kreis markiert mein Ziel. Ich bringe den Kreis mit dem Punkt übereinander, feure einen kurzen Stoß ab und lasse mich flach hinfallen. Über meinem Kopf blitzt und donnert es gewaltig. Sobald es aufhört, bin ich wieder auf den Beinen. Oben auf dem Hügel rattert ein Sturmgewehr und dann sagt Ransom mit tiefer und fröhlicher Stimme über gen-com: »Das macht dann zwei für mich, LT.«
Wir sind noch nicht fertig.
Delphi findet noch einen Ghost ungefähr zwölf Meter von mir entfernt am Fuß des Hügels. Dieses Mal handelt es sich um einen glühenden, konturlos verschwommenen Fleck, der wesentlich leichter zu erkennen ist. Wahrscheinlich kauert dort nur jemand unter einer abgewetzten Thermodecke.
Ich nähere mich ihm und beschreibe mit meiner toten Schwester hüpfend einen verrückten Zickzackkurs. Die Gelenke jammern und mein Rucksack reibt sich unterwegs quietschend an dem Gestell. Der anvisierte Ghost sieht mich kommen. Vielleicht verfällt er in Panik. Vielleicht ist er einfach nur übermütig. Er lässt seine Thermotarnung fallen und zeigt sich. Ich bin gerade mal dreiundzwanzig, aber in dem grünen Schimmer der Nachtsicht sieht er für mich wie ein schlaksiger Teenager aus, während er sein Sturmgewehr in Anschlag bringt und anfängt, auf mich zu feuern.
Ich bewege mich schnell. Seine ersten Kugeln kommen nicht einmal in meine Nähe, doch er korrigiert den Zielwinkel und die Lücke wird kleiner, während ich zurückschieße. Ich ziele aus der Hüfte heraus und benutze Kimme und Korn meines Visiers für die richtige Schusslinie. Der Abzug unter meinem Finger senkt sich, als meine KI übernimmt. Ein einziger Schuss, der Junge fliegt rückwärts und dreht sich halb um die eigene Achse, bevor er auf dem Pfad hinter sich aufschlägt.
»Volltreffer!«, bellt Ransom über gen-com.
»Erst sichern«, warne ich ihn.
»Keine Sorge, LT, da oben ist keiner mehr übrig.«
»Ich komme ran«, sagt Jaynie.
Ich sehe sie auf meiner Karte. »Alles klar.«
Sie kommt aus dem hohen Gras und zielt mit ihrer Waffe auf den Körper des Jungen, der mit dem Gesicht nach unten daliegt. Sein Hinterkopf ist weggeblasen.
»Lebenszeichen?«, fragte ich.
»Nein. Der ist tot.«
Sie geht neben der Leiche in die Hocke und benutzt ihren Arm, um ihn herum zu hebeln. Genau zwischen seinen Augen ist ein Einschussloch. »Scheiße, ist Ihre KI gut.«
Ich kann es nicht unmittelbar spüren, aber ich weiß, dass meine Schädelkappe arbeitet und mein Gehirn dazu veranlasst, einen beruhigenden kleinen Cocktail auszuschütten; eine Mischung aus Chemikalien, die natürlicherweise im Gehirn vorkommen und die eine gewisse emotionale Distanz zwischen mir und dem gerade Erlebten schaffen.
Ich sauge aufbereitetes Wasser durch eine kleine Röhre, die an einer Blase in meinem Rucksack angebracht ist. Jaynie durchsucht die Leiche. Wir sind ganz besonders an schriftlichen Befehlen und Datensticks interessiert. Weiter oben durchsucht Ransom die beiden, die er getötet hat. Ich beobachte die Bilder seiner Helmkamera. Beide sind noch Kinder; nur einer hat einen Thermoanzug. Solche Ausrüstungsstücke wollen wir nicht herumliegen lassen, also schicke ich Dubey, damit er dabei hilft, den Anzug und die Waffen einzusammeln.
Jungs wie diese kämpfen nicht für Ahab Matugo. Er ist ein moderner, weltlicher Anführer und dafür hassen sie ihn. Natürlich hassen sie uns auch. Und sie hassen die Leute dieses Distrikts, denn die haben sich mit uns arrangiert. Sie wurden mit Hass indoktriniert und es würde mich nicht überraschen, wenn ein Sicherheitsunternehmen dahintersteckt und das vorantreibt und finanziert, damit Soldaten wie wir etwas zu tun haben. Es gibt Gerüchte, dass der Geheimdienst ähnliche Machenschaften in Bolivien aufgedeckt hat. Doch die Untersuchung wurde unter den Teppich gekehrt, um den guten Namen der Firmen zu bewahren.
Ich rufe Yafiah. Wir pfeifen nach den Hunden und suchen gemeinsam den Hügel ab, um sicherzugehen, dass sich hier niemand mehr versteckt hält.
Nachdem wir die erbeuteten Waffen unter uns aufgeteilt haben, gehen wir weiter und setzen die vorgeschriebene Route fort. Nur ein paar Minuten später fängt der Engel wieder ein Lebenszeichen auf. Dieses Mal fährt jemand auf einem Moped und versucht nicht, sich zu verstecken, also bekommen wir schnell eine ID.
»Jalal der Totengräber«, sagt Delphi.
»Haben Sie ihn gerufen?«
»Ich sehe nach … Nein. Keine Benachrichtigung. Er kommt auf eigene Faust.«
»Der soll seine Fäuste für sich behalten.«
Jalal ist ein ortsansässiger Dienstleister. Die Army bezahlt ihn dafür, sich um die Leichen der Gegner zu kümmern, aber er wird eigentlich erst dann benachrichtigt, wenn wir nicht mehr in der Nähe sind.
»Delphi, woher weiß Jalal, dass nicht wir tot auf dem Boden liegen?«
»Er kennt Ihren Ruf, Shelley. Aber Sie haben die Genehmigung, vor Ort eine Befragung durchzuführen.«
Ich habe eine Idee und schalte auf gen-com um. »An meiner Position sammeln. Die Hunde auf dem Weg hierher anleinen.«
Ich kann das Heulen seines Mopeds bereits hören. Vielleicht folgt er dem Geruch von Schießpulver, oder vielleicht hat er aus unserer Schussrichtung geschlossen, dass der Hügel der wahrscheinlichste Ort für einen Kampf war.
Wir hocken uns im Abstand von acht Metern ins Gras, damit man uns nicht sieht – denn ich möchte nicht zu spät herausfinden, dass Jalal die Seiten gewechselt hat. Die Hunde liegen still. Sie sind uns treu ergeben. Sie wissen, von wem sie ihre nächste Mahlzeit bekommen.
Ich beobachte aus der Engelperspektive, wie das Moped sich nähert. Jalal fährt im Schutz der Dunkelheit. Ohne Licht windet er sich durch die Bäume, umfährt die Büsche und fährt, so schnell das Moped es zulässt. Ich kann keine Waffen bei ihm erkennen. Der Engel zeigt ebenfalls keine an, aber er hat einen Rucksack.
Ich schleiche mich zwischen den Bäumen entlang und bringe mich in Stellung, um ihn abzufangen.
Das Knirschen der Reifen ist lauter als der Elektromotor. Als er fast auf meiner Höhe ist, trete ich hinaus ins Freie. Meine HITR zielt auf sein Gesicht.
Er erschreckt sich so sehr, dass er das Vorderrad des Mopeds verreißt. Das Kleinkraftrad schlittert und überschlägt sich beinahe. »Shelley! Gott verdammt!«
Jalals Augen sind durch den schmalen, glänzenden Reif seines Sichtgeräts verdeckt. Dieses dürfte nachtsichtfähig sein, also überrascht es mich nicht, dass er mich im Dunkeln sehen kann. Aber er kann nicht durch mein Visier sehen – also woher zum Teufel weiß er, dass ich es bin?
Scheiße. Ich wette, er hat seine eigenen Größen- und Gewichtsprofile.
Ich sage: »Du bist aber schnell hier.«
Er antwortet im Dialekt der Einheimischen, den mein Helm auf seine eigene, kreative Weise übersetzt. »Ich will zur Stadt. Bin vor Sonnenaufgang los. Muss Arbeit schnellstens erledigen. Stimmt’s?«
Ich beäuge seinen Rucksack. Darin könnten sich Granaten oder Sprengstoff befinden. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass er Leichentücher darin hat.
»Du kannst nicht drei Leichen auf dem Moped transportieren.«
Er blinzelt. Dann runzelt er die Stirn. »Drei?« »Drei.«
»Also gut. Wird ’ne lange Nacht für mich.«
»Delphi, schicken Sie ihm die Karte.«
Auf dem Display seines Sichtgeräts flimmert es, als die Daten hereinkommen.
»Danke, Shelley.«
Er versucht, das Moped wieder anzulassen, aber ich drücke die Fußplatte meiner toten Schwester gegen sein Vorderrad. »Sag mir, was los ist. Was hast du gehört?«
Die Oberflächentemperatur seiner Wangen und Stirn macht einen kleinen Sprung nach oben. Er sieht sich um und versucht, die Position meiner Soldaten herauszufinden, aber er kann sie nicht sehen. Als er wieder spricht, flüstert er nur noch. Mein Helm verstärkt die Lautstärke aber, sodass ich ihn gut verstehen kann. »Shelley, mein Onkel hat meine Mama angerufen. Er sagte, zwölf Soldaten aus Norden kommen wahrscheinlich nächste oder übernächste Nacht. Hat sie auf Nachbarfarm gesehen. Kennt ihre Namen nicht.«
»Norden?«
»Ja. Norden. Mehr weiß ich nicht.«
Zwölf. Kein Wunder, dass Jalal hier draußen ist. Er ist kein Dummkopf. Er wird die Leichen eintüten, sie hereinbringen, lange vor Sonnenaufgang beerdigen und der Army die Rechnung präsentieren. Dann wird er zusehen, dass er schleunigst hier herauskommt, denn sollte an dem Gerücht etwas dran sein, stehen die Chancen gut, dass die Aufständischen ihn als Kollaborateur aufs Korn nehmen werden, wenn sie hier durchkommen.
»Arbeite schnell«, rate ich ihm, nehme meinen Fuß vom Reifen und gehe zurück, um den Weg frei zu machen.
»Das mache ich, Shelley. Danke.«
Während er davonfährt, stelle ich mir vor, wie der Geheimdienst in hektische Betriebsamkeit verfallen ist, um ein Dutzend versprengter Soldaten nördlich unseres Bezirks aufzuspüren.
Bis sie etwas finden, ist das nicht mein Problem.
Delphi sagt: »Klar zum Weitermachen.«
Meine Leute tauchen wieder auf. Wir lassen die Hunde von ihren Leinen und machen uns auf den Weg. Niemand versucht mehr, uns zu töten.
Wir kehren wieder zurück ins Fort, als die letzten Sterne an einem samtblauen Himmel verblassen. Das Fort entdeckt uns, erkennt uns und öffnet das Tor, als wir näher kommen. Die Hunde laufen zum Wasser und trinken.
Ich bin müde. Wir sind alle müde, aber niemand spricht darüber. Wir säubern die toten Schwestern und unsere Waffen, dann schließen wir sie an den Steckerleisten im Schlafsaal an. Wir füllen die Blasen in unseren Rucksäcken mit angereichertem Wasser auf, damit sie fertig sind, wenn wir wieder losgehen. Auf dem Dorffriedhof wird die Sonne über den Gräbern von drei Burschen, die auf dem Papier jünger waren als ich, aufgehen. Ich versuche, so etwas wie Schuld, Bedauern oder Reue zu empfinden … aber da ist nichts. Die Leitung sorgt dafür.
Wenn Roboter billiger wären, müssten wir nicht hier sein.
Es gibt nur zwei Duschkabinen und zwei Toiletten. Meine Hausregel besagt, je weniger man dir bezahlt, desto eher darfst du duschen, also sind Dubey und Yafiah zuerst dran. »Fünf Minuten!«, rufe ich ihnen vom Flur her zu.
Yafiah brüllt irgendetwas zurück. Ihre Stimme ist gedämpft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht »Jawohl, Sir« war.
Ich betrete die Küche, nehme fünf Aluminiumschüsseln und gehe nach draußen.
Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, sodass auf dem Hof nur etwa angenehme zweiunddreißig Grad herrschen. Ich öffne die Tür und sehe die Hunde, die sich unter ihrem Leinenbaldachin ausgestreckt haben. Sobald sie mich sehen, springen sie auf und umschwärmen mich. Ich mache fünf Dosen Hundefutter auf, fülle die Näpfe und werde zum Gott des Rudels, während ich die tägliche Ration ausgebe. Sie brauchen ungefähr dreißig Sekunden, bis sie aufgefressen haben. Ich lasse mir von meinem Vater etwas gegen Räude schicken sowie Verhütungsmittel und Pillen, um ihre Flöhe und Parasiten abzutöten. Ihr Futter kaufe ich bei einem örtlichen Lieferanten. Das alles lohnt sich.
Ich nehme die Schüsseln wieder mit hinein. Jaynie ist im taktischen Operationszentrum und trägt immer noch ihre schweißgetränkte Hose und das T-Shirt. Sie sieht auf und nickt, als ich vorbeigehe. Es ist Vorschrift, dass das TOZ zu jeder Zeit besetzt ist, wenn wir keine Helme tragen.
Dubey ist schon fertig mit Duschen. Er durchquert vor mir nur mit Shorts und Schädelkappe bekleidet den Flur und verschwindet in seinem Schlafsaal. Ransom hat die leere Duschkabine in Beschlag genommen. Bei Yafiah läuft immer noch Wasser. »Beeil dich, Süße«, rufe ich ihr zu.
»Ich habe immer noch dreißig Sekunden, LT.«
Wahrscheinlich stimmt das. Sie ist bei solchen Sachen ziemlich penibel.
»Wenn Sie rauskommen, lösen Sie den Sergeant ab.«
Ich warte auf ihr missmutiges »Ja, Sir« und bringe dann die Schüsseln in die Küche. Bis ich sie abgespült habe, ist Jaynie unter der Dusche und die zweite Kabine ist frei.
Ich werfe meine Klamotten in die Dampfwaschmaschine zu denen der anderen – alles, bis auf die Schädelkappe – und schalte sie dann ein. Ich trage die Schädelkappe immer noch, als ich die Duschkabine betrete. Ein kurzer Blick über die Abtrennung sagt mir, dass auch Jaynie ihre noch trägt. Gut. Wir müssen die Schädelkappen zwar nur tragen, wenn wir in unseren Vorrichtungen stecken, aber in einem Kampfgebiet dürfen wir sie jederzeit tragen, wenn wir das möchten. Ich persönlich würde einem VKG-Soldaten nicht über den Weg trauen, der das nicht wollen würde.
Die Schädelkappe arbeitet immer, ob die Leitung uns steuert oder nicht. Im Handbuch steht, dass die von ihr ausgehende Gehirnstimulation nicht süchtig macht, aber ich glaube, das Handbuch muss mal überarbeitet werden. Ich nehme meine Schädelkappe nur die neunzig Sekunden lang unter der Dusche ab, wenn ich meine Kopfhaut mit einem Enthaarungsmittel bearbeite.
Ich lasse das mehrfach aufbereitete Wasser fast eine Minute lang auf mich niederprasseln und bereite mich auf den Moment vor. Dann atme ich tief ein und nehme die Schädelkappe ab.
Ich beginne, die Sekunden zu zählen, um mich abzulenken, während ich sie im Duschregen abspüle. Sie besteht aus einem seidigen Stoff mit einem eingewebten Geflecht aus Mikrodrähten und sieht wie die Kappe eines Athleten aus – sie bedeckt alles von der Stirn bis zum Nacken, lässt aber die Ohren frei.
Als ich bis zwanzig gezählt habe, hänge ich sie an einen Haken.
Ich glaube, ich mache mich selbst verrückt. Es ergibt keinen Sinn, dass meine Stimmung innerhalb weniger Sekunden so sehr abfallen kann … aber sie tut es dennoch. Ich hole mir eine Portion des Enthaarungsmittels aus dem Spender und in meiner Brust keimt eine hohle, schwarze, panische Verzweiflung auf.
Ich verreibe das Enthaarungsmittel auf meinem Kopf und in meinem Gesicht, wo ein Bart wachsen würde, wenn ich das zuließe, und konzentriere mich auf das Zählen, während heißes Wasser über meine Schultern rinnt. Ich zähle, damit ich nicht denken muss. Bei siebzig halte ich meinen Kopf unter den Strahl und bei neunzig setze ich die Kappe wieder auf. Dabei drücke ich sie fest auf meine haarlose Kopfhaut.
Jetzt bin ich für die nächsten vierundzwanzig Stunden sicher.
Ich hasste es, die Kappe während meiner VKG-Grundausbildung tragen zu müssen. Ich fühlte mich, als sähe ständig jemand in meinen Kopf hinein, doch inzwischen ist es mir egal. Ich habe nichts mehr zu verbergen.
Jaynie zieht sich an, als ich aus der Dusche komme. Ich mustere sie. Sie ist ungefähr eins siebzig groß, schlank und hat kleine, hübsche Brüste, die sie bereits unter ihrem T-Shirt verborgen hat. Ihre Haut ist dunkel, aber nicht so dunkel wie die von Yafiah. Meine ist braun. Dubey und Ransom sind die Bleichgesichter hier.
Jaynie sieht hoch, bemerkt mein Interesse und lacht. »Das vergeht bald wieder«, sagt sie und zieht ihre saubere Hose an.
»Scheiße. Tut mir leid. Sie wissen ja, wie es ist. Der erste Tag ist immer komisch.«
»Kenn ich«, stimmt sie zu und knöpft ihre Hose zu.
Ich wende mich ab, bevor ich mich noch tiefer reinreite – aber ihr Bild bleibt mir im Kopf.
Lust ist nichts anderes als Chemie im Gehirn, aber das gilt auch dafür, wie man gegenüber seinen Geschwistern empfindet. Du liebst sie, du würdest für sie sterben, aber wenn du nicht gerade ein perverses Schwein bist, ist das Letzte, was du willst, mit deinen Geschwistern Sex zu haben. Die Ursache dafür ist Ekel vor Inzest und obwohl es in keinem Handbuch erwähnt wird, weiß jeder VKG-Soldat, dass die Führung einen Weg gefunden hat, wie man dieses Gefühl in unseren Köpfen reproduzieren kann. Es dauert vielleicht einen Tag oder zwei, bis es sich voll entfaltet, aber es geschieht ohne Fehl. Wir leben nicht mit anderen Männern und Frauen zusammen, sondern mit Brüdern und Schwestern. Ich bin zwar ein Einzelkind, aber seit ich in den vernetzten Kampfgruppen bin, weiß ich, was es heißt, Geschwister zu haben. Wir sind eine keusche Truppe.
Ich habe vielleicht drei Stunden geschlafen, als ich höre, wie Jaynie im Flur mit ihrer besten Sergeantstimme brüllt: »Raus aus den Federn, Kinder!« Sie hämmert an meine Tür. »Man hat uns von oben ein neues Spiel verordnet. Es heißt ›Patrouille entlang der Straße‹ und ihr habt zwanzig Minuten bis zum Abmarsch. Also vorwärts!«
Meine Grundausbildung ist noch nicht sehr lange her. Ich bin schon auf den Füßen und halb in meiner Hose, bevor mir einfällt, wer hier in unserem kleinen Fort das Sagen hat. »Was zur Hölle geht hier vor?«
Ich mache die Knöpfe zu und reiße die Tür auf, aber Jaynie ist bereits aus dem Flur verschwunden. Ich höre Ransom und Yafiah im Schlafsaal auf der anderen Seite fluchen. Kein Wort von Dubey, aber ich bin sicher, dass er aufgestanden ist und sich in seine Ausrüstung schwingt.
Das taktische Operationszentrum liegt neben meinem Zimmer. Dort finde ich Jaynie. »Was ist los?«, frage ich und lehne mich an den Türrahmen.
Sie steht vor dem Schreibtisch und beobachtet den großen Monitor, während sie ihre tote Schwester anlegt. »Eine Kolonne von der Firma Vanda-Sheridan wird in ungefähr neunzig Minuten am westlichen Außenbereich unseres Bezirks erwartet. Sie liefern Ausrüstung für den Bau eines neuen Horchpostens östlich von hier. Das Projekt hat Priorität, also müssen wir dafür sorgen, dass die Straße frei ist.«
»Scheißdreck!« Ich stampfe zu dem Schreibtisch, um mir den Befehl anzusehen und ihn zu bestätigen. »Ich hasse Sicherheitsunternehmen. Das sind beschissene Parasiten. Und Vanda-Sheridan ist ein beschissener Moloch. Ich schwöre bei Gott, als ich in Bolivien war, hat ihr ortsansässiger Agent Satellitendaten an den Feind verscherbelt. Vanda-Sheridan, Sergeant, ist ein hervorragendes Beispiel für ein Sicherheitsunternehmen, das beide Seiten gegeneinander ausspielt, um einen Konflikt in die Länge zu ziehen. Und jetzt sind die auch noch hier in Afrika! Immer schön den Profit im Auge.«
»Ja, Sir«, sagt Jaynie. »Noch fünfzehn Minuten, bis wir unterwegs sein müssen, Sir.«
Ich tauche wieder in mein Quartier ab, ziehe meine Stiefel und meine Jacke an und mache mich dann auf in die Küche. Dort stehen Energydrinks für uns auf dem Tisch. Ransom und Dubey haben die erste Runde schon intus. Yafiah ist wohl noch auf dem Klo. Ich nehme mir eine Packung, werfe den Kopf in den Nacken und leere sie in ein paar Zügen aus.
»Jaynie!«, brülle ich den Flur entlang. »Schnüffelt noch jemand draußen herum während unserer Schicht?«
»Nur ein paar Ziegen! Ich schalte das TOZ ab, Sir!«
»Tun Sie das!«
Ich mache meine zweite Packung leer, werfe Yafiah vom Klo, kümmere mich effizient um meine Körperfunktionen und lege dann meine Rüstung an.
Delphi beginnt, mithilfe meines Overlays mit mir zu reden. »Geländefahrzeuge heute, Shelley. Wir haben keine Informationen über die Aufständischen in der Nachbarschaft, aber das Gelände muss trotzdem überprüft werden.«
»Wie immer.«
Ich stampfe in den Schlafsaal, trenne meine tote Schwester von der Steckerleiste und schnalle sie mir um. Obwohl wir die Geländefahrzeuge nehmen, weiß man nie, ob man nicht jemandem hinterherjagen muss. Ransom überprüft meine Gurte. Ich überlasse es ihm, den beiden Privates die Freigabe zu erteilen, hole meine Waffen und meinen Helm, nehme meinen Rucksack und gehe nach draußen.
Jaynie ist bereits im Hof und schiebt die Faltabdeckung des Schuppens, in dem unsere Geländefahrzeuge parken, auf. Ich helfe ihr, die Batterien, Flüssigkeitsstände, Verbindungsmanschetten und Reifenprofile zu überprüfen. »Keine Probleme«, sagte sie und klingt überrascht.
Die Zwanglosigkeit meiner VKG führt bei Frischfleisch gerne zu Verwirrung. Wir schlagen hier zwar nicht die Hacken zusammen und salutieren, aber wenn es drauf ankommt, sind wir zur Stelle und machen alles richtig. »Ich kann dieses Spiel nur dann gewinnen, wenn wir alle lebend daraus hervorgehen«, rufe ich ihr ins Gedächtnis.
»Stimmt.«
Die Geländefahrzeuge sind niedrig und für zwei Insassen ausgelegt. Der Platz für den Schützen befindet sich leicht erhöht hinter dem Fahrer und die Sitze sind speziell dafür gemacht, Soldaten mit ihren Exoskeletten aufzunehmen. Die Fahrzeuge sind nicht unbedingt die schnellsten, aber dort, wo wir unsere Patrouillen absolvieren, haben wir nur wenig Anlass, Rennen zu fahren. Sie sind leise und halten vier Stunden durch, bis die Batterien leer sind und auf ihren fotovoltaischen Matten wieder aufgeladen werden müssen. Der Allradantrieb und die Einzelradaufhängung machen sie beweglich und stabil.
Die Grünschnäbel zanken sich gerne darum, wer fahren darf.
»Ich!«, brüllt Yafiah, während sie mit Waffe und Helm unter dem Arm auf den Hof stürmt. »Ich fahre. Ransom, du bist mein Schütze.«
Er trottet hinter ihr her und sieht verwirrt aus. »Scheiße. Wie kommt es, dass du immer …«
Dubey schiebt sich an ihm vorbei. »Ich will einen fahren.«
Ich bin leicht verblüfft, dass Dubey für sich selbst spricht, und möchte ihn ermutigen. »Gut. Einverstanden. Nehmen Sie sich zwei Hunde und setzen Sie sie auf den Schützensitz. Ich setze mich hinter den Sarge. Helme auf!«
Ich überprüfe meine Verbindungen; ich überprüfe die Verbindungen meiner Gruppe. Dann stehe ich am Tor und halte die drei Hunde zurück, die nicht mit uns kommen können, während die Wagen hinausrollen. Nachdem ich die Hunde sicher eingesperrt habe, klettere ich auf meinen Sitz und wir machen uns auf den Weg.
Die Straße führt einige Kilometer nach Süden, bevor man das Dorf erreicht. Im Dorfzentrum zweigt eine weitere Straße nach Westen ab. Auf der Karte steht, wenn man dieser Straße weit genug folgt, erreicht man eine Stadt. Wir machen gerne Witze darüber, dass wir eines Tages abhauen wollen, um die Stadt zu finden, aber das ist nur ein Spiel. Die Geländewagen würden uns bis zur Abenddämmerung nicht einmal ein Viertel des Weges zurücklegen lassen, also bleiben wir hier, bis die Army beschließt, dass wir woanders hingehen.
Heute müssen wir nur die ersten ungefähr hundert Kilometer der Straße nach Westen abdecken. Bis dahin sollten wir Vanda-Sheridans Konvoi gefunden haben. Danach werden die Lastwagen einfach beschattet, bis sie aus unserem Distrikt verschwunden und nicht länger unsere Sorge sind.
Mit fünfzig Stundenkilometern fahren wir in südlicher Richtung im Zickzack durch das Dorf, um den Schlaglöchern und den schlimmsten Spurrillen auszuweichen. Immerhin ist es nicht so staubig wie in der Trockenzeit. Die Fahrer halten den vorgeschriebenen Abstand von neunzig Metern zwischen den Fahrzeugen ein. Yafiah und Ransom sind vorne, ich und Jaynie hinter ihnen und Dubey mit den beiden Hunden auf dem Schützensitz bildet die Nachhut. Sprengfallen sind hier selten, aber man weiß ja nie.
Ich fahre lieber nicht; einerseits, weil ich es eigentlich gar nicht richtig kann. Ich bin in Manhattan aufgewachsen, wo es keinen Grund gab, zu fahren. Meinen Führerschein habe ich dann in Texas gemacht, weil die Army es so wollte. Aber größtenteils fahre ich nicht, weil ich lieber alles aus der Engelperspektive beobachte, während wir auf der Straße unterwegs sind.
Ich schicke den Engel voraus, um unsere Route abzusuchen, und gebe ihm ein breites Suchmuster vor, um das Terrain beidseits der Straße einzuschließen. Er hat das Dorf bereits hinter sich gelassen. Bald wird er die Grenze seiner Reichweite erreichen – er sollte eigentlich nie weiter als zehn Kilometer von meiner Position entfernt sein –, aber wenn wir am anderen Ende des Dorfs ankommen, holen wir ihn wieder ein.
Vor mir wird Yafiah mit ihrem Geländewagen langsamer, bis sie am Dorfrand nur noch Schrittgeschwindigkeit fährt.
»Visiere auf transparent«, sage ich über das gen-com. Außerhalb des Forts müssen die Helme jederzeit getragen werden. Normalerweise lassen wir die Visiere schwarz, damit der Feind es schwer hat, uns als Einzelpersonen zu identifizieren, und damit wir hinreichend einschüchternd wirken. Doch die Dorfbewohner sind nicht unsere Feinde und meine Soldaten sind keine gesichtslosen Dämonen.
Die ersten Gebäude sind Fertighütten, aber diese haben eine Tendenz, in sich zusammenzufallen, wenn der Harmattan-Wind aus der Sahara herüberweht, also bestehen die meisten Häuser aus hübschen roten Lehmziegeln. Die von Mauern umgebenen Höfe liegen im Schatten der ausladenden Äste und gefiederten Blätter der Niembäume oder dunkler, dichterer Wipfel von Mangobäumen. Ein Telefonmast steht am Rand des Dorfs und Satellitenantennen sprenkeln die Dächer.
Überall sind Ziegen, Hühner und Perlhühner, aber nur wenige Leute sind zu sehen. Es sind meistens Großeltern, die neben den Hofmauern schwatzen. Dann kommen wir an der Schule vorbei. Ein aufgeregter Schrei ist zu hören und ungefähr zwanzig Kinder im Alter von sechs bis sechzehn in bunter Kleidung rennen vom Schulhof herbei. Alle lachen und rufen, weil sie uns nicht oft zu Gesicht bekommen und weil sie Geländewagen cool finden. »Hallo Soldaten. Schön, euch zu sehen. Wo fahrt ihr heute hin? Können wir mitfahren?«
»Auf keinen Fall!«, sagt Yafiah. »Ihr müsst wieder zur Schule zurück!«
Sie rennen trotzdem neben uns her. »Shelley aus Manhattan!«, rufen sie nach mir. »Yafiah aus Kalifornien. Dubey aus Wash-ing-ton. Matthew aus Geor-gi-a!«
Dann begreifen sie, dass sie Jaynie noch nie zuvor gesehen haben. »Wer bist du? Wie heißt du?«
»Das ist Sergeant Jaynie«, erkläre ich ihnen.
»Wo kommst du her, Sergeant Jaynie? Wo kommst du her?«
Ich kann ihr Gesicht nicht sehen, aber ich höre das Grinsen in ihrer Stimme. »Detroit«, sagt sie. »Kansas City, Chicago, Philadelphia und zu viele andere Orte, als dass ich mich daran erinnern könnte.« Und dann sagt sie leise, damit die Kinder sie nicht hören können, aber mein Helm fängt es auf: »Dieser Ort ist das Paradies im Vergleich zu den Drecklöchern, in denen ich gehaust habe.«
Die Kinder plappern weiter, bis wir die Straße nach Westen erreichen, dann winken wir ihnen zum Abschied zu. Ich habe meine Zweifel, ob sie wieder in ihre Klassen gehen werden, aber das ist nicht meine Sorge.
Die Straße nach Westen ist asphaltiert. Sobald wir das Dorf hinter uns gelassen haben, beschleunigt Yafiah. Jaynie wartet den vorgeschriebenen Abstand ab und wird dann ebenfalls schneller. Wir donnern am Dorffriedhof vorbei und ich sehe die neuen Gräber im hinteren Bereich. Jalal leistet gute Arbeit und verdient das Geld, das wir ihm bezahlen.
Danach fahren wir an weiteren Hirsefeldern vorbei. Die Halme sind schon zwei Meter hoch und an ihren Spitzen formen sich Rispen mit Körnern. Dann wird das rote Flachland von verstreuten Bäumen und Büschen beherrscht. Bisher war die Regenzeit ergiebig. Alles ist grün und die Bäume sind von hohem Gras umgeben, das nach der Regenzeit vollkommen verschwinden wird. Jetzt gibt es allerdings ausreichend Nahrung für kleine Viehherden. Der Engel bemerkt jedes Tier und markiert dessen Position auf der Karte. Er markiert ebenfalls die Position zweier hochgewachsener Teenagerjungen, die das Vieh hüten. Als wir an ihnen vorbeirasen, winken sie uns mit ihren Rohrstöcken zu und grinsen.
Von meinem Sitz hinten im Geländewagen aus betrachtet, sieht die Vegetation üppig aus, aber sobald ich aus der Engelperspektive hinabschaue, wird ihre geringe Dichte offenbar. Hier kann sich kaum etwas verstecken, was mich glücklich macht. Wenn irgendetwas, das unheilvoller ist als eine herumziehende Kuh, unterwegs ist, würde der Engel das mitbekommen. Aber alles ist in bester Ordnung.
Also warum breitet sich bei mir ein unbehagliches Gefühl wegen dieses ganzen Unterfangens aus?
Wir befinden uns zweiundfünfzig Kilometer hinter dem Dorf und der Engel ist zehn Kilometer vor uns, als er schließlich ein herankommendes Fahrzeug entdeckt. Nur eins, also ist es nicht die Karawane des Unternehmens. Eine Minute später hat der Engel es identifiziert: ein kleiner, weißer Pick-up, der uns wohlbekannt ist. Ich lache.
»Achtung!«, rufe ich durchs gen-com. »Bibata ist unterwegs zur Stadt mit unserem Hundefutter.«
»Wer ist Bibata?«, fragt Jaynie misstrauisch.
»Die Freundin vom LT«, sagt Yafiah.
Ich fühle mich, als sei ich in der Oberschule. »Sie ist nicht meine Freundin.«
»Nur, weil Sie nicht ins Gefängnis wollen.«
»Gefängnis?«, fragte Jaynie ungläubig. »Sie sind nicht wegen eines Gefängnisaufschubs hier?«
Yafiah wieder: »Oh doch, das ist er.«
»Sie sind ein Offizier«, protestiert Jaynie, als ob das bisher noch keiner von uns gewusst hätte.
»Es war ein Verbrechen im Namen der Ehre«, versichere ich ihr.
»Er will uns nicht verraten, was er angestellt hat«, fügt Dubey hinzu und überrascht mich schon wieder, weil er an einer Unterhaltung teilnimmt.
»Hat es sich wenigstens gelohnt?«, fragt Jaynie.
Über die Frage will ich nicht nachdenken, und außerdem kommt Bibatas weißer Pick-up schnell auf uns zu. Jaynie steuert uns an den Straßenrand. Ich lehne mich hinaus und winke mit meinem Arm, in der Hoffnung, dass sie stehen bleibt. Zunächst sieht es nicht so aus, doch dann tritt sie hart auf die Bremse und bringt den Transporter neben mir zum Halten. Ich springe vom Schützensitz hinunter. Wir nähern uns Bibatas Pick-up aus entgegengesetzten Richtungen und werfen beide verstohlene Blicke auf die Ladung, die über das Kabinendach hinausragt und unter einer blauen Plane versteckt ist. Darunter könnte alles sein.
Ich flüstere Dubey zu, er solle die Hunde holen. Dann stelle ich mein Visier auf transparent und schlendere mit meinem Gewehr in der Armbeuge auf das Fahrerfenster zu. Die Scheibe fährt hinunter. Ich spüre die heilige, gesegnete Kühle einer Klimaanlage durch den dünnen Stoff meiner Handschuhe hindurch. Aber noch besser als das ist das kokette Lächeln, das Bibata mir schenkt. Sie ist ganz bestimmt nicht meine Schwester.
»Ah, Shelley, mein Lieber. Bist du unterwegs, um mich zu besuchen? Und war das hier der beste Treffpunkt, der dir eingefallen ist? Ich hätte Besseres von dir erwartet!«
Vielleicht ein Viertel meiner Vorfahren stammt aus Afrika und hat sich mit europäischen Linien und den Ureinwohnern Mexikos vermischt. Bibata lässt mich an reine und uralte Blutlinien denken. Ihre Haut ist tiefschwarz – noch dunkler als die Yafiahs – und ihr Gesicht ist stark und wunderschön mit hoher Stirn, kokett leuchtenden, dunklen Augen und Lippen, die mühelos zwischen einem spöttischen Lächeln und einer Drohung umschalten. Zwischen uns läuft nichts, außer, dass ich sie bewundere und ihr das gefällt – doch heute habe ich das Gefühl, dass sie nicht recht bei der Sache ist. Ihr Lächeln scheint Furcht zu überdecken, vielleicht sogar Zorn. Dubey hat die Hunde von der Leine gelassen. Sie wirft ihnen einen Blick zu, während sie auf den Transporter zurennen.
»Alles okay, Süße?«, frage ich sie.
Ich entdecke in der Lücke zwischen Fahrer- und Beifahrersitz eine Pistole, doch das kümmert mich nicht, weil sie diese immer dort aufbewahrt. Ransom scannt die Fahrerkabine von der anderen Seite her, während sie mir ungeduldig antwortet. »Natürlich ist alles okay! Bei mir ist immer alles okay. Ich bin schon seit Anbeginn der Welt okay.« Sie senkt ihre Stimme etwas und schlägt einen flirtenden Tonfall an. »Obwohl es mir wahrscheinlich noch besser gehen würde, wenn du irgendwann am Abend bei mir mitfahren würdest. Was meinst du, Shelley? Soll ich dich heute Abend abholen kommen?«
Ich grinse sie breit an. »Oh Gott, ja, meine Liebe. Ich werde schon steif, wenn ich nur an den Anblick denke, wie sich die Nacht um dein hübsches Gesicht legt. Aber Mama beobachtet mich. Sie wird mich nicht gehen lassen.«
Bibata macht einen Schmollmund. Die Hunde sind hinten um den Pick-up gelaufen und schnüffeln an den Reifen. »Oh, du Armer. Du musst dich befreien und nicht länger ein Sklave von Mamas hässlichen alten Bräuchen sein.«
»Eines Tages«, verspreche ich ihr.
Sie wendet sich ab und starrt auf ihre perfekt manikürten Hände, die das Lenkrad umklammern. Leise sagt sie: »Ich komme morgen und bringe dir dein Hundefutter.«
Ihr ruhiger Tonfall sagt mir, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Ich stelle mir vor, dass Aufständische sich unter der Plane verstecken, aber die Hunde hätten angezeigt, wenn dort etwas wäre. Also beuge ich mich hinab, bis ich fast durch das Fenster in den Innenraum rage. »Sag mir, was los ist, Bibata.«
Sie schüttelt den Kopf. »Nichts. Noch nicht. Aber der Krieg kommt näher, nicht wahr? Es sind nicht nur ein paar dumme kleine Jungs aus dem Norden, die herkommen, um Ärger zu machen.«
»Doch, mehr ist da nicht. Ahab Matugo wird nicht hierherkommen.«
»Ahab Matugo ist ein moderner Mann. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn er es täte!«
Ich zucke mit den Schultern. »Na, ich weiß nicht. Vielleicht.«
Sie nickt, ohne mich anzusehen. »Ich komme morgen vorbei.« Dann legt sie den Gang des Transporters ein, winkt mir zu und fährt davon. Das Fenster schließt sich wieder, während der Pick-up sich in Bewegung setzt. Ich bleibe zurück und starre auf die schwarze Maske von Ransoms Visier.
»Ich glaube, sie hatte nur Lebensmittel«, sagt er.
Der Engel schaltet mein Visier wieder schwarz, während ich nach Westen die Straße entlangstarre – in die Richtung, aus der Bibata gekommen ist, die Richtung der entfernten Stadt. Dann sehe ich wieder durch die Augen des Engels, doch da draußen auf dem flachen, heißen, ausgelaugten Land befindet sich nichts weiter als Bäume, Büsche und Vieh.
»Dubey, ruf die Hunde her!«
Er pfeift sie an seine Seite. Ransom und ich kehren auf unsere Schützensitze zurück. Jaynie fängt an, mich zu verhören, aber ich winke ab und wende mich stattdessen an die Gruppe. »Irgendetwas geht hier vor. Ich weiß nicht, was, aber ich habe so ein Gefühl. Wachsam bleiben.«
Zwanzig Minuten später teilt Delphi mir mit, dass der Konvoi sich verspätet. »Die haben Probleme mit einem der Lastwagen. Wird wohl ein paar Stunden dauern, ihn zu reparieren.«
Ich habe das Gefühl, als kratze ein Dämon an der Innenseite meines Schädels. »Was glauben Sie, was wirklich dahintersteckt?«, frage ich sie.
»Die Kommandozentrale möchte, dass Sie diese Frage beantworten. Sie sollen sich weiter nach Westen begeben, bis Sie auf den Konvoi treffen, aber Sie sollen sich vorsichtig nähern. Sondieren Sie erst die Lage, bevor Sie Ihre Anwesenheit kundtun.«
Das stellt uns vor ein Problem, denn die Geländewagen halten nur ein paar Stunden durch, bevor die Batterien leer sind. Wir müssen noch mindestens eine Stunde fahren, um den Konvoi zu finden, und damit wären die Batterien dann nur noch weniger als halb voll. Wir haben zwar fotovoltaische Matten, die wir zum Wiederaufladen verwenden können, aber die Vorschriften besagen, dass wir zu jeder Zeit ausreichend Energie haben müssen, um ins Fort zurückkehren zu können.
Wie sich herausstellt, ist das Kommando mehr daran interessiert, was die Sicherheitsunternehmen im Schilde führen, als daran, ob wir vor Einbruch der Nacht ins Fort zurückkehren können. »Sie haben die Freigabe, weiterzufahren«, sagt Delphi, als ich meine Besorgnis äußere. »Wenn Sie die FV-Matten vor vierzehnhundert auslegen, sollten Sie eine Teilaufladung erreichen, bevor der nächste Regensturm durchzieht.«
Also folgen wir dem Engel nach Westen.
Wir haben 105 Kilometer auf freiem Gebiet zurückgelegt, als der Engel die Lastwagen von Vanda-Sheridan entdeckt. Sie parken neben der Straße hinter einem Schutzschirm aus Büschen, die in der Regenzeit hoch aufgeschossen sind.
»Sie sagten, es handele sich um zwei Lastwagen, richtig?«, frage ich Delphi.
Ich sehe vier. Zwei haben offene Ladeflächen. Darauf befinden sich Fertigwände, Frachtkisten aus Plastik und einige Antennenabschnitte, wie man sie für den Bau eines neuen Horchpostens braucht. Beide haben das blaue V-S-Logo auf den weißen Türen der Fahrerkabinen. Von den anderen beiden ist einer ein geländefähiger Lastwagen. Der andere ist das, was wir in den Schluchten von Manhattan einen Lieferwagen nennen würden. Die umschlossene Ladefläche wird von einer Klimaanlage gekühlt, die auf dem Kabinendach montiert ist. Statt einer Rolltür hinten gibt es eine große Tür wie von einem begehbaren Kühlschrank mit einem großen Schnappverschluss.
Delphi sagt: »Der Geheimdienst ordnet das hier mit siebzigprozentiger Sicherheit als eine Operation der Aufständischen ein …«
»Entführung oder Verrat?«
»Sie sollen eine Feindeslage annehmen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Annäherung getarnt und zu Fuß. Identifizieren Sie die Anwesenden und sondieren Sie die Lage, bevor Sie Ihre Anwesenheit kundtun.«
Bibata hat vielleicht recht, was Ahab Matugo angeht; ich weiß, dass ich möglicherweise auf der falschen Seite kämpfe, aber eigentlich habe ich keine Wahl. Außerdem macht es mich fuchsteufelswild, dass eine amerikanische Firma wie Vanda-Sheridan – eine Firma, die sich auf Überwachung spezialisiert hat – eine Korrumpierung in den Reihen ihrer eigenen Angestellten übersehen konnte. Oder schlimmer noch, dass sie diese möglicherweise billigt. »Hat Ahab Matugo angefangen, unsere Lieferanten aufzukaufen?«
Und wenn ja, wie lange kann dieser Krieg dann noch dauern?
»Machen Sie einfach Ihren Job, Shelley«, sagt Delphi.
»Ja, Ma’am.«
Wir bleiben auf der Straße, bis wir nur noch fünfzehnhundert Meter von den Lastwagen entfernt sind. Dann schlagen wir uns in die Büsche und fahren noch einen halben Kilometer weiter. Danach binden wir die Hunde an, schließen die Geländewagen ab und rollen die FV-Matten aus, damit die Batterien sich aufladen können.
Wir gehen zu Fuß weiter.
Der Engel schwebt hoch oben am Himmel und ist im Gleißen der Nachmittagssonne nicht zu sehen, doch er zeigt mir, was ich wissen muss: an dem Schauplatz gibt es nur wenig Aktivität. Ich beobachte, wie ein Mann aus der Fahrerkabine des Geländelastwagens aussteigt, um zu pinkeln. Über seiner Schulter hängt ein Sturmgewehr am Trageriemen. Die meisten Reisenden hier tragen Waffen, aber ein Gewehr zum Pissen nur ein paar Schritte entfernt vom Truck mitzunehmen, erscheint mir etwas übertrieben.
Ich beobachte, wie er wieder in die Fahrerkabine klettert und auf den Beifahrersitz gleitet. Bei ihm ist noch ein zweiter Mann, der hinter dem Lenkrad sitzt. Ich weiß das, weil der Engel seinen Ellenbogen sieht, der aus dem offenen Fenster ragt. Dieser Ellenbogen hat sich seit einigen Minuten nicht bewegt. Da die Nachmittagstemperatur auf 37 Grad angestiegen und die Luft so stickig ist, als wäre kein Sauerstoff mehr darin, komme ich zu dem Schluss, dass der Fahrer höchstwahrscheinlich schläft.