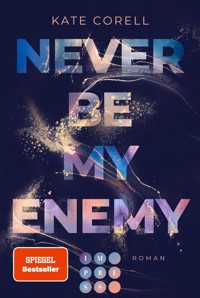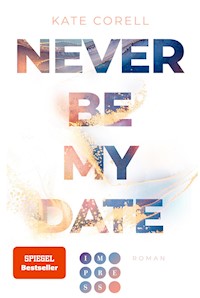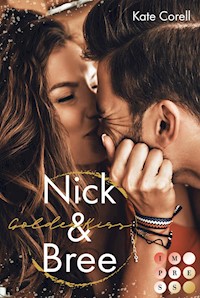9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kämpft um den Erhalt der renommierten Gin Manufaktur ihrer Familie. Er muss heiraten, um an seinen Treuhandfonds zu gelangen. Ein zufälliges Treffen führt zu einem verführerischen Deal. Dynastie-Tochter Demeter Brouwer ist nur knapp einer Tragödie entkommen. Seitdem hat sie sowohl persönlich als auch finanziell mit den schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. Während ihre Brüder das Gin-Geschäft modernisieren, packt sie auf den Feldern mit an. Und trifft dort auf den unverschämt gutaussehenden Riek Clifford. Der Bankierssohn adliger Herkunft stellt sich als rechtmäßiger Erbe ihres Familienanwesens heraus und hat bereits Pläne mit dem Besitz. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass Demy ihm die Stirn bietet. Und noch viel weniger damit, was für ein Feuer sie in ihm entfacht. Als sie ihm eine Abmachung vorschlägt, ist Riek mehr als gewillt, auf diese einzugehen. Ein gefährliches Geheimnis. Ein gerissener Deal. Eine Scheinehe, die mehr verspricht als nur finanzielle Sicherheit. »The Secrets We Live« ist eine Enemies To Lovers Romance mit einer gehörigen Portion Spice. Alle Bände der New Adult Romance »Brouwen Dynasty«: The Lies We Hide (Band 1) The Secrets We Live (Band 2) The Rivals We Kiss (Band 3) Die drei Bände sind keine Standalones und bauen aufeinander auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ImpressDie Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Kate Corell
The Secrets We Live (Brouwen Dynasty 2)
Sie kämpft um den Erhalt der renommierten Gin Manufaktur ihrer Familie. Er muss heiraten, um an seinen Treuhandfonds zu gelangen. Ein zufälliges Treffen führt zu einem ungewöhnlichen Deal.
Dynastie-Tochter Demeter Brouwer ist nur knapp einer Tragödie entkommen. Seitdem hat sie sowohl persönlich als auch finanziell mit den schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. Während ihre Brüder das Gin-Geschäft modernisieren, packt sie auf den Feldern mit an. Und trifft dort auf den unverschämt gutaussehenden Riek Clifford. Der Bankierssohn adliger Herkunft stellt sich als rechtmäßiger Erbe ihres Familienanwesens heraus und hat bereits Pläne mit dem Besitz. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass Demy ihm die Stirn bietet. Und noch viel weniger damit, was für ein Feuer sie in ihm entfacht. Als sie ihm eine Abmachung vorschlägt, ist Riek mehr als gewillt, auf diese einzugehen.
Ein gefährliches Geheimnis. Ein gerissener Deal. Eine Scheinehe, die mehr verspricht als nur finanzielle Sicherheit. »The Secrets We Live« ist eine Marriage of Convenience Romance mit einer gehörigen Portion Spice. Die Enemies To Lovers-Liebesgeschichte zwischen Riek und Demy ist kein Standalone und der zweite Band der Brouwen Dynasty-Trilogie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Kate Corell.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Cocktailkarte
Triggerwarnung
© privat
Kate Corell liebt Charaktere mit Ecken und Kanten, unvorhergesehene Plottwists und das Umgehen literarischer Regeln. Wenn sie nicht gerade am nächsten Roman schreibt, besucht sie Konzerte, reist durch die Welt oder genießt gutes Essen. Sie lebt mit ihrer Familie sowie zwei verrückten Bulldoggen in der Nähe von Leipzig. Ihre »Never Be«-Romance-Serie machte sie zur SPIEGEL-Bestseller-Autorin.
Der Narr tanzt durch die Zeilen.
Sein Lachen scharf und kalt wie zerbrochenes Glas.
Die Worte malen ein Märchen, in dem das Licht der Unschuld verlischt, bevor es zu leuchten begann.
JUNIPER
Wacholder ist der Hauptbestandteil eines jeden Gins.
DEMETER
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Ich brauche mehrere Versuche, um die Augen zu öffnen. Das grelle Licht zwingt mich dazu, sie sofort wieder zu schließen. Mein Hals fühlt sich wund an.
»Hey, Tausendschön«, höre ich meinen Bruder sagen. Aber es ist nicht Leens Stimme. Es ist die von Baas.
Ich zwinge meine Lider erneut auseinander, um sicherzugehen, dass ich mir seine Anwesenheit nicht nur einbilde. Nein, er sitzt tatsächlich auf einem Stuhl neben meinem Bett. In dem Moment kehrt die Erinnerung daran zurück, wie ich hier gelandet bin.
»Das Feuer … Ezra …«, presse ich mit kratziger Stimme hervor und muss husten, wodurch der Rest meiner Worte unausgesprochen bleibt.
Baas steht auf, nimmt ein Glas vom Nachtschrank und reicht es mir. »Du musst dich ausruhen«, sagt er ebenso sanft wie fordernd.
Wochenlang höre ich nichts von ihm und jetzt taucht er einfach so hier auf. So war das nicht abgemacht. Er hat versprochen anzurufen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Er hat gesagt, es kommt alles wieder in Ordnung. Nichts ist in Ordnung.
»Du hast mich im Stich gelassen«, zische ich und huste erneut. Es hat ein Feuer gebraucht, damit er den Weg zu mir zurückfindet. Enttäuschung und Wut machen sich in mir breit.
»Ich weiß.«
Zwei Worte. Kein Es tut mir leid. Würde ich ihn nach dem Grund fragen, bekäme ich keine Reaktion. In seinen tiefbraunen Augen sehe ich, dass er nicht hier ist, um meine Fragen zu beantworten.
Und wenn er an Leens Stelle gekommen ist, bedeutet das …
Die Tür wird aufgerissen und Kommissarin Diamantis kommt herein. »Bastiaan Brouwer, Sie sind vorläufig festgenommen wegen dringenden Tatverdachts, Piet Brouwer getötet zu haben.«
Baas wehrt sich nicht einmal, als ihm Handschellen angelegt werden.
»Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten –«
»Leen, ruf Wolters an«, sagt Baas seelenruhig zu unserem Bruder, der gerade mit einem Kaffeebecher in der Hand durch die offene Tür kommt und lediglich perplex zur Seite tritt, während Baas von zwei Beamten abgeführt wird.
»Was ist hier los?«, will ich wissen und setze mich unter höllischen Schmerzen auf. Jeder Atemzug brennt in meiner Brust. Ich blicke zwischen der offenen Tür und Leen hin und her. Mein Bruder kommt mit starrer Miene auf mich zu. Aber nicht nah genug, dass ich die Hand nach ihm ausstrecken kann. Sein Blick ist leer und lässt das Blut in meinen Adern gefrieren, gleichzeitig spüre ich ein brennendes Feuer, das meine Haut quält. Ich sehe an mir herab, schlucke, als ich die weißen Verbände an meinen Unterarmen entdecke. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals, während ich gegen den Drang ankämpfe, das OP-Hemd hochzureißen, um zu sehen, was darunter verborgen liegt. Woher das einschnürende Gefühl um meinen Brustkorb kommt. Weil ich nicht vor Augen haben will, wie diese Nacht mich für immer gezeichnet hat. Der Schmerz, der mich zerreißt, ist unerträglich, aber noch quälender ist die Frage, die alles andere übertönt, die mich selbst in den Hintergrund schiebt.
»Was ist hier los, Leen?«, flüstere ich, doch meine Stimme zittert vor Angst.
Leen schluckt sichtlich und stellt den Kaffeebecher auf dem kleinen Tisch unter dem Fenster ab. Das Krankenhauszimmer um uns herum wirkt wie ein unwillkommener Rückzugsort der Erinnerungen. Das letzte Mal bin ich hier gelandet, als ich nach dem Tod unseres Vaters einen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Die Welt hat sich so schnell unter mir geteilt, dass ich ins Bodenlose fiel. Unaufhaltsam. Das Gefühl, in jenen Abgrund zu stürzen, an dessen Rand ich seit diesem Tag balanciere, kehrt in dieser Sekunde zurück.
»Die Ärzte haben alles –«
»Nein«, bringe ich keuchend hervor. Die Realität rieselt zwischen meinen Fingern hindurch, während ich verzweifelt versuche, mich an sie zu klammeren.
Leens Lippen beben, als er meinen Namen flüstert: »Demy … Ezra, er –« Der Satz bleibt unvollendet.
»Nein!« Die Wucht meines Schreis schmerzt in meiner Brust, während Leen stumm Worte formt, die vom Piepen des Monitors verschluckt werden.
Mit zittrigen Händen beginne ich die aufgeklebten Sensoren von meiner Haut zu reißen. »Er ist nicht tot!« Meine Stimme klingt so fremd in meinen Ohren. Das Piepen wird schneller, lauter.
Ich schiebe die Decke beiseite, doch Leen packt mich an den Schultern und zwingt mich beim Versuch aufzustehen zurück ins Bett.
»Das muss ein Irrtum sein«, fauche ich und schlage gleichzeitig seine Hände weg.
»Demy, hör auf damit«, sagt Leen leise, gebrochen.
»Das muss ein Irrtum sein.« Doch das ist es nicht, denn ich kann in Leens Augen sehen, dass er mir die Schuld dafür gibt, dass er seinen besten Freund verloren hat.
»Das ist nicht fair. Er sollte hier liegen, nicht ich«, presse ich hervor. Mit jedem Schluchzen zerreißt meine Seele ein weiteres Stück. Die Tränen, die mir ohne Vorwarnung über die Wangen laufen, sind heiß, brennen wie die Schuld, die tief in meinem Inneren lodert.
»Demy, du musst dich beruhigen«, höre ich meinen Bruder sagen, was alles nur noch viel schlimmer macht, weil ich seine Zerrissenheit heraushören kann. Sie schneidet wie eine Messerklinge in mein Herz, verhindert, dass es schlägt.
»Das ist alles meine Schuld«, stoße ich immer wieder aus. Als würde das ständige Wiederholen irgendetwas ändern.
»Es war ein Unglück, niemand –«
»Hör auf!«, schreie ich. Leen will mich schützen, aber das kann er nicht. Niemand kann das. »Ezra ist tot, weil ich zu schwach bin, um mich selbst zu retten.«
»Du weißt, dass das nicht stimmt.«
»Doch!«, brülle ich, und es ist, als würde mein Innerstes nun vollständig aufreißen. Wir wissen beide, dass es so ist. So war es schon immer. Ich bin das schwache Ding, das beschützt werden muss. Von Leen, von Baas … von Ezra. Keiner von ihnen hat je gefragt, keiner hat je gezögert. Sie haben es einfach getan. Leen ist zurückgekommen, meinetwegen. Baas hat sein Leben weggeworfen, meinetwegen. Ezra hat seins verloren, meinetwegen. Wie sieht mein Opfer im Gegenzug aus?
Für den Rest meines Lebens in Schuldgefühlen zu ertrinken, weil ohne mich nichts von alledem geschehen wäre. Das wäre nur fair.
Mein Herz zieht sich so schnell zusammen, dass ich kaum noch atmen kann. Der Nebel in meinem Kopf wird immer dichter, der Druck auf meiner Brust unerträglich. Meine Atmung wird hektisch, flach. Alles verschwimmt vor meinen Augen. Der Schmerz auf meiner Haut ist nichts gegen den, der mein Herz übermannt, als es in eine Million Scherben zerspringt. Und auf jeder einzelnen steht dasselbe Wort: Schuld. Es hallt wie ein endloses Echo in den Stimmen aller, die ich je geliebt habe, in meinem Kopf wider. Es schwingt in den ernsten Worten meiner Mutter mit, den schweigsamen Blicken meines Vaters, in den enttäuschten Seufzern meiner Brüder. Und schließlich höre ich es auch von Ezra – leise, kaum mehr als ein Flüstern, aber unüberhörbar.
»Demy.« Leen schließt mich in seine Arme, hält mich fest, als könnte er damit verhindern, dass ich zerbreche. Jede Träne fühlt sich an, als würde sie mir einen Atemzug rauben. Nein, als würde sie den letzten Sauerstoff aus meinen Lungen herauspressen. Weil ich es nicht verdiene weiterzuatmen, wenn alle anderen es doch auch nicht können. Ich bringe den Tod. Erst meine Mutter, dann mein Vater und jetzt Ezra.
Entschlossen stoße ich Leen von mir. »Geh!« Meine Stimme bricht unter dem Gewicht des Wortes.
»Nein, das werde ich nicht.«
»Ich habe gesagt, du sollst verschwinden!« Er muss sich von mir fernhalten, sonst ist er möglicherweise der Nächste. Baas wurde gerade von der Polizei mitgenommen. Er muss doch sehen, dass ich der Quell des Übels bin, das über unsere Familie hereingebrochen ist.
Leen sieht mich an, und in seinem Blick liegt etwas, das ich nicht ertragen kann. Enttäuschung, weil ich gerade die Kontrolle verliere, obwohl es doch das ist, was man uns beigebracht hat.
»Was ist denn hier los?« Eine Schwester kommt ins Zimmer gestürmt. »Sie gehen jetzt besser, Ihre Schwester braucht Ruhe«, sagt sie an Leen gewandt, der mich ansieht, als wäre ich nicht Herrin meiner Sinne.
Die Schwester tritt neben das Bett und blickt mich mitleidig an. Ich hasse es, dass sie mich so ansieht. »Sie legen sich jetzt wieder hin. Ich besorge Ihnen etwas gegen die Schmerzen und dann ruhen Sie –«
»Ich will keine Medikamente, ich will hier raus!«, unterbreche ich sie energisch, woraufhin sie sich zu einem verständnisvollen Lächeln durchringt, obwohl sie höchstwahrscheinlich einfach nur von meinem zickigen Verhalten genervt ist. Zu Recht. Sie kann weder etwas dafür, dass ich hier gelandet bin, noch für dieses erdrückende Gefühl, das mich erstickt.
»Sie sind hier in den besten Händen«, versichert sie. Es klingt so verdammt einstudiert, dennoch lasse ich mich zurück auf das Bett sinken. Niemand wird mich gehen lassen. Die Entscheidung treffe nicht ich. Habe ich noch nie. Es gab eben schon immer jemanden, der wusste, was gut für mich ist. Es schickt sich nicht zu widersprechen. Niemand mag aufmüpfige Gören. Lächle. Schweig. Sei ein braves Mädchen und tu, was man von dir verlangt. Worte, die mein ganzes Leben bestimmt haben.
Ich schaue zu Leen. Er lächelt nicht. Der Ausdruck auf seinem Gesicht ist streng, missbilligend und erhaben. In diesem Augenblick ähnelt er unserem Vater viel zu sehr, und ich frage mich, ob seine Rückkehr der größte Fehler war, den mein Bruder hätte begehen können. Leen war frei. Wir alle haben geglaubt, Baas würde nach dem Tod unseres Vaters zum neuen Oberhaupt der Brouwers werden, doch es ist Leen, der dieses Erbe nun auf seinen Schultern trägt. Ein simples Stück Papier hat sein Schicksal besiegelt, und sein Pflichtgefühl zwingt ihn dazu, es zu akzeptieren. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass mein kleiner Bruder nun in dem Käfig sitzt, dem ich selbst nie entkommen bin. Der Preis, den nun jeder Einzelne von uns dafür bezahlt, könnte nicht höher sein.
Keiner von uns wird jemals frei sein. Der Name Brouwer haftet an uns wie ein Etikett und mit ihm all seine dunklen Abgründe.
CARDAMOM
Kardamom fügt ein würzig-warmes, leicht süßliches Aroma hinzu.
DEMETER
Clifford Bankfiliaal, Oude Noorden, Rotterdam
DREI WOCHEN SPÄTER …
Geduld ist eine Tugend.
Wenn dem so ist, bin ich das Gegenteil von tugendhaft. Was sich deutlich darin zeigt, dass meine Fußspitze immer wieder in einem kaum hörbaren dumpfen Ton rhythmisch auf den Fliesenboden trifft. Und doch bin ich froh, dass seit wenigen Augenblicken die Zeit stillsteht.
Das Pärchen vor mir konzentriert sich seit mehreren Minuten auf seine Abendplanung, anstatt den Geldautomaten zu bedienen. Früher hätte mich einzig und allein die Tatsache, ein höflicher Mensch zu sein, davon abgehalten, ihnen einen dezenten Hinweis zu geben. Aber gerade genieße ich es, ein Teil des Treibens um mich herum zu sein.
Bloem war noch nie so einsam. Die Stille wird mit jedem Tag unerträglicher. Es fühlt sich an, als würde der Ort, der von jeher meine Zuflucht war, sich in nichts auflösen und mich vertreiben. Und ich lasse es zu. Jeden Tag ein bisschen mehr. Bloems Glanz verblasst und ich mit ihm. Ich entdecke es jeden Morgen, sobald ich in den Spiegel sehe. Das Strahlen in meinen Augen. Das Lächeln auf meinen Lippen. Beides ist verschwunden. Was bleibt, ist dieses Gefühl der Ohnmacht, der Leere und der Stille.
Demeter Brouwer wird zu einem der Schatten, die in den alten Gemäuern lauern. Ich habe nie verstanden, was Leen damit meinte – dass Bloem von den Menschen lebe, deren Opfer es fordert. Aber jetzt fühle ich, wie es meine Essenz aussaugt.
Hinter mir räuspert sich jemand lautstark, was die Aufmerksamkeit des Paares vor mir erregt.
»Oh!«, entfährt es der Frau, während ihr Partner sich dem Geldautomaten widmet, um sein Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen. Später gehen sie ins Kino, das habe ich aus Gesprächsfetzen aufgeschnappt.
Wann war ich zuletzt im Kino? Das muss Jahre her sein, dabei bin ich als Teenager wirklich gerne mit Baas hingegangen. Auch wenn er sich selten für meine Filmauswahl begeistern konnte, ist er stets mitgekommen.
Baas – bei dem Gedanken an meinen älteren Bruder wird mein Herz schwer, gleichzeitig empfinde ich Wut. Wut, weil er versprochen hatte, zurückzukommen. Wut, weil er dieses Versprechen gebrochen hat.
»Sie sind dran.« Eine tiefe Stimme reißt mich aus den Gedanken und lässt mich instinktiv einen Schritt nach vorne treten. Über die Schulter erhasche ich einen Blick auf die Person. Ein älterer Herr mit Halbglatze, der gut einen Kopf kleiner als ich ist, sieht mich mürrisch an.
Hastig krame ich das Portemonnaie aus der Handtasche, nehme die Karte heraus und stecke sie in den dafür vorgesehenen Schlitz. Der Blick auf meinen Kontostand ist ein Trauerspiel. Ich habe bereits einen Großteil meiner Ersparnisse in die Instandsetzung des Seitenflügels investiert. Geld, das ich zwar zurückbekomme, sobald die Versicherung für den Schaden aufkommt, aber wie lange das dauert, konnte man mir nicht sagen. Die laufenden Kosten für den Gnadenhof auf Bloem muss ich ebenfalls selbst tragen.
Diese Bedingung hat mein Vater damals gestellt, als ich den Wunsch geäußert habe, die ungenutzten Stallungen zu einem Zuhause für verstoßene Tiere zu machen. Und da die Destillerie nach wie vor nicht genügend abwirft, erhalte ich aktuell nicht mehr als ein großzügiges Taschengeld, das dennoch nicht genug ist, um vollständig für den Schaden aufzukommen und all das zu ersetzen, was ich verloren habe.
Der Automat spuckt hundert Euro aus, gerade als mein Handy klingelt. Weil ich hoffe, es könnte Leen sein, wühle ich in der Handtasche danach. Es ist Selma.
»Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht?«
»Die schlechte, die passt zu meinem Gemütszustand.«
»Das Essen ist angebrannt.«
»Ich kann etwas von unterwegs mitbringen.«
»Ah, das wäre super. Oder wir teilen uns eine halbe Portion Falafel, die von gestern Abend übrig geblieben ist, und zum Dessert gibt es Minzeis mit Schlagsahne. Klingt nicht sehr verlockend, oder?« Ihr leises Lachen dringt an mein Ohr. »Vielleicht bringst du doch lieber etwas mit, die Schlagsahne ist abgelaufen.«
»Es ist wirklich kein Problem, in der Nähe ist ein hervorragender Italiener, den ich noch aus meiner Studienzeit kenne.«
»Habe ich schon erwähnt, dass du mir all deine Geheimtipps für Rotterdam verraten musst? Ich bin seit zwei Wochen hier und habe nicht mehr als das Bürogebäude und den Schnellimbiss an der Ecke kennengelernt.«
»Ich habe bereits eine Liste zusammengestellt. Und was ist die gute Nachricht?«
»Dass ich in einem der Schränke eine DVD-Sammlung gefunden habe.«
Hin und wieder ertappe ich mich bei der Frage, ob Selma mit mir befreundet wäre, würden die Dinge anders stehen. Wäre Leen nicht mit ihrer besten Freundin Nika zusammen und wäre ich nicht zu einer tragischen Randfigur in ihrer Geschichte geworden. Ich mag Selma, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auf Gegenseitigkeit beruht oder ob Nika sie gebeten hat, sich in ihrer Abwesenheit um mich zu kümmern. Egal, woher ihr Interesse rührt, Zeit mit mir zu verbringen, ihr Angebot, sie während ihres Praktikums in Rotterdam zu besuchen, habe ich nur zu gern angenommen. Weil mich mit der Einsamkeit Bilder all jener Momente heimsuchen, die ich vergessen will. Doch vergessen fühlt sich falsch an. Weil es bedeutet, auch Ezra hinter mir zu lassen.
»Demy?«
»Wie wäre es mit Kino?«, frage ich in einem spontanen Einfall.
»Kino? Gott, da war ich schon ewig nicht mehr, aber klar, wenn du Lust dazu hast.«
»Wird es heute noch was?«, ertönt es hinter mir schroff.
Ich will die Bankkarte aus dem Schlitz ziehen, greife jedoch ins Leere.
»Verdammt!«, entfährt es mir. Der Automat hat sie geschluckt. »Selma, ich muss Schluss machen, ich bin spätestens in vierzig Minuten da«, sage ich und lege auf.
Ratlos starre ich auf den Geldautomaten. Dann suche ich nach einer Möglichkeit, damit er meine Karte doch noch ausspuckt. Vergebens. Das Display zeigt lediglich den Hinweis an, dass ich meine Karte einstecken soll, um eine Aktion auszuführen.
Damit ich nicht unnötig den Verkehr aufhalte, trete ich beiseite und sehe mich im Vorraum der Bank um. Dann werfe ich einen Blick auf die Uhr. Die Filiale hat seit zehn Minuten geschlossen, aber die Automatiktür gleitet auf, als ich mich ihr nähere.
Eilig trete ich an den Schalter und halte nach jemandem Ausschau, der mir behilflich sein kann.
Ungeduldig trommle ich mit den Fingern auf der Holzplatte herum, doch dann öffnet sich eine Tür im hinteren Bereich. Ein hochgewachsener Kerl im weißen Hemd und mit einem Stapel Papiere unter dem Arm kommt auf mich zu, das Handy am Ohr.
»Ja, ich habe die Unterlagen hier … Nein, das Investment überschreitet die von mir angedachte Summe … Entweder Sie nehmen das Angebot an oder … Das freut mich zu hören. Ich lasse Ihnen die Verträge zukommen.« Er lässt das Handy sinken und tippt auf dem Display herum, während er, ohne von mir Notiz zu nehmen, vorbeigeht.
»Stopp!«
Es dauert einen weiteren Schritt, bis er tatsächlich stehen bleibt und sich mir zuwendet.
»Entschuldigung, ich weiß, Sie haben Feierabend, aber Sie müssen mir helfen.«
Ich nehme ihn genauer in Augenschein. Markante Kieferpartie, ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, die blonden Strähnen fallen ihm lässig in die Stirn, so als hätte nach einem langen Tag seine Pomade versagt. Er kommt einen Schritt näher. »Muss ich das?«
»Ja, es ist Ihr Job, mich glücklich zu machen.«
Als er eine seiner hellen Augenbrauen hochzieht, bemerke ich, wie meine Worte geklungen haben. »Und wie genau kann ich Sie glücklich machen?« Er kommt noch einen Schritt näher und legt die Unterlagen auf dem Tresen ab. Dann sieht er mich abwartend an.
»Der Automat hat meine Karte geschluckt. Können Sie sie für mich rausholen?«
»Der Automat hat Ihre Karte geschluckt?«
»Ja, und ich hätte sie gerne wieder.«
Ich befürchte schon, er könnte jeden Augenblick anfangen zu lachen, um mir dann zu erklären, dass diese Art von Problem nicht zu seinem Aufgabengebiet gehört. Immerhin hat er gerade von Investmentverträgen gesprochen, und überhaupt wirkt er nicht wie jemand, der sich mit der Laufkundschaft abgibt. Die Rolex an seinem Handgelenk lässt ebenfalls darauf schließen, dass er zur höheren Führungsebene gehört. Gerade ist mir das aber herzlich egal, weil ich mir gerne den bürokratischen Aufwand ersparen würde, um meine Karte auf anderem Wege zurückzubekommen. Nur dürfte ihm das deutlich lieber sein, als seine kostbare Zeit mit einer Lappalie zu verschwenden.
Er atmet tatsächlich tief durch und stößt genervt die Luft aus, bevor er hinter dem Schalter verschwindet und eine Schublade nach der anderen aufzieht.
»Was suchen Sie denn?«, rutscht es mir heraus, weil er etwas planlos wirkt.
»Den Schlüssel für den Geldautomaten.«
»Sie arbeiten doch hier, sollten Sie sich da nicht besser auskennen?«
»Nein.«
»Was, nein?«, frage ich irritiert.
»Nein wie Ich arbeite nicht hier.«
»Warum wühlen Sie dann in den Schubladen herum?«
»Weil Sie mich um Hilfe gebeten haben.«
Erneut sehe ich mich in der kleinen Filiale nach dem Personal um. »Dann ist das gar nicht Ihr Büro, aus dem Sie gerade gekommen sind?« Der Kerl kleidet sich wie ein Banker. Er klingt wie einer. Bewegt sich wie einer. Verflucht, er riecht sogar wie jemand, bei dem sich alles um Geld dreht.
»Nein.« Ihm entfährt ein leises Lachen.
»Finden Sie das lustig?«
»Ah, hier ist er ja.« Wie eine Trophäe hält er einen Schlüsselbund in die Höhe.
»Okay, ich warte lieber auf jemanden mit der nötigen Kompetenz, den Automaten zu öffnen«, sage ich und versuche ihm den Schlüssel zu entreißen.
»Dann müssen Sie sich bis morgen gedulden, die sind bereits gegangen.«
»Und was machen Sie dann noch hier?«
»Ich wollte durch die Vordertür verschwinden, bis Sie mich davon abgehalten haben.«
»Das ist ein schlechter Scherz, oder?«, zische ich.
Dieses freche Grinsen, das seine Lippen ziert, ruft in mir den Impuls hervor, es ihm aus dem Gesicht zu wischen. Weil es mindestens so unverschämt wie attraktiv ist. Und er ist sich dessen bewusst, denn sein Mundwinkel zuckt amüsiert, als ich etwas zu offensichtlich auf seinen Mund starre.
»Wenn Sie Ihre Bankkarte wollen, kommen Sie mit.« Er nimmt den Stapel Papiere wieder an sich und geht auf die Tür zu, durch die ich zuvor gekommen bin.
Als sie sich nicht automatisch öffnet, bleibe ich erschrocken stehen. »Sagen Sie nicht, wir stecken hier fest.« Eingesperrt in einer Bankfiliale mit einem Kerl, der sich für besonders witzig hält – das hat mir gerade noch gefehlt.
»Klingt verlockend«, erwidert er mit einem winzigen Hauch Sarkasmus. Was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? Zielstrebig geht er auf das Touchpad neben der Tür zu, holt eine Karte heraus, hält sie dran und gibt anschließend einen Code ein.
»Sie arbeiten also doch hier.«
»Nein.«
Will der Typ mich eigentlich verarschen?
Die Tür gleitet auf, und ich sehe ihm verwundert nach, als er in den Vorraum tritt, in dem die Geldautomaten stehen.
»Welcher?«
»Der rechte«, teile ich ihm mit und versuche einen Blick auf den Automaten zu erhaschen, als er mir die Sicht darauf versperrt.
Es dauert nicht länger als zwei langsame Atemzüge, da hält er mir meine Karte entgegen. Ich will sie ihm abnehmen, aber er zieht die Hand zurück. »Können Sie sich ausweisen?«
»Was?«, antworte ich perplex.
»Na, woher soll ich wissen, dass das auch tatsächlich Ihre Karte ist?«
»Im Ernst? Ich habe Ihnen doch gesagt, in welchem Automaten meine Karte verschwunden ist.«
Er verkneift sich sichtlich ein Grinsen. »Die Betrugsmaschen werden immer ausgeklügelter.«
»Ich bin doch keine Betrügerin.«
Statt sich mit mir auf eine Diskussion einzulassen, verschränkt er abwartend die Arme vor der Brust.
»Also schön«, sage ich genervt und krame meine Geldbörse aus der Handtasche, um meine Identität nachzuweisen. So ein Arsch, er sieht sich meinen Ausweis nicht mal genau an.
»Bitte, die Clifford Bank ist stets bemüht, die Kundschaft glücklich zu machen. Einen schönen Tag noch.«
»Danke.« Ich stürme aus der Bank, und ich schwöre, ich kann den Kerl bis auf den Bürgersteig hinter mir lachen hören.
Bevor ich wenige Augenblicke später in mein Auto steige, das ich nur wenige Meter vorm Eingang der Filiale geparkt habe, blicke ich über meine Schulter und sehe, wie er die Straße entlanggeht, das Handy am Ohr. Ich schaue ihm so lange nach, bis er um die Ecke biegt und somit aus meinem Blickfeld verschwindet.
Exakt siebenundvierzig Minuten später drücke ich den Klingelknopf, neben dem auf einem mit Klebeband befestigten Post-it der Name van Art steht. Das Geräusch des Summers ertönt.
»Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freue – die Pizzakartons in deinen Händen oder deinen Anblick«, sagt Selma eine Spur zu theatralisch.
»Ich habe auch Tiramisu«, erwidere ich und wackle leicht mit dem Arm, von dessen Beuge eine Papiertüte baumelt.
»Okay, jetzt bringst du mich zum Heulen.« Mit dem Zeigefinger wischt sie sich eine imaginäre Träne weg. »Komm rein.« Sie tritt beiseite und nimmt mir die Kartons ab, damit ich meine Boots von den Füßen streifen kann.
Das Apartment ist winzig, aber hell und freundlich und auf den ersten Blick mit dem Nötigsten ausgestattet. Im Wohnzimmer befindet sich eine Küchennische. Der Geruch von verbranntem Essen steigt mir in die Nase.
»Setz dich«, sagt Selma und deutet in Richtung Sofa.
»Und wer ist das?« Mit dem Zeigefinger tippe ich vorsichtig gegen das Goldfischglas, das auf dem Couchtisch steht.
»Gijsbert. Er gehört Nika, und ich habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er ihre Abwesenheit überlebt.«
Fragend hebe ich eine Augenbraue, weil es aus ihrem Mund klingt, als wäre das nicht selbstverständlich.
Sie lässt sich neben mir auf der Couch nieder und wirft einen neugierigen Blick in die Pizzaschachteln. Hawaii mit extra Käse für sie, vegetarisch für mich. Mit einem zufriedenen Nicken greift sie nach einem Stück. »Sagen wir, es gab einmal Olga, eine Monstera, die sich in meiner Obhut befand und die Weltreise meiner Eltern nicht überstanden hat«, erklärt sie kauend und mit einem Seufzen, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es genüsslich oder bedauernd ist.
Sicherheitshalber betrachte ich den Goldfisch eindringlich, um nach Anzeichen zu suchen, dass es ihm nicht gut geht. Da er aber munter im Wasser schwimmt, lehne ich mich entspannt zurück. Ob er Nika ebenso sehr vermisst wie ich Leen?
Ich krame mein Handy aus der Handtasche und tippe eine Nachricht, dass ich an ihn denke, verwerfe sie jedoch wieder.
»Du solltest ihm schreiben«, sagt Selma, die offensichtlich einen Blick auf mein Display geworfen hat.
Ich lege das Handy auf den Couchtisch. »Nicht heute.«
»Wann ist ein besserer Zeitpunkt, jemandem zu sagen, dass man in Gedanken bei ihm ist?« Auch wenn Selmas Worte keinen Vorwurf beinhalten, höre ich ihn dennoch heraus.
Ezra ist heute beerdigt worden, und ich habe mich mit der Ausrede, nicht von hier wegzukönnen, davor gedrückt. Die Wahrheit ist, ich hatte Angst, was dieser Tag mit Leen und mir macht. Es ist einfacher, Ereignisse zu ignorieren, die man nicht miterlebt hat. Wie feige das ist, weiß ich. Aber wie könnte ich neben Leen stehen, seine Hand halten und um seinen Freund trauern, wenn es meine Schuld ist, dass es überhaupt so gekommen ist? Das macht mich zu einer Heuchlerin, und ich fürchte mich vor dem Augenblick, in dem Leen das erkennt. Seit ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist unser Verhältnis angespannt. Ich halte ihn auf Distanz und er respektiert es. Vielleicht ist es ihm aber auch ganz recht, dass ich ständig betone, alleine klarzukommen, und er immer wieder zu Nika flüchten kann.
Nach dem, was auf Bloem geschehen ist, war mein Bruder nicht wiederzuerkennen. Es war, als hätte er aufgehört zu existieren. Leen hat den Ort, an dem wir aufgewachsen sind, nie gemocht und ist, sobald er seinen Abschluss in der Tasche hatte, nach London verschwunden. Und heute verstehe ich seine Entscheidung, all die Schatten hinter sich zu lassen. Genau wie den Umstand, dass wir zu ihnen gehören. Der Tod unserer Mutter vor acht Jahren hat Leen zerstört. Es hat einen Umzug nach London gebraucht, damit er sich selbst wiederfindet. Es ging ihm besser. Leen war glücklich. Dann wurde ihm in der Nacht der Preview-Party für unseren alkoholfreien Gin erneut ein geliebter Mensch genommen. Meinetwegen. Weil Ezra mich gerettet hat.
Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Bis zu jenem Moment, der schlussendlich zu dieser Katastrophe geführt hat. Aber das kann ich nicht. Wir alle müssen mit den Konsequenzen leben. Und es ist so verdammt schwer. Mindestens so sehr, wie den Kopf aufrecht zu halten, weil der Name Brouwer weder Schwäche noch Versagen zulässt. Deswegen habe ich Leen vor wenigen Tagen weggeschickt. Zurück nach London. Damit er sein Studium an der Kingston University beendet. Ich kann nicht auch noch dafür verantwortlich sein, dass er seine Zukunft opfert, weil er sich in der Verantwortung sieht, sich um seine Schwester und Bloem zu kümmern.
»Ich rufe ihn morgen an«, lüge ich.
Ebenso wenig werde ich Baas in der Untersuchungshaft besuchen, obwohl Wolters sich um die Möglichkeit für ein Treffen bemüht. Wie viel Schuld tatsächlich wiegt, spüre ich deutlich, und mit jedem Tag, der vergeht, kommen ein paar Gramm hinzu. Ich sollte meinen Brüdern beistehen, doch alles, was ich tue, ist, sie von mir zu stoßen. Weil ich weder Baas’ noch Leens Liebe verdiene.
»Ihr macht alle eine schwere Zeit durch, aber wenn ihr zusammenhaltet, steht ihr sie durch. Als Freya beinahe das Wohnhaus verloren hat, hat es uns geholfen, uns regelmäßig zusammenzusetzen und darüber zu reden. Letztlich hat es alle noch enger zusammengeschweißt, nicht aufzugeben, sondern für das zu kämpfen, was wir lieben. Verrate es nicht meinen Eltern, aber die Bewohner der Pastelstraat 8 sind meine Familie, und ich hätte mein letztes Hemd gegeben, damit wir nicht auseinandergerissen werden, weil irgendein Immobilienmogul alles in De Pijp aufkauft, um dort Luxusapartments zu errichten. Wenn du dich jetzt von deinen Brüdern abwendest, wirst du es bereuen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber spätestens dann, wenn du kein Teil ihres Lebens mehr bist, sondern nur noch ein Schatten der Vergangenheit, der auf Fotos existiert, die aus einer glücklicheren Zeit stammen. Familie bedeutet aber, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen, nicht jeder für sich selbst. Es ist deine Entscheidung, aber denk wenigstens über meine Worte nach.«
Mit allem, was Selma sagt, hat sie recht. Es ist nicht so, als wüsste ich nicht selbst, dass aus dem Keil zwischen uns irgendwann eine unüberwindbare Schlucht werden würde. Nur ist es eben auch so, dass es einiges an Überwindung kostet, den Keil zu entfernen, wohl wissend, wie viel Schmerz darunter lauert.
»Okay, Schluss mit den schweren Gedanken, wir verdrücken jetzt diese herrlich duftenden Pizzen und schießen uns mit dem Tiramisu ins Zuckerkoma«, sagt Selma und ich ringe mich zu einem Lächeln durch.
»Du wirst dich allein über das Dessert hermachen müssen, ich muss meinen Zuckerspiegel im Blick behalten.«
»Aber nicht wegen deiner Figur, die ist Neid erweckend.«
Ich lache, als Selma mir zuzwinkert und neckisch den Kopf schräg legt, als würde sie jeden Augenblick in den Flirt-Modus schalten.
»Nein, ich würde tatsächlich in ein Zuckerkoma fallen. Also, nicht wortwörtlich …« Ich zögere, eine Erklärung hinterherzuschieben. Die Krankheit, die mich schon mein Leben lang begleitet, ist nichts, worüber ich gerne rede. Mein Vater hat sie erst als Makel und später als Schwäche betrachtet. Wie ich selbst dazu stehe, kann ich nicht einmal genau sagen. Es ist ein Auf und Ab. Mal ist es okay und dann wieder nicht. Ich schätze, es hängt von der Reaktion meines Gegenübers auf die Offenbarung ab.
Über Selmas Kopf schwebt ein Fragezeichen. Nika hat sie also nicht eingeweiht. »Diabetes Typ 1«, bringe ich es kurz und knapp auf den Punkt.
»Ich würde dich ja bemitleiden, aber gerade bin ich sehr dankbar, die Zuckerbombe nicht mit dir teilen zu müssen«, erwidert Selma und grinst. Ich bin mir sicher, sie würde gerne die Fragen stellen, die Unwissende oft von sich geben, egal ob man sie beantworten will oder nicht. Und? Wie ist das so? Kannst du überhaupt normal essen? Musst du dich spritzen? Also, ich könnte das ja nicht. Wenn dein Leben maßgeblich davon abhängt, dir eine Nadel in den Körper zu rammen, bist du zu so einigem fähig.
Im Alter von drei Jahren bekam ich die Diagnose. Keine Ahnung, wie ich mich damals gefühlt habe. Keine Ahnung, ob ich den Einschnitt in mein Leben zu dem Zeitpunkt überhaupt verstanden habe. Ich erinnere mich nur an winzige Ereignisse. Zum Beispiel daran, dass mir ein Arzt einen Gummihandschuh als Luftballon aufgeblasen hat oder dass ich mit Krankenschwestern zum Labor gegangen bin. Bei einem bestimmten Blutzuckerwert durfte ich gleich essen, weshalb mich dieser brennend interessiert hat. Außerdem durfte ich plötzlich keine Smarties mehr essen und Diätnutella schmeckte nach Fisch. Ich musste alle Süßigkeiten ablehnen, was mir zum Glück gar nicht so schwerfiel, weil es bei uns zu Hause ohnehin kaum welche gab. Verzicht gehörte einfach zu meinem Leben dazu. Anders als meine Brüder habe ich nie den Kindergarten besucht, wodurch ich sehr isoliert aufgewachsen bin. Etwas, das ich nicht verstand, weil Leen und Baas jeden Morgen das Haus verließen, während ich allein zurückblieb. Mein Essen wurde von Jeffrey abgewogen, während meine Brüder Nachschlag und Pudding bekamen.
Mit fünf lernte ich während meines Kuraufenthalts, mich selbst zu spritzen. Dennoch bestand meine Mutter darauf, dass Baas in der Schule ein Auge auf mich hatte, um Spritzfehler zu vermeiden. Mein Bruder war fortan meine ganz persönliche Pflegekraft, damit niemand in mir das kranke Mädchen erkannte. Aber genau das war ich, und es blieb nicht unbemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich wurde zur Außenseiterin. Der größte Fehler, den ich begangen habe, war, Hendrikje davon zu erzählen, weil ich sie für eine Freundin hielt.
Ein neuer Lebensabschnitt begann und andere Probleme tauchten auf. Plötzlich wurde ich von manchen Mitschülern wegen meiner Krankheit ausgelacht, mein Traubenzucker wurde aus meiner Sporttasche geklaut oder ich musste mit diesem für Freundschaften bezahlen. Zu Geburtstagsfeiern wurde ich nicht eingeladen, weil es für viele der Eltern zu »kompliziert« war, auf meine Krankheit Rücksicht zu nehmen. Nicht, dass sie das gemusst hätten, ich habe mich selbst gut genug damit ausgekannt. Das Unbekannte macht den Menschen Angst, hat meine Mutter gesagt. Ja, da ist was dran.
Viel Ausgrenzung und Unverständnis führten dazu, dass ich einfach »normal« sein wollte. Die Krankheit sollte nicht mein Leben bestimmen, aber genau das tat sie. Oft fühlte ich mich allein. Ein Gefühl, das mich auch heute noch begleitet.
Ich sehe auf meine Uhr, dann greife ich nach einem Stück Pizza und beiße hinein.
»Boah, die ist so gut«, schwärmt Selma mit vollem Mund. Ich bin froh, dass sie meine Krankheit nicht thematisiert und mir gerade das Gefühl gibt, »normal« zu sein. Einfach zwei Freundinnen, die gemeinsam auf der Couch sitzen, Pizza essen und anschließend ins Kino gehen.
CORIANDER
Koriander erzeugt eine würzige, zitronige Note.
RIEK
Büro Willem Visser, Jordaan, Amsterdam
»Hörst du mir eigentlich zu?«
Ich sehe auf. »So halb, ja«, antworte ich, schließe mein E-Mail-Postfach und stecke das Handy weg.
»Riek, das hier ist wichtig«, ermahnt mich Willem, damit ich ihm endlich meine volle Aufmerksamkeit schenke.
»Was genau ist daran wichtig? Es ist eins von vielen Grundstücken auf der Liste, die im Besitz der Bank sind.«
Er tippt auf die Mappe vor mir, in die ich noch nicht hineingesehen habe, obwohl er mich darum gebeten hat. Der Grundstücks- und Immobilienmarkt interessiert mich nicht. Meine Investments drehen sich um Firmen, die innovative Ideen in ihrem Portfolio haben.
»Es ist dein Anwesen«, erklärt er eine Spur genervt. Vermutlich hat er das bereits erwähnt, während ich mir den Businessplan eines Start-ups angesehen habe, das sich mit der Aufbereitung von Regenwasser in den Entwicklungsländern beschäftigt.
»Was meinst du mit ›Es ist mein Anwesen‹?«
»Bloem ist Teil der Erbmasse. Bisher unterlag das Anwesen einer nach dem Erbbaurecht vertraglich geregelten Nutzungserlaubnis, die mit einer jährlichen Pachtzahlung seitens der Brouwers beglichen wurde. Mit dem Tod von Piet Brouwer erlosch diese jedoch und nun ist das Anwesen in deinen Besitz übergegangen.«
»Und?«, frage ich, weil ich ihm nicht ganz folgen kann.
»Du musst entscheiden, was damit geschieht.«
Jetzt schlage ich den Ordner doch auf und werfe einen Blick auf die Unterlagen.
»Ich habe ein Schloss geerbt?« Mir entfährt ein Lachen. Bloem Kasteel in Bloemdaalen, um genau zu sein. Laut Willem hat mein Vater wenig auf den hübschen Titel »Graf« gegeben. Das blaue Blut existiert in meiner Familie nur auf dem Papier und geht schon lange nicht mehr mit gesellschaftlichen Pflichten einher. Wäre dem so, hätte ich den Titel längst abgelegt, weil er fürchterlich albern klingt. Aber ich muss gestehen, die ein oder andere Tür hat er mir geöffnet.
»Du musst nicht sofort entscheiden, ob du es behalten oder verkaufen möchtest. Fahr hin, sieh es dir an.«
»Ich habe keine Verwendung für ein Schloss.« Allein der Gedanke, ein Schlossherr zu sein, der in einem protzigen Esszimmer speist oder zehn verschiedene Schlafzimmer zur Verfügung hat, lässt mich schmunzeln. So viel Dekadenz ist einfach too much. In den Unterlagen suche ich nach dem aktuellen Marktwert, werde aber auf die Schnelle nicht fündig. »Über welche Summe sprechen wir bei dem Anwesen?«
»Zehn Millionen Minimum.«
»Mmh …« Das ist ein nettes Sümmchen, das ich nach dem kürzlichen Investment-Fehltritt durchaus gebrauchen könnte. »Ist es bewohnt?«
»Die Nachkommen des Verstorbenen leben noch dort.«
»Würden sie es denn kaufen wollen?«, will ich wissen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Willem sie umgehend über die Sachlage informiert hat. Der Kerl ist so akribisch in seiner Arbeit als Nachlassverwalter, dass ich mich frage, ob er nachts von diesem Büro hier träumt.
»Die Brouwers leben seit Generationen auf Bloem, sie werden es nicht aufgeben wollen.«
»Heißt, sie werden vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen und die Angelegenheit geht rasch über die Bühne?« Das Letzte, worauf ich Lust habe, sind Verhandlungen, die sich ins Unermessliche ziehen.
»Ich sage nur, sie werden nicht ausziehen wollen.«
Bedeutet im Klartext, sie verfügen nicht über die Mittel, um ein vierhundert Jahre altes Schloss zu kaufen.
»Und ich bin niemand, der Menschen ihr Zuhause wegnimmt.« Was ihm klar sein dürfte. Er war der beste Freund meines Vaters und kennt meine Geschichte. Ein fehlender Zusatz im Testament hat dafür gesorgt, dass nicht ich heute in der Familienvilla wohne. »Was ist mit einer Verlängerung der Erbpacht um weitere, sagen wir, fünfzig Jahre?«, werfe ich ein.
»Möglich, aber nichts, was sich rentiert«, antwortet er und lehnt sich in dem Ledersessel zurück.
Ein Schmunzeln erscheint auf meinen Lippen. Geld ist nun wirklich kein Thema, um das ich mir Gedanken machen muss.
»Dein Treuhandfonds ist ebenfalls etwas, über das wir reden müssen.«
»Sag bloß, ich bin dich bald los?«, mutmaße ich und grinse ihn schief an. Meine Eltern haben im Testament festgehalten, dass die Auszahlung einer Art Belohnungssystem folgt. Zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten gibt es ein großzügiges Taschengeld, damit ich mir meine Geschenke selbst kaufe. Mit achtzehn erhielt ich einen Bonus, dessen Höhe sich aus meinem VWO-Durchschnitt ergab. Die nächsten kamen mit der Aufnahme eines Studiums, dem Erreichen des Bachelors und anschließend brachte mir der Master ein hübsches Sümmchen ein. Auf meine Frage, ab wann ich über das Vermögen frei verfügen könne, hat er sich verhalten geäußert. Es gebe eine Bestimmung, die zu geeigneter Zeit in Kraft tritt. Bis dahin verwaltet Willem den Treuhandfonds.
Er zieht die Schreibtischschublade auf und nimmt ein Kuvert heraus. »Hier«, sagt er und reicht es mir. Das Blut in meinen Adern gefriert. Wie jedes Mal, sobald ich die Handschrift meiner Mutter auf einem der Briefe entdecke. Ich schlucke. Für gewöhnlich händigt Willem mir die Umschläge zu jenen besonderen Anlässen aus, die seit siebzehn Jahren ohne meine Eltern stattfinden. Siebzehn Geburtstage. Siebzehnmal Weihnachten. Drei Bildungsabschlüsse und das Erlangen des Führerscheins. Tage, die ich mit Willem an meiner Seite verbracht habe.
Neununddreißig Briefe, die meine Eltern lebendig gehalten haben, weil sie Teil der Wendepunkte meines Lebens waren, ohne wahrhaftig anwesend zu sein.
»Ist das der letzte?« Meine Stimme bricht, weil mir plötzlich bewusst wird, dass sie endgültig gehen könnten. Denn im Gegensatz zu all seinen Vorgängern steht auf diesem Umschlag kein Anlass, sondern ein einziger Satz: Glücklich allein ist die Seele, die liebt.
Willem verzieht entschuldigend das Gesicht, weil mir eine Antwort verwehrt bleiben wird. »Ich dürfte dir diesen Brief zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht geben. Damit verstoße ich gegen die Treuhandbestimmungen.«
Ja, denn die besagen, die Belohnung erfolgt erst, nachdem ich die jeweilige Aufgabe eigenständig gemeistert habe. Verrückt, wenn man bedenkt, dass mir zwei Million durch die Lappen gegangen wären, hätte ich mich gegen ein Studium entschieden. Denn es gibt da diesen winzigen Zusatz, der Willem zur Verschwiegenheit darüber zwingt, wie genau die Bucketlist aussieht, die meine Eltern an den Treuhandfonds geheftet haben. Ob ich einen Punkt erfüllt habe, erfahre ich erst mit Übergabe eines Briefes und einem anschließenden Zahlungseingang auf meinem Konto. Laut Willem war es ihnen wichtig, dass ich meinen Weg selbstbestimmt und nicht angetrieben von Geld gehe. Ob ihnen die Richtung gefallen hätte, die ich eingeschlagen habe?
»Warum tust du es dann?«, will ich wissen, weil er überkorrekt ist und sich noch nie gegen die Bestimmungen hinweggesetzt hat. Mehr als einmal habe ich versucht, ihm zusätzliches Geld zu entlocken. Erfolglos.
»Weil ich dich großgezogen habe. Du bist wie ein Sohn für mich, Riek. Alles, was sich deine Eltern für dich gewünscht haben, wünsche auch ich mir für dich.«
»Wird das hier jetzt so ein sentimentaler Moment, in dem wir unsere gemeinsamen Jahre Revue passieren lassen?«
»Lies den Brief, Riek, und dann reden wir darüber«, erwidert er bestimmt, als wäre es unumgänglich.
Ich lege den Kopf schräg, mustere ihn skeptisch. Ich habe immer angenommen, Willem kenne die Inhalte nicht. Möglicherweise habe ich mich geirrt. »Ich bin gerade nicht in Stimmung«, antworte ich ehrlich, verstaue den Brief in meiner Laptoptasche und erhebe mich. Die Worte meiner Mutter sind nichts, was ich in einem stickigen Büro im Beisein von Willem vor Augen haben will.
Er nickt verständnisvoll. »Du kannst jederzeit vorbeikommen. Vergiss das nicht, Riek.« Das sagt er wie immer, aber heute fühlt es sich an, als würde ich darauf zurückkommen, sobald ich die Zeilen auf dem rosa Briefpapier gelesen habe.
Ich stehe auf. »Danke, aber ich reise heute noch ab.«
Mein Leben findet schon lange in Rotterdam statt. Direkt nach dem Schulabschluss habe ich die Koffer gepackt, um fernab von allem zu studieren, und bin schlussendlich dortgeblieben. In Rotterdam fühlt sich alles so viel leichter an. Nichts in dieser Stadt zwingt mich zu Erinnerungen an meine Eltern. Amsterdam bildet das Davor, Rotterdam das Danach. Willem ist das Dazwischen, das schmerzt. Und oft komme ich mir wie ein undankbares Arschloch vor, weil ich ihn auf Distanz halte, obwohl er mich in seinem Haus aufgenommen hat, als mich sonst niemand wollte.
Er begleitet mich zur Tür. Für einen Moment befürchte ich, er würde mich umarmen, und trete instinktiv einen Schritt zurück. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, der in den Arm genommen werden muss, weil ihm das Schicksal übel mitgespielt hat und er den Grund dafür nicht versteht. Der Junge, der sich fragt, was er getan hat, um diesen Verlust zu verdienen. Die Antwort ist, dass es keine Erklärung für den Tod meiner Eltern gibt. Mit dreizehn habe ich akzeptiert, dass die unbeantworteten Fragen immer unbeantwortet bleiben werden. Dass Scheiße nun mal passiert und es unmöglich ist, sie in Gold zu verwandeln.
Es ist Bullshit, wenn Menschen dir sagen, dass dich Schicksalsschläge stärker machen. Denn die Wahrheit ist, du wächst nicht daran, du kapitulierst und funktionierst nur noch. Trauer hat ein Ablaufdatum, Einsamkeit nicht. Sie ist es, die dich immer wieder einholt. Du siehst sie nicht kommen. Und dann rennst du, rennst und rennst. Wie ein Hamster in seinem Rad. Runde um Runde, weil man es verdammt noch mal von dir erwartet.
Willem drückt mir die Mappe mit den Unterlagen in die Hand. »Sieh dir das Anwesen wenigstens an.«
Dass er darauf beharrt, macht mich stutzig. »Ich rufe dich an, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe.«
»Okay, Junge. Ich bin Anfang Juli in Rotterdam, vielleicht lässt deine Zeit ein gemeinsames Mittagessen zu.«
»Sicher.« Ich ringe mich zu einem Lächeln durch, gerade will ich nur von hier verschwinden.
Als ich das Gebäude verlasse, ist die Sonne gerade untergegangen und hat die Tagträumer gegen Nachtschwärmer getauscht. Ich steige in meinen Wagen, um die Heimreise anzutreten. Von Amsterdam nach Rotterdam ist es knapp eine Stunde, und doch fühlt es sich jedes Mal an, als lägen Welten zwischen den beiden Städten. Mein Herz hämmert wie wild in meiner Brust, als ich die Laptoptasche öffne und nach dem Papier taste, um mich zu vergewissern, dass die Worte meiner Mutter noch da sind. Der Brief wird mir keine Ruhe lassen, bis ich ihn gelesen habe, außer ich lenke mich ab. Fuck!
Und dann tue ich das, was ich immer tue, wenn ich den vergessenen Teil von mir betäuben will, sobald er nach Aufmerksamkeit verlangt – ich fahre in den erstbesten Nachtclub, der meinen Weg kreuzt, um nicht allein zu sein.
VIOLET
Veilchen verleihen eine zarte Süße mit erdigen Nuancen.
DEMETER
Clifford Bank, Oude Centrum, Amsterdam
EINE WOCHE SPÄTER …
Nervös wische ich die feuchten Hände an dem Stoff meines schwarzen Etuikleides ab, während ich versuche, das Zittern in meinen Fingern zu kontrollieren und nicht auf dem unbequemen Stuhl herumzurutschen. Was mir nicht gelingt, denn ich stoße mit dem Knie gegen das Tischbein. Das goldene Namensschild auf dem Schreibtisch schwankt bedrohlich, bevor schlanke Finger mit perfekt manikürten Nägeln es vor dem Umkippen bewahren. Es ist eine fast beiläufige Bewegung, aber sie sagt alles über das Machtgefälle in diesem Raum aus. Ein leises Räuspern hallt von den Wänden, die in der vergangenen Viertelstunde deutlich näher gekommen sind. Es fühlt sich an, als säße ich in einer Falle, gerade groß genug, um atmen zu können, aber nicht, um ihr zu entkommen.
In weniger als einer Minute wird Daphne Lilienthal über das Schicksal meiner Familie entscheiden. Ein Blick in das makellose Gesicht der Bankangestellten verrät mir alles, was ich wissen muss – es läuft nicht wie von mir erhofft. Leen hat es prophezeit, aber ich wollte dennoch einen Versuch wagen. Ein Nein ist nicht immer in Stein gemeißelt. Erfahrungswerte, die ich an der Uni gesammelt habe, die sich heute als nutzlos erweisen.
»Wie wir Ihnen bereits in unserem letzten Schreiben mitgeteilt haben, können wir Ihrer Familie keinen weiteren Kredit gewähren. Es tut –«
Bevor sie mir mitteilt, wie leid es ihr tut, dass ihr aber dennoch die Hände gebunden sind, unterbreche ich sie. »Was ist mit einer Stundung der monatlichen Raten?« Sie setzt ein entschuldigendes Lächeln auf.
»Und ein Privatkredit?«
Sie faltet die Hände und legt sie vor sich auf dem Tisch ab, womit sie mich an meinen Vater erinnert, der mir gleich mein Fehlverhalten vor Augen führen wird.
Daphne schaut mich an, als wäre ich nur ein weiterer Punkt auf ihrer Daily-to-do-List, den sie mit höflicher Effizienz abwickeln muss. »Sie haben momentan kein sicheres Einkommen, sind nicht verheiratet und Ihre Familie ist hoch verschuldet. So leid es mir tut –«
»Es muss doch eine Möglichkeit geben, uns entgegenzukommen. Die Brouwers sind wie lange Kunden dieser Bank?« Ich suche in ihrem Gesicht nach einem Zeichen, einem Funken Menschlichkeit, an den ich mich klammern kann.
»Seit drei Generationen.« Dass sie das weiß, macht es umso tragischer, hängen gelassen zu werden.
»Und genau deswegen sollten Sie etwas mehr Verständnis für unsere Lage haben«, sage ich bissig.
»Frau Brouwer, ich würde Ihrer Familie wirklich gerne helfen, aber –«
»Warum tun Sie es dann nicht?« Es ist keine Frage, sondern ein Schrei nach Rettung, ein verzweifeltes Flehen, das von den kahlen Wänden des Büros zurückprallt. Ich klinge so verzweifelt, wie ich mich fühle. Hilflos und irgendwie im Stich gelassen. Nicht nur von der Clifford Bank, sondern auch von all den Menschen, die mir wichtig sind. Wohl wissend, warum ich allein in diesem stickigen Büro sitze.
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas anderes sagen.« Ihre Worte klingen wie eine hohle Phrase, die sie täglich wiederholt, ohne sie wirklich ernst zu meinen.
»Ja, das wünschte ich auch«, erwidere ich resigniert und stehe vom Stuhl auf. Ich spüre, wie der Boden unter mir schwankt, lasse mir jedoch nicht anmerken, dass sie ihn mir gerade unter den Füßen wegzieht.
Einen Moment sehen wir einander abwartend an, bis Daphne hinter dem Schreibtisch hervortritt, um mir den Weg aus ihrem Büro zu weisen. Ihre Bewegungen sind elegant, selbstbewusst, und das Lächeln, das sie mir schenkt, könnte glatt aus einem Handbuch für Kundenbetreuung stammen.
»Auf Wiedersehen«, verabschiedet sie sich, höflich, aber mit Nachdruck.
Ich nicke, unfähig, noch etwas zu sagen, und öffne die Tür. Die Luft, die mir aus dem Flur entgegenschlägt, ist kühl, aber statt Erleichterung spüre ich nur die Schwere in meiner Brust, die mich nicht atmen lässt. Doch kaum trete ich hinaus, stoße ich auf eine Wand – keine echte, sondern einen Mann, der so präsent ist, als würde er den Raum mit seiner bloßen Existenz füllen. Er steht vor mir, hochgewachsen, in einem lachsfarbenen Poloshirt, das im krassen Gegensatz zu der bedrückenden Atmosphäre des Bankbüros hinter mir steht.
Ich warte darauf, dass er beiseitetritt, um mich vorbeizulassen, doch er bewegt sich keinen Zentimeter von der Stelle. Etwas an ihm zwingt mich dazu, aufzublicken, ihn genauer anzusehen, obwohl alles in mir schreit, diesen Moment so schnell wie möglich hinter mir zu lassen. Mein Blick bleibt länger an seinen Lippen hängen, als er sollte, und ich beobachte, wie sie sich zu einem Schmunzeln verziehen, als er es bemerkt. Er kommt mir vage bekannt vor. Die markante Kieferpartie, die gerade Nase, auf der eine silberne Pilotenbrille mit schwarzen Gläsern sitzt, der freche Zug, der seine Lippen umspielt. Sein Haar ist sonnengebleicht, in einem perfekt unperfekten Chaos, das so aussieht, als wäre er gerade erst mit den Fingern hindurchgefahren – lässig, mühelos.
Wahrscheinlicher ist allerdings, er hat sie vor dem Spiegel genau in diese Position gebracht. An dem Kerl wirkt nichts wie ein Zufallsprodukt. Er will vielleicht wie der lässige Typ rüberkommen, doch seine Körpersprache verrät ihn mindestens so sehr wie die Rolex an seinem Handgelenk. Old Money geht mit einer unverkennbaren Aura einher. Sie schwingt in jeder seiner Bewegungen mit, in der Art, wie er dasteht, ohne auch nur den Anschein zu erwecken, er müsse zur Seite treten. Es ist die Haltung von jemandem, der es gewohnt ist, dass sich die Welt um ihn herumbewegt – nicht umgekehrt.
Unter anderen Umständen hätte ich mich vielleicht über seine Arroganz geärgert. Dank des Fiaskos im Büro fühle ich nur stumpfe Erschöpfung. »Darf ich mal vorbei?«
»Wenn Sie bitte sagen«, antwortet er seelenruhig, ohne mir den Weg freizugeben.
»Was?«, entfährt es mir perplex.
»Da, wo ich herkomme, bittet man um Dinge«, erklärt er mit einer Selbstverständlichkeit, die mir die Kehle zuschnürt. »Wenn Sie also vorbeiwollen, versuchen Sie es erneut. Diesmal etwas freundlicher, bitte.« Seine Lippen verziehen sich wieder zu diesem selbstgefälligen Schmunzeln, als würde die Welt tatsächlich nur darauf warten, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Es fehlt der verhöhnende Ton, den ich erwartet hätte, und genau das macht es noch unverschämter – als wäre er so sehr davon überzeugt, über den Dingen zu stehen, dass er es nicht einmal nötig hat, mich direkt zu provozieren. Aber diese Stimme …
»Wären Sie so nett, mich vorbeizulassen? Bitte«, presse ich mühsam hervor, um den Irrsinn zu beenden.
In aller Ruhe nimmt er die Sonnenbrille ab, klemmt sie mit einer übertriebenen Geste in den Ausschnitt seines Poloshirts, als wäre das hier eine Art Theaterstück, in dem er die Hauptrolle spielt. Mein Herz setzt einen Schlag aus, als mir klar wird, wer da vor mir steht – der Typ aus Rotterdam. Und er weiß es. Natürlich weiß er es. Denn in seinen Augen glitzert Belustigung, ein Funken Erkenntnis, der alles nur noch schlimmer macht.
»Hat der Automat Ihre Karte geschluckt?« Er lächelt breiter, als würde er mir einen persönlichen Gefallen tun. »Ich könnte behilflich sein, wenn Sie es wünschen. Der Clifford Bank ist es das größte Anliegen, die Kundschaft glücklich zu machen.« Abwartend sieht er mich an. Vielleicht auch herausfordernd. Bevor ich ihn fragen kann, ob ihn dieses winzige Machtspiel amüsiert, das er hier so offensichtlich demonstriert, werden wir von einem Räuspern unterbrochen. Über die Schulter sehe ich zu Daphne, die Prince Charming mit finsterer Miene fixiert.
»Schade«, murmelt er, ohne den Hauch echter Enttäuschung. »War gerade so nett.«
Mein Kopf schnellt in seine Richtung. Nett? Irgendwas stimmt mit seiner Wahrnehmung nicht. Unangenehm beschreibt es treffender. Überraschenderweise erbarmt er sich dennoch, zur Seite zu treten.
»Danke«, sage ich gezwungen höflich, obwohl der Impuls, ihm den Ellbogen in die Rippen zu rammen, mir weitaus befriedigender erscheint.
Als ich an ihm vorbeigehe, spüre ich, wie sein Blick mir folgt. Der Duft von Jasmin und Zedernholz liegt in der Luft. Da klingelt ein Handy. Kaum merklich streifen seine Finger meinen Unterarm. Es ist nur ein Hauch, ein flüchtiger Kontakt, aber es genügt, um mich erstarren zu lassen. Plötzlich bin ich gefangen, als hätte er seine Präsenz wie ein Netz um mich gelegt.
Er mustert mich mit zusammengezogenen Brauen, als wäre ich ein Rätsel, das er lösen möchte. Dabei zieht er sein Smartphone aus der Hosentasche, doch sein Blick ruht auf mir. Als er sich das Handy ans Ohr hält, klingen seine Worte beiläufig, fast uninteressiert: »Bevor du etwas sagst, Daphne und ich sind auf dem Weg. Wir wurden in der Bank aufgehalten.«
Mein Herz schlägt schneller, während ich den Atem anhalte. Mein Blick bleibt an seinen Fingern haften, die mich eben noch berührt haben, wenn auch nur zufällig. Der Widerspruch zwischen diesem flüchtigen Moment und meiner eigenen Reaktion macht mich wütend. Geh weiter, ermahne ich mich selbst. Aber meine Füße weigern sich. Sie sind wie festgeklebt auf dem kalten Marmorboden.
»Alles okay?«, fragt er leise und zu meinem Ärger auch besorgt, während er mit der freien Hand das Mikro seines Handys abdeckt. Er neigt sich ein kleines Stück näher zu mir, nur einen Hauch, doch es reicht, um die Distanz zwischen uns weiter schrumpfen zu lassen. Seine Augen fangen das Neonlicht ein und schimmern veilchenblau. Was sie unwirklich, beinahe wie etwas aus einer anderen Welt erscheinen lässt. Dunkle Wimpern rahmen sie ein, stehen in einem provokativen Kontrast zu seinen blonden Haaren und der gebräunten Haut. Der Kerl ist so perfekt inszeniert, dass es lächerlich ist. Genau wie der Bartschatten, der sich auf seinem Kinn und seinen Wangen abzeichnet, passend zu dem kleinen Fleck an seinem Poloshirtkragen, der verdächtig nach Lippenstift aussieht.
Ich schlucke die Enge in meinem Hals herunter. »Alles bestens«, teile ich ihm mit und gebe meinen Füßen den Befehl, sich endlich in Bewegung zu setzen. Ein erleichtertes Seufzen entfährt mir, als sie tatsächlich gehorchen und mich dem Ausgang näher bringen.
Die Automatiktür öffnet sich und die warme Frühsommerluft schlägt mir entgegen, befreit mich aus der stickigen Atmosphäre des Bankgebäudes. Für einen Augenblick bleibe ich auf der oberen Steinstufe stehen und atme tief durch.
Der Termin hätte nicht schlechter laufen können. Der komplette Tag scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, mir die Laune zu verderben. Heute Morgen hat Rosie sich in einem Maschendrahtzaun verfangen und die Tierärztin musste die Wunde am Hals nähen. Die Straßen von Amsterdam waren noch vollgestopfter als gewöhnlich, weil eine Großbaustelle die nächste jagt. Zum Banktermin kam ich zwanzig Minuten zu spät. Und jetzt parkt ein knallroter Ferrari quer vor meinem Mini Cooper.
»Vielen Dank auch«, fluche ich leise und gehe auf mein Auto zu. Ich drücke die Hupe – einmal, zweimal, dreimal –, in der Hoffnung, dass der Besitzer des Wagens auftaucht.
»War ja klar«, rutscht es mir heraus, als ausgerechnet er aus der Bankfiliale kommt. Mit geschmeidigen, selbstgefälligen Schritten gleitet er nahezu die Stufen hinunter, als wäre die Welt sein verfluchter Laufsteg.
»Ihr Auto?«, fragt er und verkneift sich sichtlich ein Grinsen, während er sich nähert.
»Ihr Luxusschlitten?«, gebe ich genervt zurück.
»Vielleicht.« Sein linker Mundwinkel zuckt auf diese überhebliche Art, die mich innerlich kochen lässt. Er lehnt sich gegen die Beifahrertür des Ferraris und mustert mich mit einem Blick, der für meinen Geschmack zu intensiv ist.
»Da, wo ich herkomme, ist es unhöflich, andere zuzuparken«, imitiere ich ihn spöttisch.
Er hebt eine Augenbraue, schmunzelt kaum merklich. »Dann hätten Sie den Wagen vielleicht lieber auf dem Kundenparkplatz abstellen sollen.«
Ich verschränke die Arme vor der Brust und spüre, wie mein Ärger wächst. »Das ist ein Kundenparkplatz, Sie Schlauberger!«
»Nein, ist es nicht«, sagt er ruhig, als bestünde an seiner Aussage kein Zweifel.
Unauffällig sehe ich mich nach einem Schild um. Nichts. Kein Hinweis darauf, dass ich im Unrecht bin.
»Und warum sind Sie sich da so sicher?«
»Weil es mein Parkplatz ist«, erwidert er mit einem aufrichtigen Lächeln, das mich kurz vergessen lässt, worüber wir diskutieren.
Verwirrt gehe ich um den Mini herum und sehe an der Hauswand nach. Da, zwischen den roten Backsteinen, auf Knöchelhöhe, entdecke ich das Schild. »R. A. Clifford«, lese ich laut vor und drehe mich dann langsam zu ihm um.
»Japp, das bin ich.« Sein Lächeln weitet sich zu einem triumphalen Grinsen.
Verflucht!
»Sie arbeiten also tatsächlich nicht für die Clifford Bank, Sie sind die Clifford Bank«, sage ich, unfähig, die Mischung aus Überraschung und Groll zu unterdrücken.
»Sozusagen«, antwortet er, als wäre nichts dabei.
»Das rechtfertigt dennoch nicht, dass Sie mein Auto blockieren. Das ist Nötigung«, erkläre ich spitz, obwohl ich netter zu ihm sein sollte. Schließlich gehört seiner Familie die Bank, bei der wir bis zum Hals in Schulden stecken.
»Riek!«, ertönt Daphnes Stimme schneidend und klar.
Wir sehen beide zum Eingang. Unweigerlich frage ich mich, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Die Art, wie sie seinen Namen ruft, lässt eine Vertrautheit vermuten.
»Dein Timing ist wie immer perfekt«, sagt er und wendet sich an Daphne, »ich wollte gerade den Wagen vorfahren.« Er greift in seine Hosentasche, und ein leises Piepen durchbricht die Stille, als er den Ferrari öffnet. Mit geschmeidigen Bewegungen geht er zur Fahrerseite, als wäre das alles ein perfekt einstudierter Ablauf, den er schon tausendmal durchgespielt hat. Noch einmal sieht er über das Autodach zu mir herüber, seine Augen funkelnd mit dieser unausgesprochenen Überheblichkeit. »Auf bald«, sagt er, als wäre es ein Versprechen.
Ich antworte nicht, stehe einfach nur da und sehe zu, wie er in den Wagen steigt. Der Motor erwacht mit einem tiefen Röhren zum Leben, ein Geräusch, das seine Macht und die Privilegien, mit denen sein Leben einhergeht, nur noch unterstreicht. Privilegien, die ich bis vor Kurzem selbst noch besessen habe.
Der Ferrari rollt rückwärts und kommt neben Daphne zum Stehen. Sie sieht mich kurz an, misstrauisch, aber auch irgendwie neugierig.
Ich sehe dem roten Sportwagen nach, als er davonfährt. Das grollende Motorengeräusch verklingt in der Ferne, aber das Gefühl von Beklommenheit bleibt.
ROSEMARY
Rosmarin enthält eine mediterrane Note mit einem Hauch Würze.
RIEK
The White Room, Burgwallen Nieuwe Zijde, Amsterdam
»Sie ist Kundin bei uns«, erklärt Daphne in gewohnt strengem Ton. Was sie sich schenken kann, denn warum sonst sollte sie in der Bank gewesen sein? Außerdem hatte ich bereits in Rotterdam das Vergnügen. Zugegeben, es hat einen Augenblick gebraucht, bis ich sie in dem Business-Outfit, mit Make-up im Gesicht und spießiger Steckfrisur wiedererkannt habe. Ihr ausgerechnet in Amsterdam erneut über den Weg zu laufen, war allerdings auch das Letzte, womit ich gerechnet habe.
»Du könntest ihr alle Kreditverträge kündigen, dann wäre sie es nicht mehr«, erwidere ich trocken. Daphne befasst sich ausschließlich mit Geschäftskrediten, daher liegt auf der Hand, warum die Kleine hier war.
Nicht, dass ich ein ernsthaftes Interesse an der Frau hege. Ich provoziere meine Cousine lediglich gern. Und tatsächlich stößt Daphne genervt die Luft aus, bevor sie zu einer Antwort ansetzt.
»Oder du hörst auf, unsere Kundinnen anzugraben, und suchst dir eine anständige Freundin.«
»Was ist denn anständig?«, frage ich. »Nur damit sie auch den Ansprüchen der Familie entspricht«, schiebe ich zynisch hinterher.
»Jemand, der weniger präsent ist als du«, erwidert sie.
Mit präsent meint meine Cousine Liebling der Boulevardpresse in wechselnder Begleitung. »Tja, Gordon hast du ja bereits geheiratet«, ziehe ich sie auf. Ihr Ehemann ist steif und humorlos und somit der Inbegriff von Langeweile. Warum ihre Wahl ausgerechnet auf Gordon Lilienthal gefallen ist, dürfte weniger in einer innigen Liebesbeziehung begründet liegen, sondern eher dem gigantischen Bauimperium geschuldet sein, das er inzwischen sein Eigen nennt.
Wir fahren am Koninklijk Paleis vorbei und halten an einer roten Ampel. Vor dem königlichen Palast tummeln sich Touristen, die Fotos schießen oder hoffen, einen Blick auf das Königspaar zu erhaschen. An manchen Tagen hat man durchaus Glück.
»Wirklich, Riek, ich verstehe nicht, warum du dich derart dagegen wehrst, dich ernsthaft auf jemanden einzulassen.«
Mir fallen da auf Anhieb locker fünf Gründe ein, die dagegensprechen, mich festzulegen.