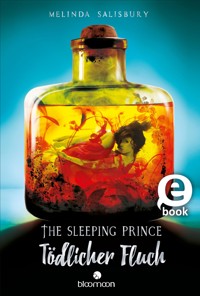
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bloomoon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Land ist in Aufruhr. Die Königin hat eine alte Legende entfesselt und den gefährlichen Schlafenden Prinzen nach vielen Jahrhunderten wieder zum Leben erweckt. Nun bringt er Krieg und Zerstörung zu den Menschen von Tregellian. Die junge Apothekerstochter Errin versucht verzweifelt, sich in diesen gefährlichen Zeiten über Wasser zu halten. Doch seit ihr Bruder Lief verschwunden ist, muss sie sich alleine um ihre kranke Mutter kümmern. Über die Runden kommt sie nur, weil sie verbotene Kräutertränke braut, die sie heimlich verkauft. Als Soldaten sie und ihre Mutter aus ihrem Dorf vertreiben, gibt es nur einen, an den sich Errin wenden kann: den mysteriösen Silas. Ein junger Mann, der tödliche Gifte bei ihr kauft, aber nie verrät, wozu er sie verwendet. Silas verspricht, Errin zu helfen. Doch als ihr vermeintlicher Retter spurlos verschwindet, muss Errin eine Entscheidung treffen, die das Schicksal des Reiches verändern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Melinda Salisbury
The Sleeping Prince
Tödlicher Fluch
Übersetzung aus dem Englischen von A. M. Grünewald
Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe
bloomoon, München 2017
Text © Melinda Salisbury, 2016
Titel der Originalausgabe: The Sleeping Prince
Die Originalausgabe ist 2016 im Verlag Scholastic Children’s Books, London, erschienen.
© 2017 bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, 80801 München
Alle Rechte vorbehalten
Text: Melinda Salisbury
Übersetzung: A. M. Grünewald
Covergestaltung: © Rekha Garton, 2016
Illustration Landkarte: © Maxime Plasse
Verwendung von Cover und Landkarte mit freundlicher Genehmigung von Scholastic Ltd
Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH
ISBN eBook 978-3-8458-2194-8
ISBN Printausgabe 978-3-8458-1794-1
www.bloomoon-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für James Field.
Unter anderem dafür, dass du es geschafft hast, Premierenkarten fürHarry Potter und das verwunschene Kindzu bekommen.
Danke dir, Strdier.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Das Märchen vom Schlafenden Prinzen
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 2
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Danksagungen
Weitere Titel
Leseprobe zu "Goddess of poison - Tödliche Berührung"
Das Märchen vom Schlafenden Prinzen
Vor fünfhundert Ernten stand das Land Tallith in voller Blüte. Das Volk der Tallithi war gesund und wohlhabend, es gab keine Bettler und nur selten Krankheiten. Es war ein Paradies, dessen Grenze die Berge bildeten und das Meer. Doch am Ende war es auch das Meer, das den Untergang einläutete.
Der König von Tallith schickte seine Entdecker mit Schiffen hinaus auf die See, und als sie zurückkehrten, brachten sie Geschichten von fremden Königreichen und den dortigen Sitten mit. Sie brachten Gewürze und Stoffe, lauter Dinge, die man noch nie gesehen hatte. Aber sie brachten auch Ratten mit. Die Tiere hatten sich auf die Schiffe gestohlen, und nun kamen sie an Land und bald schon wurde das Reich von ihnen überrannt. Also schickte der König die Schiffe neuerlich auf große Fahrt und sagte, sie sollten mit einem Rattenfänger zurückkehren. Und das taten sie auch.
Der Rattenfänger kam mit seinem Sohn und seiner Tochter nach Tallith und sie wurden sogleich ins Schloss geführt. Der König versprach dem Sohn des Rattenfängers seine Tochter, die Prinzessin, zur Frau, wenn er Tallith von der Plage befreite. Aber der Rattenfängerlehnte ab. Er sagte, er würde das Land nur von den Ratten befreien, wenn er den Prinz als Gemahl für seine Tochter bekäme. Der König weigerte sich, denn das hätte die Tochter des Rattenfängers zur Königin und zur Mutter des Thronerben gemacht, und das konnte er nicht zulassen. Aber der Rattenfänger wollte keine der anderen Reichtümer und Titel annehmen, die der König ihm bot. Nur die Hand des Prinzen für seine Tochter wollte er akzeptieren.
Und da das Volk in Aufruhr war, weil die Ratten Speisen stahlen und das Wasser verseuchten und die Kleinkinder bissen, gab der König schließlich nach und sagte, er würde seinen Sohn mit der Tochter des Rattenfängers vermählen.
Also zog der Rattenfänger seine Flöte aus der Tasche und begann zu spielen. Bald schon kamen alle Ratten aus ihren Löchern gehuscht und folgten ihm auf seinem Weg durch die Straßen von Tallith. Als er sie alle angelockt hatte, führte er sie bis ans Meer. Er spielte weiter, und sie sprangen alle ins Wasser, wo sie ertranken. Und so ward Tallith von ihnen befreit.
Als der Rattenfänger die Ratten ausgemerzt hatte, ging er zurück aufs Schloss, wo seine Tochter verheiratet werden sollte. Aber der König weigerte sich, seinen Teil der Abmachung einzuhalten. Darauf geriet der Rattenfänger in rasende Wut und er verfluchte den König und seinen Sohn und alle seine weiteren Söhne für ihren Verrat.
Doch was der Rattenfänger nicht wusste, war, dass sich seine Tochter in Erwartung ihrer Ehe vom Prinzen hatte verführen lassen. Sie trug bereits seinen Sohn unter dem Herzen, und als der Fluch wirksam wurde, traf er auch sie. Der König und der Prinz und die Tochter des Rattenfängers fielen in einen tiefen Schlaf, aus dem niemand sie erwecken konnte. Den König raffte es dahin und er verstarb, aber der Prinz und die Tochter des Rattenfängers schliefen weiter. Jeden Tag kam der Rattenfänger, kümmerte sich um seine Tochter und träufelte Honig und Wasser in ihren Mund, um sie und ihr ungeborenes Kind am Leben zu erhalten.
Doch nachdem sie, immer noch schlafend, ihren Sohn zur Welt gebracht hatte, starb auch sie. Der Rattenfänger begrub sie und nahm seinen scheinbar unversehrten Enkelsohn mit sich fort. Der Prinz schlief weiter, aber um ihn kümmerte sich niemand. Er blieb so, wie er an dem Tag gelegen hatte, als er eingeschlafen war. Er wurde nur ein wenig blasser, aber er alterte nicht und starb auch nicht. Er schlief, und während er schlief, ging Tallith unter.
Etwa einhundert Ernten später verschwand ein Mädchen aus Tregellan. Sie hatte Pilze gesammelt und war im Wald vom Weg abgekommen. Man suchte überall nach ihr, konnte sie jedoch nirgends finden. Man glaubte, sie sei von Wölfen gefressen worden, bis ein Wanderprediger behauptete, er habe gesehen, wie sie einem Mann mit einer Flöte gefolgt war. Sie seien Richtung Tallith gezogen. Die Familie des Mädchens eilte nach Tallith, kam aber zu spät. Neben der Totenbahre, auf der noch immer der Schlafende Prinz lag, fanden sie den toten Körper des Mädchens. Ihr Herz war herausgerissen und lag in den blutverschmierten Händen des Schlafenden Prinzen.
Und seitdem taucht alle hundert Jahre der Bringer wieder auf, denn so nennen sie den verfluchten Jungen mit seiner Flöte. Er ist niemand anderes als der Sohn des Schlafenden Prinzen und er zieht durchs Land auf der Suche nach einem neuen Opfer für seinen Vater.
Man sagt, wenn er ein Mädchen bringt, während die Solarislichter über den Himmel ziehen, wird der Schlafende Prinz erwachen und alle Herzen aller Mädchen im Königreich verschlingen.
Prolog
Ohne jede Vorwarnung spürte der Nachtwächter am Osttor einen scharfen Stich an seinem Hals und fuhr sich unwillkürlich mit der Hand an die Kehle. Schon im nächsten Augenblick gaben seine Beine unter ihm nach, und noch während er zusammenbrach, sah er im matten Schein der Torlaterne das Blut an seinen Fingern. Er war tot, noch bevor sein Körper zu Boden gegangen war.
Der Golem trat über seine Leiche hinweg.
Der zweite Wächter drehte sich um. Sein Mund öffnete sich zu einem Schrei, und er riss sein Schwert in die Höhe, um sich der Kreatur entgegenzustellen. Doch es war zu spät. Ein silberner Blitz fuhr durch die Luft, und der Mann stürzte zu Boden, wo sich sein Blut mit dem seines Kameraden verband.
Der Golem wandte sein leeres Gesicht dem Himmel zu, als würde er einen Geruch wittern oder angestrengt lauschen. Dann trat er durch das Tor. Sein unförmiger Kopf stieß gegen die Lampe, die quietschend hin und her schaukelte und an der dicken Steinmauer albtraumhafte Schatten tanzen ließ. Während das Öl rauchend zu Boden tropfte und die Flamme flackerte, hinterließ der Golem blutige Fußspuren auf seinem Weg in die schlafende Königsstadt Lortune. In der einen Hand schleifte er einen Knüppel hinter sich her, der fast so groß war wie er selbst, in der anderen eine riesige Doppelaxt.
Wenige Augenblicke später folgte ein zweiter Golem, der in seinen deformierten Händen ebenfalls Knüppel und Axt trug. Seine Waffen schienen noch nicht benutzt worden zu sein.
Die zwei Geschöpfe bewegten sich langsam, aber mit Bestimmtheit. Sie schwankten beim Gehen hin und her, glichen eher Schiffen auf dem Ozean als irgendeinem Lebewesen.
Ihnen folgte der Schlafende Prinz.
Im Gegensatz zu der Monstrosität der Golems war der Prinz wunderschön. Sein silbrig weißes Haar reflektierte das Mondlicht und ergoss sich über seinen Rücken wie ein Wasserfall. Wenn das Licht der Laterne seine Augen traf, leuchteten sie golden wie Honig. Er war groß und schlank und bewegte sich mit einer Anmut, die jeden seiner Schritte aussehen ließ, als beginne er einen Tanz. In beiden Händen hielt er kurze, geschwungene Schwerter, deren goldenen Hefte mit Symbolen einer lange untergegangenen Welt geschmückt waren. Er hatte jedoch nicht vor, seine Waffen zu benutzen oder sich in dieser Nacht überhaupt mit Blut zu besudeln. Wenn alles nach Plan verlief, würde das auch nicht nötig sein. Heute Nacht dienten die Schwerter bloß dazu, Angst zu verbreiten. Es war ja durchaus möglich, dass jemand zufällig wach war, vielleicht eine alte Frau, die von ihren schmerzenden Knochen um den Schlaf gebracht wurde, oder ein kleiner Junge, der aus einem schlimmen Traum aufschreckte. Wenn also jemand aus dem Fenster blickte, würde er sehen, mit welch herrschaftlicher Würde der Schlafende Prinz durch ihre Stadt zog.
Er wollte gesehen werden – nicht von allen, noch nicht –, aber ganz gewiss von einigen. Er wollte, dass sich die Kunde davon verbreitete, wie er ohne Gegenwehr in die Stadt gelangt war und sie eingenommen hatte. Wie er mit nur zwei Golems Lortune und das Schloss erobert hatte, ohne jemanden zu töten, abgesehen von den beiden, deren Aufgabe es gewesen war, Wache zu halten. Er wollte, dass sich die Bewohner der Stadt hinter vorgehaltener Hand zuraunten, wie königlich er ausgesehen hatte, als er an ihren Häusern vorbeimarschiert war. Er wollte, dass sie sich daran erinnerten, dass er sie alle in ihren Betten hätte umbringen können, es aber nicht getan hatte. Er hatte sie verschont. Seine Untertanen.
Er wollte, dass sein neues Volk einmal eine gute Meinung von ihm haben würde. Sein Vater hatte ihm beigebracht, dass es zwei Wege gab zu herrschen: durch Angst oder durch Liebe. Er konnte von den Lormerianern nicht erwarten, dass sie ihn liebten, noch nicht. Aber er konnte sie dazu bringen, ihn zu fürchten. Das war ganz leicht.
Er folgte seinen Golems durch die stillen Straßen und warf abschätzige Blicke auf die schäbigen Gassen, auf die Flecken, die die aus den Fenstern gekippten Abwässer hinterlassen hatten, auf die Gebäude, die sich im Schatten des Schlosses eng und schmutzig aneinanderdrängten. Eher wie Aborte sahen sie aus und nicht wie die Häuser wohlhabender Kaufleute in der Hauptstadt des Landes.
Seine Lippen verzogen sich angewidert, als er im Vorübergehen durch einige Fenster schaute. Diese billigen Möbelstücke, dieser trostlose Zimmerschmuck. Er blickte zum Schloss von Lormere hinauf. Eine klobige, rechteckige Feste, flankiert von zwei dunklen Türmen, in denen die Bewohner ahnungslos schliefen. Hässlich, wie die ganze Stadt. Aber besser als gar kein Schloss …
Auch am Wassertor, dem am wenigsten gesicherten Eingang von Schloss Lormere, ließen sich die Golems nicht aufhalten, trotz der zusätzlichen Wachen, die der König hier aufgestellt hatte. Acht Männer verloren ihr Leben, vier bewaffnete Wächter am Tor und vier Bogenschützen auf der Festungsmauer. Diesmal jedoch sah sich der Schlafende Prinz gezwungen, selbst in den Kampf einzugreifen, um ihn rasch zu beenden. Er kümmerte sich um die Männer am Tor, während seine Geschöpfe nach den Bogenschützen griffen, die sechs Meter über ihnen auf der Mauer positioniert waren. Die Pfeile der Männer prallten an der Lehmhaut der Golems ab, die gar nicht zu bemerken schienen, dass auf sie geschossen wurde. Wenige Augenblick später waren die Schädel der Kämpfer am Boden zerdrückt.
Die goldene Tunika des Prinzen war mit Blut besudelt. Er wischte es ab und verschmierte es dabei über den Samt. Seine Miene verfinsterte sich, woraufhin die Golems ihre Knüppel schwangen und wutschnaubend aufstampften. Der Prinz marschierte an ihnen vorbei und eilte über den Pfad, der zwischen den Außengebäuden entlangführte, durch die Küchengärten auf das vor ihm aufragende Schloss zu.
Der Klang eines Horns durchschnitt die Nacht. Der Prinz wirbelte herum und lief zum Wassertor zurück, hinter sich die schweren Schritte der Golems. Ein bleicher Wächter, der offenkundig noch einen Rest Leben in sich hatte, lag auf dem Boden und blies mit letzter Kraft in sein Horn. Der Schlafende Prinz stieß eines seiner Schwerter tief in die Brust des Mannes. Der Klang verstummte.
Doch es war zu spät. Als der Prinz sich wieder zum Schloss umwandte, sah er Lichter in den Fenstern aufflammen, die bis eben noch dunkel gewesen waren. Er hörte neue Hörner Alarm schlagen, hörte Männer brüllen. Der Schlafende Prinz seufzte. Er griff in seine Tasche und holte ein zusammengerolltes Pergament hervor. Mit gerunzelter Stirn kritzelte er einige Worte darauf, dann riss er das Pergament entzwei. Er winkte die Golems zu sich und legte jedem ein Stück Pergament in die Handfläche. Sofort wurde das lehmige Fleisch flüssig, und das Schriftstück sank darin ein, bis es ganz verschwunden war. Die Rufe aus dem Schloss wurden lauter, kamen näher und das Rauschen abgeschossener Pfeile zischte durch die Luft.
Der Schlafende Prinz seufzte erneut. Dann ging er mit ruhigen Schritten dem Tumult entgegen. Er schwang sein Schwert und lächelte.
In der Großen Halle des Schlosses stand der König von Lormere in hellen Beinkleidern, einem offenen weißen Hemd und ungebundenen Schuhen und musterte argwöhnisch den Schlafenden Prinzen.
Der hatte den Kopf schief gelegt und ließ sein Gegenüber nicht aus den Augen. Seine Kleidung war jetzt zerfetzt und tiefrot und sein schönes Haar triefte von Blut. Hinter ihm lag eine Spur toter Leiber: Soldaten und Wächter und Dienstboten, die dumm genug gewesen waren, ihren König verteidigen zu wollten. Er hatte ein Band aus Leichen hinter sich hergezogen wie einen blutigen Pfad, der beim Wassertor begann, sich durch die Gärten und Korridore wand und bis hierher führte.
Auf der anderen Seite der Großen Halle, in der Nähe der Tür, die zu den königlichen Gemächern führte, lag leblos einer der Golems. Ein Wächter hatte das Glück gehabt, den Arm der Kreatur verwunden zu können, und so die Alchemie geschwächt, mit der das Geschöpf kontrolliert wurde. Ein zweiter Wächter hatte die Chance genutzt und dem Golem den Kopf abgeschlagen. Als das Ungeheuer über ihm zusammengebrochen war, hatte es ihn jedoch mit in den Tod gerissen. Der zweite Golem stand im Tor zur Großen Halle, als warte er ungeduldig auf weitere Gardisten, die sich ins Gefecht stürzen wollten.
Doch es gab keine mehr.
Der König hielt etwas in den Händen: ein metallenes Amulett an einer Kette, das er vor dem Schlafenden Prinzen schwenkte wie ein Geschenk. Dieser lächelte genüsslich.
»Lasst uns miteinander reden«, sagte der König eindringlich. Sein Gesicht war bleich, sein Haar ein wildes Durcheinander schwarzer Locken.
»Kein Gerede, Merek von Lormere«, entgegnete der Schlafende Prinz. Seine ruhige, weiche Stimme bildete einen scharfen Kontrast zu seinem wahnsinnigen Lächeln. »Eure Männer sind alle tot. Euer Schloss und Euer Königreich gehören mir. Alles, was ich jetzt noch hören will, ist, wie Ihr um Gnade winselt.«
Mereks dunkle Augen blitzten auf. »Ich versichere Euch, das wird nicht geschehen«, sagte er. »Ich werde mit aufrechtem Haupte sterben.«
Der Schlafende Prinz zog eines seiner Schwerter. Mit einem schnellen Streich versenkte er es in der ungeschützten Brust des neuen Königs von Lormere.
König Merek gab einen leisen Ton der Überraschung von sich. Er sah den Schlafenden Prinzen an und seine Verblüffung ließ ihn geradezu kindlich wirken. Dann schlossen sich seine Augen flatternd und er sank zu Boden. Der Schlafende Prinz betrachtete ihn ausdruckslos.
Dann stieg er über den Leichnam des Königs hinweg, durchquerte die Halle und erklomm die Empore. Hinter der langen hölzernen Tafel hing das Siegel des Hauses Belmis, ein Schild geschmückt mit drei leuchtenden Sonnen und drei silbernen Monden auf blutrotem Grund. Mit einem angeekelten Laut riss er es herunter und trampelte darüber hinweg. Dann ließ er sich auf dem großen Thron an der Mitte der Tafel nieder. Er fuhr mit den Fingern über die Schnitzereien, und wieder kräuselten sich missbilligend seine Lippen. Billige Bauernarbeit. Er hatte Besseres verdient.
Und nun, da Lormere ihm gehörte, würde er es auch bekommen.
Teil 1
Kapitel 1
Ich halte meinen Blick starr auf die Tür vor mir gerichtet und schaue keinen der Soldaten an, die links und rechts von ihr positioniert sind. Stattdessen bemühe ich mich, möglichst gelangweilt zu wirken und ein bisschen geistesabwesend. Ich bin nichts Besonderes, es lohnt sich überhaupt nicht, auf mich zu achten. Bloß eine Dorfbewohnerin, die an der Versammlung teilnimmt. Zu meiner großen Erleichterung haben sie keine Blicke für mich übrig, als ich aus dem Nieselregen in das heruntergekommene Gerichtsgebäude trete. Als ich an ihnen vorbei bin, atme ich langsam aus und meine Anspannung legt sich ein wenig.
Hier drin ist es nicht viel wärmer als draußen, also ziehe ich meinen Umhang enger um mich, während ich auf den Saal zusteuere, in dem uns Chanse Unwin, selbst ernannter Richter von Almwyk, über die Neuigkeiten aus der letzten Ratssitzung von Tregellan informieren wird. Mir tropft immer noch der Regen von der Nase, während mein Blick über die hölzernen Bankreihen und Stühle schweift, die dem Podium am Ende des Saales zugewandt sind. Viel zu viele Plätze für die verbliebenen Dorfbewohner. Obwohl nur noch wenige von uns übrig sind, stinkt es so sehr in dem Raum, dass ich die Nase rümpfe: ungewaschene Körper, nasse Wolle, Leder, Metall und Furcht – all das verbindet sich zu einem suppigen, muffigen Geruch. So riecht Verzweiflung.
Diejenigen von uns, die noch immer in Almwyk festsitzen, sind nass und zittern. Unsere dünne, fadenscheinige Kleidung bietet kaum Schutz vor der kalten Luft und dem Herbstregen, und ich bezweifle, dass sich in diesem Winter noch etwas daran ändern wird. Die Soldaten dagegen, die sich an den Wänden aufgereiht haben, scheinen es in ihren dicken grünen Tuniken und den Hosen aus festem Leder warm und trocken zu haben, während ihre Blicke aufmerksam durch den Raum wandern.
Hinter mir ertönt ein Scharren. Ich drehe mich um und sehe, wie die Soldaten einen Mann aufhalten und ihn gegen die Wand drücken. Sie tasten ihn ab, untersuchen seinen Umhang und seine Kapuze, bevor sie ihn weitergehen lassen. Hitze steigt mir ins Gesicht, aber ich schaue rasch beiseite, tue so, als hätte ich es nicht bemerkt.
Mit gesenktem Kopf husche ich an der Rückwand des Raumes entlang und nehme auf einer Bank Platz, achte aber darauf, gute sechs Schritte Abstand von meiner Sitznachbarin zu halten. Sie stößt ein dumpfes Schnaufen aus. Es könnte ein Gruß sein, wahrscheinlicher aber ist es eine Warnung, denn ihre Hand greift unwillkürlich zu dem Talisman, der an einem Lederband um ihren Hals hängt. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie eine goldene Scheibe zwischen ihren knotigen Fingern aufblitzt, bevor sie sie wieder unter ihrem Umhang verschwinden lässt. Ich weiß, was es ist, auch wenn ich bezweifle, dass es sich um echtes Gold handelt. Wäre es echtes Gold, hätte es ihr schon jemand vom Hals gerissen. Bei allen Göttern, wäre es echtes Gold, hätte ich es vielleicht selbst getan. Echtes Gold wäre immerhin etwas wert.
Mein Freund Silas hat gelacht, als ich ihm erzählt habe, dass fast jeder im Dorf einen Talisman besitzt, um sich vor dem Schlafenden Prinzen zu schützen. Ich habe mit ihm gelacht, obwohl ich insgeheim zugeben musste, dass es gar nicht so seltsam ist, unter diesen Umständen an magische Kräfte zu glauben. Halbmonde aus Salzteig hängen beinahe an jeder Tür und in jedem Fenster des Dorfes, und Medaillons mit drei eingravierten goldenen Sternen stecken unter den Hemdkrägen der Bewohner. Schließlich umgibt den Schlafenden Prinzen selbst die Aura von Magie, von Mythen und Aberglauben.
Ich kann also durchaus verstehen, warum es den Leuten sinnvoll erscheint, im Kampf gegen ihn ebenfalls auf Magie, Mythen und Aberglauben zu setzen. Aber ich weiß tief in meinem Inneren, dass keine noch so hohe Zahl von billigen Blechanhängern ihn davon wird abhalten können hierherzukommen, wenn er will. Keine mit Salz bestreuten Türschwellen oder Zweige der heiligen Eiche oder der Winterpalme, die man über Fenster und Pforten hängt, werden ihn aufhalten, wenn er sich dazu entschließt, Tregellan zu erobern. Wenn eine Burg voller Soldaten ihn nicht stoppen konnte, wird es Metallscheiben und Ästen auch nicht gelingen.
Vor seiner Rückkehr hätte in Tregellan kaum jemand seine Hoffnung auf derartig kindische Bräuche gelegt; das ist ganz untypisch für unser Land. Gewiss gibt es noch den ein oder anderen, der an die Eiche und die Winterpalme glaubt und sich zu jeder Sonnenwende das Gesicht rot mit Beerensaft einfärbt; aber die meisten von uns leben ganz anders. Wir sind nicht wie die Menschen aus Lormere mit ihren Tempeln und ihren wiedergeborenen Göttinnen und ihrer unheimlichen Königsfamilie. Wir glauben an die Wissenschaft und die Vernunft. Zumindest habe ich das immer angenommen. Aber es ist wohl ziemlich schwierig, auf der Seite der Vernunft zu bleiben, wenn eine fünfhundert Jahre alte Sagengestalt zum Leben erwacht ist und das benachbarte Land samt seinem Schloss in Schutt und Asche gelegt hat.
Sei ein braves Mädchen, sonst kommt der Bringer, und dann wird der Schlafende Prinz dein Herz verschlingen.Das hat man den Mädchen in Tremayne stets eingeschärft. Er war ein Ungeheueraus den Märchen, aus einer Geschichte, die man uns erzählt hat, damit wir gehorsam bleiben – als Warnung vor der Gier nach Macht. Wir haben es nicht im Traum für möglich gehalten, dass er tatsächlich erwacht. Wir hatten vergessen, dass es ihn wirklich gegeben hat.
Ich wende mich von meiner Sitznachbarin ab und gehe im Geiste durch, wer noch übrig geblieben ist in Almwyk. Dabei fange ich versehentlich den Blick eines der Soldaten auf. Er nickt mir zu und die Beklemmung in meiner Brust wird stärker. Ich nicke kurz zurück und beende den Blickkontakt, versuche, ruhig zu bleiben und dem Drang zu widerstehen, in meine Tasche zu greifen und zu überprüfen, ob die Phiole noch da ist.
Ich bin einfach nicht zur Schmugglerin geboren. Auf dem Weg hierher habe ich mindestens sechs Mal nach der Phiole gegriffen, obwohl mir keine einzige Menschenseele über den Weg gelaufen ist. Und erst recht ist niemand nahe genug gekommen, um sie mir aus der Tasche zu entwenden. Andererseits kann man gar nicht vorsichtig genug sein in Almwyk.
Dies ist schließlich kein Dorf, in dem man mit seinen Nachbarn freundlichen Umgang pflegt. Bittet man hier um Hilfe oder zeigt irgendeine Schwäche, wird man im besten Fall ausgelacht. Im schlimmsten Fall aber, wenn man zur falschen Zeit den Falschen bittet, bekommt man ein Messer zwischen die Rippen. Bevor die Soldaten hier aufgetaucht sind, konnte man manchmal beobachten, wie eine Leiche in den Wald geschleift wurde. Wir alle haben die Augen davor verschlossen. Hier lernt man schnell, blind zu sein.
Die baufälligen Hütten, aus denen Almwyk besteht, werden von den Verzweifelten und Ausgestoßenen bewohnt, von denen, die ihr wahres Zuhause und ihr früheres Leben in anderen Teilen Tregellans aufgeben mussten – aus Angst, für ihre Verbrechen verurteilt zu werden. Die Leute behaupten immer, in Zeiten großer Not, wenn Krieg herrscht oder schlimme Seuchen grassieren, würden die Menschen zusammenrücken, einander unterstützen. Nicht in Almwyk. Seit der Krieg immer näher kommt, sind mehr und mehr Häuser verlassen worden, und die Hiergebliebenen haben geplündert, was immer sie gebrauchen konnten. Ich wette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Aasgeier auch vor den bewohnten Häusern nicht mehr haltmachen werden. Ich lasse meinen Blick durch den Raum wandern und überlege, von welchem der Anwesenden wohl die größte Bedrohung ausgeht.
Das ist ein Spiel, das ich manchmal spiele: Ich stelle mir vor, welche Verbrechen die Leute begangen haben, die noch hier leben. Die schlimmsten unter ihnen – die Mörder etwa – haben sich sofort aus dem Staub gemacht, als die Soldaten aufgetaucht sind. Übrig bleiben also die Schuldner, die Trinker, die Süchtigen, die Spieler und Lügner. Die Armen und Unglücklichen. Diejenigen, die nicht wegkönnen, weil man sie nirgendwo anders aufnehmen würde.
Das hier ist kein Ort, an den man kommt, um zu leben; hierher kommt man, um zu verrotten.
Unter meinem ausgefransten Umhang balle ich die Fäuste und sehe zu, wie mein Atem in der kalten Luft eine Wolke bildet, die sich mit dem Atem all der anderen verbindet und die klamme Feuchtigkeit verstärkt, die uns in diesem Raum umgibt. Die dicken Glasfenster sind beschlagen, und es gefällt mir gar nicht, dass sogar die Luft, die ich hier atme, gebraucht ist oder gestohlen. Das Atmen fällt mir sowieso schon schwer genug.
Es sieht so aus, als wären mittlerweile alle eingetroffen. Verstreut wie Rosinen in einem Pudding sitzen sie im Raum herum, als Chanse Unwin in den Saal marschiert und mit geschwollener Brust von einem zum anderen blickt. Er ist gewiss der absurdeste Richter des Reiches. Als sich sein Blick auf mich richtet, lässt er zum Gruß ein halbes Lächeln sehen, das sich sofort wieder in ein besorgtes Stirnrunzeln verwandelt. Eigentlich ist es eher eine Parodie davon. Mir läuft es eiskalt den Rücken herunter. Er wird von zwei grimmig dreinblickenden Soldaten in grünen Uniformen flankiert, die bis eben noch die Tür bewacht haben. Merkwürdigerweise ist ihr Hauptmann bei ihnen, der an der roten Schärpe erkennbar ist, die er über der breiten Brust trägt. Als ihnen sechs weitere Soldaten folgen und sich an den Ecken des Saales positionieren, nimmt die Anspannung im Raum spürbar zu.
Sofort richte ich meinen Oberkörper auf. Wie ein Hase auf dem Feld hocke ich da, und um mich herum nehmen auch alle anderen Haltung an. Selbst die Frau, die mich eben noch angeschnauft hat, strafft ihren Buckel, um mit scheelem Blick zu Unwin hinüberzustarren. Während meine Hand zum Gürtel fährt, um zu überprüfen, ob mein Messer an Ort und Stelle ist, sehe ich, dass auch andere Hände an Stiefelschächte und Mieder greifen. Alle wollen sichergehen, dass sie ihre Waffen griffbereit haben.
Ganz gleich, zu welchem Zweck diese Versammlung einberufen wurde, Unwin geht offenbar davon aus, dass wir die Neuigkeiten schlecht aufnehmen werden. Mir rutscht das Herz in die Kniekehlen, denn eigentlich gibt es nur eines, was uns zu diesem Zeitpunkt rebellisch machen könnte. Die ohnehin schon drückende Luft schnürt mir die Kehle zu.
Chanse Unwin schaut sich noch einmal im Saal um und mustert uns, bevor er seine Handflächen zueinanderführt. »Ich habe Neuigkeiten vom Rat in Tressalyn«, sagt er mit salbungsvoller Stimme. »Und sie sind nicht gut. Vor drei Nächten haben die Golems des Schlafenden Prinzen die Stadt Haga in Lormere angegriffen. Sie haben die beiden dortigen Tempel zerstört und keine Überlebenden zurückgelassen. Sie haben alle niedergemetzelt, die sich weigerten, vor dem Prinzen auf die Knie zu gehen, gute vierhundert Menschen. Dieser Angriff folgt der Zerstörung der Tempel in Monkham und Lortune, und damit steht sein Heer nun keine fünfzig Meilen entfernt von der Grenze, die uns von Lormere trennt. Wenn er seinen bisher eingeschlagenen Kurs nicht ändert, geht der Rat davon aus, dass er als Nächstes auf Chargate vorrückt.«
Alle blicken einander mit erhobenen Augenbrauen an. In diesem Augenblick sind all ihre großen und kleinen Fehden plötzlich vergessen und ein allgemeines Murmeln setzt ein. Ich schaue niemanden an. Stattdessen umklammere ich den Griff meines Messers und atme tief ein. Chargate befindet sich auf der anderen Seite des Waldes, es ist Almwyks Gegenpart auf der lormerianischen Seite. Würden die Golems dort angreifen, wären sie nur noch wenige Stunden von uns entfernt.
Unwin räuspert sich und das Raunen im Saal verebbt. »Der Rat lässt verlauten, dass seine Versuche, mit dem Schlafenden Prinzen zu verhandeln, gescheitert sind. Er hat sich rundheraus geweigert, ein Friedensabkommen mit Tregellan zu unterzeichnen, und er leugnet nicht, dass er vorhat, seine Eroberungen fortzusetzen.« Unwins Blick huscht kurz zum Hauptmann hinüber, der bloß verächtlich grinst. Ich frage mich, was Unwin uns verschweigt. »Daher«, fährt Unwin fort, »hat der Rat eine Notstandssitzung einberufen und einhellig beschlossen, dass wir keine Wahl haben und in Tregellan den Kriegszustand ausrufen müssen.«
Er macht eine dramatische Pause, als würde er unseren Protest erwarten. Aber wir sagen und tun gar nichts, sitzen bloß mit versteinerten Mienen da. Wir sparen uns unsere Reaktionen auf, bis er zu dem Punkt kommt, der uns wirklich betrifft. Warum sonst sollte er fünfzehn der neu eingezogenen Männer aus Tregellans Heer in einem Saal aufmarschieren lassen, in dem wir gerade so die Überzahl bilden.
Nach einer Pause fährt er fort: »In der vergangenen Nacht hat das tregellianische Heer die Grenze vom Fluss Aurmere bis zu den Klippen von Tressamere gesichert. Einschließlich des Ostwaldes.« Er hält inne, und plötzlich verengt sich die ganze Welt auf diesen einen Raum und auf die folgenden Worte. Sag’s nicht. Ich konzentriere mich, so fest ich kann. Sag’s nicht.
»Jeder Handel und jeder Verkehr mit Lormere ist von nun an untersagt. Die Grenze ist geschlossen. Jeder, der bei dem Versuch ertappt wird, sie zu überschreiten, wird ohne Warnung getötet.«
Wir atmen alle gleichzeitig scharf ein, nehmen dem Raum noch die letzte Luft.
»Angesichts seiner strategisch wichtigen Lage ist das Dorf zum Heeresstützpunkt bestimmt worden, als Hauptquartier für die Garnison, die die Grenze verteidigt. Almwyk wird dementsprechend evakuiert. Und zwar unverzüglich.«
Nein. Es dauert einen kurzen Augenblick, bis die Neuigkeiten in den Köpfen derjenigen ankommen, die um mich herum im Saal sitzen.
Und dann bricht die Hölle los.
Kapitel 2
Von der Versammlung hatte ich an diesem Morgen erfahren, kurz vor Sonnenaufgang, als Chanse Unwin an meine Tür klopfte. Ein oder zwei Stunden zuvor war ich endlich eingeschlafen, und wieder hatte ich von dem Mann geträumt. Diesmal standen wir auf der Brücke, die über den Fluss führt, in der Nähe meines alten Zuhauses in Tremayne. Es war Sommer; unter uns im Wasser schossen kleine Fische hin und her, und die Sonne brannte auf uns herab, sodass mir der Kopf regelrecht glühte. Ich trug das alte Gewand aus meiner Lehrzeit. Mein Kleid war blau und sauber und die vielen Taschen meiner Schürze waren voll mit kleinen Fläschchen und Pflanzen und Pulvern. Ich konnte sie riechen, das würzig scharfe Aroma von Rosmarin, Weidenrinde und Kiefer: heimatliche Düfte nach Wissen, nach Arbeit und Glück. Ich griff in eine der Taschen und spürte zwischen meinen Fingern die getrockneten Blätter, während ich seinen Worten lauschte.
Er war groß, dünn und trotz des warmen Wetters hatte er sich die Kapuze seines Umhangs übergeworfen. Er beugte sich beim Sprechen vor und kam mir sehr nahe, während er mir eine Geschichte erzählte. Dabei fuhren seine Hände anmutig durch die Luft, um seine Worte zusätzlich auszuschmücken. Die Worte verloren sofort ihren Sinn, wie so oft in Träumen, aber die Gefühle, die sie in mir erweckten, blieben, und ich wusste, dass er sie gewählt hatte, um mich zum Lachen zu bringen. Und ich lachte so sehr und aus vollem Hals, dass ich mir den Bauch halten musste. Sie tat weh, diese Freude. Das schien ihn zu freuen, er lächelte, und das machte es nur umso schöner.
Als ich schließlich zu lachen aufhörte, sah ich, wie er in seinem Umhang wühlte. Er zog eine kleine Puppe hervor und schob sie über den steinernen Brückenrand auf mich zu. Ich griff danach, fuhr mit den Fingern darüber. Ich hörte, wie er eine Art Keuchen ausstieß, und nun tat mir der Bauch auf andere Art weh.
»Was ist das?«, fragte ich und schaute die winzige Figur an.
»Das bist du«, erwiderte er. »Ich trage dich gern bei mir. Ich habe dich gern dicht bei mir. Damit ich auf dich aufpassen kann.«
Dann nahm er mir die Puppe aus meinen Armen, wo ich sie eben noch gewiegt hatte, und ließ sie in den Falten seines Umhangs verschwinden. Ich sah ihm zu und mein Herz schlug doppelt so schnell wie sonst. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, merkte aber, dass er mich ansah. Ich errötete, worauf er noch einmal sanft lächelte. Seine Lippen teilten sich und er befeuchtete sie mit der Zunge.
Das Klopfen meines Herzens wurde noch lauter, als er mir näher kam, bis es sich plötzlich in das Hämmern an unserer Haustür verwandelte und mich aus meinem sommerlichen Traum riss. Jetzt hörte ich, wie der Regen gegen die hölzernen Fensterläden prasselte. Der Schmerz in meinem Bauch kam nicht vom Lachen, sondern vom Hunger, und der Traum zerstob endgültig wie ein zerrissenes Spinnennetz. Ich war todunglücklich und erleichtert zugleich. Es war ein bittersüßes Gefühl, hier, im winterlichen Almwyk, an Tremayne im Sonnenschein zu denken.
Ich streckte mich und rappelte mich von meinem Schlaflager auf. Eine der Decken wickelte ich als notdürftigen Umhang um mich und schlug mir mit einem dumpfen Knall das Knie an einem Tischbein. Kurz fluchte ich, während, rhythmisch wie ein Puls, weiter an der Tür gepocht wurde.
Als ich sie öffnete, stand – bleich, die fleischigen Lippen zu einem Grinsen verzogen – Chanse Unwin vor mir und musterte mich von Kopf bis Fuß. Meine Haut kribbelte, als er meinen Körper mit seinen Blicken abtastete.
»Guten Morgen, Errin, habe ich dich geweckt?«
»Natürlich nicht, Mr Unwin.« Ich lächelte starr.
Sein Grinsen wurde breiter. »Gut, gut. Es wäre mir gar nicht lieb, wenn ich euch Unannehmlichkeiten bereiten würde. Kann ich mit deiner Mutter sprechen?«
»Ich fürchte, sie ist nicht da.«
Er spähte an mir vorbei, als würde sie sich womöglich hinter mir verstecken.
»Nicht da?« Er nickte der Sonne zu, deren allererste Strahlen hinter den Bäumen des Ostwaldes hervorleckten. »Aber die Ausgangssperre ist kaum vorbei. Ich hätte sie doch gesehen, wenn sie gerade erst fortgegangen wäre.«
»Ist mir ein Rätsel, dass Ihr sie nicht gesehen habt«, entgegnete ich geistesgegenwärtig. »Sie ist gerade aufgebrochen, kurz bevor Ihr geklopft habt. Ich dachte, sie hätte selbst geklopft, weil sie etwas vergessen hat.«
»Und doch kommst du an die Tür und bist noch gar nicht angekleidet.« Er grinste mich lüstern an und nutzte noch einmal die Gelegenheit, seinen Blick über meinen Körper wandern zu lassen.
Ich zog die Decke enger um mich. Ich weiß, dass Unwin schon gute zwanzig Jahre in Almwyk lebt – und ich kenne auch die Klatschgeschichten, die man sich am Dorfbrunnen über ihn erzählt. So respektabel er auch auftritt, es ist allgemein bekannt, dass er aus demselben Grund hierhergekommen ist wie wir alle – er hatte keine andere Wahl und war nirgendwo sonst mehr willkommen. Es heißt, er habe Almwyk aus den Ruinen eines alten königlichen Jagddorfes neu aufgebaut, indem er erst einen Umschlagplatz für den Schwarzmarkt daraus gemacht hat, der später zu einem Dorf angewachsen ist. Als eines Tages die Abgesandten der Obrigkeit vor der Tür standen, tat er alles, um den reuevoll Zerknirschten zu spielen. Er nahm Bedürftige im Dorf auf, ohne viel Geld von ihnen zu verlangen, sodass er sie gleichzeitig unter Kontrolle halten konnte. Und er wurde zum Richter von Almwyk.
»Es überrascht mich, dass du die Tür geöffnet hast; es hätte ja jeder davorstehen können. Dies sind harte Zeiten, die Menschen haben nichts zu verlieren … Soldaten, die viele Meilen von ihrer Heimat entfernt sind, von ihren Mädchen. Flüchtlinge, die sich nehmen, was sie kriegen können.«
Ich sagte nichts. Ich konnte nicht. Aber ich vermute, mein Gesicht sprach Bände.
»Jetzt empfindest du für diese Menschen vielleicht noch Mitleid, aber wenn sie erst mal frieren und hungern und die Nacht heranbricht …« Unwin beugte sich vor. »Du hast keinen Schutz.« Er blickte zum Türsturz hinauf, bevor er eine Handvoll Beeren und eine goldene Scheibe aus seiner Tasche zog und mir entgegenstreckte. »Das hilft gegen alle möglichen Angreifer. Und gegen den Schlafenden Prinzen.«
Ich glaubte nicht, dass Unwin mehr Vertrauen auf solche Talismane und Amulette legte als ich, aber das behielt ich für mich. »Ihr seid sehr freundlich, aber ich möchte nicht, dass Ihr selbst verletzbar werdet.«
»Ich würde gern hereinkommen und mit dir warten, bis deine Mutter zurückkehrt. So könnten wir beide von dem Schutz profitieren, den meine Talismane bieten.«
Es kostete mich einige Anstrengung, höflich zu bleiben. »Habt vielen Dank für Euer großzügiges Angebot, aber ich möchte Euch nicht Eure Zeit stehlen. Außerdem habe ich heute Morgen noch Besorgungen zu machen. Ich muss mich jetzt auch wirklich beeilen. Auf Wiedersehen also.« Ich begann, die Tür zu schließen, aber er stellte seinen Fuß in den Spalt.
Seine Augen wurden schmaler, bis sie nur noch Schlitze über seinen geröteten Wangen waren. Er steckte sein Amulett wieder ein. »Es ist doch alles in Ordnung bei euch, oder?«, fragte er. »Ich nehme an, du hast nichts von deinem Bruder gehört? Du kannst mir vertrauen, das weißt du. Ich bin dein Freund. Und der Freund deiner Mutter. Ich würde euch gerne helfen, du musst mich nur bitten.«
»Schon gut, Mr Unwin. Alles ist in Ordnung. Meine Mutter ist einfach nur sehr beschäftigt, das ist alles.«
»Offensichtlich. Es ist gewiss Wochen her, dass ich sie das letzte Mal zu Gesicht bekommen habe. Monde gar. Aber ich bin sicher, die heutige Versammlung will sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.«
Mein Magen krampfte sich zusammen. »Eine Versammlung?«
Theatralisch schlug er sich mit der Hand vor die Stirn. »Habe ich das noch gar nicht erwähnt? Herrje, was bin ich zerstreut! Ich habe Nachricht erhalten vom Rat in Tressalyn. Sie haben einen Boten mit einer wichtigen Bekanntmachung geschickt. Und jetzt sage ich rasch allen Bescheid, dass sie ins Gericht kommen sollen, wo ich die Neuigkeiten verkünden werde.«
»Dann darf ich Euch auf keinen Fall länger aufhalten.«
Sein Gesicht verzog sich empört, und ich wusste, dass ich zu weit gegangen war. Ich war nie gut darin gewesen, meine Zunge im Zaum zu halten. Aber es dauerte nur Sekunden, bis er sich wieder in der Gewalt hatte. Die geplatzten Adern auf seinen Wangen tanzten, als sich seine Lippen zu einem Grinsen verzogen.
»Du bist zu gütig. Aber reichlich forsch. Ungewöhnlich bei einer so jungen Frau. Ist sicher nicht nach jedermanns Geschmack. Ich bewundere das allerdings. Ich finde deine Direktheit erfrischend. Ich bin überzeugt, dass du diese Eigenschaft auch bei anderen zu schätzen weißt, also werde ich nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ich bin auch wegen der Miete hier. Ihr schuldet mir immer noch zwei Florins von letztem Mond. Ich dachte, ich erspare dir die Mühe, sie mir extra vorbeizubringen, da ich ja ohnehin meine Nachricht auszurichten hatte.«
»Natürlich«, erwiderte ich. »Das habe ich nicht vergessen. Genau das hat ja meine Mutter heute so früh aus dem Haus geführt. Da seid Ihr wohl aneinander vorbeigelaufen.«
»Ich fürchte es«, sagte er finster. »Trotzdem gehe ich davon aus, euch beide bei der Versammlung zu sehen. Die vier Florins kannst du mir ja dann anschließend geben.«
»Vier? Die Miete beträgt zwei.«
»Zinsen, Errin. Leider musste ich mir Geld borgen, um eure letzten Ausstände zu decken. Ich habe auch Verpflichtungen, weißt du. Also brauche ich diesmal etwas mehr. Du verstehst das, da bin ich ganz sicher. Nicht viele Hauswirte würden ihre Mieter bleiben lassen, wenn sie die Miete nicht bezahlen. Aber, wie ich schon sagte, ich bin euer Freund.« Er hatte ein widerwärtig triumphierendes Grinsen aufgesetzt. »Ich will euch nur helfen, sonst nichts.«
Ich kochte vor Wut. Er log, nutzte schamlos die Tatsache aus, dass ich gerade in meine eigene Falle getappt war. Er wusste genau, dass ich kaum die zwei Florins abzweigen konnte, die ich ihm bereits schuldete.
»Das wird doch kein Problem sein, oder? Denn wenn doch, kannst du einfach mit mir reden. Wir können verhandeln.« Er leckte sich die Lippen, und nun war ich doch dankbar für meinen leeren Magen.
»Es ist schon in Ordnung, Mr Unwin. Ich bin mir sicher, meine Mutter hat für alles gesorgt.«
Unwins Lächeln erstarb und ein grässlicher Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Die Versammlung beginnt pünktlich um drei. Bis später also.« Er griff nach meiner Hand und zog sie sich an die Lippen, während er sich vor mir verbeugte.
Nachdem er meinen Körper noch ein letztes Mal taxiert hatte, wandte er sich ab und ich schloss die Tür. Ich lehnte mich dagegen und lauschte, wie sich seine Schritte entfernten. Ich erschauderte.
Vier Florins. Einer war immer noch im Topf versteckt. Unser letztes Geld, zurückgelegt für Notfälle. Immerhin gab es Silas. Ich musste ihn vor der Versammlung finden. Mit etwas Glück würde er eine weitere Bestellung aufgeben und mich im Voraus bezahlen.
Aber meine Erleichterung wurde gleich wieder im Keim erstickt, als es neuerlich an der Tür hämmerte. Diesmal war es die andere Tür. Die zum Schlafzimmer.
Als ich sie öffnete, wurde ich beinahe am Kopf getroffen, da mir irgendetwas aus dem dunklen Raum entgegengeschleudert wurde. Ich duckte mich, aber nicht schnell genug. Der Nachttopf aus Emaille erwischte mich noch an der Schulter, und schon triefte die Decke, mit der ich mich noch immer einhüllte, vor Urin. Meine Mutter lag zusammengekauert auf dem Bett und fletschte die Zähne. Ihre Augen funkelten wild und blutunterlaufen, als sie sich bereit machte, mir entgegenzuspringen.
»Mama?«, sagte ich leise.
Gerade noch rechtzeitig schloss ich die Tür. In dem Augenblick, da das Schloss einrastete, warf sie sich von innen dagegen. Ich drehte den Schlüssel um, während sie gegen das Holz hämmerte, und ging dann auf wackligen Beinen in die Küche.
Das war knapp.
Ich wartete, bis die Sonne vollständig aufgegangen war, bevor ich zu meiner Mutter zurückkehrte. Ich fand sie zwischen dem Bett und der Wand, wo sie zusammengekauert lag und schweigend an mir vorbeistierte.
»Mama?«, Langsam ging ich auf sie zu, achtete aber darauf, rasch zur Tür entkommen zu können, falls immer noch Gefahr von ihr ausging. Sie hatte mich schon oft genug getäuscht.
Ich hob sie sanft hoch, bis sie aufrecht stand. Sie fühlte sich so zerbrechlich an in meinen Armen. Die Binsen auf dem Boden raschelten leise, als ihre Füße hindurchschleiften. Eigentlich mussten sie dringend erneuert werden, aber unser Erspartes ließ nicht einmal das zu. Ich setzte meine Mutter im ramponierten Schaukelstuhl ab und holte frisches Wasser und einen Lappen.
Ganz gleich, wie oft ich es tat, jedes Mal fühlte es sich merkwürdig an, sie zu waschen. Ihre Haut war dünn wie Papier und verzog sich, wenn ich mit dem Lappen darüberfuhr. Die Kratzer auf ihrem Unterarm waren verheilt, hinterließen aber ein Muster silberner Narben, die im Kerzenschein leuchteten. Ich tupfte sie mit besonderer Sorgfalt ab, versuchte aber, nicht hinzuschauen.
Als ich ihre Arme hob, um ihr ein sauberes Nachthemd überzustreifen, hielt sie sie gehorsam oben. Manchmal lässt sie es zu, dass ich sie hin und her bewege wie eine Puppe.
Mir ist es lieber, wenn sie sich wehrt.
Es war einmal, vor langer Zeit, da lebte ein junges Mädchen, das bei einem Herbalisten in die Lehre ging, auf einem Backsteinbauernhof mit goldenem Strohdach, der umgeben war von grünen Feldern. Sie hatte einen Vater, der sie »kluges Mädchen« nannte und ihr ihren eigenen Kräutergarten anpflanzte, und eine Mutter, die gesund war und freundlich. Sie hatte auch einen Bruder, der wusste, wie man lacht.
Doch dann hatte ihr Vater eines Tages einen Unfall, und obwohl sie alles tat, um ihn zu retten, starb er. Und mit ihm all ihre Hoffnungen und Träume. Der Bauernhof – Heim ihrer Familie seit Generationen – wurde verkauft. Ihre Mutter sank in sich zusammen, ihr braunes Haar wurde grau, und sie ließ sich nach Almwyk kutschieren wie ein Geist, ohne sich zu beschweren, ohne etwas zu empfinden. Und ihr Bruder, der einst so impulsiv und voller Lebensfreude gewesen war, wurde kalt und hart und sein Blick wandte sich voller Hass nach Osten.
Hätte mir jemand vor sechs Monaten erzählt, bevor mein Leben mir durch die Finger zu rinnen begann wie Wasser, dass meine Mutter einem Fluch zum Opfer fallen würde, dass ich sie einsperren und mit Tränken betäuben müsste, ich hätte bloß gelacht. Und dann hätte ich demjenigen wohl einen Tritt versetzt für die Beleidigung und nur noch lauter gelacht. Vielleicht hätte ich schon früher daran glauben sollen, dass Märchen wahr werden können. Heute glauben wir alle daran.
Der Scharlachrote Varulv hat sich aus den Seiten meines Buches befreit und lebt nun mit mir in dieser Hütte. Der Schlafende Prinz ist erwacht und hat Lormere erobert, mit einem Heer aus Golems, die von den Alchemisten erschaffen wurden und hinter ihm marschieren, während er mordend durch das Land streift. Legenden sind nicht mehr bloß Legenden, ihre Geschöpfe laufen mit einem Mal lebendig durch unsere Welt. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass der Handlose Mully an mein Fenster klopft und um Einlass bittet, um sich zu wärmen.
Nein, das ist nicht wirklich das, worauf ich warte.
Der neue König, Merek vom Hause Belmis, wurde getötet, bevor er Gelegenheit hatte, sich die Krone auf den Kopf zu setzen, genau wie alle anderen, die sich weigerten, dem Schlafenden Prinzen Gefolgschaft zu schwören.
Ich habe König Merek in Fleisch und Blut gesehen, vor etwas weniger als einem Jahr, als er noch Prinz war. Mit einem Gefolge stolzer junger Männer war er durch meine alte Heimat Tremayne geritten. Meine Freundin Lirys und ich tauschten beeindruckte Blicke aus, und unsere Wangen leuchteten so rot, dass mein Bruder erst uns böse anschaute und dann den Prinzen auf seinem weißen Pferd. Er war schön, dieser Prinz Merek, fast zu schön, mit den dunklen Locken, die locker sein Gesicht umspielten, während er denjenigen zunickte, die Blumen und Münzen auf seinen Weg warfen. Wir in Tregellan hatten unsere eigene Monarchie längst abgeschafft, dem zukünftigen König von Lormere aber jubelten wir gerne zu. Er sah aus, wie ein Prinz aussehen sollte.
Bevor die Soldaten bei uns ankamen, habe ich oft mit den Flüchtlingen aus Lormere gesprochen, die auf ihrem Weg nach Tyrwhitt durch unser Dorf zogen. Sie haben mir erzählt, dass der Kopf des Königs nun einer von vielen ist, die aufgespießt auf Speeren über dem Haupttor aufragen, das nach Lortune führt. Ich weiß ja, dass es nichts bringt, sentimental zu werden, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sein hübsches, hoffnungsvolles Gesicht nun schlaff über ein Königreich hinwegblickt, das er niemals regieren wird, umgeben von den Köpfen derjenigen, die ihm bis zum Schluss treu geblieben sind. Und ich weiß nicht, ob einer dieser Köpfe Lief gehört.
Jeden ausgemergelten Flüchtling, mit dem ich sprechen konnte, habe ich gefragt, ob er etwas von einem Tregellianer gehört habe, der in Lortune vom Schlafenden Prinzen getötet wurde. Oder ob ein Kopf, der meinem ähnlich sieht, neben dem des Königs über den Toren aufragt. Ob sie von einem Tregellianer gehört haben, der gefangen genommen und festgehalten wurde. Oder der sich irgendwo versteckt. Denn ich kann nicht glauben, dass mein Bruder tot ist. Lief hätte alles unternommen, um am Leben zu bleiben. Hätte der Schlafende Prinz ihn aufgefordert, sich zu ergeben, um seinen Hals zu retten, er hätte es getan. Er wäre niedergekniet und hätte auf den richtigen Moment gewartet, um zu entkommen. Er war raffiniert – ist raffiniert. Er muss irgendwo in der Falle stecken. Vielleicht ist er krank oder verwundet oder wartet bloß auf einen sicheren Moment, um sich aus dem Staub zu machen.
Die Familie kommt an erster Stelle, hat Papa immer gesagt. Er erinnerte uns daran, wie seine Großmutter ihre Söhne mit sich fortgenommen hat vom alten Schloss Tregellan in der Nacht, da sich das Volk gegen die Königsfamilie erhob und sie tötete. Unsere Urgroßmutter war Hofdame bei der Königin gewesen und die Frau des Oberkommandanten des Heeres. Als sie die Menschen an den Toren hörte, verließ sie ihre Kammer, holte ihre Kinder und floh. Floh vor ihrem alten Leben und begann ein neues in Sicherheit. Andere Menschen kommen und gehen, aber die Familie bleibt für immer.
Lief hat es genauso gemacht. Er ist mit uns fortgezogen, damit wir am Leben bleiben. Und er musste nach Lormere gehen, weil uns nichts mehr geblieben war. Wir haben alles verkauft, um unsere Schulden zu begleichen, und Tremayne verlassen. Diese Hütte, dieser zugige, dreckige, viel zu enge Unterschlupf und die Apathie unserer Nachbarn sind das Einzige, was mich und meine Mutter schützt, während wir darauf warten, dass Lief nach Hause kommt. Und nun soll uns auch das noch genommen werden. Nun können wir uns nirgends mehr verstecken.
Und ein Versteck brauchen wir, denn wenn sich der Mond rundet, wenn er fett und schwer wird, verwandelt sich meine Mutter, die früher so zart und ruhig und liebevoll war, in ein Ungeheuer mit roten Augen und Klauenhänden, das mir durch die geschlossene Tür zuflüstert, auf welche Arten sie mir wehtun will.
Doch wenn sie das Ungeheuer in sich hat, kann sie mich wenigstens sehen. Sie kann mich hören. Wenn sie meine Mutter ist, bin ich bloß ein Gespenst für sie. Wie mein Vater und mein Bruder, nur dass ich noch lebe. Ich bin immer noch da.
Kapitel 3
Siebzehn wutentbrannte Dorfbewohner sind auf die Füße gesprungen, brüllen und drohen mit den Fäusten. Einige umklammern ihre Amulette, andere schwenken sie. Ihr Protest ist kaum zu verstehen, abgesehen von einigen Flüchen. Der Raum, der mir so groß vorkam, als ich ihn betrat, fühlt sich jetzt eng und gefährlich an. Ich mache mich klein auf meinem Platz und meine Hand fährt zu der Phiole in meiner Tasche. Die Soldaten drängen die Leute, sich wieder hinzusetzen und zuzuhören. Unwin schlägt mit der Faust aufs Podium, fordert Ruhe im Saal, aber das alles geht an mir vorbei. Meine Ohren sind erfüllt vom Rauschen meines eigenen Blutes und meine Finger umklammern die Kante der Bank.
Ich kann Almwyk nicht verlassen. Ich habe kein Geld, ich kann nirgendwo hin. Ich muss auf meinen Bruder warten. Wenn wir von hier fortgehen, findet er uns womöglich nicht wieder. Vor allem aber kann ich nicht weg wegen meiner Mutter. Denn ich kann sie nicht aus dem Haus schaffen, ohne dass sie jemand sieht. Und man darf sie nicht sehen. Nicht in ihrem Zustand.
Die Soldaten schaffen es schließlich doch noch, für Ordnung zu sorgen, aber die Stimmung ist alles andere als friedlich. Aufgebrachtes Murmeln geht durch die Reihen wie Donnergrollen. Unwin blickt mit aufgesetztem Mitleid auf uns herab.
»Ich verstehe, dass es euch aufregt, eure Häuser verlassen zu müssen«, sagt er mit einschmeichelnder Stimme. »Im Beschluss des Rates heißt es, dass ihr bevorzugt in dem neuen Flüchtlingslager vor Tyrwhitt aufgenommen werdet, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingehen könnt. Man wird euch dort keine Fragen stellen. Denkt nur daran, die von mir abgestempelten Papiere bereitzuhalten, damit sie dort wissen, dass ihr aus Tregellan seid und nicht aus Lormere kommt und Asyl sucht.«
»In solchen Lagern sind wir nicht sicher!« Eine dünne Stimme erhebt sich in der Mitte des Raumes – der alte Samm, nehme ich an, ein unverbesserlicher Spieler, aber ein ziemlich netter Mann. »Wie sollen wir denn den Winter in Zelten überleben, ganz zu schweigen von einem Winter, in dem uns der Schlafende Prinz angreift?«
»Selbstverständlich könnt ihr auch anderswo hingehen, wenn ihr wollt, das gesamte Reich steht euch offen.« Unwin grinst. »Die Lager sind ja lediglich eine Möglichkeit für diejenigen, die nicht wissen, wohin, und nicht wegen Landstreicherei ins Zuchthaus kommen wollen.«
Wieder sieht es aus, als könne jeden Augenblick der Aufruhr losbrechen. Unwin weiß genau, dass keiner von uns hier leben würde, wenn wir woanders hingehen könnten.
»Das war’s also?«, fährt der alte Samm fort. »Wir werden einfach rausgeworfen, ohne jeden Schutz?«
»Es herrscht Krieg«, entgegnet Unwin großspurig und schaut zu den Soldaten hinüber, versucht eifrig, Blickkontakt mit ihnen herzustellen. Dass sie keine Miene verziehen und ihm nicht zustimmen, macht sie mir etwas sympathischer. »Es herrscht Krieg«, wiederholt Unwin. »Wir müssen alle Opfer bringen. Von Almwyk aus wird von nun an ganz Tregellan verteidigt, und zwar von unseren besten Männern.«
»Wie sollen die uns vor Golems schützen?«, fragt der alte Samm und wieder schaut Unwin Hilfe suchend zu den Soldaten hinüber. Aber es ist zu spät. Die Erwähnung der Golems lässt den ganzen Raum erbeben, und plötzlich sind wieder alle auf ihren Füßen. »Wie sollen sie uns gegen Ungeheuer verteidigen, die man nicht töten kann? Sie sind drei Meter groß und aus Lehm. So junge Burschen werden sie nicht aufhalten.« Seinen Worten folgt eine ganze Flut anderer Stimmen, und sie alle sind wild vor Angst.
»Ich habe gehört, der Schlafende Prinz kann einen Menschen zu Stein erstarren lassen, wenn er ihn nur anschaut. Stimmt das? Erschafft er sich so sein Heer? Besteht es aus Leuten, die er verzaubert hat? Werden uns unsere Amulette schützen?«
»Wir haben keine Tempel, uns lassen sie doch bestimmt in Ruhe, oder?«
»Ich habe gehört, dass man ihm junge Frauen geben muss als Steuer und dass er ihre Herzen auffrisst«, ruft eine Frauenstimme, schrill vor Angst.
»Na, dann hast du ja nichts zu befürchten, du bist ja seit dreißig Ernten nicht mehr jung«, blafft jemand in ihre Richtung.
»Wirken wenigstens die Beeren der Winterpalme?«, brüllt eine andere Stimme. »Müssen sie frisch sein? Wenn ich mir den Saft auf die Haut schmiere, wird ihn das abschrecken?«
»Können wir ihm nicht irgendwas anbieten? Haben wir nichts, was er haben will?«
Die Lautstärke steigert sich erneut, während die Leute ihre Fragen in den Saal rufen, um Antwort flehen oder wüste Beschimpfungen ausstoßen. Die Soldaten treten vor, die Hände auf den Griffen ihrer Schwerter, aber die Dorfbewohner lassen sich nicht einschüchtern. Ihre Stimmen werden lauter und lauter. Inzwischen stehen einige auf ihren Stühlen und ich kann es nicht mehr ertragen. Ich klettere über die Rücklehne der Bank, eile an der Wand entlang und husche zur Tür hinaus.
Ich halte inne und lehne mich an den Pranger, der vor dem Gerichtsgebäude steht. Mein Herz schlägt so schnell, dass mir ganz übel ist, und meine Haut wird abwechselnd heiß und kalt. Entsetzt stelle ich fest, dass die Sonne sich langsam dem Horizont entgegenneigt. Bald wird es dunkel. Ich muss das Beruhigungsmittel für meine Mutter mischen. Ich muss Silas finden und das Geld für Unwin beschaffen.
Ich brauche meinen Vater und meinen Bruder.
Nein. Ich dränge diesen Gedanken beiseite, während mein Herz kurz auszusetzen scheint. Nicht jetzt. Ich habe zu tun.
Aber mein Körper gehorcht mir nicht. Die Angst schnürt ein Korsett um meine Rippen und ich renne blindlings zurück zur Hütte. Dabei beachte ich nicht die starren Blicke der beiden Soldaten, die Richtung Wald marschieren.
Ich kann nicht atmen.
Als die Soldaten an mir vorbei sind, halte ich inne, drücke mir die Handballen gegen die Augen und versuche, mich zu beruhigen. Mein Kopf spuckt in rasender Geschwindigkeit Gedanken aus, die ich nicht festhalten kann: Könnte ich sie so weit betäuben, dass sie auf der ganzen Reise schläft? Auf der Reise wohin? Du kannst doch nirgends hin, hast nichts und niemanden. Könnte ich weiterhin so tun, als wäre sie krank, als hätte sie etwas Ansteckendes? Wir sind im Krieg, wir sind wirklich im Krieg. Wie lange könnten wir noch hierbleiben? Unmöglich, er ist weniger als fünfzig Meilen entfernt. Wir können nirgendwo hin. Wir müssen weg, wir können nicht weg. Wie soll Lief uns finden? Wir können ihn nicht zurücklassen.
Fünfhundert Menschen sind in Haga getötet worden, zuzüglich zu den dreihundert in Monkham. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele in Lortune gestorben sind oder in den kleineren Dörfern und Städten Lormeres. Als Lief damals dorthin aufgebrochen ist, kam es mir vor, als habe er eine halbe Weltreise gemacht, doch nun scheint es überhaupt keine Entfernung zu sein. Der Ostwald ist bloß eine geringe Barriere, die ein Heer von Golems mit Leichtigkeit niedertrampeln könnte.
Ich stelle mir die Köpfe von Leuten vor, die ich kenne, aufgespießt auf Speeren am Rande des Westwaldes. Unwin. Den aufgeregten alten Samm, die sauertöpfische Pegwin, die immer finster vor sich hin murmelt und in die Gegend stiert.
Silas.
Ich schlage mir die Hände vor den Mund und sehe ihn im selben Augenblick. Als hätten meine Gedanken ihn auf der Bildfläche erscheinen lassen. Im Schatten unserer Hütte lungert er herum, verborgen vor den Blicken der Soldaten und eingehüllt in seinen schwarzen Umhang. Silas Kolby. Wie immer ist sein Gesicht so weit von der Kapuze verdeckt, dass nur sein Mund sichtbar bleibt. Es sagt viel darüber, wie seltsam das Leben in Almwyk ist, dass mein einziger Freund ein junger Mann ist, dessen Gesicht ich noch nie gesehen habe, und dass mir das inzwischen völlig normal vorkommt.
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












