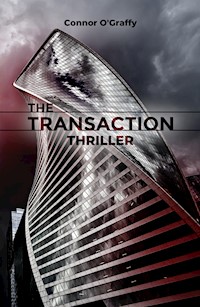
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Noch weiß es keiner. Die Prinz Hempel Bank ist durch unbedachte Kreditvergabe während des Dotcom-Hypes insolvent geworden. Eine schnelle Transaktion kann das vergessen machen. Es geht um alles. Doch sehr viele Kräfte wirken auf dieses Geschäft ein. Um sich einen Anteil daran zu sichern, schrecken die Beteiligten weder vor Intrigen, Betrug noch Mord zurück. Jeder will das Meiste. Egal wie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Connor O’Graffy
TheTransaction
Connor O’Graffy
TheTransaction
THRILLER
Impressum
© 2019 O’Graffy Connor
Umschlagbild: stockfresh (7091239) Umschlaggestaltung: Jonas Maus
Layout, Satz: Christiane Hunstein
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7469-9830-5
Hardcover
978-3-7469-9831-2
e-Book
978-3-7469-9832-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mit großem Dank für unentbehrliche Hinweise und freundschaftliche Hilfe an Melanie, Mona, Daniel, Reiner und Yannick.
Fiktion
Die vorliegende Geschichte ist frei erfunden, auch wenn real existierende Institutionen in ihrem Verlauf auftauchen. Äußerungen der Figuren oder deren Charakterzüge dienen rein dramaturgischen Zwecken und spiegeln nicht die Meinung des Autors oder gar die Wirklichkeit wider. Leibhaftig existierende Orte wurden ausschließlich zur Erzeugung von Tatsächlichkeit verwendet. Ähnlichkeiten zu existenten Ereignissen an einem dieser Plätze sind unumgängliche Imponderabilien.
Auch die beschriebenen Geschäftspraktiken haben keinerlei Vorbild. Selbst wenn Betrug, Intrigen und Mord Bestandteil menschlichen Seins sind, trug kein dem Autor bekannter Vorgang dazu bei, die vorliegende Erzählung zu beeinflussen. Ähnlichkeiten mit Ereignissen der Vergangenheit oder Gegenwart sind purer Zufall. Auch zukünftige Ereignisse sollen mit ›The Transaction‹ weder animiert noch vorhergesehen werden. Für eine Nachahmung durch Finanzinstitutionen übernimmt der Autor weder Verantwortung noch Haftung.
Die Sprache der Finanzindustrie ist Fach-Englisch und dies auf dem ganzen Erdball. Es wäre zu klären, ob die Verwendung einer einheitlichen – selbst für viele Experten intellektuell unzugänglichen – Fremdsprache helfen soll die Bedeutsamkeit dieses Industriesektors zu stärken oder ein globales gleichgeschaltetes Verstehen zu vereinfachen. Dennoch darf konstatiert werden, dass trotz der einheitlichen Fachsprache die letzte Finanzmarktkrise nicht verhindert werden konnte.
Für Krisen sind wohl weitere Aspekte verantwortlich: Arbeitsprozesse innerhalb eines Finanzinstituts oder die Motivation Geld zu machen. Selbst, wenn für die Erschaffung eines komplexen Finanzproduktes viele Abteilungen eines Hauses benötigt werden, bleibt die konkrete Umsetzung einer Aufgabe vor Schwesterabteilung verborgen. Die für diese Vorgänge verantwortlichen Sachbearbeiter wissen womöglich was sie tun, aber sie verstehen weder die Gesamtzusammenhänge noch kennen sie deren Auswirkungen. Sie arbeiten ausschließlich an der Optimierung ihrer Aufgabe. Das Endergebnis ist: trotz aller anderslautenden Beteuerungen, der Erfinder eines komplexen Finanzprodukts steht völlig im Nebel. Und auch wenn jeder glauben möchte, er sei Herr über seine Erfindungen, beweist er tagtäglich das Gegenteil.
Vermutlich ist eben das beste Vorgehen, will man große Geschäfte machen, Komplexität und Intransparenz aufzubauen. Undurchschaubare Produkte, viele beteiligte und global verteilte Institutionen, noch mehr Namen, die Behauptung unterschiedliche humanitäre Ziele erreichen zu wollen und dies alles in einer fremden Sprache, die nicht selbsterklärend ist. Eine horrende Menge an Informationen, die einen Überblick verwehrt. Nun kann isoliert und unangefochten Geld verdient werden. Genau das ist das vorrangige Ziel.
Ein glaubhaftes Innenleben der Finanzwelt darstellen zu wollen, impliziert die Anwendung dieser Elemente. Aber es geht eben auch benutzerfreundlich. Daher wird hier eine Schneise geschlagen. Zwar kommen Begrifflichkeiten vor, die für branchenfremde unbekannt sind. Aber es wurde davon abgesehen den Leser mit Fachausdrücken zu langweilen, die in einem Finanzinstitut täglich angewendet, aber dort weder vom Sender noch vom Empfänger begriffen werden.
Auch finden sich mehrere Protagonisten ein, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Doch der Leser bleibt mit einem Glossar und einem Personenregister immer auf der Höhe. Wann immer er vor einem Rätsel steht, kann er sich leicht Abhilfe verschaffen. So sollte es gelingen in die Welt der Finanzindustrie und des Verbrechens abzutauchen, ohne sich in ihr zu verirren. Denn auch dafür, dass sich ein Leser von ›The Transaction‹ angespornt fühlt, in dieser Dunkelheit zu verweilen, übernimmt der Autor keine Verantwortung und bietet mit diesen beiden Hilfsmitteln einen stets nutzbaren Anker, ein guter Mensch zu bleiben.
Mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht,solange ich das Geld kontrolliere.
Amschel Meyer Rothschild
Ich habe Wege, Geld zu machenvon denen du gar nichts weißt.
John Davison Rockefeller
1
Samstag, 20. März 2004, London, 7:20 Uhr, GMT
Sein Handywecker heulte schrill. Howard Hart begann den Tag mit einem zwiespältigen Gefühl. Große Nachrichten standen heute bevor, das ahnte er. Doch Howard konnte die unbestimmte Vermutung nicht abschütteln, dass diese News keine gänzlich positiven sein würden. Vielmehr befürchtete er, dass heute erstmals eine Grenze überschritten werden würde, die bislang unangetastet geblieben war.
Er griff nach dem auf dem Nachttisch liegenden Gerät und stellte den Wecker aus. Auf dem Display waren die Symbole für eine eingegangene SMS und einen Anruf in Abwesenheit zu erkennen. Auftraggeber AH, Berlin, Transport von Dokumenten, Abholung 11 Uhr, üblicher Ort, Ziel London, Royal Kensington Hotel, Ablieferung spätestens 19 Uhr. Er leitete die SMS an einen seiner in Berlin ansässigen Mitarbeiter weiter.
Die Nummer des entgangenen Anrufs gehörte zu der von ihm beauftragten Detektei Myers in New York.
Er stieg aus dem Bett. Geschlafen hatte er nicht. Zwei nackte Mädchen lagen noch immer eng ineinander verschlungen auf der Bettdecke und dösten. Sie nervten ihn. Er wollte allein sein. Aggression kochte plötzlich in ihm hoch. Die Willfährigkeit dieser Weiber kotzte ihn an. Dass sich Frauen, nur weil er reich und bekannt war, ihm so leicht hingaben, nutzte er aus. Aber er war stets froh, wenn er sie wieder los war.
»Steht auf!«, brüllte er die Mädchen an. »Und haut ab!« Die beiden jungen Frauen schauten ihn aus ihren verquollenen Gesichtern verschlafen an und verstanden nicht. Howard wiederholte den Befehl abermals in derselben Lautstärke und fügte außerdem hinzu: »Hier, nehmt eure Klamotten, und dann raus hier!« Er warf ihnen ihre dünnen Kleidchen entgegen, die, wie er sich erinnern konnte, kaum das Nötigste bedeckt hatten, und ging selbst, nackt wie er war, mit einem elenden Gefühl im Kopf zur Kaffeemaschine, um sich einen Cappuccino zu machen. Dann schlurfte er weiter zum Kühlschrank, öffnete eine Flasche Bier und nahm zwei große Schlucke. Binnen Sekunden fühlte er sich besser. Auf dem Weg ins Bad richtete er seine Worte nochmals an die Mädchen: »Wenn ich zurück bin, seid ihr weg. Und schließt die Tür hinter euch!« Er stieg in die Dusche und wusch sich die sündige Nacht aus den Poren.
Als er das Badezimmer wieder verließ, waren die jungen Frauen fort. Er kontrollierte die Eingangstür und stellte zufrieden fest, dass sie geschlossen war. Auf dem Weg zurück in die Küche sah er auf die Wanduhr. Es war Samstagfrüh 8:03 Uhr. Noch immer beherrschten die Drinks der vergangenen Nacht seinen Kopf. So richtig Lust auf den inzwischen fertigen Kaffee hatte er nicht. In einem Zug leerte er das zuvor geöffnete Bier, nahm dann den Cappuccino zur Hand und setzte sich an die Theke in der Küche.
In seinem Ohr piepste das Freizeichen. Um möglichst genau über die Geheimnisse der Menschen in seinem Umfeld unterrichtet zu sein, hinsichtlich seiner Recherche aber stets unentdeckt zu bleiben, hatte er eine ausländische Detektei, die Detektei Myers in New York, für seine Zwecke beauftragt. Sie war weltweit aktiv, das Büro 24/7 besetzt, und somit zu jeder Tages- und Nachtzeit zu erreichen. Mit seinem Auftrag hatte er ein persönliches Detektivteam zugewiesen bekommen, das aus drei dauerhaften Mitgliedern bestand, allesamt kluge, über den Tellerrand hinausschauende Köpfe. Sie forschten nach, analysierten und verifizierten alles Mögliche rund um seine Kontakte. Jamie war der Protokollant. Er sammelte die zusammengetragenen Informationen und hielt das Team über Neuigkeiten auf dem Laufenden. Steven war der Teamchef und für das Organisatorische zuständig, und Brian, the Brain, wie er gern genannt wurde, war sein Detektiv vor Ort hier in London. Die Kosten für ihre Arbeit waren horrend, doch die Ergebnisse, die sie lieferten, ausgesprochen gut. Er wusste, wer wie mit wem über welche Geschäfte verflochten war, kannte die genauen Tagesabläufe der Personen in Schlüsselpositionen, besaß die Zugangsdaten zu unzähligen Konten – auch jenen in Steuerparadiesen –, Computern und Hauseingängen. Zudem kannte Howard eine Unmenge verborgener Laster der Vorstände der zahlreichen Unternehmen, die zu seinen Auftraggebern zählten. Dank dieser Informationen hatte er sie bei Bedarf alle in der Hand. Die Kenntnis dieser Schwachstellen erlaubte es ihm, immer genau dort in seinem Interesse zu manipulieren, wo es ihm gerade gelegen kam. Erpressen oder bestehlen hingegen wollte er niemanden, das war ihm zu plump. Ebenso wenig würde er seine Trümpfe für unwichtige Geschäfte ausspielen.
Eine sanfte Frauenstimme hieß ihn willkommen. Er stellte sich vor und wurde prompt verbunden.
»Hi, Jamie! Ich habe eure Nummer auf meinem Display gesehen. Ich hoffe, ihr habt gute Neuigkeiten für mich?«
»Hi, Howard. Nein, leider eher das Gegenteil«, erklärte Jamie mit brüchiger Stimme. »Wir haben um kurz nach 6 Uhr eurer Zeit einen Anruf aus dem King James Hospital erhalten. Brian ist dort kurz zuvor verstorben. Es heißt, zwei Obdachlose hätten ihn angegriffen und ausgeraubt. Er wurde brutal verprügelt und abgestochen wie ein Stück Vieh …«
Jetzt konnte Howard sein mieses Bauchgefühl zuordnen. Schon viele Male zuvor war ihm aufgefallen, dass seine Intuition ihn nur selten täuschte. Vielfach schon hatte sie ihm dabei geholfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Heute hätte er jedoch lieber auf sie verzichtet. Es dauerte einen Moment, bis die Nachricht wirklich so weit zu ihm vordrang, dass er ihren Sinn erfassen konnte. Dann aber traf sie ihn mit voller Härte, schickte eine kalte Welle des Schreckens durch seinen Körper und ließ ihn seine Hände zu Fäusten ballen. Mehrere Jahre hatten er und Brian zusammengearbeitet, unzählige Abende und Nächte miteinander durchgefeiert. Und jetzt sollte er einfach so tot sein? Neben diesem bizarren Gefühl des Entsetzens und gleichzeitigen Unglaubens fühlte er sich jedoch auch seltsam gefasst. Er hatte einen dramatischen Zwischenfall wie diesen eigentlich schon viel früher erwartet. Bislang waren sein Leben und sein finanzieller Aufstieg viel zu reibungslos verlaufen.
Endlich fand Howard seine Sprache wieder: »Was? Aber … das ist unmöglich. Wir waren doch noch bis ungefähr 6 Uhr zusammen im Morgan’s End …«
»Dann muss es direkt im Anschluss an eure Verabschiedung passiert sein.«
»Aber … was für Obdachlose denn überhaupt? Da wird ein Kerl wie Brian aus heiterem Himmel von zwei Obdachlosen angegriffen? Einfach so? Das ist doch absurd!«, begann er schließlich den Versuch einer ersten aufgeregten Erklärung.
»Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt wohl Zeugen, die alles beobachtet und sofort den Krankenwagen und die Polizei gerufen haben, als die Obdachlosen von Brian abließen. Die Täter befinden sich inzwischen wohl auch schon in Polizeigewahrsam. Das glaubt zumindest unser Kontakt im Yard. Du kannst ja mal bei Oscar anrufen.«
»Hat …«, Howard zögerte einen Moment, aber Geschäft war Geschäft, das durfte er nicht aus den Augen verlieren. »Hat Brian euch noch irgendwelche Nachrichten hinterlassen? Mir hat er kurz vor unserer Verabschiedung noch vorgeschwärmt, er habe bahnbrechende Infos für mich.«
»Es gibt ein Memo von ihm, das um 3 Uhr Londoner Zeit bei uns angekommen ist. Den Inhalt kenne ich noch nicht. Ich werte es aber gleich aus. Ich muss erst dem Bürokratismus gerecht werden, den so ein Todesfall mit sich bringt.«
Howard hörte das Knarzen der unterbrochenen Leitung, als Jamie den Anruf beendete, und legte sein Handy vor sich auf den Tresen. Brian war tot. Er fühlte sich ein wenig pietätlos bei dem Gedanken, aber er hoffte inständig, dass er die angekündigten Neuigkeiten nicht mit ins Grab genommen hatte. Je nachdem um welche Art der Informationen es sich handelte, konnte ihn das sonst durchaus in seiner Position schwächen. Doch da war noch etwas, das ihm nicht aus dem Kopf gehen wollte: War der Überfall auf Brian nichts weiter als ein Raubüberfall gewesen und er nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder war es möglich, dass er Opfer einer geplanten Attacke geworden war, und wenn ja, warum? Howard konnte das alles nicht glauben. Vor einigen Stunden hatten sie noch gemeinsam Gas gegeben. Es hatte sich nicht angefühlt, als ob es das letzte Mal sein sollte. Voller Energie und Tatendrang hatten sie ihre nächsten Schritte beratschlagt und sich als am Gipfel ihrer Macht angekommen gesehen.
Howard ließ den vergangenen Abend und die Nacht nochmals Revue passieren. Es war ein Freitag wie jeder andere gewesen. Mit Camillo und Jérôme hatte er bei ihrem Stamm-Inder gegessen. Danach waren sie in die Lounge von Morgan, ›Morgan’s End‹ gegangen und hatten ordentlich gebechert. Howard selbst hatte gar nicht so viel getrunken – seinem Kopf nach zu urteilen allerdings immer noch genug. Er rief sich die wichtigsten Gespräche noch einmal in Erinnerung. Brian war ›en passant‹ in der Lounge vorbeigekommen – die Bekanntschaft der beiden sollte von niemandem als beruflich, das Treffen nicht als vereinbart wahrgenommen werden –, um ihm einige wichtige Informationen über die North Western World Bank, einen seiner langjährigen Firmenkunden, mitzuteilen. Außerdem wollte er noch etwas anderes mit ihm besprechen, das aber nur unter vier Augen. Es hatte sich beinahe konspirativ angehört. Etwa gegen 6 Uhr morgens hatten sie sich getrennt und für heute 12 Uhr in Howards Wohnung verabredet.
Waren ihm diese ominösen Obdachlosen aufgefallen? Er dachte angestrengt nach. Er hatte sich kurz vor Brian mit den beiden Mädchen, deren Namen er vergessen oder vielleicht auch nie gekannt hatte, aus dem ›Morgan’s End‹ verabschiedet und war nach Hause gegangen. Brian selbst wollte noch etwas bleiben und teilte mit einem Zwinkern mit, er habe bisher kein ›Bunny‹ für die Nacht gefunden. Das waren die letzten Worte, an die Howard sich erinnerte.
Er selbst hatte sich eines der vor dem Club parkenden Taxis geschnappt. War ihm auf dem Weg irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Er konnte sich an nichts erinnern. Wären die beiden Mädchen noch hier, hätte er sie fragen können. Allerdings waren die zwei so betrunken gewesen − er konnte sich kaum vorstellen, dass sie etwas bemerkt hatten.
In den gut sechzehn Jahren seiner beruflichen Tätigkeit war nun erstmals ein Mensch aus seinem Team zu Schaden gekommen. Und Howard konnte einfach nicht so recht an die Geschichte mit den Obdachlosen glauben. Vielleicht war er paranoid, aber es schien ihm ein zu großer Zufall zu sein, dass sich gerade in dem speziellen Moment, in dem er seinen großen Durchbruch erringen konnte, ein solcher ›Unfall‹ ereignete. War nicht etwas anderes viel wahrscheinlicher? Hatte einer seiner Kunden verhindern wollen, dass Brian sein Wissen an ihn übermittelte?
Wenn er damit recht hatte, gab es in seinem Umkreis einen Spitzel. Wer aber würde ihn so dreist hintergehen? Letztlich kam jeder in Frage, das musste sich Howard eingestehen. Er würde sie alle durchleuchten müssen. Es ging hier um die Fortdauer seiner beruflichen Existenz, ja vielleicht sogar um sein eigenes Leben. Alles musste von nun an vielschichtiger angepackt werden.
Auch wenn es Howard nie darum gegangen war, einen maximalen Treffer zu landen, um seinen unmittelbaren gesellschaftlichen Aufstieg zu erzwingen, sondern er lediglich sein Wissen hatte nutzen wollen, um durch lukrative Geschäfte mit seinen Kunden Stück für Stück emporzusteigen, so konnte es jetzt genau auf diesen ultimativen Punkt hinauslaufen: einen Moment, der ihn zum König krönte, der aber auch seine Praktiken offenbarte und ihn damit für seine Kunden disqualifizierte.
Um unabhängig vom weiteren Verlauf der Angelegenheit seine Zukunft gesichert zu sehen, musste er das Risiko erhöhen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Wenn Brians Tod kein Zufall gewesen, sondern zu seinem persönlichen Schaden herbeigeführt worden war, dann bedeutete das seine Entlarvung. Seine Strategie war offengelegt. Keiner würde ihm glauben, wenn er sich ausgerechnet jetzt zurückzöge. Niemand würde es zulassen. Jetzt würde sich herausstellen, ob er Meister genug war, den Unbekannten mit dem letzten Zug selbst schachmatt zu setzen. Nicht durch verändertes Auftreten aufzufallen, sondern in jeder Sekunde auf die neuen Gesetzmäßigkeiten vorbereitet zu sein, war jetzt die Devise. Die Spielregeln hatten sich geändert. In den Sphären, in die er nun vordrang, war die Luft dünner und ein Verbrechen nichts Unmoralisches, sondern Mittel zum Zweck. Einige seiner Kunden mussten Leichen im Keller haben, die er noch nicht kannte. Es galt unverzüglich, die Schwachstelle in seinem Netzwerk ausfindig zu machen. Dafür bedurfte es anderer Werkzeuge als bisher. Er musste schneller und variabler sein, Späher aussenden, reaktionsschnell sein, ohne dabei seinen normalen Tagesrhythmus für Dritte sichtbar zu verändern.
Die Zeit der Unschuld war vorbei.
Howard griff erneut nach seinem Handy, um seine zwei engsten Mitarbeiter anzurufen. Zuerst Jérôme. Nach einer kurzen Erläuterung der Situation beauftragte er ihn damit, herauszufinden, wer die Zeugen waren, von denen Jamie gesprochen hatte. Und er sollte Oscar anrufen. Oscar war sein direkter Draht zu Scotland Yard. »Setz ihn auch auf die Zeugen an. Und bitte ihn, dir die internen Akten zuzuschustern. Aber bleib unsichtbar!«
»Klar, mache ich«, sagte Jérôme und legte auf.
Dann Camillo. Auch ihn weihte er mit einer knappen Erklärung ein und schickte ihn dann zum ›Morgan’s End‹, um dort nachzuhaken.
Als er sich kurze Zeit später auf seinem Sofa niederließ, dachte er nochmals über sein letztes Gespräch mit Brian nach. Was hatte er genau gesagt? Hatte er ihm eventuell eine verschlüsselte Botschaft mitzugeben versucht? So sehr sich Howard auch das Hirn zermarterte, ihm wollte nichts Aufschlussreiches einfallen.
Das Klingeln des Handys riss ihn aus seinen Gedanken. Jérôme hatte die Namen der Zeugen und auch deren Adressen herausgefunden. Wie er das so schnell geschafft hatte, verriet er nicht. Sein Vorschlag war es, zwei weitere Mitarbeiter mit der Beschattung der beiden Personen zu beauftragen, um zu prüfen, ob die offizielle Geschichte überhaupt stimmen konnte. Howard war einverstanden und beendete das Gespräch abrupt, da ein weiterer Anruf in der Leitung anklopfte.
Diesmal war Jamie aus New York an der Strippe. Er hatte sich das letzte Memo von Brian angesehen. Es war noch nicht dechiffriert. »So wie ich Brian kenne, hat er uns mal wieder eine verbale Schatzkarte hinterlassen. Du weißt ja, dass ›The Brain‹ gedanklich oft in ganz anderen Sphären aktiv war als wir Normalos.« Howard schmunzelte, wusste er doch nur zu gut, wie recht Jamie damit hatte. Sobald sich Neuigkeiten ergeben würden, wollte er diese an Howard weiterleiten. »Ich verwende unser Verschlüsselungszertifikat. Der Code ist der altbekannte.«
»Geht in Ordnung. Bevor du auflegst: Ich muss so schnell wie möglich alles über meine wichtigsten Kunden wissen, und natürlich auch über diejenigen, die in Brians Memo vorkommen, hinsichtlich Verbrechen, Straftaten und so weiter. Setze mindestens zwei Leute darauf an, die in den nächsten 24 Stunden so viel wie möglich zusammentragen, okay?«
»Alles klar! Konditionen wie immer.«
Mit einer Bestätigung beendete Howard das Telefonat.
Vorerst hatte er damit alles in seiner Macht Stehende in die Wege geleitet. In der Küche bereitete er sich einen weiteren Cappuccino zu und schenkte sich danach an der Bar einen Grappa ein. Viele Jahre hatte er auf den Tag hingearbeitet, an dem er den Eintritt in die oberste Liga gewährt bekäme. Er hatte ihn herbeigesehnt. Nun war er da. Das Spiel begann. Dafür gewappnet fühlte er sich allerdings nicht.
2
Samstag, 20. März 2004, New York, 01:21 Uhr, EST
Dass in der Anwaltskanzlei Brooks, Caspar, Smith & Sterling LLP trotz der Uhrzeit noch immer ein reges Treiben herrschte, war nichts Außergewöhnliches. Alle dort beschäftigten Führungskräfte waren überaus erfolgshungrig. Termine galt es einzuhalten, und Arbeiten hatten perfekt zu sein. Mitarbeiter, die das nicht verstanden, lernten diese Lektion bei Wochenend- und Nachtarbeit. Die Entlohnung mit überdurchschnittlichen Gehältern und Bonifikationen war keineswegs als Selbstverständlichkeit zu verstehen.
Das 1869 gegründete Unternehmen mit Sitz in New York war auf die Abwicklung großvolumiger Transaktionen zwischen Kontrahenten aus verschiedenen Kontinenten spezialisiert. Auch für politische Verträge zu Handelsabkommen oder Zollgesetzen wurden sie engagiert. Mandanten waren üblicherweise Staaten, große Industrie-, Handelsoder Finanzunternehmen und steinreiche Privatpersonen.
Jetzt stand die Firma kurz vor einem weiteren großen Vertragsabschluss. Doch dieser Auftrag unterschied sich von ihrem alltäglichen Geschäft. Einerseits handelte es sich nur um einen normalen Kaufvertrag für ein Immobilienpaket, andererseits war der Auftraggeber eine unbedeutende Einzelperson, der die Gepflogenheiten der großen Geschäftswelt nicht bekannt waren.
Der Senior President der römischen Niederlassung hatte den Vorgang William Sterling V. dennoch vorgetragen und ihm empfohlen den Fall anzunehmen. Er stelle keine fachliche Herausforderung dar, würde aber aufgrund des vereinbarten Erfolgshonorars eine erhebliche Geldsumme in die Kassen der Kanzlei spülen. Zudem habe die Auftraggeberin sich auf Empfehlung eines Mandanten der Kanzlei an die Zweigstelle in Rom gewandt, was den Umgang mit ihr und die Abwicklung der Angelegenheit stark vereinfache. William Sterling V. hatte darum zugestimmt und den Vorgang übernommen.
Traditionell trug seit 135 Jahren jeder erstgeborene männliche Sterling den Namen William. Er war damit zugleich designierter Erbe des Familienimperiums und hatte im Gegenzug dafür zu sorgen, dass sich alle anderen Familienmitglieder finanziell in einer exponierten Lage befanden.
William V. war der Kopf der fünften Generation der Familie Sterling. Er war ein ausgezeichneter Anwalt, seine Führungsqualitäten brillant. Zur Erfüllung des vorrangigen Familienziels, dem Erzeugen von finanziellem Gewinn, setzte er seine Fähigkeiten uneingeschränkt ein. Bereits als Kind hatte er begriffen, dass er, wenn er erst einmal erwachsen wäre, auch das privilegierte und bedeutsame Leben seines Vaters leben wollte. Seine Schulzeit und sein internationales Studium beendete er, um diesem Ziel näher zu kommen, in Windeseile. Unmittelbar danach setzten ihn sein Vater und Großvater in der Kanzlei ein. An ihrer Seite sollte er die wichtigsten Geschäftskniffe und Kunden mit Wurzeln in Europa kennenlernen, um alsbald eigenständig den bislang unbesetzten Kontinent für sie zu entwickeln. Seine eigenen Kontakte aus seiner Studienzeit in Harvard, Cambridge und La Statale in Mailand erleichterten ihm dieses Vorhaben zudem. Entgegen der üblichen Firmenpraxis gelang William V. die massive Expansion in Europa sogar ohne Übernahme einer bestehenden Anwaltskanzlei.
Alle Sterlings verfügten über einen ausgeprägten Geschäftssinn, sodass jeder von Williams Vorvätern mit Leichtigkeit auch Händler oder Kaufmann hätten werden können. Aber der Ururgroßvater hatte mit der Eröffnung einer Anwaltskanzlei unmissverständlich die Richtung vorgegeben. Schon früh hatte er jedem Familienmitglied eingeschärft, dass ein Unternehmer zwar viel Geld verdienen könne, aber sich auch stets einem Risiko aussetze. Das Geschäft hänge schließlich jeweils von der Tagesform der Märkte und der eigenen Kräfte ab. Eine Rechtsanwaltskanzlei hingegen würde auch in schlechten Zeiten boomen – noch viel mehr natürlich, wenn die Mandanten durch sie profitierten. Diese Doktrin erwies sich als goldrichtig und bestätigte sich in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Während das Haus Sterling bis 1929 nur in New York vertreten war, nutzte William II. die Baisse und kaufte die dreimal so große Kanzlei Smith. Aus Sterling wurde Smith & Sterling mit zusätzlichen Büros in Los Angeles, Las Vegas, Washington und Dallas. Auch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gebot dem Wachstum der Firma keinen Einhalt. Mit seinem Beginn expandierte die Kanzlei nach Asien mit Vertretungen in Tokio, Seoul und Peking. Weiteres Wachstum erlebte die Firma während des Indochina- und Vietnamkrieges.
William Sterling II., geb. 1871, war derjenige, der aus der Kanzlei ein Unternehmen mit Format gemacht hatte, und seitdem das schillernde Familienvorbild. Glücklicherweise verfügte er bis zu seinem Tod im Jahre 1976 mit 105 Lebensjahren stets über einen wachen Geist, sodass alle nachfolgenden Generationen bis zu diesem Zeitpunkt von seinem Wissen, seiner Cleverness und seiner Geschäftstüchtigkeit profitieren konnten.
Unter der Führung Williams III. expandierte die Kanzlei in die Karibik. Speziell die British Virgin Islands, Trinidad und Tobago, die Bahamas und die Cayman Islands wurden zu wichtigen Standorten und sorgten für ein enormes Kundenwachstum. 1970 folgte die Übernahme der Kanzlei Brooks & Brooks, fokussiert auf Lateinamerika. 1989 war die bestens in Russland verzahnte Kanzlei Caspar & Milton der nächste Übernahmekandidat, der erfolgreich integriert wurde.
Neue Mitarbeiter verstanden recht bald nach ihrem Eintritt in das Unternehmen, dass die Mehrheit der Kanzlei trotz der vielen Namen stets in der Hand der Familie Sterling geblieben war. Die Namen Brooks, Caspar und Smith waren nur eine alphabetische Aneinanderreihung der übernommenen Kanzleien und mehr eine Trophäensammlung als ein Beleg für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Es war ein cleverer Schachzug des Urgroßvaters, den neuen Partnern dadurch eine Bedeutung in der Außenwirkung zu geben, die sie intern niemals hatten – immerhin sollten sich die hinzugewonnenen Mandanten der Kanzlei auf diese Weise weiterhin verbunden fühlen.
Ob es Vorgabe der Familie oder einfach ein grundlegender Charakterzug ihrer Mitglieder war, Emotionen aus dem Geschäftsleben herauszuhalten, war nicht mit Sicherheit festzumachen. Fakt war hingegen die beeindruckende Konsequenz, mit der Gefühle aus geschäftlichen Angelegenheiten isoliert wurden. Auch im privaten Bereich berechneten die Sterlings alles klar. Jeder Nachkomme wurde optimal verheiratet, schließlich ging es um die gesellschaftliche Stellung der Familie. Liebe spielte, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig waren – in genau dieser Reihenfolge – Reichtum, Einfluss, Macht und Schönheit des zukünftigen Partners. Dem allgemeinen Verständnis der Familientradition nach konnte Liebe mithilfe dieser Attribute ganz automatisch entstehen. Doch während die Liebe nach kurzem Aufenthalt meist wieder verschwand, würden diese vier Faktoren für einen dauerhaften Mehrwert für die familiäre Gemeinschaft sorgen.
Um diese Lebenseinstellung in jeden Sterlingschen Kopf einzubrennen, entwarf bereits William Sterling I., als er im Jahre 1871 das Grundstück in Midtown Manhattan erwarb, auf dem Jahre später der 327 Meter hohe Sterling-Tower entstehen sollte, ein Familienwappen, das bis in die Gegenwart seine Bedeutung für die Familie und das Unternehmen behielt: eine hochkant stehende goldene Ellipse, in der eine weiße Raute fünf Segmente trennte. Im Zentrum thronte eine ›Harpia harpyja‹, die mit klarem, direktem Blick den Betrachter musterte. Die vier kleinen Segmente rund um den Kopf des Tieres verzierten die lateinischen Begriffe divitia, auctoritas, potestas, forma. Heute war dieses Wappen in jedem Büro der Kanzlei weltweit, auf jedem Stockwerk, in jedem Zimmer, auf jedem Kuvert, Briefkopf, Firmensouvenir oder sonstigem Gegenstand, der mit der Kanzlei Sterling in Verbindung gebracht werden konnte, verewigt. Die Harpyie war für William I. nicht nur der Inbegriff der Erhabenheit, sondern ein Sinnbild für seine Familie. Ebenso wie diese kräftigste Greifvogelart monotypisch in der Natur war, so waren er und seine Familie, die er über alles stellte, in seinen Augen einzigartig in der Gattung Mensch.
Gesundheit und Zusammengehörigkeit schrieb man in der Kanzlei Sterling groß. Erkrankte oder verunfallte ein Mitarbeiter, standen ihm Firmenärzte zur Verfügung. Der Arbeitgeber unternahm alles, um das kranke Mitglied der großen ›Sterling-Familie‹ schnellstmöglich wieder gesund begrüßen zu können. Denn neben der Lücke, die jeder abwesende Mitarbeiter hinterließ, war jede Minute, die eine Arbeitskraft nicht im Auftrag des Sterling-Towers aktiv war, verlorene Zeit, die keinem Mandanten in Rechnung gestellt werden konnte. Krankheit war somit nicht nur eine Verletzung der Kanzleigemeinschaft, sondern eine Verringerung von Reichtum, Einfluss, Macht und Schönheit.
Als Managing Director des Unternehmens hätte William V. üblicherweise in New York sitzen müssen. Aufgrund der starken Entwicklung seines Verantwortungsbereiches lebte er jedoch in Europa und reiste dort von Niederlassung zu Niederlassung. So war er auch zur Unterzeichnung des Auftrags der Signora de Silvestri nach Rom geflogen. Da in London aber mehr Anwälte der Kanzlei ansässig waren als in Rom, koordinierte William die Ausführung des Auftrags seit der Unterzeichnung aus der britischen Metropole. Noch zwei weitere Gründe machten es opportun, aus der englischen Hauptstadt heraus zu agieren: Zum einen saß der Käufer ebenfalls ganz in der Nähe von Williams Büro, und zum anderen war London weit weg von Venedig, dem Wohnort der Auftraggeberin. Um die Einsatzzeiten seiner Kanzlei bei einem Auftrag mit Erfolgshonorar möglichst gering zu halten, mussten Auftraggebern früh die Strippen aus der Hand genommen werden, sodass die Kanzlei federführend agieren konnte. Erfolgshonorare waren zwar immer lukrativer als eine Stundenhonorierung, aber die Vergütung hing letztendlich von der finalen Umsetzung des Auftrags ab. Diesen Erfolg und damit den Profit für die Kanzlei konnte William V. unter keinen Umständen einem Mandanten überlassen, noch weniger Signora de Silvestri, die völlig unerfahren in der Abwicklung großer Geschäfte war. So hatte er ihr, die zur Vereinfachung von den Kontrahenten verlangt hatte, ausschließlich eine Rechtsanwaltskanzlei als Mediator zu akzeptieren, lediglich den Auftrag übertragen, ein zusätzliches Honorar je Partei über 0,75 Prozent des im Kaufvertrag verankerten 700 Mio. Euro-Kaufpreises für die Kanzlei durchzusetzen. Mit diesem Zug machte sich William seine Mandantin für seine Zwecke zunutze und lenkte sie gleichzeitig vom Kern der Arbeit ab.
Doch inzwischen stockten die Verhandlungen aus Gründen, die William V. nicht hatte kommen sehen.
3
Samstag, 20. März 2004, Venedig, 8:24 Uhr, MEZ
Der Morgen war angebrochen. Gina de Silvestri hatte die ganze Nacht nicht schlafen können. Zu aufgeregt war sie ob des bevorstehenden bahnbrechenden Ereignisses. Ihre Wohnung in der Nähe der Piazza San Marco in Venedig war, nachdem die ersten Sonnenstrahlen die davorstehenden Gebäude erklommen hatten, und die aufkeimende Helligkeit sich entschlossen hatte, ein strahlender Vormittag zu werden, von Licht erfüllt. Die optimale Ostlage des Schlafzimmers ermöglichte eine vollständige natürliche Beleuchtung von Ginas gesamtem Zuhause, wenn sie die Tür Richtung Innenbereich offen ließ. Sie liebte ihr Drei-Zimmer-Appartement.
Die ganze Nacht über hatte sie sich nach den ersten Sonnenminuten des Tages gesehnt und nach dem Zeitpunkt, wenn diese ihre Wohnung übernahmen, wissend, dass es ab diesem Moment nicht mehr lange dauern würde, bis sie den Weg zum Flughafen antreten durfte.
Gina war mittlerweile 46 Jahre alt. Doch für jeden, der sie kannte und ihren Namen hörte, war sie der Inbegriff ewiger Jugend – und das zu Recht: Ihr braunes langes Haar, ihre italienischen schwarzen Augen, ihre naturbraune glatte Haut und ihre vollen Lippen glichen einem Kunstwerk. Niemand, dem sie sich in voller Blüte zeigte, wäre je auf die Idee gekommen, sie könne älter als Anfang Dreißig sein. Darauf war sie stolz, mehr noch darauf, dass alles an den 152 Zentimetern ihres Körpers echt war. Kein Botox, kein Lifting, keine Brustvergrößerung oder sonstige Sperenzien. Einzig ihr absolut gesunder Lebenswandel mit viel Sport und natürlichen Lebensmitteln war für ihr Aussehen verantwortlich.
Ihr Hobby war die Musik. Mit vier Jahren hatten ihre Eltern sie zum ersten Mal an ein Klavier gesetzt. Lange galt sie als große Hoffnung und trat sogar an verschiedenen Orten in ganz Italien auf. Mit aufkeimender Pubertät und wachsendem Interesse am männlichen Geschlecht und den anderen schönen Dingen des Lebens löste sie sich jedoch von ihrem Instrument und verfolgte Musik von da an nur noch als Zuhörerin und Tänzerin. Einige italienische Popmusiker mochte sie besonders und versuchte noch heute so viele Konzerte live zu erleben, wie sie konnte.
Als leidenschaftliche Tänzerin war sie seit ihrer Jugend immer aktiv. Jede freie Minute nutzte sie, um sich zu verbessern. In den Anfängen war es eine willkommene Gelegenheit gewesen, sich dem anderen Geschlecht zu nähern. Heutzutage war es ihre Passion. Ihr Tanzpartner war zwar zehn Jahre jünger als sie selbst, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass er sich keine bessere Partnerin hätte wünschen können, das wusste sie. Sie ließ sich leicht führen, war aber gleichzeitig so sicher in allen lateinamerikanischen und Standardtänzen, dass sie jederzeit aushelfen konnte, wenn er bei der Führung in Schwierigkeiten geriet. Sie tat dies dann außerdem so dezent und zurückhaltend, dass sie ausschließlich Dankbarkeit erntete.
Die Eigenschaft, sich zurückzunehmen, war exakt diejenige, die es ihr ermöglicht hatte, in den nun knapp 30 Jahren ihrer Berufstätigkeit immer wieder auf die Füße zu fallen. Schon in jungen Jahren hatte sie sich für eine Selbstständigkeit in verschiedenen Tätigkeitsbereichen entschieden, da sie nie in die Zwangsjacke einer ausschließlichen angestellten Bürotätigkeit eingesperrt werden wollte. Nein, sie wollte frei sein Entscheidungen zu treffen, die ihrem Lebensverständnis entsprachen. Das konnten ein Spontanurlaub im Schnee, das Hinterherreisen hinter einem ihrer Lieblingsmusiker oder nicht zuletzt eine ihrer mannigfaltigen Tanzveranstaltungen sein.
Die Kehrseite ihres Lebensstils war, dass es mit einer Familie nie geklappt hatte. Ein Mann wäre ihr dabei nicht so wichtig gewesen wie ein Kind. Nur ein einziges Mal hatte sie ein männliches Exemplar an ihrer Seite gehabt, das ihren Ansprüchen genügt hatte, um der mögliche Vater ihres Kindes zu werden. Das war vor etwas mehr als sieben Jahren gewesen. Die heftige, leidenschaftliche, aber viel zu kurze Beziehung war das Beste, was sie bisher an sexueller und partnerschaftlicher Erfüllung genossen hatte. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch: erfolgreich, gutaussehend, gebildet, witzig und viel jünger als sie. Sie hatte damals geglaubt, dass auch er gerne eine Familie mit ihr gegründet hätte. Aber sein Lebensstil und seine Vielweiberei ließen das nicht zu. Denn obwohl sie ihn verstand und letztlich nur einen Samenspender ihrer Wahl gesucht hatte, wollte sie bei ihm dann doch nicht nur eine unter Vielen sein. Als er das erkannte, beendete er die Beziehung quasi ansatzlos und versetzte ihr damit einen Hieb ins Herz, den sie ihm bis heute nicht verziehen hatte. Ihn machte sie noch immer für ihre Kinderlosigkeit und die damit zusammenhängende Leere in ihrem Herzen verantwortlich.
Es gab aber noch einen weiteren Haken an ihrer Selbstständigkeit. Finanziell durchlebte sie seit Anbeginn ihrer beruflichen Tage ein stetiges Auf und Ab. Es gab kaum eine Phase in ihrem Leben, in der sie sich zurücklehnen und die Dinge einfach laufen lassen konnte. Nein, die Selbstständigkeit verlangte ihr eine dauerhafte und unermüdliche Bereitschaft zu kämpfen ab. Oft hatte das Leben sie in tiefe Täler geführt, in denen sie nicht gewusst hatte, womit sie am nächsten Tag ihr Essen bezahlen sollte. Doch sie hatte es immer wieder geschafft, sich aus diesen Phasen des Leidens herauszuarbeiten. So schlug sie sich als Fremdenführerin, Tanzlehrerin und Immobilienmaklerin in Venedig durch. Tat immer das, was je nach Jahreszeit am lukrativsten war. Von Frühling bis Herbst waren es Stadtführungen. Die Geschichte Venedigs und dessen Stadtplan waren in ihr Gehirn gemeißelt. In den Wintermonaten, wenn der Strom der Touristen abnahm, bot sie Venezianern Tanzkurse an. Für Maklergeschäfte war sie immer offen, diese waren aber eher eine Seltenheit.
Nun stand sie erstmals in ihrem Leben vor der Chance, ein Geschäft abzuwickeln, das sie für immer aus der finanziellen Unsicherheit erheben würde. Dieser Gedanke elektrisierte sie seit Wochen und ließ sie seit über vierundzwanzig Stunden wach sein.
Am heutigen Abend würde sie die Provisionsverträge der Prinz Hempel Bank und der Fraternity Union Insurance empfangen. Dann hätte das wochenlange Versteckspiel endlich ein Ende. Dafür würden sie mit ihrem Charme und ihr Rechtsanwalt William Sterling mit seiner Bestimmtheit sorgen. An der Vermittlung des Immobiliengeschäfts würde sie sage und schreibe 21 Mio. Euro verdienen. Diese Summe hatte sie in den letzten Monaten unzählige Male notiert. Sie konnte die Zahl einfach nicht begreifen, sie hatte so viele Nullen.
Per Zufall hatte sie von der Not von Adalbert von Hempel, dem Vorstand der Prinz Hempel Bank in Berlin, erfahren. Innerhalb kurzer Zeit hatte es ihm gelingen müssen, ein Immobilienpaket zu veräußern, ohne dabei viel Staub aufzuwirbeln. Der wahre Grund für den Verkauf hatte im Verborgenen bleiben sollen. Gina hatte sich informieren lassen und hatte Adalbert versichert, sie könne potenzielle Interessenten auftreiben. Da sie aber Angst hatte, zwischen zwei institutionellen Investoren zerrieben zu werden, hatte sie Adalbert vorgeschlagen, einen komplett anonymen Deal durchzuziehen. Ihm gegenüber hatte sie es als Mittel zur Verheimlichung des wahren Verkaufsgrunds dargestellt. In Wahrheit hatte dieser Umstand lediglich ihrem eigenen Schutz vor den großen Geschäftsleuten gedient, die auf diesem Gebiet weitaus mehr Erfahrung vorzuweisen hatten als sie selbst. Die Idee war bei Adalbert zu Ginas Zufriedenheit auf fruchtbaren Boden gefallen. Ein weiterer für Gina vorteilhafter Nebeneffekt dieser Abwicklungsform war, dass sich ihre Bedeutung im Rahmen der Transaktion massiv vergrößerte. Sie war nicht mehr nur Vermittlerin, sondern Bindeglied zwischen zwei einander völlig unbekannten Parteien. Sie war der Klebstoff, der die Transaktion überhaupt erst möglich machte.
Um 16:05 Uhr würde ihr Flug nach London gehen, spätestens um 18 Uhr Londoner Zeit käme sie im Royal Kensington Hotel an. Sie hatte alles außerordentlich genau ausgetüftelt und stringent getaktet. Um 19 Uhr träfe sie ihren Anwalt im Hotel. Dieser sollte zu diesem Zeitpunkt bereits den Provisionsvertrag der Fraternity Insurance erhalten haben.
Dass William Sterling V. sich ihres Auftrags persönlich annahm, hatte ihrem Wunsch entsprochen, auch wenn sie ihn nie ausdrücklich geäußert hatte. Sterling war ein erfahrener Anwalt, der ihrer Position zusätzlich noch mehr Gewicht verlieh. Mit seiner Hilfe konnte sie, mit Rückendeckung, das Heft in der Hand halten. Mehrmals hatte sie während der Anbahnung des Geschäfts erleben müssen, dass der Käufer und selbst Adalbert, den sie schon längere Zeit persönlich kannte, ihr als Frau nur wenig Respekt zollten. Ein solches Verhalten wollte sie, wenn es erst einmal in die heiße Phase ginge, nicht mehr tolerieren. Umgehen konnte sie dieses Problem, indem William an ihrer Seite und vor allem als ihr Auftragnehmer zu ihr stand.
Da William ihr von Adalbert empfohlen worden war, engagierte sie ihn sofort, nachdem er ihren beiden elementaren Voraussetzungen zugestimmt hatte: Er sollte lediglich im Erfolgsfall honoriert werden und musste sich dazu verpflichten, keiner beteiligten Partei etwas von der Gegenpartei zu sagen. Da er wie selbstverständlich akzeptierte, vertraute sie ihm blind.
Um spätestens 21 Uhr stünde dann noch die Unterzeichnung des Vertrags mit der Prinz Hempel Bank an. Sicherlich würde es sich Adalbert nach ihrem Techtelmechtel im vergangenen Jahr nicht nehmen lassen, sie persönlich zu treffen. Mit seiner Unterschrift wäre sie Multimillionärin. Im Hochgefühl des Sieges würde sie noch etwas mit Prinz Adalbert plauschen und seine Avancen abwehren.
Gegen 22 oder 22:30 Uhr läge sie dann gemütlich allein in ihrem Bett, für alle Zeiten finanziell saniert und sich nie wieder sorgen müssend.
4
Samstag, 20. März 2004, London, 8:07 Uhr, GMT
Sebastian McNamara nahm den Papierstapel von seinem Schreibtisch. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass er vollständig war, griff er nach einem weißen DIN-A4-Kuvert und öffnete es. Er schob die einzelnen Papierpakete hinein und verklebte die Lasche. Zum Schluss setzte er sein Kürzel auf die Verschlusskappe, legte den Brief auf den Schreibtisch und versiegelte ihn. Dann griff er zum Telefonhörer: »Beordern Sie Frank und Marc zu mir.«
Aus einer Schublade seines Sekretärs zog er ein leeres Papier und kritzelte einige Notizen darauf. Das beschriebene Blatt legte er auf das Kuvert.
Er ging zum Fenster. Der Ausblick aus seinem Büro über die City von London war traumhaft. Viel zu selten genoss er ihn. Links unten die Tower Bridge, rechts das London Eye und die Waterloo Station. Die Themse, die stetig und ungerührt weiterfloss.
Gedankenverloren strich er sich über die Halbglatze und dachte über seinen Werdegang nach. Wie weit er es in seinem Leben gebracht hatte! Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit. Wer aber aus seinem Bekanntenkreis und seiner Familie hätte ihm das zugetraut? Keiner. Nicht einmal seine Mutter, Gott habe sie selig, hatte je an seinen Erfolg und daran, dass er Macht ausüben könnte, geglaubt. Es war selten, dass jemand mit seiner Herkunft es in eine solch repräsentative und exponierte Position schaffte. Sein großer Vorteil war es stets gewesen, dass er sein Ziel immer klar vor Augen gehabt hatte.
Aufgrund seiner untersetzten Figur, seiner Unsportlichkeit und seines mittlerweile immensen Bauchumfangs sowie seiner deformierten Nase, seinen kleinen Augen und den buschigen Augenbrauen im gesamten Erscheinungsbild keinem Schönheitsideal genügend, war ihm klar, dass seine Stärke schon seit der Schulzeit seine Entschlossenheit war. Nach der Lehre zum Versicherungskaufmann hatte er sich schnell hochgearbeitet. Das ordentlich abgeschlossene Betriebswirtschaftsstudium, das er parallel zum Berufseinstieg und finanziert durch seinen heutigen Arbeitgeber absolviert hatte, tat dann sein Übriges.
Auf seinem Weg in den Vorstand – immerhin war er inzwischen seit vierzig Jahren in der Fraternity Union Insurance tätig – hatte er mehrere Grabenkämpfe überstehen müssen. Gelungen war ihm das, da er stets eine Empfehlung seines ersten Abteilungschefs, so etwas wie sein Mentor, beherzigte: »Hab’ deine Konkurrenz immer in der Hand!« Über die Jahre hatte er auf sein Anraten hin zu jedem Kollegen, der ähnliche Aufstiegsambitionen hatte wie er, Informationen zu Fehlern oder Richtlinienuntreue gesammelt. Vielfach waren sogar strafrechtlich relevante Vergehen zu finden gewesen. Um sicherzugehen, dass ihm keiner seine Sammlung an Informationen entwendete, hatte er Kopien aller Unterlagen bei einem externen Anwalt deponiert. Sein Wissen wollte er nur im richtigen Moment einsetzen. Dabei hatte ihm sein damaliger Chef jedoch nicht erklärt, welcher der richtige Moment sein würde. »Das wirst du erkennen!«, war der einzige Hinweis. Und er ging damit nicht fehl. McNamara hatte den richtigen Moment immer erkannt. Auf diese Weise hatte er bei wichtigen Personalentscheidungen stets den Zuschlag erhalten. Ein unerwarteter Zusatznutzen aus seinem Aufstieg war, dass ihm seine Konkurrenten blind dienten, entweder weil er sie in der Hand hatte, oder weil sie mit der Schmach der Niederlage nicht umgehen konnten und den Arbeitgeber wechselten. Auch über seinen Mitvorstand Paul McPhee besaß er brisante Dokumente.
Seit Anbeginn seiner beruflichen Laufbahn war er teurer gekleidet, als es sein Geldbeutel lange Zeit hergegeben hatte – er wusste, Kleider machen Leute. Zudem war es eine willkommene Gelegenheit, seinen niederen sozialen Stand zu kaschieren. Stets glattrasiert und parfümiert, war er nun, im Alter von 56 Jahren, auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt und eine wichtige Person in der Finanzwelt.
Die Regeln des Systems beherrschte er bis ins Detail und besaß neben seiner Selbstsicherheit auch eine angeborene Autorität. All das ließ ihn seine Hässlichkeit und Unbeliebtheit vergessen. Er war ein Geschäftsmann mit dickem Geldbeutel, der gelernt hatte, diesen optimal einzusetzen, sodass es ihm an nichts mangelte.
Ein vehementes Klopfen ließ seinen Blick in Richtung Tür schnellen. Marc und Frank kamen herein. Sie waren persönliche Handlanger der Vorstandsetage der Versicherung.
»Guten Morgen, Mr McNamara. Wie geht es Ihnen, Sir?«, begrüßten ihn beide unisono. Marc und Frank waren klassische Bodyguard-Typen. Beide über 1,90 Meter groß, muskelbepackt, kurzes dunkles Haar. Sie unterschieden sich nur dadurch voneinander, dass Frank einen leicht asiatischen Einschlag aufwies. Soweit bekannt, war seine Urgroßmutter eine Filipina. Marc holte das, was Frank ihm durch seine Gene an Teint voraushatte, durch Sonnenstudiobräune auf. Beide waren wie ihr Chef glattrasiert und trugen einen Firmenanzug.
»Gut, danke. Ich habe hier einen Auftrag für euch.« McNamara nahm das Kuvert und den Zettel und streckte beides seinen Mitarbeitern entgegen. »Bitte kümmert euch darum. Instruktionen stehen auf dem beigelegten Zettel. Haltet euch strikt daran. Wenn es Probleme gibt, meldet euch ausschließlich bei mir. Über die Vertraulichkeit muss ich ja keine Worte verlieren.«
»Nein, Sir, wir wissen Bescheid! Wird erledigt«, gab Frank zur Antwort und drehte sich um. Marc schloss die Tür hinter beiden, als sie den Raum wieder verließen.
Sebastian McNamara stand nun seit zwölf Jahren an der Spitze der Fraternity Union Insurance. Er hatte in dieser Zeit zusammen mit seinem Vorstandspartner Paul McPhee aus einer kleinen lokalen Versicherungsgesellschaft ein namhaftes Börsengewicht mit aktuell etwas über 6 Mrd. Pfund Marktkapitalisierung gemacht.
Während die Gesellschaft zu Beginn seiner Zeit ein reiner Nischenanbieter gewesen war, hatten McPhee und er beschlossen, einen Sachversicherer aus der Fraternity zu machen. Aufgrund der niedrigen Schadensquote der bestehenden Verträge hatten sie die neuen Sparten durch niedrige Beiträge anfänglich quersubventionieren können. Dadurch war es der Fraternity gelungen, innerhalb von nur zwei Jahren einen Marktanteil von knapp zehn Prozent in Großbritannien zu erzielen.
Durch geschickte Vertragsgestaltungen mit einem Rückversicherer blieben jährlich 1,5 Mrd. Pfund Gewinn und keinerlei Restrisiko unabhängig von der realen Schadensquote übrig. Daraus bedienten sie die Vertriebs-, Marketing- und Personalkosten. Der Rohertrag nach Kosten betrug mehr als 50 Prozent des Beitragsvolumens. Damit waren sie das attraktivste Versicherungsunternehmen des Marktes. Den Aktionären schüttete die Fraternity seit Jahren eine hohe Dividende aus und investierte den Rest des Gewinns langfristig. Liquide Mittel hatte die Gesellschaft daher nur wenige. McNamara schlug immer wieder Investitionsobjekte vor und überzeugte seinen Kollegen McPhee davon, seinen Empfehlungen zu folgen. Dafür musste McNamara so gut wie nie die gesamte Transaktion offenlegen. Meist reichten die Perspektiven, um das Go zu erhalten.
Vor sieben Jahren hatten sie sich mit den Altaktionären, einer davon die North Western World Bank, entschieden, über eine Kapitalerhöhung an die Börse zu gehen. Der Börsengang hatte das Dreifache des Jahresgewinns in die Kassen der Gesellschaft gespült. McPhee und McNamara hatten eine satte Tantieme erhalten, und die Aktionäre wurden fürstlich für ihre Altaktien entlohnt. Zwar hatten sie mit der Notierung an der Börse ihre Gesamtanteile reduziert, hatten aber die Mehrheit an der Versicherung behalten.
Damit hatte sich aber der Alltag der Vorstände geändert. Während sie früher Geschäfte mit den wichtigsten Aktionären auf Zuruf getätigt hatten, mussten sie heute Fristen zur Veröffentlichung von Informationen einhalten. Geschäftszahlen wurden öffentlich kommentiert. Sie selbst waren Gegenstand der Presse, womit ihr Bekanntheitsgrad zwar stieg, sie aber auch angreifbarer wurden. Und der Shareholder Value, der Marktwert der Versicherung, war das, was im Fokus der Öffentlichkeit stand. Von Quartal zu Quartal musste der Profit also getoppt werden.
Meistens war das kein Problem, weil das Geschäft ausgezeichnet lief. Aber auch die Fraternity war nicht immun gegen Einwirkungen auf die Märkte. So war seit dem Börsengang der Internethype Aktienkurstreiber Nummer 1. Als dann aber mit einem Mal Börsenmakler und Fondsmanager begonnen hatten, Versicherungsgesellschaften als ›langweilig‹ einzustufen – zu wenig Phantasie stecke im Geschäftsmodell - war die Nachfrage nach ihren Aktien gefallen und das Platzen der Dotcom-Blase hatte den Aktienkurs vollends in den Abgrund gerissen. Seit seinem Tief hatte er sich noch nicht wieder erholt und stand gerade einmal bei etwa einem Zehntel seines Allzeithochs. Der Stakeholder Value – der Mehrwert für den Aktionär – war seitdem nachhaltig negativ und bei jeder Gelegenheit öffentlich zu kommentieren. Es interessierte auch niemanden, dass die Dividendenrendite aktuell fünfzehn Prozent der Marktkapitalisierung betrug, denn für die meisten Investoren war dieses Argument nichts als ein Ablenkungsmanöver, um sich nicht für den Einsturz des Aktienkurses rechtfertigen zu müssen. Die Vorstände der Fraternity, und speziell McNamara, standen darum unter fortwährendem Druck, positive Nachrichten zu generieren und damit die Aktionäre zu besänftigen.
Durch seine langjährige Bekanntschaft mit Gina de Silvestri war er nun an eine neue Investitionsgelegenheit gelangt. Es ging um den Erwerb eines unter Wert angebotenen großen Immobilienpaketes in den USA. Mit diesem Geschäft könnte der Jahresgewinn überdimensional gesteigert werden. Einziger Haken war, dass das exakte Immobilienportfolio und der Verkäufer erst nach Unterzeichnung der Verträge bekannt gegeben würden. Für die Richtigkeit der Bewertung der Immobilien sprachen ein Gutachten, die Tatsache, dass eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei als Mittler wirkte – sich aber leider keinerlei zusätzliche Auskünfte entlocken ließ – und Ginas Wort.
Da es stets in seinem Interesse war, nur Geschäfte zu machen, die für ihn selbst kein Risiko bargen – er wollte noch lange Vorstand bleiben – holte McNamara die North Western World Bank als Aktionär der Fraternity für die Finanzierung mit ins Boot.
Sein Plan war, dass die Fraternity das angebotene Immobilienpaket für 700 Mio. Euro kaufte. Laut der beigefügten Dokumente war das Paket etwas mehr als 2 Mrd. Euro wert. Dadurch, dass er Gina zumindest die Bundesstaaten, in denen die angebotenen Immobilien lagen, hatte abringen können, war es wenigstens gelungen, die Anzahl der zu verkaufenden Immobilien einzugrenzen. Eigene Prüfungen, die er ausschließlich auf die jeweils maximal drei größten Städte der Bundesstaaten ausrichtet hatte, legten diverse potentielle Immobilien frei. Und obwohl die Transaktion nicht transparent war, stand für ihn fest, dass das Angebot eine Gelegenheit war, denn als Standorte kamen nur Miami oder Tampa in Florida, New York, Birmingham oder Mobile in Alabama und Houston, San Antonio oder Dallas in Texas in Frage. Und diese Orte waren durchweg zukunftsweisend.
Die North Western World Bank würde die gesamte Transaktion vorfinanzieren. Nach Abschluss des Kaufes würde das Paket für 3,7 Mrd. Euro an eine Projektgesellschaft mit Sitz auf Zypern übertragen. Die Käuferparteien stiegen zu diesem Zeitpunkt aus. Im optimalen Fall würde der Vorgang eine rechtliche Sekunde dauern. Es ging nur darum, kurz in Erscheinung zu treten, einen Gewinn einzustreichen und wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Neben dem hohen Millionengewinn für die Fraternity verschaffte McNamara sich selbst eine überbordende Tantieme. Aufgrund der andauernden Forderung der Aktionäre, immer wieder ›opportunities‹ aufzutreiben, waren solche inzwischen zu McNamaras Steckenpferd geworden. Mit dieser Transaktion waren sie auf dem richtigen Weg, die Shareholder wieder zufrieden zu stimmen, zumal ein großer Aktionär involviert war und ebenfalls enorm profitieren würde.
Bis zum Abschluss galt es den Deckmantel des Schweigens nicht zu lüften, damit keine Konkurrenz aufkommen konnte. Heute um 21 Uhr würde der Verkäufer im Beisein von Gina de Silvestri den Kaufvertrag unterzeichnen. Morgen früh um 9 Uhr würden Paul und er folgen. Damit wäre alles in trockenen Tüchern.
Voller Vorfreude auf seinen Triumph genehmigte sich McNamara einen Glenlivet Private Collection von 1943. Dieser Whisky war für ihn das Sinnbild des Erfolgs, seines Erfolgs. Bis zu einer neuen Stufe seines Himmelssturms waren es nur noch wenige Stunden.
5
Samstag, 20. März 2004, Berlin, 9:11 Uhr, MEZ
Prinz Adalbert von Hempel stand auf der halbmondförmigen Terrasse im zweiten Stock seiner Villa im Grunewald und sinnierte. Der Milchkaffee, den er zwischen beiden Händen hielt, dampfte in der Tasse. Es war ein sonniger Morgen, wenn auch ein wenig frisch, da die Sonnenstrahlen nur vereinzelt durch die Baumkronen drangen.
Er war allein. Den Angestellten hatte er frei gegeben, seine Frau war wie so oft weg. Wahrscheinlich hatte sie wieder einmal eine Affäre. Aber das tangierte ihn nicht mehr. Die Ehe mit Gudrun hatte er bereits vor Jahren als gescheitert anerkennen müssen. Beide lebten, ein jeder vor sich hin, nebeneinander her, ohne sich für die Angelegenheiten des anderen zu interessieren. Im Zuge seines Streits mit seinem Bruder damals hatte er darüber nachgedacht, auch mit ihr tabula rasa zu machen, doch der Aufwand war es ihm schließlich nicht wert gewesen. Für ihn hätte das nur horrende Kosten bedeutet, und außerdem ertrug er es nur schwer, allein zu sein. Er brauchte das Gefühl, dass jemand für ihn da war, auch wenn diese Vorstellung bei seiner Frau kaum mehr als einer Halluzination entsprach. Nie würde er der Frau, die inzwischen seit fast 25 Jahren an seiner Seite lebte, seine tiefsten Geheimnisse anvertrauen.
Die Situation rund um das Familienunternehmen belastete Adalbert. Sein Vater hatte es aufgebaut und innerhalb von dreißig Jahren aus der Prinz Hempel Bank ein gesundes mittelständisches Bankhaus in Berlin entwickelt. Zu Zeiten des Kalten Krieges pflegte er aus dem isolierten West-Berlin geschäftliche Kontakte in die DDR und nach Russland, die er nach dem Fall der Mauer weiter ausbaute. Bei all seinen Geschäften folgte er stets einer eisernen Devise: »Meine Bank geht niemals an einem Abschluss zu wenig zugrunde, viel eher an einem zu viel«. Die Hauptaufgabe seiner Bank sah er darin, dem Allgemeinwohl zu dienen. So finanzierte die Prinz Hempel Bank seit jeher öffentliche Vorhaben, die möglichst vielen Menschen zugutekamen, oder Firmen, die mit ihrem Geschäft der Gesellschaft einen Dienst erwiesen.
Argwöhnisch beobachtete der Vater die Konkurrenz, die sich jedem Trend anschloss, nur um eine ›schnelle Mark‹ zu machen. Seiner Ansicht nach ging es in anderen Häusern mehr um die Egozentrik der Führungskräfte als um die volkswirtschaftliche Aufgabe einer Bank, die Finanzierung des Wirtschaftskreislaufes. Überbordende Bonifikationen waren wichtiger als Kundenzufriedenheit oder Kundeninteresse. Der volkswirtschaftliche Schaden, den sie damit anrichteten, war ihnen einerlei, denn sie befassten sich ja nie mit den Geschädigten, sondern ausschließlich mit sich selbst. Dieses Geschäftsgebaren entsprach nicht Hempels Credo. So wurde der ›alte Hempel‹ in West-Berlin zur Ikone und blieb auch in der wiedervereinigten Stadt ein höchst geachteter Mann.
Das Bankhaus hielt sich bis zu seinem Tod 1997 hervorragend. Dann aber veränderte sich alles. Obwohl der Vater beide Söhne in der Bank positioniert und über das Erbe mit identischen Kapitalanteilen ausgestattet hatte, waren sich die Brüder Adalbert und der drei Jahre jüngerer Friedbert über die weitere Strategie nicht einig. Friedbert wollte die intakte Infrastruktur der Bank nutzen und die intensiven Geschäftskontakte seines Vaters vertiefen. Adalbert hingegen glaubte, die Außendarstellung der Bank müsse modernisiert werden. Zudem war er ein großer Fan der aufkommenden New Economy. Friedbert vertrat in dieser Hinsicht die Überzeugung des Vaters, nicht jedem Trend nachlaufen zu müssen. So kam es unweigerlich zum Streit zwischen den beiden, bei dem Adalbert alles daran setzte, sein Erstgeborenenrecht durchzuboxen. Der Kampf dauerte fast drei Jahre. Seit Friedberts Austritt aus der Bank im Februar 2000 sprachen die Brüder kein Wort mehr miteinander. Friedbert wurde Vorstand einer deutlich größeren Bank mit Sitz in Cardiff, und Adalbert segelte jetzt, wo er alleine entscheiden konnte, mit den Wogen des Neuen Marktes und modernisierte das Gesicht der Bank nach außen vollständig. Im Rahmen dieser Veränderungen bewilligte er Unsummen für die Verschönerung des Gebäudes. Und das obwohl sein Vater gerade erst ein Jahr vor seinem Tod die gesamte Immobilie hatte sanieren lassen. Adalbert jedoch legte Wert auf ein erneuertes Gesicht der Bank. An ihn sollte das neue Erscheinungsbild erinnern, einen modernen, weltoffenen und erfolgreichen Banker. Auch die organisatorische Struktur des Hauses änderte er. Das oberste Stockwerk wurde zur Chefetage, die Kantine, die sich ursprünglich dort befunden hatte, verlagerte er ins Erdgeschoss. Adalbert war die Außenwirkung wichtig. Die Vorstellung, dass seine Mitarbeiter während des Mittagessens auf seinem Kopf herumtrampelten – sein Büro hatte sich bis dato direkt unter der Kantine befunden –, empörte ihn. Je höher er saß, desto größer sein Ansehen, so glaubte er. Außerdem würde ihm so die Stadt Berlin zu Füßen liegen, wie es sich für einen von Hempel geziemte. Das Sonnenlicht bestrahlte seine Macht, und nur der Himmel war seine Grenze. Darüber hinaus bedurfte es im Unternehmen natürlich eines Chauffeurs. Mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn zur Arbeit zu fahren, so wie es sein Vater ein Leben lang getan hatte, empfand Adalbert als erniedrigend.
Der Rausch der Internetblase und des Neuen Marktes in den Jahren 1999 bis 2001 katapultierte den Erfolg der Bank in ungeahnte Höhen. Das Geschäft brummte. Sein Talent für Bankgeschäfte schien ausgeprägt. Doch dann geschah das Unbegreifliche. Die Euphorie an der Börse endete im März 2001 jäh. Junge Unternehmen konnten ihre Geschäftsideen nicht mehr erfolgreich am Markt umsetzen. Keiner bediente mehr die ausgereichten Kredite, und die Sicherheiten der Kreditnehmer waren wertlos. Dass seine Bank durch das Abebben eines Trends wie dem Platzen der Dotcom-Blase beeinträchtigt werden könnte, war ihm bis dahin nie in den Sinn gekommen.
Die Analyse der Misere der Bank hatte ergeben, dass sich alle Kreditberater von der Hysterie um die einfachen und ertragreichen Geschäfte in dieser Zeit hatten blenden lassen. Die Kreditvergabe wurde nicht ordentlich geprüft. Entgegen der Bankrichtlinien hatten die Berater das Vier-Augen-Prinzip missachtet. Es reichten private Bürgschaften für sechsstellige Kreditzusagen, ohne die Bonität des Bürgen validiert zu haben. Auch Adalbert selbst hatte sich dem Hype nicht entziehen können.
Mit einem Schlag hatte die Bank 2001 knapp 500 Mio. Euro wertberichtigen müssen. 2002 und 2003 waren es zusammen nochmals knapp 1,4 Mrd. Euro. Das Eigenkapital der Bank war damit innerhalb von drei Jahren nicht nur komplett ausradiert worden, sondern hatte sich in eine Unterdeckung in Höhe von fast 300 Mio. Euro verwandelt. Die Bank war pleite. Als ordentlicher Kaufmann hätte Adalbert von Hempel bereits vor drei Monaten Insolvenz anmelden müssen.
Nun stand er mit seinen 48 Jahren vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Der Tsunami, der den Neuen Markt und die New Economy dem Erdboden gleichgemacht hatte, hatte auch die Grundfesten der Prinz Hempel Bank zerstört. Adalbert blieb kaum noch Zeit, etwas zu reparieren. Alles, was einst für ihn von Belang gewesen war, hatte sich aufgelöst: seine Ehe irrelevant, das Unternehmen seines Vaters insolvent, und der Familienzusammenhalt inexistent. Er stand mit mehr als einem Bein im Gefängnis. Sein Privatvermögen war mit dem Bankhaus verwoben, er besaß nur dann noch etwas, wenn er es irgendwie schaffte, die Bank zu retten.
Die Krise der Prinz Hempel Bank ging ihm unter die Haut. Inzwischen wusste er, dass er die Prinzipien seines Vaters verraten hatte. Sein Bruder hätte es niemals soweit kommen lassen. Friedbert machte mittlerweile Geschäfte, die ein Vielfaches dessen waren, was selbst der Vater erreicht hatte, von ihm selbst ganz zu schweigen. Ein Großteil dieser Geschäfte war solides Bankgewerbe mit den russischen Kunden seines Vaters, die irgendwann erkannt hatten, dass es für sie besser sein würde, Friedbert zu folgen und sich von Adalbert abzuwenden.
Inzwischen wagte es kaum noch jemand, negative Nachrichten persönlich an Adalbert heranzutragen. Seine Sekretärin suchte schon seit langem das Weite, wenn sie ihn nur herannahen sah. Und auch sonst machten alle einen großen Bogen um ihn, da er es sich seit dem Ausbruch der Krise angewöhnt hatte, egal wen als Blitzableiter für seine Frustration zu benutzen.
Mehrfach schon hatte er am Rand des Daches des Bankhauses gestanden und sich vorgestellt, dass mit nur einem einzigen Schritt all seine Sorgen unmittelbar ein Ende hätten. Einmal hatte er sogar Anlauf genommen, hatte aber einen Meter vor dem Abgrund innegehalten und sich besonnen. Die Versuchung war latent noch immer da. Kinderlos wie er war, fragte er sich oft, wofür er das alles eigentlich noch ertrug. Und stets wenn ihm kein wirklicher Grund mehr einfallen wollte, erschien das Gesicht seines Vaters vor seinem inneren Auge und forderte ihn auf, mannhaft zu sein.
Adalbert hasste seinen Vater auch noch Jahre nach dessen Tod. Nicht etwa, weil er ein bösartiger Mensch gewesen wäre oder ihn schlecht behandelt hätte. Nein, er hasste ihn, weil er in allem, was er je prophezeite, recht behalten hatte. Sein Vater war ein integrer Bankier und feiner Mensch gewesen. Adalbert wusste, dass es nicht fair war, ihn zu hassen. Ganz genau das Gegenteil hätte er tun müssen. Nie hatte der Vater sich negativ in seine Entwicklung eingemischt – außer zweimal. Da war Adalbert bereits selbst ein gestandener Mann.
»Sohn«, sagte er, »überlasse die Bank Friedbert. Arbeite nicht als Bankier. Deine Seele ist sanft und dein Talent die Kreativität. Werde Künstler und Kunstkritiker, wie du es dir ersehnst. Du hast alle Freiheiten!« Heute wusste Adalbert, dass der Vater nur das Beste für ihn wollte. Damals erkannte er es nicht, fragte sich vielmehr, wie er als Erstgeborener auf sein Erbe verzichten konnte. Suggerierte sein Vater mit seinen Worten nicht auch, dass sein Bruder besser sei als er? Und das ausgerechnet in dem Metier, das dem Vater so wichtig war? Wie könnte der Vater stolz auf seinen Ersten sein, wenn dieser das Familienerbe aufgab? Zugleich wollte er nicht, dass sein Vater für ihn Entscheidungen traf. Nur er selbst sollte sein Leben in die Hand nehmen dürfen. Und als Erstgeborener sollte er das erste Recht bekommen!
Der zweite Ratschlag war deutlich persönlicher und ging Adalbert damals einfach zu weit.
»Sohn«, hatte er wieder begonnen, »sei mir nicht böse, wenn ich mich einmische. Aber Gudrun ist nicht gut für dich. Du brauchst jemanden an deiner Seite, der deine Seele in Geborgenheit und Vertrauen bettet. Das kann deine Frau nicht! Du hast meinen Segen, wenn du dich neu orientieren möchtest.«
Beide Empfehlungen hatte Adalbert ignoriert. Wie er heute wusste und sich eingestehen konnte, nur aus Trotz. Damals war er sich sicher, dass er genug Ausstrahlung und Wissen besaß, um die vor ihm liegenden Aufgaben, eine Bank erfolgreich zu führen und eine dauerhaft liebevolle Ehe zu führen, zu bewältigen. Allein sein Name, seine adlige Herkunft sowie seine außergewöhnliche Erscheinung mit den 1,93 Meter Körpergröße, der robusten Figur, dem wallenden grau melierten Haar, den grünen Augen und den ausgeprägten Wangenknochen schienen ihm ausreichende Voraussetzungen.
Doch er hatte bald erkennen müssen, dass oberflächliche Perfektion langfristig weder ausreichte, um eine glückliche Ehe zu führen, noch, um ein erfolgreiches Unternehmen unbeschadet durch die Stürme der Zeit zu lotsen. Niemand anderer als er selbst war schuld an seiner jetzigen Misere, das wusste er. Und das frustrierte ihn am meisten. Er war ein blauäugiger, einfältiger Unternehmer, der vom Handwerk eines Bankiers nichts verstand und letztlich auch keinerlei Interesse daran hatte, ein guter Banker zu werden.
Zusammen mit der Steuerkanzlei und den Wirtschaftsprüfern der Bank hatte er nochmals einen Weg gefunden, die Zahlen 2003 und den Forecast 2004 besser aussehen zu lassen, als sie wirklich waren. Dafür hatte er versichern müssen, ›Tafelsilber des Unternehmens‹, wie den PAREF, schnellstens zu Geld zu machen und damit die Fehler der Vergangenheit mit der Liquidität der Zukunft auszumerzen. Bislang waren weder der Markt noch eine Behörde aufgeschreckt. Doch ein einziger anonymer Hinweis würde reichen, um die Bank zu erledigen. Bis Freitag kommender Woche hatte er Zeit bekommen, eine Lösung zu finden, sonst würden die Wirtschaftsprüfer im eigenen Interesse handeln.
Der PAREF, Prinz Adalbert Real Estate Fund, verwaltete ein Immobilienpaket und war genau solch ein Asset, welches durch Verkauf die finanzielle Situation der Bank verbessern könnte. Der Vermögenswert belief sich leicht auf 2 Mrd. Euro. Adalbert hatte den Kauf der Immobilien in New York City, Tampa, Florida, Dallas, Texas und Birmingham, Alabama für den PAREF kurz nach dem Tod seines Vaters und zu Beginn des Streits mit seinem Bruder eingefädelt. Er hatte das Immobilienpaket für 1,2 Mrd. US-Dollar, damals etwa eine Mrd. Euro, erworben. Da ihm selbst die finanziellen Mittel fehlten, veräußerte er ein Drittel des PAREF für den Gegenwert des Gesamtkaufpreises an seine eigene Bank. Die anderen zwei Drittel lauteten auf seinen Namen. Die Nebenkosten des Immobilienerwerbs deckte er mit den Mieteinnahmen der Immobilien ab. Da er alleine für die Bank zeichnungsberechtigt war, schloss er das Geschäft ohne das Wissen seines Bruders ab. Zwar hätte es genaugenommen dessen Zustimmung bedurft, da sie jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits miteinander im Clinch lagen, fälschte er Friedberts Unterschrift, signierte damit einen fingierten Gesellschafterbeschluss und segnete somit die Beteiligung am PAREF nach innen und außen rechtskonform ab. Den Sitz des Fonds verlegte er nach Singapur, so war es ein Leichtes für ihn, seine Anteile vor Berlin zu verschleiern.
Während der kurzen Affäre, die er im Oktober letzten Jahres mit Gina de Silvestri gehabt hatte, zeigte sich dann schließlich ein Lösungsweg aus seinem Dilemma, der Insolvenz der Bank, auf. Als er sich Gina in einem Moment der totalen Hingabe und Schwäche anvertraute, versprach sie, für ihn zu kämpfen. Sie entwarf ein Konzept zur komplett





























