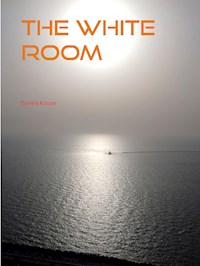
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sind Sie schon einmal gegen Ihren Willen in einen Raum eingesperrt worden? Sind dabei körperlicher und seelischer Folter unterzogen worden? Wurde das Ganze noch in den dunklen Seiten des Internets live beobachtet? Erweckt die Vorstellung ein Schaudern in Ihnen? Doch wann beginnt die wahre Hölle? In diesem Raum oder erst danach, wenn die Erinnerungen Sie heimsuchen? Begleiten Sie Henry Geller dabei, wie er mithilfe von seiner Psychotherapeutin Jennifer Cohen versucht, die Erinnerungen an die Gefangenschaft hinter sich zu lassen und wieder zurück zu sich selbst zu finden. Immer wieder wird er Sie als Leser*in mit in seinen sogenannten Weißen Raum nehmen. Sie werden eine Achterbahnfahrt der Gefühle erleben, die zwischen Hoffnung, Einsamkeit, sozialer Isolation, Wut, Schmerz, Selbstmitleid, Aussichtslosigkeit, unmenschlicher Sensationsgier und dem Verlust des rationalen Verstandes stattfindet. Wer hat ihn in diesen Raum gesperrt? Was war die Motivation der Entführer? Wiese ausgerechnet er? Im Verlauf der Handlung scheinen sich diese Fragen zu klären, doch gipfelt alles in einer überraschenden Wendung, die Sie als Leser*in die Geschichte aus einem völlig neuen Blickwinkel sehen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
The White Room
ImpressumThe White Room© 2020 Daniela Kasper
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9783749486342
Herstellung und Verlag: BoD - Books on Demand, Norderstedt
The White Room
Verfasst von Daniela Kasper
Copyright 2020 ©Daniela Kasper
The White Room
Alle Rechte vorbehalten.
Tag 1
Als ich die Augen öffnete, dröhnte mein Kopf. Mein Blick war verschwommen und ich musste blinzeln. Ich lag auf dem Rücken. Um mich herum war es hell, blendendes Weiß stach mir von den Wänden entgegen. Langsam wurde mein verschwommener Blick klarer. Vorsichtig richtete ich mich auf. Vor Schmerzen hielt ich meinen Hinterkopf. Man musste mir einen Schlag versetzt haben. Ich sah mich um. Ich befand mich in einem kleinen, nur etwa 14 qm großen Raum. Neben mir stand ein weiß bezogenes stählernes Bett, das ungemütlich aussah. Darüber ein kleines Fenster, das verschlossen und mit weißer Farbe abgedichtet war. Ein weiß gestrichenes Rohr schlängelte sich unter dem Fenster entlang. Auch es trug weiße Farbe, die noch sehr frisch aussah. Gegenüber befand sich eine Tür, die ebenfalls weiß gestrichen war. In der Ecke stand eine Toilette, direkt daneben konnte ich ein Waschbecken erkennen. Über dem Waschbecken befand sich eine Art spiegelnde Oberfläche. Man konnte jedoch erkennen, dass es kein typischer Spiegel war, der schnell zerbrach, wenn man nur gegen ihn schlug. Ich schaute an die Decke. Neonlicht durchströmte den kalt wirkenden Raum. Doch ein Detail sprang mir hier direkt ins Auge: Eine Kamera. Daneben ein Lautsprecher. Ich wurde beobachtet. Instinktiv überkam mich eine bisher unbekannte Panik. Rasend vor Angst sprang ich auf und rannte zur Tür. Ich wusste nicht, wieso ich erwarten konnte, dass die Tür sich öffnen ließ. Natürlich war sie verschlossen. Ich rüttelte panisch am Türknopf und schrie dabei um Hilfe. Fragen schossen durch meinen Kopf. Was machte ich hier? Wer beobachtete mich und wieso zum Teufel wurde ich, der durchschnittlichste Mensch ohne nennenswerte Hobbys, politische Interessen oder Ersparnisse entführt? Wer glaubte denn, dass ich mich für eine Entführung eignen würde? Ich, der 28-jährige Durchschnittsbürger, ohne Frau und Kinder, der sich als noch recht frischer Masterabsolvent nur spärlich einen kleinen Urlaub und die Mietwohnung in Westwood leisten konnte. Ich war fassungslos. Das MUSSTE ein Irrtum sein. Ich ließ den Türknauf los. Tränen schossen mir in die Augen, als mein Atem sich langsam beruhigte. Ich sank mit dem Rücken an die Tür gelehnt zu Boden. Ich wurde verwechselt! Es war zu offensichtlich. Niemand hätte einen Grund mich zu entführen. Die hatten es auf jemanden abgesehen, der so ähnlich aussah wie ich und sich auch zufällig an dem Abend im Lost and Found mit Freunden auf einen Drink getroffen hatte. Ja, so war es, da gab es für mich keine Zweifel. Wahrscheinlich ist es ihnen sogar schon aufgefallen und sie überlegten gerade, wie sie sich bei mir entschuldigen sollten. Noch immer zitterte ich am ganzen Körper und weinte. Vielleicht auch einfach vor Erleichterung, der Gedanke, dass ich verwechselt worden bin, beruhigte mich. „Oh, wie schön, dass du zu dir gekommen bist, Henry!“, schallte eine entsetzlich elektronisch verzerrte Stimme aus dem Lautsprecher durch den weißen Raum. Ich drehte mich zur Kamera. Meine Ohren glühten, als ich meinen Namen hörte und ein Gefühl der Übelkeit überkam mich. Mein Körper fühlte sich augenblicklich taub an und meine Beine wurden zu Gummi. Mir wurde schwindelig und der Raum begann sich zu drehen. Wieso kannte die Stimme meinen Namen? Augenblicklich wurde mir bewusst, dass es sich nicht um eine Verwechslung handeln konnte. Ich wurde entführt. Bewusst. Ich war gefangen. „Was wollt ihr von mir? Wer zum Teufel seid ihr?“, schrie ich die Kamera an, als Tränen weiter meine Wangen herabrannten. „Henry. Warum wirst du denn direkt so böse zu mir?“, antwortete die verzerrte Stimme. Klar, dachte ich, nur ein Feigling verzerrte seine Stimme, damit man ihn nicht erkennen konnte. Das Gefühl der Angst wich langsam der Wut. Was sollte das hier? „Oh, das kann ich ja gar nicht verstehen, wieso bin ich wohl böse? Ich bin gegen meinen Willen in einem scheiß Raum, keine Ahnung wo, weshalb und wieso gerade ich? Was wollt ihr? Meinen Sparvertrag mit den paar Dollarn? Ist es das, was ihr wollt? Geld?“ „Ach Henry. Geld, Geld, Geld, das ist doch alles, an was ihr erfolgreich Studierten immer denkt. Ihr denkt doch, alles ist käuflich. Ein schickes Auto, Urlaube, Liebe, ja sogar Freiheit? Und ihr denkt euch, will ich alles haben, gerne, kaufe ich mir. Tja, mein Lieber. So einfach ist es hier drinnen nicht. Hier kann man sich kein Glück kaufen. Sieh dich als Teil eines Experiments. Wir gestalten hier ein völlig neues Experiment, das Big Brother und die üblichen RedRooms weit hinter sich lassen wird. Und Henry, das tollste ist, DU bist das Versuchskaninchen. Ist das nicht wunderbar? Du kennst doch sicher RedRooms nehme ich an?“ Die verzerrte Stimme lachte und ich erstarrte. Versuchskaninchen? Experiment? Big Brother? RedRooms? Was zum Henker waren RedRooms? Bin ich etwa wirklich irgendwelchen Freaks zum Opfer gefallen, weil ich rein zufällig gestern mit ein paar alten Freunden aus Studienzeiten mal wieder ausgehen wollte? „Ich…ich habe keine Ahnung, wirklich nicht“, stotterte ich. Meine Beine fühlten sich weich wie Gummi an. Sterne funkelten vor meinen Augen. Mein Puls raste. „Oh, stimmt. Ein Gutmensch wie du kennt die dunklen Seiten des Internets nicht. Menschen bezahlen viel Geld dafür, um andere Menschen in RedRooms leiden zu sehen. Für den Tod zahlen sie noch mehr.“ Panisch merkte ich, dass ich meine Augen weit aufriss und rannte ich zum weiß gestrichenen Fenster und schlug um Hilfe rufend dagegen. „Hier wird dich niemand hören. Aber keine Sorge, dein Tod ist nicht geplant, wir wollen ja kein klassischer RedRoom sein. Hab ich gerade gesagt, du hörst mir einfach nicht zu, Henry. Mein Freund, nutze den heutigen Tag, um dich mit deiner schönen neuen Wohnung anzufreunden. Ich hoffe sie gefällt dir, auf Deko mussten wir leider verzichten. Sicherheitsgründe, wirst du sicher verstehen. Trotzdem wirst du ab jetzt hier leben“, sagte die Stimme und die Lautsprecher gingen mit einem lauten Knacken aus. Meine Augen waren derart stark von Tränen unterlaufen, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Ich drehte mich zur Tür und blickte an die Decke. An der Kamera blinkte noch immer der rote Punkt. Ich war auf Sendung. Schöne neue Wohnung? Ab jetzt hier wohnen? Was war das? Ein Albtraum? Ein Witz? Wollte mich jemand übel auf den Arm nehmen? „Hey, komm zurück, wenn das hier ein Scherz ist, dann löst ihn jetzt auf. Ihr hattet doch euren Spaß an mir. Es reicht!“ Ich wartete. Nichts. Stille. Neue Wohnung, das sollte eine Wohnung sein? Hier war eine verdammte Kamera auf das Klo gerichtet! Das konnte doch keine Wohnung sein. Welchen Voyeuren war ich zum Opfer gefallen? Ich sah mich um. Das Weiß der Wände sprang mir quasi entgegen und drängte mich noch mehr in die Enge, als es das etwa 14 qm große Zimmer ohnehin schon tat. Der Lautsprecher knackte. Die Stimme meldete sich zurück: „Henry, mein Lieber. Der Spaß beginnt doch erst! Aber ich habe ganz vergessen zu fragen, ob Reis und Bohnen deine Lieblingsspeise sind?“ „Wieso?“, antwortete ich, „wozu soll das wichtig sein?“ „Na, wenn nicht, wird sie ab heute deine Lieblingsspeise. Reis und Bohnen werden nämlich ab sofort deine einzige Nahrung sein, die du sehen und essen wirst. Wasser hast du ja am Wasserhahn, du bist ja schon groß, du wirst es schon schaffen, Wasser zu schöpfen. Und nun stell keine Fragen, du wirst sie alle irgendwann selbst beantworten können, ruh dich lieber aus, genieße die Ruhe, solange du noch kannst!“ Der Lautsprecher knackte erneut. Die Stimme hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Gestern noch war alles wie immer und heute? Ich bildete mir sicher nur irgendetwas völlig Verrücktes ein, ich bin sicher auf den Kopf gestürzt, hatte zu viel getrunken und phantasierte jetzt. Ich legte mich auf das Bett. Es war hart, die Matratze mit Sicherheit gebraucht und das Laken, das Kissen und der dünne Bettbezug – natürlich weiß. Es fehlte nur noch eine Gummibeschichtung der Tür, dachte ich mir, dann wärst du sicher in einer Gummizelle gelandet. Mein Kopf dröhnte noch immer. Ich schloss die Augen. Ich redete mir ein, ich habe einfach zu viel getrunken, als ich gestern, am 15.01.2016 mit meinen Studienfreunden ausgegangen war. „Das ist kein RedRoom…das ist ein weißer Raum“, murmelte ich und verschwand aus dem weißen Raum.
10.11.2017
„Mr. Geller, ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich glaube, dass es Ihnen guttun würde, wenn sie mal ganz hier raus kommen. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem ich Ihnen nicht mehr weiterhelfen kann. Anders gesagt: ich mache mir Sorgen um Sie und Ihren Gesundheitszustand. Ich befürchte, dass Sie suizidgefährdet sind.“ „Dr. Bakerhill, nein, das verstehen Sie falsch, bitte, ich…ich…nein, nein, ich komme klar, ich bin nur im Moment…“ „Suizidgefährdet, Mr. Geller!“ Der brillentragende Psychiater mit den dunklen Haaren, die langsam ins Grau übergingen, sah mich streng an. Ich senkte den Blick. Ich schaute auf meine neun Finger, die ich in auf meinen Knien ineinander geknotet habe. Ich blickte langsam wieder auf, sah ihm direkt in die dunklen Augen und fragte: „Was schlagen Sie also vor? Was kann mir an diesem Punkt noch helfen?“ „Nehmen Sie meinen Rat ernst: Lassen Sie sich einweisen. Gehen Sie für einige Wochen oder Monate in eine geschlossene Klinik.“ Ich hielt die Luft an. Ich sollte also in die Klapse. Es war also so weit, jetzt war ich an dem Punkt angelangt, dass man mich einweisen wollte. Ich fühlte, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich. „Ich will aber nicht nach Santa Rosa!“ Dr. Bakerhill fuhr fort: „Es gibt eine noch recht neue Klinik, die ich Ihnen empfehlen kann. Sie liegt im Süden Kaliforniens, man sagt, die Klinik wärmt die Gemüter. Sie liegt auf einer kleineren Insel, Greyson, nicht zu verwechseln mit Alcatraz. Auf Greyson gibt es auch Bewohner, nicht nur die bloße Klinik, aber die Therapeuten leben dort auch und sind somit im Zweifelsfall immer zur Verfügung. Versuchen Sie es, ich habe bisher nur Positives gehört.“ „Aber…aber meinen Sie, dass ich soweit bin, dass ich mich einweisen lassen muss? Gehöre ich echt in eine Zwangsjacke?“ Ich war verunsichert. Ich war nervös, zitterte am ganzen Körper und merkte, dass Tränen meine Augen füllten. Ich versuchte sie zu unterdrücken, doch meine Stimme brach als ich weiter redete: „Ich will doch nur, dass mich der ganze Scheiß einfach wieder schlafen lässt. Ich will doch nur mein unbekümmertes Leben zurück, Doktor, können Sie da nichts machen? Hypnose oder so?“ „Mr. Geller. Ich kann Sie natürlich nicht zwingen. Aber ich bin ehrlich, an Ihrem Fall liegt mir sehr viel. Auch ich habe mal reingeschaut, wie sicher jeder Bürger mit Internetzugang weltweit und war schockiert, Sie dort zu sehen. Da kannte ich Sie noch nicht persönlich, aber ich wollte Sie unbedingt therapieren und als ich dann Ihren Fall letztes Jahr endlich tatsächlich auf dem Tisch liegen hatte, wusste ich: Das wird die größte Herausforderung meines Lebens. Aber ich wollte es schaffen. Ich wollte Sie von ihrem Raum befreien, der inzwischen mehr in Ihrem Kopf als in Ihrer Erinnerung lebt, das wissen Sie. Doch die zwei Sitzungen in der Woche helfen uns doch nicht weiter, Mr. Geller, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sie verlassen nach einer Stunde meine Praxis, gehen nach Hause und sind wieder allein mit Ihren Gedanken und Ihren Erinnerungen. Wir beide wissen doch, dass Sie sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit Ihren Erinnerungen. Auf dem Weg heim treffen Sie jedes Mal unweigerlich auf Passanten, die Sie erkennen. Inzwischen sind Sie doch derart sensibilisiert, dass Sie es schon riechen können, wenn wieder jemand überlegt, ob Sie DER Henry Geller sind. Sie können nicht loslassen, wir drehen uns doch seit einem Jahr immer wieder im Kreis. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass Sie irgendwann wieder glücklich werden. Aber das liegt nicht mehr im Rahmen meiner Möglichkeiten.“ Ich nickte betroffen, Tränen tropften mein Kinn herunter. Er hatte Recht. Ich musste es mir eingestehen. Es wurde schlimmer, mit jedem einzelnen Tag wurde es einfach schlimmer. Meine Schlaftabletten waren inzwischen so hoch dosiert, dass ich tagsüber kaum noch wach wurde, die Antidepressiva schienen meine Organe langsam zu zerfressen und trotzdem schlief ich schlecht, fühlte mich unendlich unglücklich und wurde, sobald ich die Praxisräume verließ, wieder beobachtet. Ich wollte Abstand gewinnen, vor allem zur Gesellschaft, die mich ununterbrochen erkannte. Da kam mir eine Idee: „Dr. Bakerhill. Ich mach’s. Aber ich brauche Ihre Hilfe.“ „Die bekommen Sie jederzeit von mir, das wissen Sie.“ „Dieses Mal bitte ich Sie um einen anderen Gefallen. Haben Sie heute Nachmittag Zeit mit mir in die Stadt zu fahren?“
Tag 2
Es war kein Albtraum. Es war die verdammte Realität. Wie sehr hoffte ich, die Augen zu öffnen, und einfach wieder in meinen heimischen vier Wänden zu liegen, mich wohl zu fühlen und morgen zur Arbeit zu gehen. Sicher vermisste man mich bereits und begann nach mir zu suchen. Ich erwartete, dass sich jede Minute die Tür öffnen würde. Ich konnte meine Retter schon vor meinem inneren Auge sehen. Doch nichts geschah. Hier lag ich. In dem weißen Bett, mit der steinharten Matratze inmitten der schneeweißen Wänden. Der einzige Farbklecks war meine Kamera. Ihr rotes Licht erinnerte mich daran, dass sie mich ununterbrochen und gnadenlos beobachtete. Etwas rotes hatte mein weißer RedRoom also doch. Wer weiß, vielleicht klebte bald mein Blut an den weißen Wänden. Ich wollte es mir nicht vorstellen und schleppte mich zum Waschbecken, um Wasser zu schöpfen. Über dem Waschbecken befand sich kein richtiger Spiegel, es war vielmehr ein Aufkleber, der eine sich spiegelnde Oberfläche besaß. Ich berührte den Aufkleber. Er war weich. Sie haben an alles gedacht. Ich hatte keine Chance den Spiegel zu zertrümmern und mich mit Scherben gegen mögliche Entführer, die sich ohnehin nicht blicken ließen, zur Wehr zu setzen. Ich ließ den Aufkleber los und betrachtete mich. Ich sah echt fertig aus. Meine braunen Haare wirkten matt und glanzlos, obwohl ich eine Kurzhaarfrisur trug, standen sie in alle Richtungen ab. Meine Augen waren gerötet von tiefen Furchen unterlaufen. Ich nahm das Wasser und befeuchtete mein müdes Gesicht. „Guten Morgen, Henry. Na haben wir gut geschlafen?“ Ich blickte auf zum Lautsprecher. „Halt dein Maul“, schrie ich die Stimme an. „Henry, es ist 6.30 Uhr, da kannst du doch nicht so schreien, meine armen Ohren! Du musst Hunger haben?“ „Ich hab garantiert keinen Hunger! Ich will nur hier raus, ich will nach Hause“, antwortete ich trotzend und blickte direkt in die Kamera. Ich hatte Hunger, doch war das Gefühl der Übelkeit stärker als das Loch in meinem Magen. Diese Ohnmacht, nicht in der Lage zu sein, diesen weißen Raum zu verlassen, um einfach in Ruhe zu pinkeln, drehte mir den Magen um. Die Kamera filmte mich gnadenlos. Ihr Kabel verlief unterhalb der Decke und verschwand direkt durch ein kleines Loch in der Wand. Ich hatte keinerlei Gegenstände, die ich vor die Kamera hätte werfen können. Nein, nur mich, meine Kleidung von dem Abendessen mit den ehemaligen Studienfreunden, meine Bettdecke und mein Kissen. „Henryyyy, dein Frühstück wird vorbereitet. Du musst immer gut essen, sonst wirst du zu dünn!“, mahnte die Stimme. Ich blickte an mir herab. Nun ja, ich konnte tatsächlich ein paar Pfund Gewicht verlieren, mein Bauch war mal dünner, mein ganzer Körper definierter. „Also zu dünn bin ich ja wirklich nicht, siehst du gar nichts durch deine Kamera? Wofür beobachtest du mich dann?“ „ICH? Ich bin nur dein Kontakt. Dein Publikum ist die ganze Welt. Also na gut, eher bald. Zugegeben, gerade gefallen mir die Zuschauerquoten noch gar nicht, gestern Nacht haben nur ein paar Leute reingeschaut, aber bald werden wir deine Show spannender gestalten und dann Henry, dann wirst du ein großer Star! Dann wird man dich überall kennen! Im Moment kennt dich nur ein winzig, winzig kleiner Teil des Darknets und die fühlen sich noch seeeehr gelangweilt von dir. Verstehe ich, ich meine bisher liegst du da nur rum. Momentan kostet es auch noch kein Geld, dich zu beobachten. Ich baue auf dich, irgendwann wird man ganze Bitcoins zahlen müssen, um dich zu beobachten!“ Ich verstand gar nichts mehr. Darknet? Publikum? Show? „Was redest du?“ „Henry, du bist doch schlau. Aber es wird sich alles noch klären, es ist noch so früh morgens, da habe ich einfach keine Lust viel zu erklären.“ Ich dachte an den gestrigen Tag, an den Tag meiner Entführung. „Wo sind meine Freunde?“ „Ach die Henry, die sind zu Hause und wundern sich bestimmt, wieso du dich nicht mehr gemeldet hast. Aber bald werden auch die dich im Internet finden, also behalte lieber deine Figur und iss, damit sie dich auch noch erkennen.“ „Du bist doch wahnsinnig“, strömte es aus mir heraus und ich setzte mich aufs Bett und stützte meinen Kopf verzweifelt auf meine Hände. Ich schüttelte den Kopf, als hoffte ich, durch das Kopfschütteln aus diesem Wahnsinn entrinnen zu können. Ich hob den Kopf und merkte, dass es nicht gelang. Ich schaute zur Kamera hoch und sagte klar und deutlich: „Ich wurde entführt. Einfach, damit ein Schaulustiger mich 24 Stunden am Tag ins Darknet stellt, damit perverse Leute mich beobachten können, wie ich mein Dasein hier auf diesen 14 qm verbringe und versuche vor Langeweile nicht verrückt zu werden?“ „Oh, es sind nur 13 qm Henry. Mehr Platz war leider nicht drin. Und nein, du wurdest nicht entführt, damit du ihnen deine Langeweile präsentierst. Den Weg, wie du verrückt wirst, den will ich gerne der Außenwelt präsentieren, das wird unser Werk, mein Freund.“ „Freund? DU hältst mich hier gefangen und wagst es mich einen FREUND zu nennen?“, antwortete ich wütend. „Henry, du bist einfach immer so schnell so aufgebracht. Aber keine Sorge, du wirst bald viel Zeit haben, über dein Gemüt nachzudenken.“ Ich war wütend. Ich war fassungslos. Mir fehlten die Worte. Ich fühlte mich noch immer, wie in einem Albtraum. Der wollte aber leider nicht enden. Da kam mir eine Idee. Ich blickte geradewegs in die Kamera. „Mein Name ist Henry Geller. Ich bin entführt worden, nachdem ich abends...“ Das rote Licht der Kamera erlosch. So, das wollte die Stimme also nicht. Wenn mich jemand finden konnte, dann nur, wenn man es schaffte, meinen Weg der Entführung nachzuvollziehen und Zeugen zu finden und das so schnell wie möglich, noch waren ihre Erinnerungen an eine mögliche Entführung vielleicht da. „Mein Lieber, wag es noch einmal und ich werde dir die schlimmsten Schmerzen zuführen, die du je gefühlt hast, das verspreche ich dir. Abgesehen davon, im Darknet sind nur kranke Leute unterwegs…also zumindest die meisten. Die interessiert es nicht, wie du heißt oder wer du bist. Die wollen dich einfach nur leiden sehen, mehr nicht“, zischte die Stimme bei noch immer abgeschalteter Kamera. So, jetzt wollte man mir also schon Schmerzen zufügen. Aber welcher körperliche Schmerz konnte schon schlimmer sein, als die Angst, die ich seit gestern ununterbrochen spürte? „Schön, dann stehst du Feigling wenigstens vor mir und ich hab die Chance dir aufs Maul zu hauen!“, antwortete ich wütend. Der rote Punkt an der Kamera blinkte wieder, der Lautsprecher knackte und es herrschte Stille. War meine Aufforderung etwa erfolgreich? Ich wartete…und wartete…wäre meine Situation nicht so schrecklich beängstigend gewesen, hätte ich mich sicher gelangweilt. Ein Leben ohne Uhr war wahrlich merkwürdig. Es gab aber auch kein Sonnenlicht, an dem ich mich orientieren konnte. Die weiß abgeklebten Fenster hielten jegliches natürliches Licht davon ab, in den Raum zu gelangen. Dafür strahlte die Neonsonne rund um die Uhr gnadenlos auf mich herab. Ich konnte nicht sagen, wie lange ich darauf wartete, dass etwas geschieht, es war eine gefühlte Ewigkeit. Ich wandte mich zur Kamera. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich wagte einen zweiten Versuch, sprach dieses Mal schneller, aber lauter: „Mein Name ist Henry Geller, ich befinde mich hier gegen meinen Willen, das letzte woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Lost and Found war und von da ein Taxi Richtung Westwood genommen habe, ich war mit…“ Rotes Licht aus. Gut, das sollte fürs Erste reichen, dachte ich zufrieden und setzte mich aufs Bett. Ich wartete auf die nächste Drohung der Stimme, wartete aber vergeblich. Ich wollte mich bewegen. In mir wuchs Hoffnung. Egal, wer es gehört hat, irgendjemand wird es gehört haben und vielleicht waren die Cops sogar schon am Werk. Ich ging zum Waschbecken und schöpfte Wasser, da ich Durst hatte. In dem Moment öffnete sich die Tür. Ich drehte mich schnell um und hinter mir standen 5 schwarz gekleidete Männer mit Sturmmasken. Sie stürmten auf mich zu und ehe ich mich versah, wurde ich mit Schlagstöcken und Tritten zu Boden befördert. Ich schrie und krümmte mich vor Schmerzen. „Lasst mich in Ruhe! Haut ab! Hört auf!“, schrie ich wie in Trance. Das letzte, was ich sehen konnte, bevor sich mein Bewusstsein verabschiedete, war das rote Licht der Kamera. Ich war auf Sendung. Ich wurde live ins Internet übertragen, während ich verprügelt worden bin. Jetzt bekamen sie die Show geboten, die sie verlangten.
17.11.2017
Ich blickte von der Reling der Fähre und sah die große Insel vor uns liegen. Kleine Wellen umspielten die Fähre und brachten uns schubweise näher zur Insel. Ich schob die Fake-Brille nach oben, sie drückte unangenehm auf meinem Nasenrücken. Daran musste ich mich wohl noch gewöhnen. Sie gehörte jetzt zu mir. Zu dem neuen Henry, der auf dem Weg in die Klapse war. Wir näherten uns der Insel. Shutter Island ließ grüßen. Hauptsache ich verlor hier nicht auch noch mein letztes bisschen Verstand, wie es Andrew im Film erging. Nein, ich habe Schlimmeres überstanden, dann werde ich nun auch mit einer geschlossenen Nervenklinik umgehen können, dachte ich mir. Aber vor allem brauchte ich Ruhe. Ruhe vor der Gesellschaft, die mich immer und überall erkannte. Ruhe vor meiner unfreiwilligen Medienpräsenz. Ruhe vor mir. Vor meiner Geschichte, meiner Wahrheit. Deshalb habe ich mit Dr. Bakerhill einen Ausflug gemacht. Er hat mir geholfen, eine falsche Identität zu erschaffen, mit der ich mich in die Klinik einweisen lassen konnte. Meine Aufgabe war es, mir eine alternative Geschichte zu überlegen, weshalb ich unter posttraumatischen Belastungsstörungen litt. Dr. Bakerhill erledigte den Rest für mich. Während ich an mein verändertes Äußeres, den für mich unüblich schicken Kleidungsstil und sogar den falschen Nachnamen dachte, fielen mir doch tatsächlich Parallelen zu Shutter Island auf. Ich hatte ein neues Ich geschaffen. Doch sah ich keine andere Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Ich war kein Brillenträger, der große runde Rahmen vermittelte meinem Gesicht aber unmittelbar eine völlig andere Optik. Auch meine Haare trug ich wieder etwas länger, sie reichten nun bis übers Ohrläppchen hinaus und sahen eher nach Bad Hair Day als nach gewolltem Styling aus. Ich hoffte, dass es mir half, nicht erkannt zu werden. Ich erkannte mich ja selbst kaum noch. Seit ich wieder in Freiheit lebte, nahm ich wieder etwas an Gewicht zu, was wahrscheinlich an meinem Medikamentencocktail lag. Trotzdem hatte ich noch lange nicht wieder mein früheres Gewicht erreicht, geschweige denn den kleinen Speckbauch zurück, den ich vor meiner Entführung angefuttert hatte. Nun, nicht so, dass ich ihn vermisste. Ich sah aber eindeutig verändert aus. Also ich musste verändert aussehen, ich schaute mich schon länger nicht mehr im Spiegel an. Wozu auch? Ich lächelte, während ich der Insel entgegenblickte. Greyson. Meine neue Heimat auf Zeit. Nein, ich wusste ja, dass meine Identitätsveränderung nicht real war und dass sie nur meinem Schutz diente. Zwar war mein Therapeut nicht begeistert von meiner Idee, doch ließ er sich überzeugen, dass es tatsächlich die beste Möglichkeit war, einmal nicht erkannt zu werden, sei es nur von anderen Insassen. Insassen. Wie ich redete, als wäre ich ein Gefangener gewesen. Das war ich damals. Heute fuhr ich zwar in eine geschlossene Klinik, doch mit dem Ziel, meine Freiheit zurückzuerlangen. Welch Ironie. Freiheit durch Eingesperrtsein erreichen zu wollen. Freiheit, dieser Begriff, den ich nie wirklich in meinem Leben zu schätzen wusste, bis ich ihr beraubt wurde. Nun wünschte ich mir nichts mehr. Freiheit, körperlich, aber auch geistig. Dass ich einmal nur Ruhe vor meinen Gedanken hätte. Vor diesen Gedanken, die sich permanent in einem weißen Raum befanden. Doch deshalb war ich hier auf dieser Fähre. Die Überfahrt dauerte nur etwa 40 Minuten und die Anlegestelle näherte sich. Wieder sah ich von der Reling hinab. Die Wellen zogen mich langsam in ihren Bann. Ein merkwürdiges Gefühl von Freiheit überkam mich, als ich das tiefe Blau des Wassers ansah. Ich war nervös, das konnte ich nicht abstreiten. Begleitet von meinem kleinen Samsonite Koffer verließ ich die Dachterrasse der Fähre und fand unter Deck Dr. Bakerhill, der auf mich wartete. „Wollen wir, Henry?“, fragte er mich. Ich nickte. Während aller Sitzungen, die ich knapp ein Jahr lang von ihm erhalten habe, hat er mich nie beim Vornamen genannt. Es war, als wären wir eine Art Freunde geworden. Vor der Sache wäre der Mittvierziger sicher niemand gewesen, den ich zu meinen Freunden gezählt hätte. Er war stehts kühl und besaß nur ein kleines Verständnis für Ironie. Die Wahrheit war aber, dass ich all meine sozialen Kontakte seit der Sache abgebrochen hatte. Ich konnte die Fragen nicht mehr ertragen. Täglich wurde ich mit Fragen zum weißen Raum konfrontiert. Von Journalisten, Passanten, Freunden, der eigenen Familie. Keine sozialen Kontakte bedeuteten auch keine Fragen. Einen Preis, den ich gerne zahlte. Doch fühlte es sich gut an, dass Dr. Bakerhill mich auf diesem Weg begleitete. Wir verließen die Fähre und betraten eine ganz eigene Welt. Niemals hätte ich gedacht, dass diese Insel zu Kalifornien gehörte. Nur das Wetter erinnerte einen daran, dass man sich am südlichsten Punkt eines Südstaats befand. Greyson war eine autofreie Insel. Dass es so etwas noch im 21. Jahrhundert gab und das mitten in Amerika, wunderte ich mich. Ich beobachtete die Menschen, die uns passierten. Sie wirkten alle so zufrieden, lächelten einen an oder nickten einem gar zu. Oder erkannten sie mich trotz meiner Maskerade? Das konnte nicht sein… Oder doch? Die Häuser waren klein. Sie besaßen keine Vorgärten. Die Treppen zu ihren Haustüren lagen direkt an der Straße. Die Straßen waren ungewöhnlich schmal und mit Kopfsteinpflaster ausgelegt. Fahrräder waren hier scheinbar das beliebteste Fortbewegungsmittel. Aber wozu brauchte man auch ein Auto, wenn die Insel so klein war, dass man sie in einer guten Stunde zu Fuß umrunden konnte? Hier gab es nur das Nötigste. Einen Deli, der alles anbot, was das amerikanische Herz begehrte, eine Buchhandlung, klar, man musste sich ja irgendwie beschäftigen, so fernab der wirklichen Welt, ein Chinarestaurant, einen Diner und eine Bar. Studenten wären hier sicher vor Langeweile umgekommen. Die Bewohner, die mir bisher entgegen kamen, schienen aber dem Studentenalter längst entwachsen zu sein. Kinder sah ich aber auch keine. Wie auch, sollten sie täglich mit der Fähre in den Kindergarten oder zur Schule fahren? Deshalb lebten hier wohl so viele ältere Menschen, der Weg zur Arbeit zum Festland wäre ebenso mühevoll. Wer wollte schon 40 Minuten Fährfahrt je Strecke täglich auf sich nehmen? Greyson wirkte sehr grün, überall gab es Pflanzen und Bäume. Sicher war der ein oder andere Bewohner ein Hobbygärtner. Ich vermutete, dass sich hinter jedem kleinen Haus ein großer Garten befand. Während wir die schmale Gasse schweigend nebeneinander entlang liefen, erschien in der Ferne ein großes Gebäude. Das musste sie sein, die Klinik. Die Wohnhäuser endeten. Ich fragte mich, ob diese Straße wohl die einzige auf der ganzen Insel war. Wenn ja, dann gab es scheinbar nur 32 Häuser, wie mir die Hausnummern verrieten. Nun lag sie vor uns. Meine Heimat für die nächste, unbestimmte Zeit. Von außen sah das hochmoderne Gebäude eher wie eine Schule oder ein modernes Bürogebäude aus. Es wirkte sehr einladend. Mir fielen direkt die vielen, großen Fenster und die weiße Fassade auf. Direkt vor dem Gebäude befand sich Parkplatz. Welch Ironie! Ganz autofrei konnte Amerika also doch nicht, selbst nicht auf einer Insel. „Für Notfälle, sagt man, falls mal einer schnell ans Festland in eine Klinik muss, ansonsten werden die Autos wohl nie bewegt“, beantwortete mir Dr. Bakerhill meine Gedanken. Der Kerl wusste auch immer, was ich denke. Verrieten mich meine skeptischen Blicke etwa immer? Vor dem Parkplatz befand sich ein Zaun. Gefühlte Ewigkeiten hoch und, klar, mit Stacheldraht besetzt. So freiwillig schienen hier einige Patienten also nicht hergekommen zu sein. Also doch Insassen. Gut, es war ja auch eine geschlossene Nervenklinik. An dem Zaun befand sich ein Tor. Hochmodern, mit Kameras und Klingel ausgestattet. Kameras. Die fielen mir immer direkt ins Auge. Welch Wunder nach Allem, das passiert war… „Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Sie sehen aus, als kämen Sie für eine angemeldete Einweisung?“, drang eine angenehme, freundliche Stimme aus der Gegensprechanlage entgegen. „Guten Morgen, Miss. Genau, mein Name ist Dr. Andrew Bakerhill, ich bringe meinen Patienten zu Ihnen, Mr. Henry Stonefield.“ An den Namen musste ich mich wohl noch gewöhnen. Die freundliche Stimme antwortete: „Lassen Sie mich kurz nachsehen….ah genau, treten Sie gerne ein.“ Das Tor öffnete sich mechanisch und ich folgte meinem Therapeuten. Wir überquerten den Parkplatz und befanden uns anschließend vor einem weiteren Tor, das sich bereits öffnete, als wir drauf zuliefen. Hinter dem Tor stand ein uniformierter Wächter. Er war mit einem Headset ausgestattet und nickte uns ohne eine Miene zu verziehen zu. Er war wohl instruiert worden, uns Zugang zum Gelände zu gewähren. Das Gelände um die Klinik herum wirkte wie ein überdimensional großer Schulhof. Eine Schotterbahn führte außen herum und ein junger Mann in weißen Shorts und grünem Shirt joggte diese lässig entlang. Auf der linken Seite vor der Klinik befand sich ein riesiger, alter Baum, der von einem bunten Garten umgeben war. Hier befanden sich einige Bänke und Stühle, selbst eine Baumschaukel gab es, auf der eine junge Frau mit weißer Stoffhose und grünem Shirt mit sichtbarer Freude schaukelte. Rechts befand sich eine Art Sportplatz, recht klein, aber er bot der Gruppe von 12 Personen genug Platz, um Basketball zu spielen. Auch sie trugen weiße Sporthosen und grüne Oberteile. Im Gehen sah ich mich weiter um. Überall befanden sich weitere, kleinere Bäume. Unter ihren Kronen saßen Leute, mal allein, mal haben sie sich zu kleinen Gruppen zusammengefunden. Manche lasen, andere schienen zu schreiben oder zu zeichnen oder sie unterhielten sich. Die meisten trugen weiße Hosen und grüne Oberteile. Vereinzelt befanden sich Personen mit hellblauen Kitteln und dunkelblauen Stoffhosen unter ihnen. Die Kittel ließen vermuten, dass es sich bei ihnen um Therapeuten handelte. Niemand wirkte bedrückt oder depressiv. Hier war ich richtig, es war die richtige Entscheidung, bestätigte ich mich selbst und betrat mit meinem Koffer an der Seite von Dr. Bakerhill die Stufen, die ins Gebäude hineinführten. Die Türen waren verschlossen und wurden ebenfalls von einem Uniformierten bewacht. Auch er trug ein Headset und öffnete uns unaufgefordert die Tür. Er betätigte nur einen Knopf und die Tür öffnete sich automatisch. Wir kamen ins Innere. Ein hoher Saal empfing uns. In der Mitte befand sich eine Rezeption, wie ich sie aus manchem Hotel kannte. Vor uns befand sich noch eine Person, ebenfalls mit Koffer in der Hand, am Empfang. Eine Frau mit kantiger Brille und kastanienbraunen Haaren, die einen hellblauem Kittel und eine dunkelblaue Stoffhose trug, kam sie abholen. Ich blickte an ihr herab und mein Blick blieb an ihren Gummibirkenstocks haften, die sie an den Füßen trug. Dr. Bakerhill hatte Recht. Hier konnte man zur Ruhe kommen, wie es aussah. Das war quasi ein Urlaub, ein sehr teurer Urlaub. Wir rückten auf, als die Dame am Empfang uns aufforderte. Sie war etwa Mitte 30, dunkelblond und hatte strahelnd weiße, gerade Zähne. Sie hätte sicher auch ein Zahnmodel sein können, so perfekt wie ihre Zähne gebleacht waren. Welcome to America. In diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, hatten scheinbar selbst Rezeptionistinnen genügend finanzielle Mittel, um sich ein perfektes Gebiss erkaufen zu können. Ich betrachtete sie weiter. Auch ihre Nase und ihre Wangenknochen hatten sicher etwas Nachhilfe gebraucht, um derart perfekt zu wirken. „So, Mr. Stonefield. Ich habe Ihre Akten schon hier liegen, Ihr Therapeut war so freundlich mir alles vorab per Post zuzuschicken. Sie müssten bitte noch einige Personalia ausfüllen und Ihren Pass benötigen wir noch. Sie können alle persönlichen Gegenstände behalten, die weder scharf, noch gefährlich sein könnten. Nur ein Handy oder ein anderes internetfähiges Gerät können Sie nicht mit in die Zimmer nehmen. Es wird täglich eine spezielle Handy- und Internetstunde geben, in der sie sich mit ihren elektronischen Geräten frei beschäftigen können.“ Sie lächelte freundlich, während sie sprach. Das perfekte weiße Lächeln zog mich in ihren Bann. Gut, da ich eh keine sozialen Kontakte mehr pflegte, war es keine Strafe für mich, mein Handy abzugeben. Dr. Bakerhill hatte mir erzählt, dass sich diese Klinik mit der weiteren Erforschung der Internetsucht beschäftigte und sich deshalb in einem Teil dieser Klinik besonders viele internetsüchtige Leute befanden. Sicher kannte mich jeder von denen, vielleicht habe ich sie sogar in die Internetsucht gebracht, weil sie mich so gerne an ihren Bildschirmen beobachteten. Gut, das war unrealistisch, eher spielten zu viele Onlinespiele an ihren Handys. World of Warcraft oder Candycrush waren hier sicher die Übeltäter. Wahrscheinlich wollte man die Personen einfach vor sich selbst schützen, indem man ihnen die Handys abnahm und die Nutzung überwachte. Ich dachte an einen Alkoholkranken, der andere Patienten sah, die mit Bierflaschen an ihm vorbeizogen. Nein, das war tatsächlich nicht fair. Bereitwillig reichte ich Miss Perfect Tooth meinen Koffer und sie überprüfte ihn auf Gegenstände, die ich nicht mit in die Klinik nehmen durfte. Ich beobachtete sie, wie sie mit ihren langen, rosafarbenen Gelnägeln meinen Krempel durchsuchte. Währenddessen suchte Dr. Bakerhill nach meinem gefälschten Pass, den er besorgt hatte. Ich musste schmunzeln. Ich selbst war nur ein Fake. Mein Nachname war falsch, meine Patientenakte war falsch, meine Brille war falsch. Genauso falsch wie die Nägel, Zähne, Wangenknochen, Nase, sicher auch die Lippen und langen Haare der Rezeptionistin. Diese Welt bot einem doch erstaunliche Möglichkeiten. Während ich darüber nachdachte, wie einfach es doch war, sich ein neues Äußeres zu verschaffen, wenn man nur die finanziellen Mittel dazu besaß, füllte Dr. Bakerhill den Fragebogen für mich aus. Ich kam mir vor, wie ein Kind, das betreut werden musste. Alles wurde für mich geregelt. Ich stand hier und beobachtete die beiden. Dr. Bakerhill hatte alle Akten über mich gefälscht. Ich lag ihm scheinbar wirklich am Herzen. Er riskierte es, seine Zulassung zu verlieren, sollte die Identitätslüge aufliegen. Das hat er mir oft genug deutlich gemacht in den letzten Stunden. Ich durfte mich also unter keinen Umständen verraten. Als Dr. Bakerhill alles ausgefüllt hatte, gab er den Fragebogen an die Rezeptionistin zurück. Die Gelnägel krallten sich in das Papier. Dann blickte zu mir auf und sagte – wieder mit einem extrem breiten Lächeln: „Perfekt, Mr. Stonefield. Die Schere mussten wir hier behalten, ebenso die Rasierer. Alles andere können Sie mitnehmen. Gleich kommt Ihre Betreuerin Cassidy und bringt Sie zu Ihrem Zimmer. Sie bekommen in unserer Anstalt zwei feste Betreuer. Eine davon ist Cassidy, der andere Betreuer heißt Bill, ihn lernen Sie morgen kennen, heute ist sein freier Tag“, sie redete weiter und ich starrte auf ihre Zähne, als würden sie mich hypnotisieren wollen, „zudem können Sie an vielen Kursen teilnehmen, Sport machen, musizieren, zeichnen, Spiele spielen, was immer Ihr Herz begehrt. Zusätzlich haben Sie jeden Tag eine Gruppensitzung und an fünf bis sechs Tagen in der Woche eine Einzelsitzung. In der Einzelsitzung werden Sie einem festen Therapeuten zugewiesen. Es gibt Essen in Buffetform, drei Mahlzeiten am Tag zu festen Zeiten, die Ihnen Ihre Betreuer zuweisen. Nachmittags können Sie einen Snack, Obst oder Kuchen zu sich nehmen. Getränke gibt es ganztags und Wasser haben Sie immer in einem kleinen Kühlschrank auf Ihrem Zimmer. Abends werden die Zimmer abgeschlossen, aber Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über das fest in der Wand installierte iPad, das einzig und allein der Kommunikation mit den Betreuern dient, Kontakt aufzunehmen, sollte etwas sein. Haben Sie noch Fragen?“ Oh, das waren viele Informationen in kurzer Zeit. Ich musste mich auf ihre Wörter konzentrieren, da mich ihre Zähne zu sehr ablenkten. Weiß, weiß wie mein weißer Raum. Er war immer da. Direkt schoss eine Frage in meinen Kopf: „Ehm ja, eine Sache wäre da noch. Befinden sich in meinem Zimmer Kameras?“ Ich hörte, wie Dr. Bakerhill mit einem Zischen Luft holte, wagte es jedoch nicht, ihn anzusehen. „Kameras, Sir? Ja, wir haben eine Sicherheitskamera in jedem Zimmer installiert. Das heißt nicht, dass wir Sie beobachten, sondern, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, darüber von unserem Kamerasystem informiert zu werden, wenn wir befürchten, dass Sie sich verletzen könnten. Das ist inzwischen leider die Regel in psychiatrischen Einrichtungen.“ „Danke, entschuldigen Sie mich bitte, ich möchte mich kurz mit meinem Therapeuten unter vier Augen unterhalten“, sagte ich und Weißzahn antwortete verständnisvoll, ohne ihr aufgesetztes Lächeln zu verändern: „Natürlich, ich informiere in der Zeit schon einmal Cassidy, dass sie Sie abholen kommt.“ Ich entfernte mich wenige Meter von der Rezeption und Dr. Bakerhill folgte mir. „Henry“, zischte er, „es war IHR Wunsch, nicht erkannt zu werden! Für Sie habe ich mich strafbar gemacht, als ich einen falschen Pass besorgt und die Unterlagen gefälscht habe, ist Ihnen gar nicht bewusst, wenn Sie direkt mit den Kameras um die Ecke kommen, dass Ihre Tarnung schneller als gedacht auffliegen könnte?“ „Dr. Bakerhill, Sie haben mit keiner Silbe jemals auch nur angedeutet, dass das hier eine Überwachungsanstalt ist! Ich dachte, Sie wollen mir helfen, stattdessen glaube ich, dass Sie mich einfach einsperren lassen wollen. Haben Sie Angst vor mir?“ „Henry, beruhigen Sie sich, verdammt nochmal! Sie sind suizidgefährdet, da ist es doch wohl klar, dass man ein Auge auf Sie wirft, wenn Sie allein sind! Angst vor Ihnen, jetzt kommen Sie mal wieder klar, ich mache mir Sorgen um Sie, verstehen Sie den Unterschied? Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, Ihr Fall liegt mir persönlich wirklich am Herzen, ich will Ihnen helfen!“ Ich ließ die Worte sacken und nickte schnell. Ich schaute abwechselnd zur Rezeption und dann wieder zu Dr. Bakerhill. „Henry“, sagte er eindringlich und sah tief in meine Augen, „niemand will Sie beobachten. Niemand will Sie leiden sehen. Alles, was diese Personen hier drinnen wollen, ist Ihnen zu helfen und Sie schützen. Und zwar vor sich selbst.“ Ich war zwar noch immer nicht recht überzeugt, doch nickte ich erneut und antwortete: „Na schön, versuchen wir es. Dr. Bakerhill, wieso nennen Sie mich beim Vornamen? Das haben Sie doch nie getan, wieso dann jetzt ab heute?“ „Ich möchte im Gegensatz zu Ihnen nicht riskieren, Ihre Tarnung auffliegen zu lassen, Henry!“ Das war also der Grund. Bereits auf der Fähre wollte er mich nicht mehr Geller





























