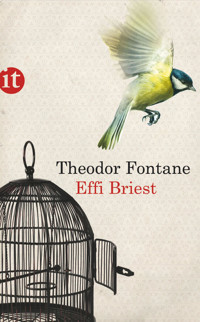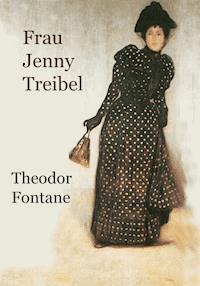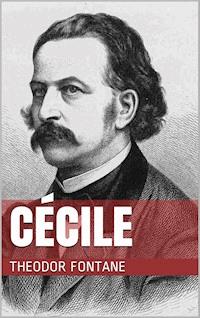3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Geschenkbuch Gedichte und Gedanken
- Sprache: Deutsch
Als Reiseschriftsteller, Balladendichter, Auslands-Korrespondent, Theaterkritiker und politischer Kommentator verbrachte Theodor Fontane den größten Teil seines Lebens. Dann warf er sich mit aller Leidenschaft in das Erzählen großer Romane, die seinen späten Ruhm begründeten. Dieser Band versammelt viele Facetten seines reichen Schaffens. Neben Auszügen aus »Effi Briest« und anderen Hauptwerken enthält er zahlreiche Fundstücke aus Tagebüchern und Briefen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wo sich Herzzum Herzenfindt
Das Fontane-Brevier
Ausgewählt vonJan Strümpel
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2019 Anaconda Verlag GmbH, Köln,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Covermotiv: »Elegant hairstyle« (vintage engraved illustration)
aus: La mode illustrée, hrsg. von La Librairie
de Firmin-Didot et Cie (1882)
Covergestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Roland Poferl Print-Design, Köln
ISBN: 978-3-641-29981-1V001
www.anacondaverlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhalt
Unsere Ruppiner Tage – Wie wir in die Schule gingen und lernten
Neuruppin. Ein Gang durch die Stadt. Die Klosterkirche
Berlin 1840. In der Wilhelm Roseschen Apotheke
An Wilhelm Wolfsohn
Gedichte: Wunsch – An Emilie – An George Fontane – Wurzels – Jan Bart
London – Richmond – Von London bis Edinburgh
Briefe von unterwegs
Kriegsgefangen
Aus den Tagen der Okkupation – Kassel
Das Belvedère im Schlossgarten zu Charlottenburg
Modernes Reisen
Aus dem Ehebriefwechsel
Parkettplatz Nr. 23
Friedrich Schiller: Die Räuber
Vierzig Jahre später
Vor dem Sturm
Allerlei Glück
Irrungen, Wirrungen
An Emil Schiff
Aus dem Ehebriefwechsel
Unwiederbringlich
Frau Jenny Treibel
An Georg Friedlaender
Mathilde Möhring
Effi Briest
Gedichte: John Maynard – Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland – Luren-Konzert – Was ich wollte, was ich wurde – Was mir gefällt – Ja, das möcht ich noch erleben
Die Poggenpuhls
Der Stechlin
Verzeiht
Zu dieser Auswahl
Quellen
Meine Kinderjahre
Unsere Ruppiner Tage
Am 27. März 1819 waren meine Eltern in Ruppin eingetroffen; am 30. Dezember selbigen Jahres wurde ich daselbst geboren. Es war für meine Mutter auf Leben und Sterben, weshalb sie, wenn man ihr vorwarf, sie bevorzuge mich, einfach antwortete: »Er ist mir auch am schwersten geworden.« In dieser bevorzugten Stellung blieb ich lange, bis nach achtzehn Jahren ein Spätling, meine jüngste Schwester, geboren wurde, bei der ich Pate war und sie sogar über die Taufe hielt. Das war eine große Ehre für mich, ging aber mit meiner Dethronisierung durch eben diese Schwester Hand in Hand. Als jüngstes Kind rückte sie selbstverständlich sehr bald in die Lieblingsstellung ein.
Ostern 1819 hatte mein Vater die Neu-Ruppiner Löwen-Apotheke in seinen Besitz gebracht. Ostern 1826, nachdem noch drei von meinen vier Geschwistern an eben dieser Stelle geboren waren, gab er diesen Besitz wieder auf. Dieser frühe Wiederverkauf des erst wenige Jahre zuvor unter den günstigsten Bedingungen, man konnte sagen »für ein Butterbrot«, erstandenen Geschäfts wurde später, wenn das Gespräch darauf kam, immer als verhängnisvoll für meinen Vater und die ganze Familie bezeichnet. Aber mit Unrecht. Das »Verhängnisvolle«, das sich viele Jahre danach – glücklicherweise auch da noch in erträglicher Form, denn mein Papa war eigentlich ein Glückskind – einstellte, lag nicht in dem Einzelakte dieses Verkaufs, sondern in dem Charakter meines Vaters, der immer mehr ausgab, als er einnahm, und von dieser Gewohnheit, auch wenn er in Ruppin geblieben wäre, nicht abgelassen haben würde. Das hat er mir, als er alt und ich nicht mehr jung war, mit der ihm eigenen Offenheit viele, viele Male zugestanden. »Ich war noch ein halber Junge, als ich mich verheiratete«, so hieß es dann wohl, »und aus meiner zu frühen Selbständigkeit erklärt sich alles.« Ob er darin recht hatte, mag dahingestellt sein. Er war überhaupt eine ganz ungeschäftliche Natur, nahm ihm vorschwebende Glücksfälle für Tatsachen und überließ sich, ohne seiner auch in besten Zeiten doch immer nur bescheidenen Mittel zu gedenken, der Pflege »nobler Passionen«. Er begann mit Pferd und Wagen, ging aber bald zur Spielpassion über und verspielte, während der sieben Jahre von 1819 bis 26, ein kleines Vermögen. Der Hauptgewinner war ein benachbarter Rittergutsbesitzer. Als mir dreißig Jahre später der Sohn dieses Rittergutsbesitzers eine kleine Summe Geld lieh, sagte mein Vater: »Das stecke nur ruhig ein; sein Vater hat mir ganz allmählich zehntausend Taler in Whist en trois abgenommen.« Vielleicht war diese Zahl zu hoch gegriffen, aber wie’s damit auch stehen mochte, die Summe war jedenfalls bedeutend genug, um sein Credit und Debet außer Balance zu bringen und ihn, neben andrem, auch zu einem sehr säumigen Zinszahler zu machen. Dies wäre nun, unter gewöhnlichen Verhältnissen, wo man etwa zu Hypotheken-Einschreibungen und Ähnlichem hätte greifen können, eine Zeit lang ganz ertragbar gewesen; zum Unglück aber traf es sich so, dass meines Vaters Hauptgläubiger sein eigener Vater war, der nun Gelegenheit nahm, seinem nur zu berechtigten Unmute, sei’s in Briefen, sei’s bei persönlichen Zusammenkünften, Ausdruck zu geben. Das Bedrückliche der Situation zu steigern, sahen sich diese Vorwürfe durch meine ganz auf schwiegerväterlicher Seite stehende Mutter unterstützt bzw. verdoppelt. Kurzum, je weiter die Sache gedieh, je mehr geriet mein Vater zwischen zwei Feuer, und lediglich um aus dieser sein Selbstgefühl beständig verletzenden Lage herauszukommen, entschloss er sich zum Verkauf seines Besitztums, dessen besondere Ertragsfähigkeit ihm, trotzdem er das Gegenteil von einem Geschäftsmann war, so gut wie jedem anderen einleuchtete. Seine ganze Rechnung dabei stellte sich überhaupt – wenigstens zunächst und von seinem Standpunkte aus angesehen – als durchaus richtig und vorteilhaft heraus. Er erhielt nämlich beim Verkauf der Apotheke das Doppelte von dem, was er seinerzeit gezahlt hatte, und sah sich dadurch mit einem Mal in der Lage, seine Gläubiger, die zugleich seine Ankläger waren, zufriedenstellen zu können. Das geschah denn auch. Er zahlte seinem Vater die vorgeschossene Summe zurück, fragte seine Frau, halb scherzhaft, halb spöttisch, ob sie ihr Vermögen vielleicht »sicherer und vorteilhafter« anlegen wolle, und erreichte dadurch das, wonach er sich sieben Jahre lang gesehnt hatte: Freiheit und Selbständigkeit. Aller lästigen Bevormundung überhoben, war er plötzlich so weit, »sich nichts mehr sagen lassen zu müssen«. Und das war recht eigentlich der Punkt, um den sich’s sein Lebelang für ihn handelte. Danach dürstete er von Jugend an bis in sein Alter; weil er’s aber nicht gut einzurichten verstand, so ist er zu dieser ersehnten Freiheit und Selbständigkeit immer nur tag- und wochenweise gekommen. Er war, um einen seiner Lieblingsausdrücke zu gebrauchen, beständig in der »Bredouille«, sah sich finanziell immer beunruhigt.
Wie wir in die Schule gingen und lernten
Als wir Johanni 27 in dem Hause mit dem Riesendach und der hölzernen Dachrinne, darin mein Vater bequem seine Hand legen konnte, glücklich untergebracht waren, meldete sich alsbald auch die Frage: »Was wird nun aus den Kindern? In welche Schule schicken wir sie?« Wäre meine Mutter schon mit zur Stelle gewesen, so hätte sich wahrscheinlich ein Ausweg gefunden, der, wenn nicht aufs Lernen, so doch auf das »Standesgemäße« die gebührende Rücksicht genommen hätte. Da meine Mama jedoch (…) einer Nervenkur halber in Berlin zurückgeblieben war, so lag die Entscheidung bei meinem Vater, der schnell mit der Sache fertig war und sich in einem seiner Selbstgespräche mutmaßlich dahin resolvierte, »die Stadt hat nur eine Schule, die Stadtschule, und da diese Stadtschule die einzige ist, so ist sie auch die beste.« Gesagt, getan; und ehe eine Woche um war, war ich Schüler der Stadtschule. Nur wenig ist mir davon in Erinnerung geblieben: eine große Stube mit einer schwarzen Tafel, stickige Luft trotz immer offen stehender Fenster und zahllose Jungens in Fries- und Leinwandjacken, ungekämmt und barfüßig oder aber in Holzpantoffeln, die einen furchtbaren Lärm machten. Es war sehr traurig. Ich verknüpfte jedoch damals, wie leider auch später noch, mit »in die Schule gehen« so wenig angenehme Vorstellungen, dass mir der vorgeschilderte Zustand, als ich seine Bekanntschaft machte, nicht als etwas besonders Schreckliches erschien. Ich ging eben davon aus, dass das so sein müsse. Als aber, gegen den Herbst hin, meine Mutter eintraf und mich mit den Holzpantoffeljungens aus der Schule kommen sah, war sie außer sich und warf einen ängstlichen Blick auf meine Locken, denen sie, in dieser Gesellschaft, nicht mehr recht trauen mochte. Sie hatte dann eines ihrer energischen Zwiegespräche mit meinem Vater, dem wahrscheinlich gesagt wurde, »er habe mal wieder bloß an sich gedacht«, und denselben Tag noch erfolgte meine Abmeldung bei dem uns schräg gegenüber wohnenden Rektor Beda. Dieser nahm die Abmeldung nicht übel, erklärte vielmehr meiner Mutter, »er habe sich eigentlich gewundert …« All das war nun soweit ganz gut; berechtigte Kritik war geübt und ihr gemäß verfahren worden, aber als es nun galt, etwas Besseres an die Stelle zu setzen, wusste auch meine Mutter nicht aus noch ein. Lehrkräfte schienen zu fehlen oder fehlten wirklich, und da sich, bei der Kürze der Zeit, noch keine Beziehungen zu den guten Familien der Stadt ermöglicht hatten, so wurde beschlossen, mich vorläufig wild aufwachsen zu lassen und ruhig zu warten, bis sich etwas fände. Um mich aber vor Rückfall in dunkelste Nacht zu bewahren, sollte ich täglich eine Stunde bei meiner Mutter lesen und bei meinem Vater einige lateinische und französische Vokabeln lernen, dazu Geographie und Geschichte.
»Wirst du das auch können, Louis?«, hatte meine Mutter gefragt.
»Können? Was heißt können! Natürlich kann ich es. Immer das alte Misstrauen.«
»Es ist noch keine vierundzwanzig Stunden, dass du selber voller Zweifel warst.«
»Da werd’ ich wohl keine Lust gehabt haben. Aber, wenn es drauf ankommt, ich verstehe die Pharmacopöa borussica so gut wie jeder andere, und in meiner Eltern Haus wurde französisch gesprochen. Und das andere, davon zu sprechen wäre lächerlich. Du weißt, dass ich da zehn Studierte in den Sack stecke.«
Und wirklich, es kam zu solchen Stunden, die sich, wie schon hier erwähnt werden mag, auch noch fortsetzten, als eine Benötigung dazu nicht mehr vorlag, und so sonderbar diese Stunden waren, so hab’ ich doch mehr dabei gelernt als bei manchem berühmten Lehrer. Mein Vater griff ganz willkürlich Dinge heraus, die er von lange her auswendig wusste oder vielleicht auch erst am selben Tage gelesen hatte, dabei das Geographische mit dem Historischen verquickend, natürlich immer so, dass seine bevorzugten Themata schließlich dabei zu ihrem Rechte kamen. Etwa so.
»Du kennst Ost- und Westpreußen?«
»Ja, Papa; das ist das Land, wonach Preußen Preußen heißt und wonach wir alle Preußen heißen.«
»Sehr gut, sehr gut; ein bisschen viel Preußen, aber das schadet nichts. Und du kennst auch die Hauptstädte beider Provinzen?«
»Ja, Papa; Königsberg und Danzig.«
»Sehr gut. In Danzig bin ich selber gewesen und beinahe auch in Königsberg – bloß es kam was dazwischen. Und hast du mal gehört, wer Danzig nach tapferer Verteidigung durch unseren General Kalkreuth doch schließlich eroberte?«
»Nein, Papa.«
»Nun, es ist auch nicht zu verlangen; es wissen es nur wenige, und die sogenannten höher Gebildeten wissen es nie. Das war nämlich der General Lefèvre, ein Mann von besonderer Bravour, den Napoleon dann auch zum Duc de Dantzic ernannte, mit einem c hinten. Darin unterscheiden sich die Sprachen. Das alles war im Jahre 1807.« »Also nach der Schlacht bei Jena?«
»Ja, so kann man sagen; aber doch nur in dem Sinne, wie man sagen kann, es war nach dem Siebenjährigen Krieg.«
»Versteh’ ich nicht, Papa.«
»Tut auch nichts. Es soll heißen, Jena lag schon zu weit zurück; es würde sich aber sagen lassen: es war nach der Schlacht bei Preußisch-Eylau, eine furchtbar blutige Schlacht, wo die russische Garde beinahe vernichtet wurde und wo Napoleon, ehe er sich niederlegte, zu seinem Liebling Duroc sagte: ›Duroc, heute habe ich die sechste europäische Großmacht kennengelernt, la boue.‹«
»Was heißt das?«
»La boue heißt der Schmutz. Aber man kann auch noch einen stärkeren deutschen Ausdruck nehmen, und ich glaube fast, dass Napoleon, der, wenn er wollte, etwas Zynisches hatte, diesen stärkeren Ausdruck eigentlich gemeint hat.«
»Was ist zynisch?«
»Zynisch … ja, zynisch … es ist ein oft gebrauchtes Wort, und ich möchte sagen, zynisch ist soviel wie roh oder brutal. Es wird aber wohl noch genauer zu bestimmen sein. Wir wollen nachher im Konversations-Lexikon nachschlagen. Es ist gut, über dergleichen unterrichtet zu sein, aber man braucht nicht alles gleich auf der Stelle zu wissen.«
So verliefen die Geographiestunden, immer mit geschichtlichen Anekdoten abschließend. Am liebsten jedoch fing er gleich mit dem Historischen an oder doch mit dem, was ihm Historie schien.
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
Neuruppin. Ein Gang durch die Stadt. Die Klosterkirche
Grau wie die Müllertiere erreichen wir die Stadt, sehen mit geblendeten Augen anfänglich wenig oder nichts und atmen erst auf, als wir vorm Gasthofe zum Deutschen Hause halten und freundlich bewillkommt in die Kühle des Flures treten. Moselwein und Selterwasser stellen hier unsere Lebensgeister wieder her und geben uns Mut und Kraft, eine erste Promenade zu machen und dem Pflaster der Stadt zu trotzen. In unseren dünnsohligen Stiefeln werden wir freilich mehr denn einmal an jenen mecklenburgischen Gutsbesitzer erinnert, den seine revoltierenden Hintersassen auf spitzen Steinen hatten tanzen lassen.
Ruppin hat eine schöne Lage – See, Gärten und der sogenannte »Wall« schließen es ein. Nach dem großen Feuer, das nur zwei Stückchen am Ost- und Westrande übrigließ (als wären von einem runden Brote die beiden Kanten übriggeblieben), wurde die Stadt in einer Art Residenzstil wieder aufgebaut. Lange, breite Straßen durchschneiden sie, nur unterbrochen durch stattliche Plätze, auf deren Areal unsere Vorvordern selbst wieder kleine Städte gebaut haben würden. Für eine reiche Residenz voll hoher Häuser und Paläste, voll Leben und Verkehr mag solche raumverschwendende Anlage die empfehlenswerteste sein, für eine kleine Provinzialstadt aber ist sie bedenklich. Sie gleicht einem auf Auswuchs gemachten großen Staatsrock, in den sich der Betreffende, weil er von Natur klein ist, nie hineinwachsen kann. Dadurch entsteht eine Öde und Leere, die zuletzt den Eindruck der Langenweile macht.
Die Billigkeit erheischt hinzuzufügen, dass wir es unglücklich trafen: das Gymnasium hatte Ferien und die Garnison Mobilmachung. So fehlten denn die roten Kragen und Aufschläge, die, wie die zinnoberfarbenen Jacken auf den Bildern eines berühmten Niederländers (Cuyp), in unserm farblosen Norden dazu berufen scheinen, der monotonen Landschaft Leben und Frische zu geben. Alles war still und leer, auf dem Schulplatze wurden Betten gesonnt, und es sah aus, als sollte die ganze Stadt aufgefordert werden, sich schlafen zu legen.
Aber nicht die Öde und Stille der Stadt haben uns zu beschäftigen, sondern ihre Sehenswürdigkeiten, klein und groß. Treten wir unsere Wanderung an. Vor dem malerisch im Schatten hoher Linden gelegenen Rathaus, in dessen Erdgeschoss sich auch die Hauptwache befindet, ruht auf leichter Lafette eine 1849er Kriegstrophäe, während in Front des stattlichen Gymnasialgebäudes (auf das wir weiterhin in einem eignen Kapitel zurückkommen) die Bronzestatue König Friedrich Wilhelms II. aufragt, die die Stadt nach dem großen Feuer von 1787 ihrem Wiedererbauer errichtete. Das in etwas mehr denn Lebensgröße hergestellte Bildnis ist eine Arbeit Friedrich Tiecks, gedanklich wenig bedeutend, aber in Form und Haltung jenes künstlerische Maß bekundend, das, wo andere Vorzüge fehlen, selbst schon wieder als Vorzug gelten kann.
Mehr als dies Denkmal nimmt unsere Aufmerksamkeit die alte Klosterkirche in Anspruch, die sich an der Ostseite der Stadt in unmittelbarer Nähe des Sees erhebt und das einzige Gebäude von Bedeutung ist, das bei dem mehrerwähnten großen Brande verschont blieb. Diese Klosterkirche ist ein alter, in gotischem Stile aufgeführter Backsteinbau aus dem Jahre 1253 und gehörte dem unmittelbar danebengelegenen Dominikanerkloster zu, von dem seit Restaurierung der Kirche auch die letzten Spuren verschwunden sind. Über diese Restaurierung selbst gibt eine die halbe Wand des Kirchenschiffs bedeckende Inschrift folgende Auskunft: »Dieses Gotteshaus wurde seit dem Jahre 1806 wiederholt durch feindliche Truppen entweiht und verfiel während des Krieges dergestalt, dass es über dreißig Jahre nicht für den öffentlichen Gottesdienst benutzt werden konnte. Durch königliche Gnadenwohltat wurde dieses erhabene Denkmal echt deutscher Kunst und Frömmigkeit seiner eigentlichen Bestimmung zurückgegeben, indem es auf Befehl Seiner Majestät Friedrich Wilhelms III. wiederhergestellt und in Gegenwart seines Nachfolgers, Seiner Majestät Friedrich Wilhelms IV., feierlich eingeweiht wurde am 16. Mai 1841.«
Über dieser Inschrift befindet sich eine andere aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, worin die Überweisung dieser Kirche seitens des Kurfürsten Joachims II. an die Stadt Ruppin ausgesprochen wird. Ähnliche Notizen im Lapidarstil gesellen sich hinzu und mindern in etwas den Eindruck äußerster Kahlheit und Öde, woran die sonst schöne Kirche bedenklich leidet. Dies Verfahren, durch Inschriften zu beleben und anzuregen, sollte überhaupt überall da nachgeahmt werden, wo man zur Restaurierung alter Baudenkmäler schreitet. Selbst Leuten von Fach sind solche Notizen gemeinhin willkommen, dem Laien aber geht erst aus ihnen die ganze Bedeutung auf. Und zu diesen Laien gehört vor allem die Gemeinde selbst. Ohne solche Hinweise weiß sie selten, welche Schätze sie besitzt. Ja, das Maß der Unkenntnis und Indifferenz ist so groß, dass es denen zu denken geben sollte, die nicht müde werden, von dem Wissen und der Erleuchtetheit unserer Zeit zu sprechen. Auffallen muss namentlich, wie absolut nichts unser Volk von der vorlutherischen Periode seiner Geschichte weiß. Man kennt weder die Dinge noch die Worte dafür, und unter zwanzig Leuten auf dem Lande wird nicht einer wissen, was der »Krummstab« sei. In der Ruppiner Klosterkirche fragt’ ich die Küsterfrau, welche Mönche hier wohl gelebt hätten, worauf ich die Antwort erhielt: »Ich jlobe, et sind kattolsche gewesen.«
Die Ruppiner Klosterkirche wird in der oben zitierten Inschrift ein »erhabenes Denkmal echt deutscher Kunst« genannt, was richtig und nicht richtig ist, je nachdem. Die Mittelmark, im Gegensatze zur Altmark und dem Magdeburgischen, ist im Ganzen genommen so wenig hervorragend an Baudenkmälern aus der gotischen Zeit, dass keine besondere Schönheit nötig war, um mit unter den schönsten zu sein.
Das Innere der Kirche, trotz seiner Inschriften, ist immer noch gerade kahl genug geblieben, um sich der »Maus und Ratte« zu freun, die der den Deckenanstrich ausführende Maler in gewissenhaftem Anschluss an eine halb legendäre Tradition an das Gewölbe gemalt hat. Die Tradition selbst aber ist folgende. Wenige Tage nachdem die Kirche, 1564, dem lutherischen Gottesdienst übergeben worden war, schritten zwei befreundete Geistliche, von denen einer noch zum Kloster hielt, durch das Mittelschiff und disputierten über die Frage des Tages. »Eher wird eine Maus eine Ratte hier über die Wölbung jagen«, rief der Dominikaner, »als dass diese Kirche lutherisch bleibt.« Dem Lutheraner wurde jede Antwort hierauf erspart; er zeigte nur an die Decke, wo sich das Wunder eben vollzog.
Unser Sandboden hat nicht allzu viel von solchen Legenden gezeitigt, und so müssen wir das Wenige werthalten, was überhaupt da ist.
Von Zwanzig bis Dreißig
Berlin 1840. In der Wilhelm Roseschen Apotheke
Ostern 1836 war ich in die Rosesche Apotheke – Spandauer Straße, nahe der Garnisonkirche – eingetreten. Die Lehrzeit war wie herkömmlich auf vier Jahre festgesetzt, sodass ich Ostern 40 damit zu Ende gewesen wäre. Der alte Wilhelm Rose aber, mein Lehrprinzipal, erließ mir ein Vierteljahr, sodass ich schon Weihnachten 1839 aus der Stellung eines »jungen Herrn«, wie wir von den »Kohlenprovisors« genannt wurden, in die Stellung eines »Herrn« avancierte. Der bloße Prinzipalswille reichte jedoch für solch Avancement nicht aus, es war auch noch ein Examen nötig, das ich vor einer Behörde, dem Stadt- oder Kreisphysikat, zu bestehen hatte, und bei diesem vorausgehenden Akte möchte ich hier einen Augenblick verweilen.
Etwa um die Mitte Dezember teilte mir Wilhelm Rose mit, dass ich »angemeldet« sei und demgemäß am 19. selbigen Monats um halb vier Uhr nachmittags bei dem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Jakobstraße, zu erscheinen hätte. Mir wurde dabei nicht gut zumut, weil ich wusste, dass Natorp wegen seiner Grobheit ebenso berühmt wie gefürchtet war. Aber was half es. Ich brach also an genanntem Tage rechtzeitig auf und ging auf die Alte Jakobstraße zu, die damals noch nicht ihre Verlängerung unter dem merkwürdigen, übrigens echt berlinischen Namen »Neue Alte Jakobstraße« hatte. Das noch aus der friderizianischen Zeit stammende, in einem dünnen Rokokostil gehaltene Häuschen, drin Natorp residierte, glich eher einer Prediger- als einer Stadtphysikuswohnung, Blumenbretter zogen sich herum, und ich fühlte deutlich, wie die Vorstellung, dass ich nunmehr einem Oger gegenüberzutreten hätte, wenigstens auf Augenblicke hinschwand. Oben freilich, wo, auf mein Klingeln, die Gittertür wie durch einen heftigen Schlag, der mich beinah wie mit traf, aufsprang, kehrte mir mein Angstgefühl zurück und wuchs stark, als ich gleich danach dem Gefürchteten in seiner mehr nach Tabak als nach Gelehrsamkeit aussehenden Stube gegenüberstand. Denn ich sah deutlich, dass er von seiner Nachmittagsruhe kam, also zu Grausamkeiten geneigt sein musste; sein Bulldoggenkopf, mit den stark mit Blut unterlaufenen Augen, verriet in der Tat wenig Gutes. Aber wie das so geht, aus mir unbekannt gebliebenen Gründen war er sehr nett, ja geradezu gemütlich. Er nahm zunächst aus einem großen Wandschrank ein Herbarium und ein paar Kästchen mit Steinen heraus und stellte, während er die Herbariumblätter aufschlug, seine Fragen. Eine jede klang, wie wenn er sagen wollte: »Sehe schon, du weißt nichts; ich weiß aber auch nichts, und es ist auch ganz gleichgültig.« Kurzum, nach kaum zwanzig Minuten war ich in Gnaden entlassen und erhielt nur noch kurz die Weisung, mir am andern Tage mein Zeugnis abzuholen. Damit schieden wir.
Als ich wieder unten war, atmete ich auf und sah nach der Uhr. Es war erst vier. Das war mir viel zu früh, um schon wieder direkt nach Hause zu gehn, und da mich der von mir einzuschlagende Weg an dem Hause der d’Heureuseschen Konditorei vorbeiführte, drin – was ich aber damals noch nicht wusste – hundertundfünfzig Jahre früher der Alte Derfflinger gewohnt hatte, so beschloss ich, bei d’Heureuse einzutreten und den »Berliner Figaro«, mein Leib- und Magenblatt, zu lesen, darin ich als Lyriker und Balladier schon verschiedentlich aufgetreten war. Eine spezielle Hoffnung kam an diesem denkwürdigen Tage noch hinzu. Keine vierzehn Tage, dass ich wieder etwas eingeschickt hatte, noch dazu was Großes – wenn das nun vielleicht drin stünde! Gedanke, kaum gedacht zu werden. Ich trat also ein und setzte mich in die Nähe des Fensters, denn es dunkelte schon. Aber im selben Augenblicke, wo ich das Blatt in die Hand nahm, wurden auch schon die Gaslampen angesteckt, was mich veranlasste, vom Fenster her an den Mitteltisch zu rücken. In mir war wohl die Vorahnung eines großen Ereignisses, und so kam es, dass ich eine kleine Weile zögerte, einen Blick in das schon aufgeschlagene Blatt zu tun. Indessen dem Mutigen gehört die Welt; ich ließ also schließlich mein Auge darüber hingleiten, und siehe da, da stand es: »Geschwisterliebe, Novelle von Th. Fontane.« Das Erscheinen der bis dahin in mal längeren, mal kürzeren Pausen von mir abgedruckten Gedichte hatte nicht annähernd solchen Eindruck auf mich gemacht, vielleicht weil sie immer kurz waren; aber hier diese vier Spalten mit »Fortsetzung folgt«, das war großartig. Ich war von allem, was dieser Nachmittag mir gebracht hatte, wie benommen und musste es sein; vor wenig mehr als einer halben Stunde war ich bei Natorp zum »Herrn« und nun hier bei d’Heureuse zum Novellisten erhoben worden. Zu Hause angekommen, berichtete ich nur von meinem glücklich bestandenen Examen, über meinen zweiten Triumph schwieg ich, weil mir die Sache zu hoch stand, um sie vor ganz unqualifizierten Ohren auszukramen. Auch mocht’ ich denken, es wird sich schon ’rumsprechen, und dann ist es besser, du hast nichts davon gemacht und dich vor Renommisterei zu bewahren gewusst.
Mit diesen Ereignissen schloss 1839 für mich ab, und das neue Jahr 40 brach an. Ich wechselte nicht, wie das gewöhnlich geschieht, meine Stellung, sondern blieb noch fast ein Jahr lang als Avancierter in meiner alten Position. Hatte dies auch nicht zu bedauern. Es war ein sehr angenehmes Jahr für mich, was in sehr verschiedenen Dingen und, so sonderbar es klingt, auch in der frischen politischen Brise, die damals gerade ging, seinen Grund hatte. Denn mit dem Sommer 1840 oder, was dasselbe sagen will, mit dem am 7. Juni erfolgten Tode Friedrich Wilhelms III. brach für Preußen eine neue Zeit an, und ich meinerseits stimmte nicht bloß in den überall um mich her auf Kosten des heimgegangenen Königs laut werdenden Enthusiasmus ein, sondern fand diese ziemlich illoyale Begeisterung auch berechtigt, ja pflichtmäßig und jedenfalls im hohen Maße gesinnungstüchtig. Jetzt denk’ ich freilich anders darüber und bekenne mich mit Stolz und Freude zu einer beinah schwärmerischen Liebe zu diesem lange nicht genug gewürdigten und verehrten Könige. Während meiner märkischen Arbeiten, die mich später, durch viele Jahre hin, mit allen Volksschichten in Dorf und Stadt in Berührung brachten, bin ich der Eigenart dieses Königs in von Mund zu Mund gehenden Geschichten und Anekdoten viele hundert Male begegnet, und in immer wachsendem Grade habe ich dabei den Eindruck gehabt: Welch ein herrlicher Mann! Wie mustergültig in seiner wundervollen Einfachheit und wie viel echte wirkliche Weisheit in jedem seiner, vom bloßen Espritstandpunkt aus angesehen, freilich oft prosaisch und nüchtern wirkenden Aussprüche. Wenn überhaupt noch absolut regiert werden soll, was ich freilich weder wünsche noch für möglich halte, so muss es so sein. Ganz Patriarch. Man hat ihm den Beinamen des »Gerechten« gegeben und dann, nach Berliner Art, darüber gewitzelt; aber dies Wort »der Gerechte« drückt es doch aus, und weil es keine Phrase, sondern eine Wahrheit war, war es eine große Sache. Dazu kam noch eines: für mich hat das hohe Ansehen, das der so oft als unbedeutend erklärte König in seiner eignen Familie genoss, immer eine besondre Bedeutung gehabt, wenigstens nach der moralischen Seite hin. Der kluge Kronprinz, sosehr er dem Vater überlegen war, war doch voll Verehrung und rührendster Liebe für ihn. Und so jedes Mitglied des Hauses, die Kinder wie die Schwiegerkinder. Selbst der eiserne Nikolaus konnte dem Zauber dieses schlichten Mannes, der trotzdem ein König war, nicht widerstehn. Er dachte nicht daran, wie’s damals hieß, einen »Knäs« oder »Unterknäs« aus ihm machen zu wollen, sondern hatte nur, wie wahrscheinlich für keinen andern Sterblichen, ein Hochmaß von respektvoller und zugleich herzlicher Zuneigung für ihn. Das bewies er noch in des Scheidenden letzter Stunde.
So denn noch einmal: ein König, der, wie wenige, die Liebe seines Volkes verdiente, war an jenem 7. Juni 1840 heimgegangen, aber andrerseits war zuzugestehn – und darin lag die Rechtfertigung für vieles, was geschah und nicht geschah –, dass es politisch nicht so weiterging; die Stürme von 89 und 13 hatten nicht umsonst geweht, und so war es denn begreiflich, dass das altfranzösische »Der König ist tot, es lebe der König« in vielen Herzen mit vielleicht zu freudiger Betonung der Schlussworte gesprochen wurde. Knüpften sich doch die freiheitlichsten und zunächst auch berechtigtsten Hoffnungen an den Thronfolger. Die Menschen fühlten etwas, wie wenn nach kalten Maientagen, die das Knospen unnatürlich zurückgehalten haben, die Welt plötzlich wie in Blüten steht. Auf allen Gesichtern lag etwas von freudiger Verklärung und gab dem Leben jener Zeit einen hohen Reiz. »Es muss doch Frühling werden.« Alle die, die den Sommer 40 noch miterlebt haben, werden sich dieser Stimmung gern erinnern.
Ich zählte, so jung und unerfahren ich war, doch ganz zu denen, die das Anbrechen einer neuen Zeit begrüßten, und fühlte mich unendlich beglückt, an dem erwachenden politischen Leben teilnehmen zu können. Allwöchentlich hatte ich, neben sonstigen Freistunden, auch einen freien Nachmittag, und mit der Feierlichkeit eines Kirchgängers, ja sogar in der sonntäglichen Aufgeputztheit eines solchen, begab ich mich, wenn dieser freie Nachmittag da war, regelmäßig zu Stehely, um hier allerlei Zeitungen: die Kölnische, die Augsburger, die Leipziger Allgemeine etc. zu lesen. Dieser Wunsch wurde mir freilich immer nur sehr unvollkommen erfüllt, denn es war die Zeit der sogenannten »Zeitungstiger«, die sich unersättlich auf die Gesamtheit aller guten Zeitungen stürzten und diese, grausam erfinderisch, entweder auf dem Stuhl, auf dem sie saßen, oder unterm Arm – oder auch vorn in den Rock geschoben – unterzubringen wussten. Ein Einschreiten dagegen war nicht möglich, denn die betreffenden Herren waren nicht nur Stehelysche Habitués, sondern zugleich auch Leute von gesellschaftlicher Stellung. Es hieß also sich in Geduld fassen, und manchmal wurde man auch belohnt. Aber selbst wenn alles ausblieb, so verließ ich trotzdem das Lokal mit dem Gefühl, mich, eine Stunde lang, an einer geweihten Stätte befunden zu haben.
In gehobener Stimmung nahm ich dann andern Tages meine Arbeit wieder auf und fand es in dieser Stimmung jedes Mal leichter, mit meiner Umgebung zu verkehren.
Theodor Fontane an Wilhelm Wolfsohn
Berlin, d. 10. November 47
Mein lieber alter Freund!
(…) Dass ich [mit Emilie Rouanet-Kummer] verlobt bin, weißt Du. In diesem Faktum liegt noch kein Grund zur Gratulation, wohl aber darin, dass ich mich glücklich fühle in meiner Wahl und meiner Liebe. Du hast das junge Mädchen bei Deinem Hiersein gesehn. Das Hervorstechende ihres Wesens ist, körperlich und geistig, das Interessante, sie wird mich auch da zu fesseln wissen, wo mir größere Schönheit, umfassenderes Wissen und selbst tieferes Gefühl auf meinem Lebenswege begegnen sollten. Mit einem Wort, sie ist »liebenswürdig«, sie hat jenes unerklärbare Etwas, was allem einen Reiz verleiht; die Schwächen selbst werden so zu Tugenden gestempelt; Unkenntnis gibt sich als herzgewinnende Natürlichkeit; launenhafte Wünsche und Einfälle kleiden sich in das Gewand des Eigentümlichen. – Ich habe in meiner Liebe viele Kämpfe durchgemacht; ich habe (ohne deshalb meine Braut je minder geliebt zu haben) meine Verlobung wie eine Übereilung betrachtet, ich habe mir die Befähigung abgesprochen, je ein Weib glücklich machen zu können, und habe gleichzeitig meinen eignen Untergang als eine Gewissheit vor Augen gesehn; zu dem allen hab ich den Höllensoff brennender, verzweifelnder Eifersucht gekostet, oder richtiger, meine Seele monatelang damit getränkt. Diese Zeiten sind vorüber; unter allen diesen Stürmen hat sich meine Liebe bewährt; ich darf sie als einen geklärten Wein betrachten, der, wenn auch nicht feuriger mit den Jahren wie Rheinwein, doch auch nicht schlechter wie Medoc werden wird. – Um einen passenden Übergang für das Folgende zu finden, muss ich meine obigen Mitteilungen durch das Geständnis ergänzen, dass namentlich der Poet in mir oft blutige Tränen über den verlobten Bräutigam vergoss. Auch diese Misshelligkeiten sind beigelegt; meine Braut, die sonst in meinen dichterischen Gelüsten nur eine verhasste Nebenbuhlerin sah, hat diese plötzlich von Herzen lieb gewonnen, und so hoff ich in Zukunft wie der Graf von Gleichen zu leben, bei welchem Bild ich freilich in Zweifel gerate, ob ich meine Muse oder meine Braut mit der feurigen, schwarzäugigen Orientalin vergleichen soll. Stände meine Braut jetzt hinter mir und guckte über die Schulter, so wäre eine Maulschelle mein unzweifelhaftes Los.
Nun aber ein weniges von der Poeterei. In meinem Eifer, vielleicht darf ich sagen, in meiner Begeisterung – bin ich der Alte; in dem, was ich leiste, hab ich die Leipziger Staffel hoffentlich weit hinter mir. Es fehlt mir möglicherweise jetzt die Unbefangenheit und Natürlichkeit, mit der ich damals Schlechtes und Gutes in friedlicher Gemeinschaft aufs Papier kritzelte, dafür aber hat sich ein gewisses Bewusstsein, eine Kenntnis dessen, worauf es ankommt, eingestellt, die vielleicht keinen besseren Poeten, aber zweifellos bessere Verse schafft. – Du würdest mich in dieser Beziehung sehr verändert finden; ich bin jetzt von meinem Recht durchdrungen, ein Gedicht zu machen; das mag Dir andeuten, dass ich ein anderer geworden bin. Du lächelst vielleicht; Du frägst, worauf sich dieses Selbstvertrauen stützt, und lächelst wieder, wenn ich sage, das fühlt sich. Ich könnte Dir erzählen, dass ich mit dem Cottaschen »Morgenblatt« auf dem besten Fuße stehe, könnte Dir mitteilen, dass man in mich dringt, meine Sachen zusammenzustellen und rauszugeben – indessen wiederhol ich Dir, es ist nicht diese Anerkennung von außen; sondern die tief innere Überzeugung, dass ich einen Vers schreiben kann, was mein Fiduzit erweckt. Diese Überzeugung lässt mich ruhig und bedachtsam handeln; ich laufe mir nicht nur nicht die Beine ab, um einen Buchhändler zu ergattern, sondern ich danke sogar für diejenigen, die mir unter der Hand angeboten werden. Was gut ist, bleibt gut, und das andre mag fallen, wenn es vor der eignen, gereifteren Kritik nicht mehr bestehen kann. – Das Lyrische hab ich aufgegeben, ich möchte sagen, blutenden Herzens. Ich liebe eigentlich nichts so sehr und innig wie ein schönes Lied, und doch ward mir gerade die Gabe für das Lied versagt. Mein Bestes, was ich bis jetzt geschrieben habe, sind Balladen und Charakterzeichnungen historischer Personen; ich habe dadurch eine natürliche Übergangsstufe zum Epos und Drama eingenommen und diesen Sommer bereits ein episches Gedicht in neun (kleinen) Gesängen geschrieben, das hier auf die Berliner Herzen seines Eindrucks nicht verfehlte und Dir vielleicht mit nächstem im »Morgenblatte« zu Gesicht kommen wird, wenn nicht die größere Ausdehnung des Gedichts seine Aufnahme unmöglich macht. Titel: »Von der schönen Rosamunde«. – Mit heiligem Eifer würd ich mich unverzüglich an die Gestaltung eines Dramas machen, das bereits im