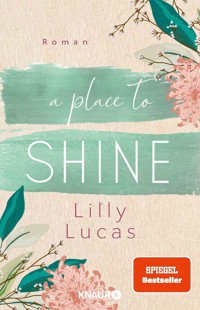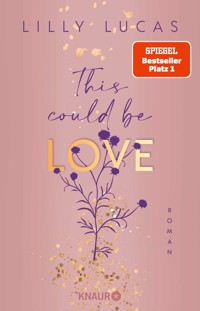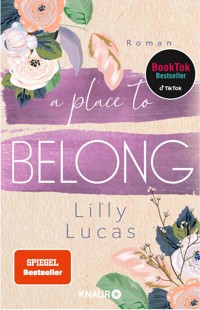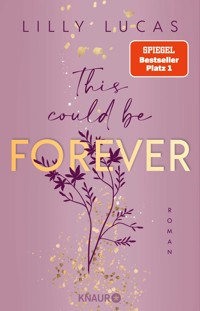
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Hawaii Love
- Sprache: Deutsch
Wunderschöne cozy Romance voll unerwartetem Herzklopfen und dritter Roman innerhalb der New-Adult-Trilogie »Hawaii Love« von Bestseller-Autorin Lilly Lucas, auch unabhängig lesbar. Er ist Big Wave Surfer und ihr Ex. Sie wollte ihn nie wiedersehen. Aber jetzt soll sie einen Film über ihn drehen. Millie kann ihr Glück kaum fassen, als sie ihren ersten Job als Regisseurin ergattert. Aber ihre Euphorie hält nur kurz an, denn im Mittelpunkt der geplanten Netflix-Doku steht ausgerechnet Griffin »Chip« Chipman – Shootingstar der Surfszene und Millies erste große Liebe. Sie hat ihn nicht mehr gesehen, seit ein tödlicher Surfunfall ihrer beider Leben erschütterte und sie ihre Heimat Hawaii verließ. Als Millie Chip nun wiederbegegnet, wird sie von einer Welle an Gefühlen und Erinnerungen überrollt … Die weiteren New-Adult-Liebesromane der Hawaii-Love-Trilogie auf einen Blick: - This could be love (Louisa & Vince: Enemies to Lovers) - This could be home (Laurie & Tristan: Grumpy & Sunshine, Enemies to Lovers, Forced Proximity) - This could be forever (Millie & Chip: Second Chance Romance, Forced Proximity)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lilly Lucas
This could be forever
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Millie kann ihr Glück kaum fassen, als sie ihren ersten Job als Regisseurin ergattert. Aber ihre Euphorie hält nur kurz an, denn im Mittelpunkt der geplanten Netflix-Doku steht ausgerechnet Griffin »Chip« Chipman – Shootingstar der Surfszene und Millies erste große Liebe. Sie hat ihn nicht mehr gesehen, seit ein tödlicher Surfunfall ihrer beider Leben erschütterte und sie ihre Heimat Hawaii verließ. Als Millie Chip nun wiederbegegnet, wird sie von einer Welle an Gefühlen und Erinnerungen überrollt …
Cozy Romance mit jeder Menge Herzklopfen: der traumhaft schöne Abschluss der Hawaii-Love-Reihe, auch unabhängig lesbar
Weitere Informationen unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Chips Playlist
Auszug aus dem Surfer’s Mag Interview mit Griffin Chipman
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Danke
Für Andy
This is forever
»Wer Abschied nimmt, nimmt Sehnsucht mit.«
(Unbekannt)
Chips Playlist
Jackal & the Wind – Ukulele Song
Dekker – Maybe October
Ziggy Alberts – Days In The Sun
Sean Koch – Your Mind Is A Picture
Mark Ambor – Good To Be
Declan McKenna – Brazil
alt-J – Left Hand Free
The Green – Love I
Landon McNamara – Loss for Words
The Drums – Let’s Go Surfing
The Green, Fia – Threat (Fall in Love)
Sashamon – Necta
Dirty Heads – Vacation
Xavier Rudd – Followthe Sun
Vance Joy – Saturday Sun
Jack Johnson – Upside Down
Auszug aus dem Surfer’s Mag Interview mit Griffin Chipman
________________________________________________
Chip, was ist dein Ziel für die kommende Saison?
Die höchste Welle aller Zeiten surfen und hinterher noch am Leben sein.
Kapitel 1
San Diego, Kalifornien
Das Vibrieren meines Weckers riss mich aus dem Schlaf. Ich verfluchte mich dafür, ihn nicht ausgestellt zu haben, tastete nach meinem iPhone und fegte es vom Nachttisch. Dem Geräusch nach landete es weich. Auf meiner Jeans, die noch genau dort lag, wo ich sie mir nach der Schicht im Lighthouse Grill von den Beinen gestrampelt hatte – was den üblen Geruch erklärte, der mir in die Nase stieg, als ich mich über die Bettkante beugte und das Handy vom Boden aufhob. Zu meiner Irritation stammte das sonore Brummen nicht von meinem Wecker. Stattdessen blinkte eine unbekannte Nummer auf dem Display. Meine Augen zuckten nach links oben. 7:31 Uhr. Alles in mir drängte darauf, den Anruf zu ignorieren. Vor allem die Tatsache, dass ich erst vor wenigen Stunden ins Bett gekommen war, weil jemand zum wiederholten Mal in dieser Woche die Restaurant-Toilette geflutet hatte. Diesmal hatten meine Kollegin Myriam und ich es allerdings erst bemerkt, als das Wasser bereits unter der Tür hindurchgesickert war. Statt Feierabend zu machen, hatten wir bis in die frühen Morgenstunden den Wischmopp geschwungen und nach Kloake stinkende Putzlappen ausgewrungen. Gott, ich hasste diesen Job. Aber wenigstens bezahlte er meine Rechnungen, während ich darauf wartete, endlich als Dokumentarfilmerin Fuß zu fassen. Seit ich vor einem Jahr mein Regie-Studium an der UC San Diego abgeschlossen hatte, war ich nicht über Assistenzen und die Produktion belangloser Image- und Unternehmensfilme hinausgekommen. Freelance-Aufträge, die zwar Geld einbrachten, aber weit entfernt waren von den Themen, die mich umtrieben. Den Lebensrealitäten, die ich aufzeigen, den Botschaften, die ich vermitteln wollte.
Dass ich am Ende über das grüne Symbol wischte, statt ins Reich der Träume zurückzugleiten, hing hauptsächlich damit zusammen, dass ich meine Kontaktdaten auf SetWork, einer Plattform für Filmschaffende, hinterlegt hatte, über die immer mal wieder zu den unmöglichsten Zeiten Jobangebote reinkamen. Ich rappelte mich auf und räusperte mich. Trotzdem klang ich wie eine stimmbandgeschädigte Kettenraucherin, als ich mich mit »Hallo?« meldete.
»Spreche ich mit Millie Preston?«, fragte eine mir unbekannte Männerstimme.
»Ja. Wer ist denn da?«
»Oh, entschuldigen Sie bitte. Alex Jones.« Ein etwas gestresst klingendes Lächeln drang durch die Leitung. »Wir haben uns letztes Jahr auf dem Filmfestival Ihrer Uni kennengelernt, falls Sie sich erinnern.«
Ich kramte in meinem Gedächtnis. Nachdem mein Kurzfilm über den umstrittenen Teleskopbau auf dem Mauna Kea als beste Abschlussarbeit ausgezeichnet worden war, hatte ich viele Hände geschüttelt, Gespräche geführt und Visitenkarten ausgetauscht. Gut möglich, dass ein Alex Jones darunter gewesen war.
»Ich war Teil der Jury«, gab er mir den entscheidenden Hinweis.
Jetzt hatte ich ein Gesicht vor Augen. Ein Kerl um die fünfzig mit Timothée-Chalamet-Ausstrahlung. Dünn, blass, wangenknochenlange Locken, grüblerischer Blick.
»Natürlich. Mr. Jones. Tut mir leid. Hat einen Moment gedauert.«
Noch während ich diese Worte aussprach, erinnerte ich mich daran, dass er als einziges Jurymitglied nicht dem Lehrstuhl angehört, sondern für einen lokalen Fernsehsender gearbeitet hatte. CBS8 oder KFMB. Ob er mich deswegen anrief? Wollte er mich für einen Fernsehbeitrag anheuern?
»Mehr als verständlich. Sie waren ja sehr gefragt an diesem Abend. Und entschuldigen Sie bitte die frühe Störung.«
»Kein Problem«, murmelte ich, aber er fuhr bereits fort.
»Ich arbeite inzwischen bei Stokes Productions. Der Name ist Ihnen ein Begriff?«
Spätestens jetzt war ich hellwach. Natürlich kannte ich Stokes Productions, die Produktionsfirma aus Los Angeles, die für ihre bildgewaltigen Dokumentarfilme bekannt war. Erst letztes Jahr hatten sie eine Oscarnominierung für The Sky Above Us eingeheimst, einen Film über den Free-Solo-Kletterer Eric Knox.
»Ja, sicher«, beeilte ich mich zu sagen und spürte, wie mein Herz einen Takt schneller schlug.
»Ich habe eine etwas ungewöhnliche und leider auch dringliche Anfrage. Unser Regisseur ist kurzfristig ausgefallen. Liegt mit einer Ciguatera-Vergiftung im Krankenhaus.«
»Oh Gott«, hauchte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das bedeutete.
»Hände weg von Supermarkt-Fisch, sag ich da nur.« Er seufzte. »Na ja, jedenfalls fällt er für das aktuelle Projekt aus, und wir suchen dringend Ersatz. Da kommen Sie ins Spiel.«
»Ich?«, stieß ich perplex hervor und klang, als hätte ich mich verhört. So musste es auch sein. Schließlich war es unwahrscheinlich – nein, völlig ausgeschlossen –, dass eine Produktionsfirma wie Stokes Productions mit einer Regisseurin zusammenarbeiten wollte, die sich mit Imagefilmen für mittelständische Handwerksbetriebe durchschlug.
»Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Miss Preston. Sie sind nicht meine erste Wahl für diesen Job.«
Ich schluckte.
»Da draußen gibt es zahlreiche Regisseure mit mehr Berufserfahrung, und glauben Sie mir, ich habe so ziemlich jeden davon angerufen.« Er klang zerknirscht. »Aber keiner von denen ist flexibel genug, um heute noch in ein Flugzeug zu steigen.«
Ich hätte gekränkt sein können. Mich vor den Kopf gestoßen fühlen können. Aber mein Verstand stürzte sich auf das Wort »Flugzeug«. Denn es implizierte, dass es hier um ein größeres Projekt ging.
»Ich habe Ihren Namen bei SetWork entdeckt und mich an Ihren Kurzfilm über diesen einen Berg erinnert.«
Auch wenn ich mich an seiner Wortwahl störte – der Mauna Kea war weitaus mehr als irgendein Berg –, spitzte ich die Ohren.
»Daran, wie Sie es geschafft haben, in wenigen Minuten die besondere Beziehung der indigenen Bevölkerung Hawaiis zu ihm einzufangen.«
Sein Lob kam unerwartet und löste ein warmes Gefühl in mir aus.
»Ich hab mir Ihren Film eben noch einmal auf YouTube angesehen und finde ihn nach wie vor sehr gelungen. Bildgewaltig. Emotional. Informativ. Character-driven. Genau das, was wir suchen.«
Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich versuchte, meine Gedanken im Zaum zu halten. Nicht zu spekulieren. Zu hoffen.
»Daher frage ich Sie jetzt einfach direkt: Sind Sie gerade verfügbar? Und mit gerade meine ich sofort.«
Ich presste mir die Hand auf den Mund und unterdrückte ein Quietschen. Passierte das hier wirklich? Um einen professionellen Ton bemüht, antwortete ich: »Ja, ich wäre verfügbar. Worum geht es denn genau?«
»Um die letzte Episode einer achtteiligen Doku-Reihe. Drei, maximal vier Drehtage. Kleines, erfahrenes Team. Überschaubares Budget.«
Ich ließ die Informationen kurz auf mich wirken. »Und … zu welchem Thema?«
Er zögerte. »Sie werden verstehen, dass ich mich ein wenig bedeckt halten muss, bis Sie den Vertrag und die NDA unterschrieben haben.«
Vertrag. NDA. Sie meinten es wirklich ernst.
»Die Reihe trägt den Arbeitstitel Pushing Boundaries. Im weitesten Sinne geht es um Extremsport.«
»Extremsport?«, wiederholte ich und klang genauso geschockt, wie ich war.
»Freeclimber, Basejumper, Apnoetaucher … also Menschen, die …«
»Ihr Leben aufs Spiel setzen«, raunte ich und spürte, wie mein Herz zu rasen begann.
»Genau. Aber keine Sorge. Sie müssen Ihres bei den Dreharbeiten nicht aufs Spiel setzen.« Er lachte, aber ich war nicht zum Scherzen aufgelegt. »Das Filmmaterial in Aktion kaufen wir ein. Ihr Fokus soll auf dem Athleten liegen. Wo er wohnt, wie er lebt, wie sein Umfeld aussieht, wo er trainiert. Wie er damit umgeht, jederzeit sterben zu können. Wie seine Freunde und seine Familie damit klarkommen. So was …«
Mir brach endgültig der Schweiß aus. Ich musste in einer dieser Pranked-Shows gelandet sein. Anders ließ es sich nicht erklären, dass ausgerechnet ich für eine Doku über Extremsport ausgewählt wurde.
»Folge eins, so viel darf ich verraten, handelt von Eric Knox. Dem Extremkletterer aus …«
»The Sky Above Us.«
»Kennen Sie den Film?«
»Ja.«
Es war nicht ganz die Wahrheit. Ich hatte den Trailer gesehen, danach aber beschlossen, dass ich kein Interesse daran hatte, einem erwachsenen Mann zwei Stunden dabei über die Schulter zu schauen, wie er sein Leben für einen Adrenalinkick riskierte. Trotzdem hatte ich größten Respekt vor der Leistung der Regisseurin. Zumal Skylar Lane nur ein paar Jahre älter war als ich und niemandem ein Begriff gewesen war, bevor Stokes Productions sie engagiert hatte.
»Es war gar nicht so leicht, Skylar für den Dreh der Episode zu gewinnen. Sie kann sich vor Aufträgen nicht mehr retten, seit The Sky Above Us so durch die Decke gegangen ist.«
Auch wenn ich durchschaute, was er mit seiner Bemerkung bezweckte, verfehlte sie ihre Wirkung nicht. Skylar Lane musste keine überfluteten Toiletten putzen, das stand fest.
»Ach ja, ich habe noch etwas vergessen, das vielleicht nicht irrelevant für Sie ist. Um ehrlich zu sein, ist es auch ein Aspekt, der für Sie gesprochen hat.« Er ließ einen Moment verstreichen. »Die Dreharbeiten finden auf O’ahu statt.«
Ich erstarrte. »O’ahu?«
»An der Aussprache muss ich wohl noch arbeiten«, bemerkte er in einem selbstironischen Ton.
Erst mit Verzögerung begriff ich, dass ich das Wort anders betont hatte als er. Mit der vorgesehenen Pause zwischen O und a, die der ʻOkina, das Pazifik-Hochkomma, andeutete.
»Ihrer Vita habe ich entnommen, dass Sie dort geboren und aufgewachsen sind.«
»Ja.«
Meine Mutter war im dritten Monat schwanger gewesen, als sie mit mir nach Hawaii gezogen war, um eine Stelle als Krankenschwester im Queen’s Medical Center in Honolulu anzunehmen. Zuvor hatte sie in einer Klinik in Chicago gearbeitet und sich auf eine Affäre mit einem zwanzig Jahre älteren Chefarzt eingelassen, der sie zur Abtreibung gedrängt und ihr mit Kündigung gedroht hatte. Sie hatte den Mistkerl zum Teufel gejagt, die HR-Abteilung der Klinik informiert und beschlossen, dass sie den eisigen Wind ohnehin satthatte. Von meinem biologischen Vater hatte sie nie wieder etwas gehört. Dafür war an ihrem zweiten Arbeitstag ein attraktiver Surfer in der Notaufnahme aufgetaucht.
»Was haben wir denn hier?«, hatte Mom gesagt.
»Eine Platzwunde und ein gebrochenes Herz, wenn Sie nicht mit mir ausgehen.«
Mom hatte gelacht, aber den Kopf geschüttelt, und er hatte sie gefragt, ob sie vergeben war.
»Nein, aber im dritten Monat schwanger.«
»Dann sollten wir keine Zeit verlieren. In sieben Monaten haben wir was anderes zu tun.«
Als Teenager hatte ich immer die Augen verdreht, wenn meine Eltern die Geschichte ihres Kennenlernens zum Besten gegeben hatten, aber tief in mir drin hatte ich sie geliebt. Weil es der Moment gewesen war, in dem Dad in mein Leben getreten war. Gabe Preston. Der Mann, mit dem ich nicht dieselben Gene teilte, aber denselben Humor. Der mir Fahrradfahren und Schwimmen beigebracht hatte. Wie man sich auf einem Surfbrett hielt, aber auch wie man sich bei jemandem entschuldigte, wenn man im Unrecht war. Der mich nicht gewählt hatte, weil er es gemusst, sondern gewollt hatte.
»Das trifft übrigens auch auf den Sportler zu, um den es gehen soll«, holte mich die Stimme von Alex Jones zurück ins Jetzt. »Ein Big Wave Surfer.«
Nein. Die Wärme, die sich eben noch um mein Herz gelegt hatte, verwandelte sich in etwas Kaltes, Unangenehmes.
»Vielleicht kennen Sie ihn. Sein Name ist …«
Bitte nicht. Bitte. Nicht.
»Griffin Chipman.«
Fuck! Fuckfuckfuck!
»Aber in der Surfszene kennt man ihn unter dem Namen …«
»Chip«, sagte ich im selben Moment wie er.
»Ah, Sie kennen ihn tatsächlich!«
»Ja«, hauchte ich. »Er …« Hat mein Herz auf dem Gewissen. »Kommt aus demselben Ort wie ich.«
»Umso besser. Chipman ist sehr umgänglich, aber es schadet natürlich nicht, wenn …«
Den Rest hörte ich nicht mehr, weil da plötzlich eine Erinnerung in meinem Kopf aufblitzte. Ein Telefonat mit meinem Vater, das mindestens ein Jahr zurücklag. Er hatte mir von einer geplanten Netflix-Doku über Griffin erzählt, die ihm Sorgen bereitete. Hauptsächlich die Tatsache, dass der Tod meines Bruders darin eine Rolle spielen könnte. Keiko war nicht nur Griffins bester Freund gewesen, sondern auch sein Surfpartner und Tow-in-Buddy. Mit dem Jetski hatte er ihn in die großen Wellen gezogen – bis sie ihm selbst zum Verhängnis geworden waren. War es möglich, dass es hier um genau diese Doku ging? Alarmiert von meiner Befürchtung, fragte ich: »Wurde die Doku bereits verkauft? Ich meine, steht schon fest, wo sie ausgestrahlt wird?«
»Netflix. Habe ich das nicht erwähnt?«
Statt in Jubel zu verfallen, für den Streaminggiganten schlechthin arbeiten zu dürfen, verdichtete sich das flaue Gefühl in meinem Magen. Das konnte alles kein Zufall sein.
»Also, Miss Preston, was meinen Sie? Kommen wir zusammen?«
Ich war weit davon entfernt, zu begreifen, was hier geschah. Stand völlig unter Schock.
»Was das Finanzielle anbelangt, werden wir uns sicher einig. Daran soll es nicht scheitern.«
Ich ließ ihn in dem Glauben, dass mein Schweigen reiner Gehaltspoker gewesen war. Dabei war mir gerade nichts unwichtiger als meine Gage.
»Bis wann brauchen Sie meine Entscheidung?«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nur eine Stunde geben.«
»Eine Stunde?!«
»Die Zeit drängt. Das Filmteam ist bereits unterwegs nach O’ahu. Und Chipman kann jeden Moment den Anruf aus Nazaré bekommen.«
»Nazaré.« Das Wort schmeckte bitter wie Galle.
»So ein Hotspot für Big Wave Surfer. Irgendwo in Portugal. In den Wintermonaten gibt es dort Rekordwellen. Sobald die sich ankündigen, veranstaltet die World Surf League die Big Wave Challenge, und Chipman muss sich in den Flieger setzen.«
»Natürlich.« Es kam bissiger als beabsichtigt aus meinem Mund. »Dann melde ich mich in spätestens einer Stunde bei Ihnen, Mr. Jones.«
»Und ich freue mich auf Ihren Anruf, Miss Preston.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, starrte ich einen Moment lang ins Halbdunkel meines Einzimmerapartments. Was war da eben passiert? Und war das wirklich mir passiert? Ich atmete tief ein und aus. Sortierte meine Gedanken, bis ich wusste, was ich jetzt brauchte. Wen.
Dad ging beim zweiten Läuten ran.
»Millie?«, meldete er sich und klang eher besorgt als verschlafen. »Ist alles okay?« Das Rascheln von Bettwäsche drang an mein Ohr, und mir fiel ein, dass es auf O’ahu erst kurz nach fünf war.
»Alles okay. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe.«
»Du kannst immer anrufen, das weißt du doch.«
Hinter meinen Lidern begann es verdächtig zu brennen, und das nicht nur, weil Dads Stimme so warm und liebevoll klang.
»Bist du noch dran?«
»Ja«, beeilte ich mich zu sagen.
»Ist wirklich alles okay?«
»Ja, ich hab nur gerade ein Jobangebot bekommen. Eine Produktionsfirma will mich als Regisseurin.«
Es war immer noch unwirklich, vor allem, wenn ich es aussprach.
»Das ist doch großartig.«
»Es geht um eine Doku-Serie. Ich würde eine Episode davon drehen.«
»Millie! Herzlichen Glückwunsch! Ich freu mich riesig für dich.«
»Es … gibt da nur einen Haken.« Ich holte tief Luft, bevor ich die Bombe platzen ließ. »Es ist die Doku über Griffin.«
Kapitel 2
Ich weiß nicht, was ich machen soll, Dad.« Das Handy am Ohr, ließ ich mich zurück auf die Matratze sinken.
»Du überlegst zuzusagen?«, fragte er überrascht.
»Ich bin hin- und hergerissen. Einerseits ist es die Chance, auf die ich seit einem Jahr warte. Ich meine, das könnte mein Türöffner sein. Andererseits …«
»Geht es um Griffin.«
Ein zustimmendes Seufzen kam über meine Lippen. »Ich kann doch keinen Film über meinen Ex drehen. Oder?«
»Wissen die das? Dass ihr mal zusammen wart?«
»Bisher nicht. Ich hab nur angedeutet, dass wir uns kennen.«
Zum ersten Mal blitzten Zweifel in meinem Kopf auf. War es ein Fehler gewesen, es nicht zu erwähnen? Nicht offen anzusprechen, dass wir miteinander aufgewachsen waren? Uns als Teenager ineinander verliebt hatten und fast vier Jahre ein Paar gewesen waren?
»Also wissen sie auch nicht, dass …«
»Nein«, unterbrach ich ihn etwas schroff. Ich konnte jetzt nicht über den Tod meines Bruders sprechen. Nicht, ohne auch noch das letzte bisschen Verstand zu verlieren. »Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Dad. Ihn täglich zu sehen, mit ihm zusammenzuarbeiten, als wäre nie etwas gewesen.« Als hätte er mir nicht das Herz gebrochen.
»Du hast lange gebraucht, um über ihn hinwegzukommen.«
Meine Brust zog sich schmerzhaft zusammen, als ich an mein erstes Jahr in San Diego dachte. Die schlaflosen Nächte, die endlosen Tage. Die Kissen, in die ich geschluchzt, die Taschentücher, die ich vollgeweint hatte.
»Bis wann musst du dich entscheiden?«
»Ich hab eine Stunde.«
»Eine Stunde!?«, erwiderte mein Vater in einem ähnlich ungläubigen Tonfall wie ich zuvor.
In knappen Worten schilderte ich ihm die Umstände. Dass ich kurzfristig für einen Regisseur einspringen sollte, der erkrankt war. Dass das Team bereits auf dem Weg nach O’ahu war.
»Das heißt, du würdest nach Hause kommen«, bemerkte Dad mit einem hoffnungsvollen Unterton.
Nach Hause. Auf einmal fiel mir das Atmen schwer. So schwer wie vor vier Jahren.
»Nur für ein paar Tage.«
»Ich weiß«, sagte er, während im Hintergrund Laken raschelten. Das Bett knarrte, und eine Frauenstimme nuschelte: »Ist was passiert?«
Oh Gott! Er war nicht allein in seinem Schlafzimmer!
»Nein, alles gut«, hörte ich ihn flüstern. »Schlaf weiter.«
»Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du … äh … Besuch hast.« Wärme schoss mir in die Wangen. »Ich ruf später noch …«
»Neinneinnein. Ich muss nur kurz …« Seinem Stammeln nach war ihm die Situation genauso unangenehm wie mir. »Warte, ich geh schnell …« Wieder raschelten Laken, wieder knarrte das Bett. Dann tapsten Füße über den Holzboden. Nackte Füße. Ob Dad auch nackt …? Ich kniff die Augen zusammen und verdrängte das Bild. Fragte mich stattdessen, wer die Frau war. Soweit ich wusste, hatte er keine Freundin. Aber vielleicht war ich auch nicht auf dem neuesten Stand. Unser letztes längeres Telefonat lag Monate zurück, und in den Nachrichten, die wir uns seitdem geschrieben hatten, war es meist um Belangloses gegangen. Das Wetter, meinen Job im Lighthouse Grill, die Rätsel-App der New York Times (Dad bevorzugte Wordle, ich Spelling Bee), Blake Lively vs. Justin Baldoni, die Thriller-Serie auf Prime, die wir uns beide ansahen …
»Was … ähm … sagt deine Mutter?«, fragte er, nachdem ich durchs Telefon gehört hatte, wie er eine Tür – vermutlich die Schlafzimmertür – hinter sich zugezogen hatte.
Dass er in dieser Situation ausgerechnet auf Mom zu sprechen kam, erschien mir ein bisschen unglücklich – auch wenn die beiden schon lange geschieden waren.
»Ich hab noch nicht mit ihr gesprochen. Sie ist seit gestern auf einem ihrer Schweigeretreats und hat keinen Handyempfang.«
Nach dem Tod meines Bruders hatte meine Mutter Zuflucht in der Spiritualität gefunden. Sie hatte Trauer-Yoga gemacht und sich mit den buddhistischen Lehren befasst. Nachdem sie ein Schweigeretreat besucht hatte, hatte sie Dad mitgeteilt, dass sie einen Neuanfang brauchte. Ohne ihn. Dass ihre Wahl auf San Diego gefallen war, hatte mit mir zu tun gehabt. Meiner Entscheidung, an der UC San Diego zu studieren, statt wie geplant an der School of Cinematic Arts in Honolulu. Weit weg von dem Ort, der mir den Bruder genommen hatte. Von all den Erinnerungen. Und weit weg von ihm. Mehr als vier Jahre waren vergangen, seit Griffin und ich uns das letzte Mal gesehen hatten. Am Abend vor dem Paddle Out. Mom, Dad und ich waren uns einig gewesen, dass das Abschiedsritual, bei dem man gemeinsam mit Familie und Freunden aufs Meer hinaus paddelte und Blumenketten ins Wasser warf, besser zu meinem Bruder passte, als seinen Sarg in ein Erdloch hinunterzulassen. Den ganzen Nachmittag über hatte ich mit Mom die Plumeria-Blüten aufgefädelt, die Dad von den Bäumen aus unserem Garten gepflückt hatte. Damit die leis nicht welkten, hatten wir den Kühlschrank ausgeräumt und sie dort untergebracht.
»Ich frage die Chipmans, ob wir die Lebensmittel vorübergehend bei ihnen lagern können«, schlug ich Mom vor. »Ist sicher kein Problem.«
Meine Mutter nickte, aber ich sah ihr an, wie egal es ihr war, ob die Milch verdarb oder die Butter schmolz. Auch mich hätte nichts weniger interessieren können. Es war eher ein Vorwand, das Haus zu verlassen, das sich wie ein Mausoleum anfühlte. Still. Leer. Bedrückend. Noch dazu wollte ich zu Griffin. Eine voll bepackte Einkaufstüte in den Armen, machte ich mich auf den Weg zu unseren Nachbarn. Als Griffins Mom mir die Tür öffnete, trat ein mitfühlender Ausdruck auf ihr Gesicht. Seit dem Tod meines Bruders sah mich jeder so an.
»Aber natürlich«, sagte sie, nachdem ich ihr die Situation geschildert hatte, und nahm mir die Tüte ab. »Können wir sonst noch etwas für euch tun? Braucht ihr bei irgendetwas Unterstützung?«
»Das ist nett, aber es ist alles vorbereitet.«
»Ich bin sicher, es wird so, wie er es sich gewünscht hätte.« Sanft berührte sie mich an der Schulter, und obwohl ich es nicht wollte, wurden meine Augen schon wieder feucht. »Oh, Liebes«, raunte sie, stellte die Tüte ab und zog mich in eine Umarmung. Wie immer roch sie nach den Heilkräutern in ihrem Garten, die sie zu Tees, Ölen und Salben verarbeitete und auf Märkten an Touristen verkaufte. Sie hielt mich an sich gedrückt, bis ich mich vorsichtig von ihr löste und mir die Tränen von den Wangen strich.
»Ist Griffin da?«
Sie nickte, und ein sorgenvoller Ausdruck trat in ihr Gesicht. »Er hat sein Zimmer heute noch nicht verlassen.«
Mein Herz zog sich zusammen. Ich wusste, dass es ihm schlecht ging. Dass er genauso litt wie ich. Aber ihn so abgeschottet zu wissen, so verloren in seinem eigenen Schmerz, machte es noch schlimmer.
»Kann ich zu ihm?«
Er musste wissen, dass er nicht allein war. Wir das zusammen durchstehen würden.
»Aber natürlich. Es tut ihm sicher gut, dich zu sehen.« Sie trat zur Seite und ließ mich ins Haus.
Kurz darauf klopfte ich an Griffins Zimmertür. Ohne sein »Ja« abzuwarten, drückte ich die Klinke nach unten. Das Bild, das sich mir bot, war nicht das, das ich erwartet hatte. Die Schranktüren standen offen, die Schubladen der Kommode waren aufgezogen. Klamotten lagen über den Boden verstreut, und auf dem Bett befand sich ein halb gepackter Koffer, in den er sichtlich in Eile Boxershorts warf. Sein Blick zuckte kurz zu mir, aber er hielt nicht inne.
»Was machst du da?«, fragte ich irritiert.
»Packen.« Er klang fahrig und gestresst, sah mich nicht einmal an.
»Wofür?«
»Ich muss nach Nazaré.«
Ich riss die Augen auf. »Was?«
»Ein Big Swell ist im Anmarsch. Ich muss den nächsten Flieger erwischen.« Er fischte ein Shirt vom Boden und warf es in den Koffer.
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Ich muss es tun, Millie.«
Ich traute meinen Ohren nicht. »Dein bester Freund ist gerade gestorben. Mein Bruder. Um ein Haar hätte es dich auch erwischt.« Meine Lippen bebten. »Und du … willst einfach … weitermachen?«
»Ich muss.«
»Du musst gar nichts.«
»Das war unser Plan. Unser Traum. Wenn ich jetzt aufhöre …« Seine Stimme brach. »Dann ist er umsonst …«
»Hör auf!«
Sein Kopf schnellte hoch, und mir blieb die Luft weg. Er sah schrecklich aus. Blass und übermüdet. Aber das Schlimmste war der Ausdruck in seinen Augen. So viel Schmerz und Schuld. Ich wollte etwas sagen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken.
»Du verstehst das nicht.« Mit einem Ruck zog er den Reißverschluss seines Koffers zu, und etwas wie Panik ergriff von mir Besitz.
»Was ist mit dem Paddle Out? Willst du dich nicht von ihm verabschieden?«
»Ich verabschiede mich auf meine Weise.«
»Indem du dich umbringst?«
»Indem ich für uns beide antrete.«
»Aber … wie?« Meine Stimme zitterte. »Du … hast … keinen Partner mehr.«
»Ich finde schon jemanden, der mich in die Wellen zieht.« Er klappte den Koffer zu, und mit jeder Schnalle, die er einrasten ließ, wurde mir bewusster, dass er es ernst meinte.
»Du darfst nicht gehen, Griffin!« Meine Hand krallte sich in den Ärmel seines T-Shirts. »Bitte!«
»Millie …«
»Ich kann nicht noch jemanden verlieren, den ich liebe. Ich ertrag das nicht.« Meine Stimme schwoll an. »Ich … erlaube es nicht!«
Er hielt inne.
»Wenn du gehst, brauchst du nicht wiederzukommen.«
Er blinzelte, als hätte ich ihn geschlagen. »Das meinst du nicht ernst.«
Zittrig zog ich die Luft ein. »Ich werde nicht dabei zusehen, wie du dein Leben aufs Spiel setzt.«
Er schüttelte ganz leicht den Kopf, machte einen Schritt auf mich zu. »Stell mich nicht vor die Wahl.« Er flehte mich mit seinen Augen an. »Bitte nicht.«
»Wenn du mich liebst, dann bleibst du hier«, krächzte ich. Tränen liefen mir über die Wangen. Tränen der Wut, der Verzweiflung, der Angst.
Er schloss die Augen. Nur für einen Moment. Und als er sie wieder öffnete, wusste ich, dass ich verloren hatte.
»Millie?«, holte mich Dads Stimme zurück ins Jetzt. Verscheuchte das Bild vor meinen Augen, aber nicht die Gänsehaut, die meine Arme überzogen hatte.
»Hm?«
»Ob dein Zögern auch etwas damit zu tun hat, dass ich dieser Doku eher … zwiegespalten gegenüberstehe.«
»Schon. Ich meine, ich will keine Doku drehen, die du verhindern wolltest.«
»Ich wollte nicht die ganze Dokuverhindern. Nur, dass dein Bruder darin in ein schlechtes Licht gerückt wird. Dass sie ihn hinstellen wie einen … verantwortungslosen Draufgänger, der die Sturmwarnung ignoriert und die Quittung dafür bekommen hat.«
»Ich weiß«, sagte ich leise.
»Insofern ist es vielleicht Schicksal, dass das Projekt in deine Hände gefallen ist.« Wieder schwang etwas Hoffnungsvolles in seiner Stimme mit.
»Das Drehbuch ist längst geschrieben, Dad.«
»Aber ich bin mir sicher, du würdest darauf achten, dass respektvoll mit Keikos Tod umgegangen wird.«
»Ich hätte zumindest Einfluss darauf.«
Noch dazu nahm das Drehbuch beim Dokumentarfilm eine untergeordnete Rolle ein. Es war eher ein Leitfaden und bot Raum für spontane Veränderungen, die durch Interviews oder unerwartete Situationen entstanden. Womöglich – aber so weit wollte ich mich Dad gegenüber nicht aus dem Fenster lehnen – bestand sogar die Möglichkeit, meinen Bruder komplett außen vor zu lassen. Aber dazu musste ich mich tiefer in das Projekt einarbeiten. Kurz erschrak ich darüber, wie weit ich bereits in meinen Gedanken war.
»Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen, Millie. Aber ich kann dir sagen, dass du dir diese Chance verdient hast. Du hast hart dafür gearbeitet. Zu hart, um sie dir ausgerechnet von ihm nehmen zu lassen.«
Dads kleiner Pep Talk rief mir nicht nur in Erinnerung, dass Griffin immer noch ein rotes Tuch für ihn war, sondern auch, wie anstrengend die letzten Jahre gewesen waren. Wie viel Mühe ich mir gegeben hatte, den Anforderungen des Regie-Studiengangs zu entsprechen. Wie einsam ich mich unter den vielen männlichen Studierenden gefühlt hatte. Wie viel Zeit ich damit verbracht hatte, unentgeltlich an Filmsets zu arbeiten, um meine Vita aufzupolieren. Wie viele Nebenjobs ich angenommen hatte, um mir das Studium leisten zu können. All das würde sich nun endlich auszahlen. Das war der Moment, in dem ich eine Entscheidung traf. Ich würde diese Chance ergreifen. Selbst wenn es bedeutete, mich meiner Vergangenheit stellen zu müssen. Ihm.
Keine zehn Minuten später teilte ich Alex Jones meine Entscheidung mit. Er reagierte erfreut, aber vor allem erleichtert und versprach, mir zügig alle nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Den Vertrag mitsamt NDA, Informationen zur Crew, das Treatment, Drehbuch und Storyboard sowie sämtliche Drehgenehmigungen und Vereinbarungen. Außerdem meine Flugunterlagen. Ich sollte um 12:08 Uhr mit Hawaiian Airlines von San Diego nach Honolulu fliegen und mir ein Uber an den North Shore nehmen, wo sich das Hostel befand, das die Produktionsfirma gemietet hatte. Dort würde ich auf mein vierköpfiges Team treffen. Laut Alex Jones verfügten fast alle über langjährige Erfahrung im Dokumentarfilmbereich, was zugleich beruhigend und einschüchternd war. Dass ich mich auf mein Team verlassen konnte, war wichtig. Gleichzeitig hing viel davon ab, dass ich respektiert und ernst genommen wurde.
»Ich werde für heute Abend ein Meeting ansetzen. Dann können Sie und die Crew sich kennenlernen und gemeinsam den ersten Drehtag besprechen.«
Den ersten Drehtag. In meinem Magen begann es zu kribbeln.
»Gut, dann will ich Sie gar nicht länger aufhalten. Sie müssen ja noch packen.«
Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass ich dafür höchstens zwanzig Minuten hatte, wenn ich pünktlich am Flughafen sein und vorher noch unter die Dusche springen wollte. Kurz verfluchte ich mich dafür, gestern keine Unterwäsche mehr gewaschen zu haben.
»Wenn irgendwas sein sollte, können Sie mich jederzeit anrufen oder per Mail erreichen. Haben Sie noch Fragen?«
Ja. Viele. Ist das wirklich eine gute Idee oder begehe ich einen großen Fehler? Will ich wirklich zurück an den Ort, an dem mein Herz in Stücke gerissen wurde? An dem mich jeder Atemzug daran erinnert, was nicht mehr ist? Nie wieder sein wird?
»Im Moment nicht.«
»Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und freue mich auf die Zusammenarbeit.«
Die Aussicht darauf, dass er jeden Moment auflegen würde und diese Sache hier ernst wurde – so richtig ernst –, trieb meinen Puls abnorm in die Höhe.
»Danke.« Meine Stimme klang heiser. Als käme sie von weit weg. Ich legte auf und stierte noch einen Moment vor mich hin. Dann sprang ich vom Bett auf und hastete zum Schrank. Ich zog meinen Rollkoffer runter und rümpfte die Nase, als mir Staubflocken ins Gesicht rieselten. Mir fiel auf, dass mein letzter größerer Trip über ein Jahr zurücklag. Ich unterdrückte ein Niesen, warf den Trolley aufs Bett und klappte ihn auf. Dann begann ich zu packen.
Kapitel 3
Sechs Flugstunden lagen zwischen meiner Wahlheimat und meiner Heimat. Zwischen meiner Gegenwart und meiner Vergangenheit. Ich hatte sie nutzen wollen, um mich in das Projekt einzuarbeiten. Mir einen Überblick über Drehbuch und Storyboard zu verschaffen und die Lebensläufe meines Teams durchzugehen. Es war nie verkehrt, zu wissen, mit wem man es zu tun hatte. Aber da ich nicht ins Bord-WLAN kam, hatte ich keinen Zugriff auf meine Mails und konnte nicht überprüfen, ob Alex Jones mir inzwischen die Unterlagen geschickt hatte. Ich rief nach einer Stewardess, die sich in unmittelbarer Nähe befand, und schilderte ihr mein Problem.
»Unsere App haben Sie vor dem Flug runtergeladen?«
Ich nickte.
»Und die Gebühr entrichtet?«
»Yep.«
»Vielleicht mal neu starten?«, warf sie in den Raum.
»Hab ich auch schon gemacht.« Ich stieß ein Seufzen aus. »Außerdem den Browser gewechselt.«
»Hm.« Ratlos blickte sie auf den Bildschirm meines Notebooks, und zum ersten Mal fiel mir die Kunstblume auf, die sie sich ins schwarze Haar gesteckt hatte. Eine weiße Blüte, die mich an die Plumeria-Bäume im Garten meiner Eltern denken ließ. Als Kind hatte ich unzählige Stunden damit verbracht, die Blüten vom Boden aufzusammeln und zu Ketten zu verarbeiten. Bis ich es eines Tages getan hatte, um meinem Bruder die letzte Ehre zu erweisen. Das nostalgische Gefühl in meiner Brust wich Schmerz.
»Ähm … fällt das noch unter Hilfsbereitschaft oder ist es Mansplaining, wenn ich die Vermutung äußere, dass es an der Firewall liegt?«, fragte mein Sitznachbar, ein Typ im hellblauen Hemd, der seit dem Start nicht von seinem Laptop aufgesehen hatte. Er war jünger, als ich zunächst angenommen hatte. Ende zwanzig, schätzte ich. Und er sah gut aus mit seinen grünbraunen Augen und den dunklen, leicht welligen Haaren, die an den Ohren etwas zu lang waren. Ein bisschen wie Adam Brody in StartUp. Nach O.C., California, aber vor Nobody Wants This.
»Schmaler Grat, oder?«, flachste die Stewardess und warf mir einen Blick zu.
»Sehr schmaler Grat.« Ich konnte die ernste Miene keine zwei Sekunden aufrechterhalten. »Danke für den Tipp«, sagte ich mit einem Lächeln in seine Richtung.
»Ich hatte dasselbe Problem beim letzten Flug. Hab die Firewall vorübergehend deaktiviert, dann ging’s.«
Die Stewardess nahm es zum Anlass, sich zu verabschieden, und ich rief den Netzwerkschutz meines Notebooks auf und änderte die Einstellungen. Es dauerte keine zehn Sekunden, bis ich eine stabile WLAN-Verbindung hatte. Leider wartete keine neue Mail von Alex Jones in meinem Posteingang.
»Shit«, murmelte ich und rutschte unruhig auf dem Sitz hin und her.
»Klappt nicht?«, fragte er.
»Oh … doch, ich hatte nur gehofft … Ich warte auf eine wichtige Mail. Ehe die nicht da ist, kann ich nicht arbeiten.«
»Schade, dass ich das nicht von mir behaupten kann.« Er schnitt eine Grimasse.
»Tja, du musst nur deine Firewall aktivieren.« Die Hand vor dem Mund flüsterte ich: »Ich verrat’s auch niemandem.«
Er lachte. »Blöderweise lässt sich dieser Vortrag hier auch ganz gut ohne Internet vorbereiten.«
Aus einem Reflex heraus folgte ich seiner Handbewegung hin zum Bildschirm und blinzelte.
»Das ist der Mauna Kea«, stellte ich mit Blick auf die PowerPoint-Folie fest. Das Foto zeigte nur den schneebedeckten Gipfel des 4200 Meter hohen Vulkans, aber ich erkannte die riesigen Kuppeln des Keck Observatoriums, das sich dort oben befand.
»Ja. Warst du schon mal dort?«, fragte er interessiert.
»Zweimal.«
Als ich elf oder zwölf gewesen war, hatten unsere Eltern mit Keiko und mir einen Tagestrip auf unsere Nachbarinsel unternommen. Wir waren früh am Morgen mit der ersten Maschine von O’ahu nach Big Island geflogen und mit einem Mietwagen zum Mauna Kea aufgebrochen. Unterwegs hatte Dad uns die spirituelle Bedeutung des Bergs nähergebracht, den die Hawaiianer als Bindeglied zwischen Himmel und Erde betrachten. Als Ort allen Ursprungs. Mein zweiter Besuch lag nur etwa ein Jahr zurück. Für meinen Abschlussfilm hatte ich dort gedreht und indigene Aktivisten interviewt, die den Bau eines weiteren Megateleskops auf dem Gipfel verhindern wollten.
»Worum geht es in deinem Vortrag?«
»Um die Chancen astronomischer Forschung auf dem Mauna Kea.«
»Oh.« Ich konnte meine Ernüchterung nur schwer verbergen. »Für wen arbeitest du? Caltech? NASA? Smithsonian?«
Er verengte die Augen. »Da kennt sich jemand aus.«
»Ich hab einen Film über das Thema gemacht.«
»Einen Film? Bist du … Regisseurin?«
»Dokumentarfilmerin.« Seine Brauen zuckten beeindruckt nach oben, und in meiner Brust machte sich ein Gefühl breit, das am ehesten mit Stolz zu übersetzen war. Aber mein Unterbewusstsein war sofort zur Stelle, um mit Bescheidenheit dagegen anzukämpfen. »Es ist nur ein Kurzfilm.«
»Wie heißt er?«
»Sacred Mountain.«
»Find ich den auf YouTube?«
»Du willst ihn dir ansehen?«, fragte ich erstaunt.
»Wieso nicht?«
»Na ja, du arbeitest für die Gegenseite.«
»Eigentlich hab ich noch gar nicht gesagt, für wen ich arbeite«, bemerkte er schmunzelnd.
Abwartend sah ich ihn an.
»NASA«, räumte er ein. Dass er es mit einem Grinsen auf den Lippen tat, war irgendwie sympathisch. Ich mochte Menschen, die sich selbst nicht zu ernst nahmen.
»Dann glaube ich nicht, dass dir gefallen würde, was du in dem Film zu hören bekommst.«
»Ist kein Grund, ihn mir nicht anzusehen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin übrigens Noah.«
Er reichte mir die Hand, und ich schüttelte sie.
»Millie.« Mit dem Kinn wies ich auf das Notebook. »Dieser Vortrag, wo hältst du den?«
»An der University of Hawaii in Honolulu.«
»Und wann?«
Er zog eine Braue hoch. »Willst du mit Farbeimern und Eiern auf mich warten?«
Ein Schmunzeln zuckte um meine Mundwinkel. »Nein. Aber ich würde mir gerne anhören, wie du es rechtfertigst, dass ein heiliger Berg mit Riesenteleskopen zugemüllt und ein weltweit einzigartiges Ökosystem gestört wird.« Meine Stimme hatte Fahrt aufgenommen, aber er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Du hast recht. Es ist eine große Herausforderung, die Interessen der Wissenschaft mit denen von Religion und Umweltschutz zu vereinbaren. Und ja, in der Vergangenheit sind viele Fehler gemacht worden. Aber wir arbeiten an Lösungen, die die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigen.«
»Und wie sollen die aussehen?«
»Ich hab gesagt, wir arbeiten dran.« Er zwinkerte. »Nicht, dass wir sie schon gefunden hätten.«
»Klingt nach einer klassischen Hinhaltetaktik.«
Er betrachtete mich. »Weißt du, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Als Sohn eines Reverends weiß ich, wie wichtig Religion für die Menschen sein kann. Wie viel ihnen ihr Glaube bedeuten kann. Gleichzeitig bin ich Wissenschaftler und will den großen Fragen der Menschheit auf den Grund gehen. Und das können wir auf dem Mauna Kea wie nirgendwo sonst auf der Welt. Nirgendwo sonst haben wir bessere Bedingungen, um nach dunkler Materie zu suchen, schwarze Löcher zu erforschen, Exoplaneten zu analysieren, nach außerirdischem Leben zu suchen …«
»Was, wenn wir das gar nicht müssen?«, unterbrach ich seinen Redeschwall.
Er runzelte die Stirn. »Stellst du gerade die Existenz der gesamten Weltraumforschung infrage?«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich frage mich, ob wir wirklich auf andere Planeten schauen müssen, wenn wir uns nicht mal um unseren eigenen kümmern können. Ich meine, vielleicht wäre es wichtiger, den Blick wieder mehr auf den Boden statt in den Himmel zu richten.«
Sein Mund öffnete und schloss sich. Nachdenklich sah er mich an.
»Kaffee oder Tee?«
Die Stewardess von vorhin hatte mit ihrem Servierwagen bei uns haltgemacht.
»Kaffee, bitte«, murmelte ich.
»Für mich auch.«
Bildete ich mir das ein oder klang er ähnlich aufgewühlt wie ich?
»Und? Hatte er recht?«, fragte sie mich, während sie uns die Kaffeebecher reichte.
Verdutzt starrte ich sie an. Woher wusste sie, worüber wir … Dann wurde mir bewusst, dass sie auf mein Internet-Problem anspielte.
»Ja, lag an der Firewall. Jetzt funktioniert’s.«
»Sehr gut.« Sie lächelte uns beide an und schob den Wagen weiter.
Ich blies in meinen Kaffee und nahm aus dem Augenwinkel wahr, dass Noah dasselbe machte.
»Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sehr bereust du es inzwischen, mir geholfen zu haben?« Ich schob ein versöhnliches Schmunzeln hinterher.
»Gar nicht.« Er sah mich über den Rand seines Bechers hinweg an. »Das war die beste Vorbereitung auf meinen Vortrag. Da werden nämlich jede Menge Studierende sitzen, die deine Ansichten teilen.«
»Ich bezweifle, dass man am Lehrstuhl für Astronomie so denkt wie ich.«
»Am Lehrstuhl für Astronomie vielleicht nicht, am Lehrstuhl für Hawaiian Studies hingegen …«
Er ließ das Ende seines Satzes in der Luft hängen. Vielleicht, weil er meinen verdutzten Blick bemerkt hatte.
»Du hältst den Vortrag am Lehrstuhl für Hawaiian Studies?«
»Ich hab doch gesagt, wir suchen nach Lösungen. Und die findet man am besten, wenn man miteinander spricht, oder?«
»Hm«, stieß ich verblüfft aus.
»Du bist übrigens herzlich eingeladen.« Er nahm einen Schluck. »Morgen, 12 Uhr, im Orvis Auditorium.«
»Ich würde super gerne kommen, aber das fällt mitten in den Drehtag.«
»Also fliegst du für Dreharbeiten nach O’ahu?«
Ich nickte.
»Worum geht’s?«, fragte er ehrlich interessiert und sah aus, als würde er Antworten wie »Obdachlosigkeit«, »Meeresverschmutzung«, »Overtourism« oder »Wasserknappheit« erwarten.
Mein kurzes Zögern entging ihm nicht.
»Oh, du darfst nicht darüber reden?«
»Ja«, hauchte ich bedauernd und nippte an meinem Becher.
Es war nicht ganz die Wahrheit. Natürlich hätte ich ihm erzählen dürfen, dass ich eine Doku über einen Extremsportler drehen würde. Nur kam es mir plötzlich schrecklich banal vor. Es gab so viele Missstände und Probleme auf der Welt, und ich würde meinen Ex-Freund dabei filmen, wie er für ein paar Sekunden Ruhm sein Leben aufs Spiel setzte. Aber ich musste es anders sehen, rief ich mir in Erinnerung. Als Türöffner. Als Investition in meine berufliche Zukunft. Wenn ich mir hier einen Namen machte, konnte ich mir meine Projekte danach aussuchen.
Von der Seite schob sich etwas Helles in mein Blickfeld. Eine Visitenkarte.
»Nur für den Fall, dass du mal einen Kontakt bei den Bösen brauchst.« Er zwinkerte, und ich nahm die Karte entgegen.
»Dr. Noah Fitzgerald«, las ich vor und betonte jedes Wort. »Danke. Und viel Erfolg bei deinem Vortrag.«
Er nickte. »Ich wünsch dir auch viel Erfolg, Millie.«
Kapitel 4
Auf den ersten Blick sah die Ankunftshalle des Daniel K. Inouye Flughafens in Honolulu aus wie jede andere. Shops, Cafés, Mietwagenanbieter und ein paar Infoschalter. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckte man die Details, die verrieten, dass man auf einer hawaiianischen Insel gelandet war. Über digitale Reklametafeln flimmerten endlos weiße Strände und steil abfallende Küstenstreifen, sattgrüne Berge und spektakuläre Lavafontänen. In den Pflanztrögen wuchsen Strelitzien in den prächtigsten Farben, und aus nahezu jeder Ecke sprang einen ein »Aloha« an. Männer und Frauen in Hawaiihemden überreichten Blumenketten an frisch eingetroffene Honeymooner oder hielten Schilder mit Hotelnamen hoch. Ich wollte den Blick gerade abwenden, als mir mein eigener Name ins Auge stach: Millie Preston stand in krakeligen Großbuchstaben auf einem Stück Pappe. Ich warf meinem Vater einen teils ungläubigen, teils amüsierten Blick zu, den er mit einem Grinsen und einem Schulterzucken quittierte. Meinen Koffer im Schlepptau, lief ich auf ihn zu.
»Hattest du etwa Angst, ich würde dich nicht mehr erkennen?«, scherzte ich anstelle einer Begrüßung.
Wobei ich zugeben musste, dass ich tatsächlich zweimal hingesehen hatte. Innerlich ein wenig zusammengezuckt war. Seit unserem letzten Videocall war er offenbar seinen Bart losgeworden. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte er glatt rasierte Wangen, und ich fragte mich, ob ihm bewusst war, dass er jetzt noch mehr wie eine ältere Ausgabe von Keiko aussah.
Rein optisch hätte auch ich Dads leibliches Kind sein können. Mein langes, gelocktes Haar war dunkelbraun, fast schwarz, und meine Augen hatten die Farbe von Koaholz. Ich besaß einen etwas dunkleren Teint als meine Mom, woraus ich schloss, dass ich nach meinem Erzeuger kam. Ich hatte nie das Bedürfnis gehabt, mehr über ihn zu erfahren, aber ab und zu, wenn ich in den Spiegel blickte, packte mich die Neugier nach seinem Aussehen.
»Komm her!«, sagte Dad und zog mich in eine Umarmung, die vertraut und fremd zugleich war. Fast vier Jahre waren vergangen, seit wir uns das letzte Mal so nah gewesen waren, und im ersten Moment wusste ich nicht, wohin mit meinen Händen. Zaghaft ließ ich mich auf die Umarmung ein, nahm den Geruch der Aromaöle wahr, die Dad in seiner Physiotherapiepraxis verwendete. Das Wintergreen seines Kaugummis. »Willkommen zu Hause.« Er löste sich von mir, aber nur um meinen Kopf in beide Hände zu nehmen und mir einen Kuss auf die Stirn zu drücken. Eine Geste, die ich so sehr mit ihm und meiner Kindheit verband, dass mein Brustkorb eng wurde. »Du siehst müde aus.«
»Es war eine kurze Nacht«, seufzte ich. »Für uns beide. Sorry noch mal, dass ich dich aus dem Bett geklingelt habe.«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich bin froh, dass du’s gemacht hast. Und dass du jetzt hier bist. Lass dich noch mal drücken.« Er herzte mich so fest, dass mir die Luft wegblieb.
»Dad«, beschwerte ich mich nur halb ernst.
»Hey, ich muss vier Jahre aufholen.« Er entließ mich aus der Umarmung und schnappte sich meinen Trolley. »Wie war dein Flug?«, fragte er, während wir uns auf den Ausgang zubewegten.
»Gut.« Ich dachte zurück an den Kerl von der NASA. »Mein Sitznachbar war … interessant.«
Dads Brauen hoben sich, und ich verdrehte die Augen.
»Nicht auf diese Weise interessant.«
Durch die Schiebetür traten wir ins Freie. Feuchte Hitze und grelles Sonnenlicht empfingen uns. Sofort befreite ich mich von dem Hoodie, den ich im Flieger getragen hatte, und stopfte ihn in meinen Rucksack.
»Was ist eigentlich aus diesem Sean geworden? Du hast ihn lange nicht mehr erwähnt.«
Wir passierten die Haltebuchten für Taxis, Ubers und Shuttlebusse.
»Ach, das war nichts Ernstes.«
Sean und ich hatten uns kennengelernt, als er mich für einen Werbefilm für SeaWorld San Diego angefragt hatte. Er arbeitete dort im Marketing und hatte den Auftrag bekommen, das angeschlagene Image des Freizeitparks wieder aufzupolieren. Ich war kein Fan von Einrichtungen, in denen Meeressäuger Kunststücke für Touristen aufführen mussten, und hatte höflich, aber begründet abgesagt. Daraus war überraschenderweise ein netter E-Mail-Kontakt entstanden, der schließlich auch zu ein paar Dates und einer Beziehung geführt hatte. Richtig gefunkt hatte es allerdings nie zwischen uns, weshalb ich die Sache nach drei Monaten beendet hatte.
»Also gibt es gerade niemanden?«