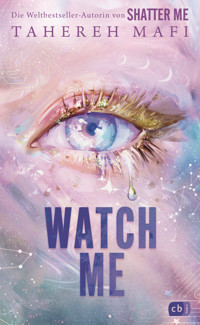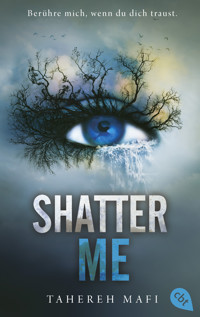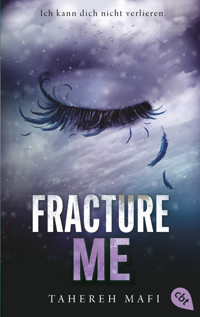12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die This-Woven-Kingdom-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine verschollene Königin. Ein mächtiger Kronprinz. Eine verbotene Liebe.
In einem Reich, in dem jahrtausendelange, bittere Kämpfe zwischen den Menschen und Dschinn tiefe Gräben und Hass hinterlassen haben, verbirgt Alizeh ihre Identität als Dschinn hinter einer Fassade als Dienstmädchen. Denn nicht nur sind die Dschinn seit der Friedensschließung mit den Menschen eine unterdrückte Minderheit, Alizeh ist zudem die verschollene Königin des gesamten Dschinn-Volks. Als Alizehs Weg sich mit dem des Kronprinzen Kamran kreuzt, ist daher klar: Die beiden werden nie zusammenkommen. Doch Kamran seinerseits ist fasziniert von dem Dienstmädchen mit den seltsamen Augen und drängt sich in Alizehs Leben. Keiner der beiden ahnt, welch dramatische Folgen ihre Begegnung haben wird und dass ein ganzes Reich auf dem Spiel steht …
Band 1 der grandiosen, süchtig machenden Bestsellerreihe: voller Magie, großer Gefühle, dramatischer Verwicklungen und mit einer epischen Liebesgeschichte, von der Autorin des TikTok-Sensationserfolg »Shatter Me«.
Die Bände der This-Woven-Kingdom-Reihe:
This Woven Kingdom (Band 1)
These Infinite Threads (Band 2)
All This Twisted Glory (Band 3)
Every Spiral of Fate (Band 4)
Enthaltene Tropes: Fated (Soul-)Mates, Chosen One, Forbidden Love/Romance, Love Triangle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tahereh Mafi
THIS WOVEN KINGDOM
Aus dem Englischen von Barbara Imgrund
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde im Rahmen des Programms »NEUSTARTKULTUR« aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Copyright © 2022 by Tahereh Mafi
Published by Arrangement with Tahereh Mafi
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
© 2024 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Barbara Imgrund
Lektorat: Julia Przeplaska
Umschlaggestaltung und Einband: Geviert, Grafik & Typografie,
unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (Peyker, Anna Pogulyaeva, Siam Vector)
Jacket art © 2022 by Alexis Franklin. Jacket design by Jenna Stempel-Lobell.
Innenillustrationen: © Anna Poguliaeva/Shutterstock
he · Herstellung: AJ
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30240-5V002
www.cbj-verlag.de
Für Ransom
Blicke ich auf der Erde nach links oder rechts,
Sehe ich keine Spur eines Sinns, Werts und Rechts:
Ein Mann tut Böses, und seine Tage
Sind voller Glück und ohne Klage;
Ein anderer ist gut zu jeder Stunde
Und geht gebrochen, verkannt zugrunde.
All die Welt ist eine Mär, die jemand erfindet –
Das Böse der Menschen wie ihr Ruhm entschwindet.
Aus dem Schahnameh von Firdausi
EINS
ALIZEHSASSWIESO oft stickend im Licht der Sterne und des Feuers in der Küche, zusammengekauert, fast schon in der Kochstelle. Haut und Röcke waren hier und da von rußigen Streifen überzogen: Flecken auf einem Wangenknochen, ein dunklerer Klecks über einem Auge. Sie schien es nicht zu bemerken.
Alizeh war kalt. Nein, eiskalt.
Sie wünschte sich oft, sie wäre ein Körper mit Angeln, damit sie eine Tür in ihrer Brust aufstoßen und den Raum dahinter mit Kohle und Petroleum füllen könnte. Um dann ein Zündholz anzustreichen.
Leider.
Sie raffte ihre Röcke und rückte näher ans Feuer, vorsichtig, um den Stoff nicht zu beschädigen, den zu verarbeiten sie noch immer der unehelichen Tochter des Botschafters von Lojjan schuldete. Das raffinierte, glitzernde Kleidungsstück war ihr einziger Auftrag diesen Monat, doch Alizeh nährte insgeheim die Hoffnung, dass das Kleid aus eigener Kraft Kundinnen herbeizaubern würde. Schließlich waren derlei Schneideraufträge das unmittelbare Ergebnis von Neid, der nur in einem Ballsaal und an einer großen Tafel geboren wurde. Solange im Königreich Frieden herrschte, würde die königliche Elite – ehelich oder nicht – weiter Gesellschaften geben und Schulden machen, was bedeutete, dass Alizeh doch noch Wege finden konnte, ihnen das Geld aus den bestickten Taschen zu ziehen.
Da erschauerte sie so heftig, dass sie fast einen Stich falsch gesetzt hätte, fast ins Feuer gefallen wäre. Als kleines Mädchen war Alizeh einmal so fürchterlich kalt gewesen, dass sie absichtlich auf die glühend heiße Herdstelle geklettert war. Natürlich war ihr dabei nicht in den Sinn gekommen, dass das offene Feuer sie erfassen könnte; sie war fast noch ein Baby gewesen, das nur seinem eigenen Antrieb auf der Suche nach Wärme gefolgt war. Damals konnte Alizeh noch nicht ahnen, wie ungewöhnlich ihr Leiden war, denn dieses Frostgefühl, das in ihrem Körper wucherte, war so selten, dass sie selbst in ihrem eigenen Volk, das doch ohnehin schon als eigenartig galt, damit recht allein dastand.
Es war ein Wunder gewesen, dass das Feuer nur ihre Kleider verzehrt und das enge Haus in Rauch gehüllt hatte, Rauch, der in ihren Augen gebrannt hatte. Ein Schrei hatte jedoch dem auf den Herd gekuschelten Kleinkind angezeigt, dass sein Vorhaben zum Scheitern verurteilt war. Entmutigt, weil sein Körper einfach nicht warm werden wollte, hatte es sich frostige Tränen aus den Augen gewischt, als man es vor den Flammen in Sicherheit brachte, und seine Mutter hatte anschließend die schrecklichen Verbrennungen versorgt, die es davongetragen hatte und deren Narben Alizeh noch jahrelang studieren würde.
»Ihre Augen«, hatte die zitternde, weinende Frau ihrem Mann zugerufen, der bei dem Lärm eilends angelaufen gekommen war. »Sieh nur, was mit ihren Augen passiert ist … Sie werden sie dafür töten …«
Alizeh rieb sich jetzt die Augen und hustete.
Natürlich war sie zu klein gewesen, um sich an den genauen Wortlaut dessen zu erinnern, was ihre Eltern untereinander gesprochen hatten; zweifellos nährte sich Alizehs Erinnerung nur aus einer oft wiederholten Erzählung, die sich ihr so unauslöschlich eingeprägt hatte, dass sie sogar meinte, noch immer die Stimme ihrer Mutter hören zu können.
Sie schluckte.
Ruß war in ihre Kehle gelangt. Ihre Finger waren taub geworden. Erschöpft und mit einem tiefen Seufzer entließ sie ihre Sorgen in die Feuerstelle, wobei eine weitere Rußwolke aufgewirbelt wurde.
Da musste Alizeh zum zweiten Mal husten, und diesmal so heftig, dass sie sich mit der Sticknadel in den kleinen Finger stach. Sie veratmete die anbrandende Schmerzwelle mit übernatürlicher Ruhe und entfernte zunächst vorsichtig die Nadel, bevor sie die Verletzung begutachtete.
Der Stich war tief.
Langsam, nacheinander, schlossen sich ihre Finger um das Kleid, das sie noch in der Hand hielt, sodass die erlesene Seide den Blutfluss hemmte. Nach einigen Augenblicken – in denen sie leer nach oben in den Kamin starrte, zum sechzehnten Mal in dieser Nacht – ließ sie das Kleid los, biss den Faden ab und warf das juwelenbesetzte, funkelnagelneue Kleidungsstück auf einen Stuhl.
Keine Angst. Alizeh wusste, dass ihr Blut keine Flecken hinterließ. Dennoch war es eine gute Ausrede, um sich geschlagen zu geben und das Kleid beiseitezulegen. Ausgebreitet, wie es nun war, konnte sie es eingehend betrachten. Das Mieder war vornüber auf den Rock gefallen, ganz so, wie ein Kind auf einem Stuhl einschlafen würde. Seide sammelte sich in einer Pfütze aus Stoff um die Holzbeine, und das Licht fing sich in den Perlenstickereien. Eine sanfte Brise rüttelte an einem nicht fest genug verschlossenen Fenster, eine einzelne Kerze erlosch und nahm das letzte bisschen Haltung mit sich, das für die Auftragsarbeit geblieben war. Das Kleid glitt vom Stuhl, einer der schweren Ärmel löste sich und fiel raschelnd herab, bis sein glitzerndes Bündchen über den rußigen Boden streifte.
Alizeh seufzte erneut.
Dieses Kleid war wie all die anderen weit davon entfernt, schön zu sein. Sie fand die Gestaltung einfallslos und die Umsetzung allenfalls passabel. Sie träumte davon, ihrer Fantasie die Zügel schießen lassen zu dürfen, ihre Hände zu befreien, um ohne Einschränkungen zu erschaffen – doch das Brausen ihrer Vorstellungskraft wurde wie immer erstickt von dem unseligen Bedürfnis, sich selbst zu schützen.
Erst zu Lebzeiten ihrer Großmutter war das Feuerabkommen geschlossen worden, ein noch nie da gewesener Friedensvertrag, der es den Dschinns und Menschen gestattete, sich zum ersten Mal seit fast tausend Jahren ungehindert zu vermischen. Obwohl sie einander oberflächlich betrachtet glichen, war der Dschinnleib aus der Essenz des Feuers gemacht und mit verschiedenen körperlichen Vorzügen versehen, während die Menschen, weil sie aus Erde und Wasser entstanden waren, lange Lehmlinge genannt worden waren. Die Dschinns hatten dem Abschluss der Vereinbarung mit lebhafter Erleichterung zugestimmt, denn die beiden Rassen waren äonenlang in gegenseitigem Blutvergießen gefangen gewesen, und obwohl sich die Feindschaft zwischen ihnen nicht aus der Welt schaffen ließ, waren alle des Tötens überdrüssig geworden.
Die Straßen waren mit flüssiger Sonne vergoldet worden, um diesen zerbrechlichen Frieden einzuläuten, und im Freudentaumel darüber hatte man die Flagge und Währung des Reichs neu gestaltet. Jeder königliche Gegenstand wurde mit der Maxime dieses neuen Zeitalters gestempelt:
MAUGH
Möge allzeit uneingeschränkt Gleichheit herrschen
Gleichheit, so stellte sich heraus, bedeutete, dass die Dschinns sich den Schwächen der Menschen beugen und stets die Stärken ihrer eigenen Rasse leugnen mussten – ihre Schnelligkeit und Kraft und die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, die ihnen angeboren waren. Sie mussten sofort all das einstellen, was der König zu »übernatürlichen Handlungen« erklärt hatte, oder mit dem sicheren Tod rechnen. Und die Lehmlinge, die sich als eine Gattung wenig verlässlicher Geschöpfe erwiesen hatten, waren nur zu willig, »Verrat« zu rufen, gleichgültig, wie die Umstände sein mochten. Alizeh hatte noch immer die Schreie, die Tumulte in den Straßen im Kopf …
Sie starrte jetzt auf das mittelmäßige Kleid.
Immer musste sie sich beherrschen, um kein zu ausgefallenes Kleidungstück zu entwerfen, denn außergewöhnliche Arbeiten wurden einer noch strengeren Prüfung unterzogen und nur zu schnell als das Ergebnis übernatürlichen Zaubers gebrandmarkt.
Nur ein einziges Mal hatte Alizeh – die immer verzweifelter versuchte, ein halbwegs hinreichendes Auskommen zu finden – daran gedacht, einen Kunden nicht mit Stil, sondern mit Handwerkskunst zu beeindrucken. Nicht nur, dass die Qualität ihrer Arbeit um ein Vielfaches höher war als die der ansässigen Schneiderin, Alizeh konnte ein elegantes Morgenkleid auch in einem Viertel der üblichen Zeit nähen und war bereit gewesen, nur halb so viel dafür zu verlangen.
Die Aufsicht hatte sie zum Tod durch den Strang verurteilt.
Es war nicht etwa die glückliche Kundin gewesen, sondern die rivalisierende Näherin, die sie dem Gericht gemeldet hatte. Wunder über Wunder, es war ihr gelungen, dem behördlichen Versuch zu entkommen, sie mitten in der Nacht zu verschleppen, und sie war aus der ländlichen Gegend ihrer Kindheit in die Anonymität der Stadt geflohen, weil sie hoffte, in der Menge untertauchen zu können.
Wenn sie doch nur die Bürde abstreifen könnte, die sie immer mit sich herumtrug. Doch Alizeh kannte eine Vielzahl von Gründen, sich im Schatten zu halten. Der wichtigste war die Tatsache, dass ihre Eltern ihr Leben hingegeben hatten, damit sie selbst in aller Stille überleben konnte, und dass sie all ihre Anstrengungen entehrte und zunichtemachte, wenn sie jetzt unvorsichtig wurde.
Nein, lange bevor Alizeh beginnen konnte, ihre Auftragswerke zu lieben, hatte sie Lehrgeld bezahlt und gelernt, ihre hohen Ansprüche an sich selbst aufzugeben.
Sie erhob sich. Eine Rußwolke tat es ihr gleich und bauschte sich um ihre Röcke. Sie würde die Herdstelle säubern müssen, bevor Frau Amina am Morgen herunterkam, sonst würde sie wahrscheinlich gleich wieder auf der Straße sitzen. Obwohl sie stets ihr Bestes gab, war Alizeh öfter aus dem Haus gejagt worden, als sie zählen konnte. Sicher, es bedurfte keines großen Anstoßes, um sich von etwas zu trennen, das bereits als entbehrlich galt. Solche Gedanken hatten sie allerdings nie wirklich beruhigen können.
Alizeh holte einen Besen; sie fuhr leicht zusammen, als das Feuer erstarb. Es war spät – sehr spät. Das stetige Ticken der Uhr berührte etwas in ihrem Herzen, machte sie nervös. Alizeh hegte eine natürliche Abneigung gegen die Dunkelheit, eine tief verwurzelte Angst, die sie nicht vollständig benennen konnte. Sie hätte lieber bei Sonnenlicht mit Nadel und Faden gearbeitet, doch die Tage brachte sie mit den Aufgaben zu, die wirklich wichtig waren: dem Putzen der Zimmer und Latrinen von Bazhaus, dem hochherrschaftlichen Anwesen Ihrer Hoheit, der Herzogin Jamilah von Fetrous.
Alizeh war der Herzogin niemals begegnet, sie hatte die schillernde ältere Dame nur aus der Ferne gesehen. Alizeh traf nur Frau Amina, die Hauswirtschafterin, die Alizeh lediglich probeweise eingestellt hatte, da sie keine Referenzen vorweisen konnte. Was zur Folge hatte, dass es Alizeh bisher nicht gestattet war, mit der übrigen Dienerschaft in Kontakt zu treten. Außerdem war ihr auch kein eigenes Zimmer in deren Unterkünften zugewiesen worden. Stattdessen hatte man ihr eine muffige Abstellkammer auf dem Dachboden gegeben, in der sie eine Pritsche, eine mottenzerfressene Matratze und eine halbe Kerze vorgefunden hatte.
Alizeh hatte in jener ersten Nacht in ihrem schmalen Bett wach gelegen, so überwältigt, dass sie kaum atmen konnte. Weder der muffige Dachboden noch die mottenzerfressene Matratze machte ihr etwas aus, denn Alizeh wusste, dass sie großes Glück gehabt hatte. Dass ein großer Haushalt bereit war, eine Dschinn einzustellen, erschien ihr aufregend genug, doch dass man ihr sogar ein Zimmer gegeben hatte – eine Verschnaufpause von den winterlichen Straßen …
Alizeh hatte seit dem Tod ihrer Eltern immer wieder für eine Weile Arbeit gefunden, und oft hatte man ihr erlaubt, im Haus oder auf dem Heuboden zu schlafen; doch noch nie hatte sie ein eigenes Zimmer bekommen. Es war das erste Mal seit Jahren, dass sie einen Bereich für sich allein hatte, eine Tür, die sie hinter sich schließen konnte, und Alizeh war so satt und schwer vor Glück gewesen, dass sie schon fürchtete, durch den Boden zu brechen. Ihr ganzer Körper zitterte, während sie in dieser Nacht zu den Holzbalken hinaufblickte, in das Dickicht aus Spinnweben über ihrem Kopf. Eine große Spinne hatte sich am eigenen Faden zu ihr herabgelassen, um ihr in die Augen zu sehen, und Alizeh, einen Schlauch voll Wasser an die Brust gedrückt, hatte nur gelächelt.
Das Wasser war das Einzige, worum sie gebeten hatte.
»Ein Schlauch Wasser?«, hatte Frau Amina gefragt, stirnrunzelnd, als hätte Alizeh darum gebeten, das Kind der Frau essen zu dürfen. »Du kannst dir dein eigenes Wasser holen, Mädchen.«
»Vergebt mir, das würde ich ja auch«, hatte Alizeh geantwortet, den Blick auf ihre Füße gesenkt, auf das abgeschabte Leder rund um die Zehen, das sie noch nicht ausgebessert hatte. »Aber ich bin noch neu in der Stadt und habe festgestellt, dass es so weit weg von zu Hause schwierig ist, Zugang zu frischem Wasser zu finden. Hier in der Nähe gibt es keine verlässliche Zisterne, und ich kann mir noch kein Glas Wasser vom Markt leisten …«
Frau Amina brach in schallendes Gelächter aus.
Alizeh verstummte, während ihr Hitze den Hals emporkroch. Sie wusste nicht, warum die Frau sie auslachte.
»Kannst du lesen, Mädchen?«
Alizeh sah auf, ohne es zu wollen, und hörte ihr eigenes vertrautes, ängstliches Keuchen, noch bevor sie dem Blick der Frau begegnet war. Frau Amina trat zurück, ihr Lächeln erlosch.
»Ja«, erwiderte Alizeh. »Das kann ich.«
»Dann musst du versuchen, es zu vergessen.«
Alizeh fuhr zusammen. »Ich bitte um Verzeihung?«
»Sei nicht dumm.« Frau Aminas Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Niemand will eine Dienerin, die lesen kann. Du ruinierst dir deine eigenen Möglichkeiten mit einer solchen Sprache. Woher, sagtest du, kommst du?«
Alizeh stand stocksteif da.
Sie konnte nicht sagen, ob diese Frau grausam war oder ihr eine Freundlichkeit erwies. Es war das erste Mal, dass jemand andeutete, ihre Intelligenz könnte ein Problem für ihre Anstellung sein, und Alizeh überlegte, ob es stimmte: Vielleicht war es tatsächlich ihr Kopf gewesen – allzu voll, wie er war –, der dafür gesorgt hatte, dass sie immer wieder auf der Straße landete. Vielleicht gelang es ihr endlich, sofern sie vorsichtig war, eine Anstellung länger als ein paar Wochen zu behalten. Fraglos konnte sie im Austausch gegen Sicherheit Dummheit vortäuschen.
»Ich komme aus dem Norden«, sagte sie ruhig.
»Dein Akzent klingt nicht nach Norden.«
Alizeh hätte beinahe erwidert, dass sie in der Abgeschiedenheit aufgewachsen war, dass sie so zu sprechen gelernt hatte, wie ihre Erzieher es ihr beigebracht hatten. Doch dann fiel es ihr ein, fiel ihr ihre Anstellung wieder ein, und sie schwieg.
»Wie ich vermutet habe«, hatte Frau Amina in die Stille hinein gesagt. »Gewöhne dir diesen lächerlichen Akzent ab. Du klingst wie eine Idiotin, die so tut, als wäre sie etwas Besseres. Am besten redest du überhaupt nicht. Wenn dir das gelingt, könntest du nützlich für mich sein. Ich habe gehört, dass deinesgleichen nicht so leicht ermüdet, und ich erwarte, dass deine Arbeit diesen Ruf bestätigt. Sonst habe ich keine Bedenken, dich zurück auf die Straße zu jagen. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Ja, gnädige Frau.«
»Du darfst deinen Schlauch Wasser haben.«
»Danke, gnädige Frau.« Alizeh knickste und wandte sich zum Gehen.
»Oh, und noch etwas …«
Alizeh drehte sich um.
»Besorge dir so schnell wie möglich eine Snoda. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen.«
ZWEI
ALIZEHHATTEEBENERST die Tür zu ihrer Abstellkammer geöffnet, als sie es spürte, ihn spürte, als hätte sie die Arme in die Ärmel eines Wintermantels gesteckt. Mit hämmerndem Herzen hielt sie inne und blieb im Türrahmen stehen.
Töricht.
Alizeh schüttelte den Kopf, um wieder klar zu denken. Sie sah Gespenster, und das war auch kein Wunder: Sie brauchte dringend Schlaf. Nachdem sie die Herdstelle gefegt hatte, musste sie sich den Ruß von Händen und Gesicht waschen, und all das hatte viel länger gedauert als gehofft. Ihr müder Geist war wohl kaum für seine fiebrigen Gedanken zu dieser Stunde verantwortlich zu machen.
Mit einem Seufzer streckte Alizeh einen Fuß in die schwarzen Tiefen ihrer Kammer, um blind nach den Zündhölzern und der Kerze zu suchen, die sie immer neben der Tür deponierte. Frau Amina hatte Alizeh nicht gestattet, abends eine zweite Kerze nach oben mitzunehmen, denn sie konnte sich ganz und gar nicht vorstellen, dass das Mädchen vorhaben könnte, noch lange nach dem Löschen der Gaslampen zu arbeiten. Doch die fehlende Fantasie der Hauswirtschafterin änderte nichts an einer Tatsache: In einem so großen Anwesen war es nahezu ausgeschlossen, dass Licht aus den unteren Etagen in die oberen Stockwerke streute. Wenn nicht gerade der Mond günstig stand und durch das schmale Fenster im Gang hereinschien, war der Dachboden des Nachts in undurchdringliches Dunkel getaucht, so schwarz wie Pech.
Ohne das Glühen des Nachthimmels, das Alizeh half, über die vielen Treppenfluchten zu ihrer Abstellkammer zu gelangen, hätte sie den Weg vielleicht nicht gefunden, denn sie litt an einer Angst, die so lähmend war, dass ihr im Angesicht vollständiger Dunkelheit unlogischerweise der Tod lieber gewesen wäre.
Ihre Kerze war rasch gefunden, das gesuchte Zündholz angestrichen, ein Luftzug, und der Docht brannte. Ein warmer Schein erhellte einen Kreis in der Mitte des Raums, und zum ersten Mal an diesem Tag entspannte sich Alizeh.
Leise zog sie die Tür hinter sich zu und trat vollends in die Kammer, die kaum groß genug war, um ihre Pritsche zu fassen.
Eben darum liebte sie sie.
Sie hatte die völlig verdreckte Kammer so lange geschrubbt, bis ihre Knöchel bluteten, bis ihre Knie pochten. Diese alten, schönen Häuser waren früher bis unters Dach perfekt gebaut worden, und begraben unter Schichten von Schimmel, Spinnweben und verkrustetem Schmutz hatte Alizeh elegante Fischgrätböden entdeckt und massive Holzbalken an der Decke. Als sie fertig war, strahlte der Raum.
Frau Amina hatte natürlich die alte Lagerkammer nicht mehr besichtigt, seitdem sie der neuen Hausangestellten zugewiesen worden war, und Alizeh fragte sich oft, was die Hauswirtschafterin wohl sagen würde, wenn sie den Raum jetzt sehen würde, denn er war nicht wiederzuerkennen. Aber Alizeh hatte ja schon vor langer Zeit gelernt, erfinderisch zu sein.
Sie löste das feine Stoffgespinst von ihren Augen und legte die Snoda ab. Alle Bediensteten im Haus mussten dieses Stück Seide tragen, denn die Maske kennzeichnete den Träger als Angehörigen der unteren Klassen. Sie war für harte Arbeiten entworfen und lose genug gewebt, um ihre Gesichtszüge zu verschleiern, ohne die notwendige Sicht einzuschränken. Alizeh hatte ihr Gewerbe mit großem Bedacht gewählt. Sie klammerte sich jeden Tag an die Anonymität ihrer Stellung und entfernte ihre Snoda außerhalb ihrer Kammer selten, denn obwohl die meisten Leute die Fremdheit, die sie in ihren Augen sahen, nicht zu deuten wussten, fürchtete sie, dass es eines Tages vielleicht doch der falschen Person gelingen würde.
Sie atmete jetzt tief ein und aus und drückte die Fingerspitzen an die Wangen und Schläfen, um sanft dieses Gesicht zu massieren, das sie gefühlt seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Alizeh besaß keinen eigenen Spiegel, und ihr gelegentlicher Blick in die Spiegel von Bazhaus enthüllte ihr nur das untere Drittel ihres Gesichts: Lippen, Kinn, die Säule ihres Halses. Sonst war sie eine gesichtslose Dienerin, eine von Dutzenden, und sie hatte nur eine vage Erinnerung daran, wie sie aussah – oder wie sie anderen zufolge früher ausgesehen hatte. Da war das Flüstern der Stimme ihrer Mutter in ihrem Ohr, die Empfindung der schwieligen Hand ihres Vaters an ihrer Wange.
Du bist die Beste von uns allen, hatte er einmal gesagt.
Alizeh verdrängte die Erinnerung daran, während sie die Stiefel auszog und sie in ihre Ecke stellte. Über die Jahre hatte Alizeh genug Stoffreste von früheren Aufträgen gesammelt, um die Steppdecke und das Kissen zu nähen, die jetzt auf der Matratze lagen. Ihre Kleider hatte sie an alte Nägel gehängt, die sie sorgfältig mit farbenfrohen Fäden umwickelt hatte; alle anderen persönlichen Gegenstände hatte sie in einer entsorgten Apfelkiste arrangiert, die sie in einem der Hühnerställe gefunden hatte.
Jetzt rollte sie ihre Strümpfe herunter und hängte sie zum Lüften über eine straff gespannte Leine. Ihr Kleid wanderte an einen der bunten Haken, ihr Mieder an einen anderen, ihre Snoda an den letzten. Alles, was Alizeh besaß, alles, was sie berührte, war sauber und ordentlich, denn sie hatte längst gelernt, dass ein Heim nicht vorgefunden, sondern geschaffen wurde – sogar aus nichts.
Nur noch das Hemdkleid am Leib, gähnte sie; sie gähnte, als sie sich auf ihre Pritsche setzte, als die Matratze einsank, als sie die Nadeln aus ihrem Haar zog. Als ihre langen, schweren Locken auf ihre Schultern herunterfielen, fiel auch der Tag von ihr ab.
Ihre Gedanken begannen zu verschwimmen.
Mit großem Widerwillen blies sie die Kerze aus, zog die Beine an die Brust und fiel um wie ein Insekt, das die Balance verloren hatte. Die Unlogik ihrer Phobie war nur dahingehend folgerichtig, dass sie sie selbst verblüffte. Denn wenn sie im Bett lag und die Augen schloss, stellte sich Alizeh vor, dass sie die Dunkelheit leichter bezwingen konnte, und trotz des vertrauten Schüttelfrosts fand sie schneller in den Schlaf. Sie griff nach ihrer weichen Steppdecke und zog sie bis zu den Schultern hoch, während sie versuchte, nicht daran zu denken, wie kalt ihr war. Sie bemühte sich, überhaupt nichts zu denken. Tatsächlich bebte sie so heftig, dass sie es beinahe nicht bemerkt hätte, als er sich setzte und sein Gewicht die Matratze am Fußende ihres Bettes beschwerte.
Alizeh verbiss sich einen Schrei.
Sie riss die Augen auf, ihre müden Pupillen hatten Mühe, sich zu weiten. Hektisch tastete Alizeh über ihre Decke, ihr Kissen, die verschlissene Matratze. Da war niemand auf ihrem Bett. Niemand in ihrer Kammer.
Hatte sie halluziniert? Sie griff ungeschickt nach ihrer Kerze und ließ sie fallen, weil ihre Hände so zitterten.
Bestimmt hatte sie nur geträumt.
Die Matratze ächzte unter einem fremden Gewicht, das verlagert wurde, und Alizeh wurde von einer so heftigen Angst befallen, dass sie Sterne sah. Sie drängte rückwärts, wobei sie mit dem Kopf gegen die Wand stieß, und irgendwie bündelte der Schmerz ihre Panik.
Ein scharfes Schnippen, und zwischen seinen Fingern, die kaum da waren, erschien eine Flamme und erleuchtete die Konturen seines Gesichts.
Alizeh wagte kaum zu atmen.
Sie konnte nicht einmal seine Silhouette sehen, nicht richtig, aber andererseits war es auch nicht sein Gesicht, sondern seine Stimme, die den Teufel in Verruf gebracht hatte.
Alizeh wusste das besser als die meisten.
Selten zeigte sich der Teufel in einer annähernd fleischlichen Gestalt; selten waren auch klare und erinnerbare Mitteilungen von ihm. Tatsächlich war diese Kreatur nicht so stark, wie ihr Vermächtnis es glauben machen wollte, denn ihr war das Recht verwehrt, wie jedermann zu sprechen. Sie war bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, sich in Rätseln auszudrücken, und ihr war nur erlaubt, jemanden zu seinem eigenen Verderben zu überreden, aber nicht, ihn zu zwingen.
Es war also nicht an der Tagesordnung, dass jemand den Teufel zu kennen behauptete, noch konnte jemand überzeugend von seinen Methoden berichten, denn die Gegenwart des Bösen wurde zumeist nur dem Gefühl nach erlebt.
Alizeh gefiel es nicht, dass sie die Ausnahme war.
Allerdings musste sie wohl oder übel die Umstände ihrer Geburt geltend machen: dass es der Teufel gewesen war, der als Erster seine Glückwünsche an der Wiege überbracht hatte, wo seine unerwünschten Chiffren so unausweichlich gewesen waren wie Nässe bei Regen. Alizehs Eltern hatten verzweifelt versucht, dieses Scheusal aus ihrem Haus zu verbannen, doch er war wieder und wieder zurückgekehrt, um in alle Ewigkeit Alizehs Lebensteppich mit Unheil verkündenden Vorahnungen zu besticken. Ein gefühltes Versprechen auf Zerstörung, dem sie nicht entrinnen konnte.
Und auch jetzt spürte sie die Stimme des Teufels, spürte sie wie Atem in ihrem Körper, als würde die Luft, die er ausstieß, ihre Knochen behauchen.
Es war einmal ein Mann, flüsterte er.
»Nein«, hätte sie beinahe panisch geschrien. »Nicht noch ein Rätsel – bitte …«
Es war einmal ein Mann, flüsterte er, auf jeder Schulter ihm eine Schlange lag.
Alizeh hielt sich die Ohren zu und schüttelte den Kopf. Noch nie hatte sie sich so sehr zu schreien gewünscht.
»Bitte«, flehte sie. »Bitte nicht …«
Und wieder:
Es war einmal ein Mann,
auf jeder Schulter ihm eine Schlange lag.
Und waren die Schlangen satt,
alterte ihr Meister keinen weiteren Tag.
Alizeh kniff die Augen zusammen und zog die Knie an die Brust. Er würde nicht aufhören. Sie konnte ihn nicht aussperren.
Was sie fraßen, wusste niemand zu sagen, selbst als man die Kinder fand …
»Bitte«, sagte sie, und sie bettelte jetzt. »Bitte, ich will nicht wissen …«
Was sie fraßen, wusste niemand zu sagen,
selbst als man die Kinder fand,
das Gehirn geschält aus dem Schädel,
ihre Leichen verstreut im Sand.
Sie atmete tief ein, und er war fort, fort, die Stimme des Teufels hatte sich losgerissen von ihren Knochen. Der Raum erbebte plötzlich um sie her, die Schatten hoben und streckten sich – und im verzerrten Licht erwiderte ein seltsames, verschwommenes Gesicht ihren Blick. Alizeh biss sich so fest auf die Lippen, dass sie Blut schmeckte.
Es war ein junger Mann, der sie anstarrte – einer, den sie nicht kannte.
Alizeh bezweifelte nicht, dass er ein Mensch war – doch etwas an ihm schien anders zu sein als bei den anderen. Im trüben Licht wirkte der Mann nicht aus Lehm geformt, sondern aus Marmor. Sein Gesicht war in harte Linien gemeißelt, in deren Mitte ein weicher Mund saß. Je länger sie ihn ansah, desto schneller raste ihr Herz. War das der Mann mit den Schlangen? Aber warum sollte das eine Rolle spielen? Warum sollte sie auch nur ein einziges Wort von dem glauben, was der Teufel sprach?
Doch die Antwort auf diese letzte Frage kannte sie bereits.
Alizeh kam die Ruhe abhanden. Im Geiste schrie sie, dass sie den Blick abwenden solle von diesem zauberischen Gesicht, schrie, dass all das hier nur Wahnsinn war – und doch.
Hitze kroch ihren Hals empor.
Alizeh war es nicht gewöhnt, lange in Gesichter zu starren; und dieses hier sah auf eine gewaltsame Art gut aus. Es hatte edle Züge, war von geraden Linien und Höhlungen geprägt, ganz lässige Überheblichkeit, die in sich ruhte. Der Mann neigte den Kopf, während er sie betrachtete, und zuckte nicht mit der Wimper, als er ihre Augen studierte. Seine unverwandte Aufmerksamkeit entfachte eine vergessene Flamme in ihr und rüttelte ihren müden Geist wach.
Und dann eine Hand.
Seine Hand, aus einem Wirbel in der Dunkelheit geboren. Er sah ihr geradewegs in die Augen, während er mit einem Finger über ihre Lippen fuhr, der sich in Luft auflöste.
Und sie schrie.
AMANFANG
DIEGESCHICHTEDESTEUFELS hatte sich abgenutzt, während sie wieder und wieder erzählt wurde, doch Iblees, Iblees, sein wahrer Name wie ein Herzklopfen auf der Zunge, verlor sich in den Katakomben der Geschichte. Sein eigenes Volk wusste am besten, dass das Scheusal nicht aus Licht, sondern aus Feuer geschmiedet war. Kein Engel, sondern ein Dschinn, ein altes Geschlecht, dem einst die Erde gehört hatte, das einst die außergewöhnliche Auffahrt dieses jungen Mannes in den Himmel gefeiert hatte. Sie wussten am besten, woher er kam, denn sie waren da gewesen, als er zurückgeschleudert wurde, als sein Körper auf die Erde herniederkrachte und ihrer aller Welt dank seiner Überheblichkeit dem Untergang geweiht wurde.
Vögel erstarrten in der Luft, als sein Körper vom Himmel stürzte, die scharfen Schnäbel geöffnet, die Schwingen mitten im Schlag gelähmt. Er glitzerte im Fall, frisch, schlüpfrig, geschmolzen, während schwere Feuertropfen von seiner Haut perlten. Sie trafen noch dampfend auf der Erde auf, bevor er selbst es mit voller Wucht tat, ließen Frösche und Bäume und die gemeinschaftliche Würde einer ganzen Kultur verdampfen, die in alle Ewigkeit verdammt war, seinen Namen zu den Sternen hinaufzuschreien.
Denn als Iblees fiel, fiel auch sein Volk.
Nicht Gott, sondern die Bewohner des sich ausdehnenden Universums waren es, die bald die Dschinns im Stich lassen würden. Jedes himmlische Wesen war Zeuge der Entstehung des Teufels geworden, einer Kreatur der Dunkelheit, wie sie bisher unbekannt, ungenannt gewesen war – und niemand hatte den Wunsch, des Mitgefühls für einen Feind des Allgewaltigen bezichtigt zu werden.
Als Erstes wandte sich die Sonne von ihnen ab. Ein einziges Blinzeln, und es war vollbracht. Ihr Planet, die Erde, war in fortwährende Dunkelheit gehüllt, gepanzert mit Eis und aus der Umlaufbahn geworfen. Der Mond verblasste als Nächstes, sodass die Welt aus den Angeln gehoben wurde und ihre Meere sich krümmten. Bald war alles überflutet, dann gefror es; die Bevölkerung halbierte sich binnen drei Tagen fein säuberlich. Tausende Jahre Geschichte, Kunst und Literatur und Erfindungsgeist: ausgelöscht.
Dennoch wagten die überlebenden Dschinns zu hoffen.
Da verschlangen sich die Sterne selbst, einer nach dem anderen, festes Land versank und spaltete sich unter den Füßen, Landkarten vergangener Jahrhunderte waren mit einem Mal veraltet. Da, als sich die Dschinns in der anhaltenden Dunkelheit nicht mehr zurechtfanden, fühlten sie sich wirklich, unwiderruflich, verloren.
Bald zerstreuten sie sich.
Iblees war für sein Vergehen mit einer einzigen Aufgabe bestraft worden: bis in alle Ewigkeit die Lehmgestalten heimzusuchen, die binnen Kurzem aus der Erde gekrochen kommen würden. Lehm – jene rohe, unentwickelte Form, vor der Iblees nicht auf die Knie gehen wollte – würde die Welt erben, die die Dschinns einst besessen hatten. Dessen waren die Dschinns gewiss. Es war geweissagt worden.
Wann? Das wussten sie nicht.
Die Himmel beobachteten den Teufel, das Halbleben, das er zu leben gezwungen war. Alle sahen stumm zu, während sich vereiste Meere über die Ufer schoben und sich die Gezeiten im gleichen Maße erhoben wie sein wachsender Zorn. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde das Dunkel schwärzer und gesättigter mit dem Gestank des Todes.
Da die Himmel ihnen keine Orientierung mehr gaben, konnten die verbliebenen Dschinns nicht sagen, wie lange ihr Volk in Kälte und Dunkelheit zusammengedrängt verbracht hatte. Es fühlte sich wie Jahrhunderte an, mochte aber auch nur Tage gewährt haben. Was war die Zeit, wenn es keine Monde gab, um die Stunden zu hüten, und keine Sonnen, um ein Jahr abzustecken? Zeit ließ sich nur noch durch eine Geburt bestimmen, durch die Kinder, die lebten. Dass ihre Seelen aus Feuer geschmiedet waren, war einer der beiden Gründe, weshalb die Dschinns die endlosen Winter überlebten. Der zweite: dass sie nur Wasser als Nahrung brauchten.
Lehm formte sich langsam in solchen Wassern, fand zitternd zur endgültigen Gestalt, während eine andere Kultur an großem Kummer, an Schrecken starb. Die Dschinns, die es allen Widrigkeiten zum Trotz überstanden, wurden von Zorn gequält, der in ihrer Brust gefangen war, von Zorn, der nur durch die Last einer unerbittlichen Schmach in Schach gehalten wurde.
Dschinns waren früher die einzigen intelligenten Wesen auf der Erde gewesen, Geschöpfe, die stärker, schneller, simpler und schlauer erdacht waren, als es Lehmlinge je sein würden. Dennoch waren die meisten in der immerwährenden Dunkelheit erblindet. Ihre Haut wurde aschfarben, ihre Augenfarbe weiß, da das Schwarz ihr die Pigmente nahm. Die quälende Abwesenheit der Sonne hatte selbst diese feurigen Wesen geschwächt, und als die Lehmlinge Gestalt angenommen hatten und endlich auf zuverlässigen Beinen stehen konnten, erwachte die Sonne lodernd zu neuem Leben, schleuderte den Planeten zurück in die Umlaufbahn, und ein brennender Schmerz wurde geboren.
Hitze.
Sie trocknete die Augen der Dschinns aus, die nicht daran gewöhnt waren, und sengte ihnen das letzte Fleisch von den Knochen. Für jene Dschinns, die Schutz vor dieser Hitze gesucht hatten, gab es Hoffnung: Mit der Rückkehr der Sonne zeigte sich auch wieder der Mond, und mit ihm kamen die Sterne. In deren Licht bahnten sie sich ihren Weg in die Sicherheit und suchten Zuflucht auf dem Scheitelpunkt der Erde, in klirrender Kälte, in der sie sich heimisch zu fühlen begonnen hatten. In aller Stille errichteten sie ein bescheidenes neues Königreich, und währenddessen lehnten sich ihre übernatürlichen Leiber mit solcher Gewalt gegen die Ebenen von Raum und Zeit auf, dass sie sich praktisch in Luft auflösten.
Es spielte keine Rolle, dass die Dschinns stärker waren als die Lehmlinge – Menschen, wie sie sich selbst nannten –, die die Erde und die Himmel in Besitz genommen hatten. Es spielte keine Rolle, dass die Dschinns mächtiger und stärker und schneller waren. Es spielte keine Rolle, wie heiß ihre Seelen brannten. Erde, das hatten sie gelernt, erstickte eine Flamme. Erde würde sie am Ende alle begraben.
Und Iblees …
Iblees war nie weit.
Die unvergängliche, schimpfliche Existenz des Teufels war eine eindringliche Erinnerung an alles, was sie verloren hatten, an alles, was sie erduldet hatten, um zu überleben. Mit dem größten Bedauern überließen die Dschinns die Erde ihren neuen Königen – und beteten, dass man sie selbst niemals finden würde.
Es war nur ein weiteres Gebet, das nicht erhört werden sollte.
DREI
ALIZEHTRATINSFRÜHE Morgenlicht.
Sie war aus dem Bett gestiegen, hatte ihre Kleider angezogen, Nadeln in ihr Haar gesteckt, Schuhe übergestreift. Üblicherweise verwandte sie mehr Sorgfalt auf ihre Morgentoilette, doch sie war später eingeschlafen, als sie vorgehabt hatte, und hatte nur Zeit gehabt, sich mit einem feuchten Lappen über die Augen zu fahren. Der fertige Auftrag sollte heute ausgeliefert werden, und so hatte sie das glitzernde Kleid in Lagen aus Tüll gewickelt und das Paket mit einer Schnur zugebunden. Alizeh trug das Paket vorsichtig nach unten. Nachdem sie Feuer im Kamin gemacht hatte, drückte sie die schwere Holztür auf – nur um bis zu den Knien in frisch gefallenem Schnee zu versinken.
Alizeh ließ vor Enttäuschung die Schultern hängen. Sie kniff die Augen zusammen und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.
Nein.
Sie würde nicht wieder ins Bett zurückkehren. Es stimmte, sie besaß noch keinen eigenen Wintermantel. Oder eine Mütze. Oder auch nur Handschuhe. Es stimmte ebenfalls, dass sie, wenn sie sofort wieder die Treppe hinaufging, noch eine ganze Stunde würde schlafen können, bevor man ihrer Dienste bedurfte.
Aber nein.
Sie richtete sich kerzengerade auf und barg das kostbare Bündel vor der Brust. Heute würde sie bezahlt werden.
Alizeh trat in den Schnee.
Der Mond war an diesem Morgen so groß, dass er fast den ganzen Himmel ausfüllte, und sein Widerschein erfüllte alles mit einem verträumten Schimmer. Die Sonne wirkte wie ein Stecknadelkopf in der Ferne, ihre Umrisse schienen durch watteweiche Wolken. Die Bäume waren groß und weiß und ihre Äste schwer von Puder. Es war noch sehr früh und der Schnee auf den Wegen noch unberührt. Die Welt schimmerte so weiß, dass es fast bläulich aussah. Blauer Schnee, blauer Himmel, blauer Mond. Die Luft schien sogar blau zu riechen, so kalt war es.
Alizeh zog ihre dünne Jacke enger um den Leib und lauschte, wie der Wind durch die Straßen pfiff. Straßenkehrer tauchten so plötzlich auf, als wären sie von Alizehs Gedanken herbeigerufen worden, und sie sah ihren choreografierten Bewegungen zu, bei denen die roten Pelzmützen vor und zurück wippten, während ihre Schaufeln über den Boden kratzten und Streifen goldener Pflastersteine bloßlegten. Alizeh nahm eilends den rasch frei werdenden Pfad und schüttelte den Schnee von ihren Kleidern, unter den Füßen den glitzernden Stein. Sie war nass bis zu den Oberschenkeln und wollte nicht darüber nachdenken.
Stattdessen sah sie nach oben.
Der Tag hatte noch gar nicht richtig begonnen, seine Geräusche waren noch nicht zu hören. Straßenverkäufer mussten ihre Stände noch aufbauen, Läden ihre geschlossenen Fenster öffnen. Heute watschelte ein Trio aus hellgrünen Enten die bestäubte Mittellinie entlang, während misstrauische Ladeninhaber aus den Türen spähten und Besenstiele in den Schnee steckten. Ein gewaltiger weißer Bär fläzte an einer eisigen Ecke, und ein Straßenkind schlief tief und fest an sein Fell gekuschelt. Alizeh hielt großen Abstand zu dem Bären, als sie um die Ecke bog; ihre Augen folgten einer Rauchspirale, die gen Himmel aufstieg. An Essensständen auf Rädern wurde Feuer gemacht, wurden Waren vorbereitet. Alizeh atmete die fremden Gerüche ein, verglich sie mit ihrem Gedächtnis. Sie hatte kochen gelernt – konnte Lebensmittel benennen, wenn sie sie sah –, doch sie hatte nicht genug Erfahrung mit Essen, um es dem Geruch nach bestimmen zu können.
Dschinns nahmen gern Nahrung zu sich, doch anders als die meisten Lebewesen brauchten sie sie nicht; daher hatte Alizeh diese Verhaltensweise seit einigen Jahren aufgegeben. Sie verwendete ihr Einkommen stattdessen darauf, Nähzubehör zu kaufen und regelmäßig im örtlichen Hammam ein Bad zu nehmen. Ihr Bedürfnis nach Sauberkeit wuchs gemeinsam mit ihrem Bedürfnis nach Wasser. Feuer war ihre Seele, doch Wasser war ihr Leben – es war alles, was sie zum Überleben brauchte. Sie trank es, badete darin, wollte oft in seiner Nähe sein. Reinlichkeit war infolgedessen ein grundlegendes Prinzip ihres Lebens geworden, eines, das ihr seit der Kindheit eingebläut worden war. Alle paar Monate ging sie tief in den Wald hinein zu einem Miswak- oder Zahnbürstenbaum, von dem sie sich eine Zahnbürste pflückte, mit deren Hilfe sie ihren Mund frisch und ihre Zähne weiß hielt. Bei ihrer Arbeit wurde sie immer schmutzig, und sie verbrachte jede Sekunde Freizeit damit, sich selbst sozusagen auf Hochglanz zu bringen. Es war tatsächlich ihre Beschäftigung mit Reinlichkeit, die sie dazu gebracht hatte, sich Gedanken über die Vorzüge eines solchen Berufs zu machen.
Alizeh blieb stehen.
Sie war zufällig in einen Sonnenstrahl getreten und badete nun darin, wärmte sich daran, während eine Erinnerung vor ihrem geistigen Auge erblühte.
Ein Eimer mit Seifenwasser.
Die groben Borsten einer Wurzelbürste.
Ihre Eltern, die lachten.
Die Erinnerung fühlte sich nicht unähnlich einem feurigen Handabdruck auf ihrem Brustbein an. Alizehs Mutter und Vater hatten es für wichtig erachtet, ihr Kind nicht nur darin zu unterweisen, wie man das eigene Zuhause instand und rein hielt, sondern auch grundlegende Kenntnisse der meisten technischen und mechanischen Arbeiten zu erwerben; sie wollten, dass sie die Bürde des Tagwerks kennenlernte. Allerdings hatten sie nur beabsichtigt, ihr eine wertvolle Lektion zu erteilen – sie hatten nie gewollt, dass sie so ihren Lebensunterhalt verdiente.
Während sich Alizeh in ihren frühen Jahren von Lehrern und Erziehern ausbilden ließ, hatten ihre Eltern sie hübsch bescheiden erzogen und – in Vorbereitung auf die Zukunft, die sie sich für sie ausmalten – das Augenmerk stets auf das Allgemeinwohl und die unerlässliche Eigenschaft des Mitgefühls gerichtet.
Fühle, hatten ihre Eltern einmal zu ihr gesagt.
Die Fesseln, die dein Volk trägt, sind oft für das Auge unsichtbar. Fühle, hatten sie gesagt, denn so wirst du wissen, wie diese Fesseln zu lösen sind, selbst wenn du blind bist.
Hätten ihre Mutter und ihr Vater gelacht, wenn sie sie jetzt hätten sehen können? Hätten sie geweint?
Alizeh machte es nichts aus, als Dienstmädchen zu arbeiten – harte Arbeit hatte ihr noch nie etwas ausgemacht –, doch sie wusste, dass sie wahrscheinlich eine Enttäuschung für ihre Eltern war, wenn auch nur für die Erinnerung, die sie an sie hatte.
Ihr Lächeln erstarb.
Der Junge war schnell und Alizeh abgelenkt, daher brauchte sie eine Sekunde länger als üblich, um ihn zu bemerken. Was genauer gesagt bedeutete, dass sie ihn überhaupt nicht bemerkt hatte, bis sein Messer schon an ihrer Kehle saß.
»Le Mann et Paket«, sagte er, und dabei hauchte er ihr seinen heißen und säuerlichen Atem ins Gesicht. Er sprach Feshtoon, was bedeutete, dass er weit von zu Hause entfernt und wahrscheinlich hungrig war. Er stand hinter ihr und überragte sie dabei; seine freie Hand hielt sie grob an der Hüfte gepackt. Allem Anschein nach war ihr Angreifer ein Barbar – und doch wusste sie irgendwoher, dass er nur ein für sein Alter zu groß geratener Junge war.
Sanft sagte sie: »Lass mich los. Tu’s, und ich gebe dir mein Wort, dass ich dir nichts zuleide tun werde.«
Er lachte. »Nez beshoff.« Dummes Weib.
Alizeh klemmte das Paket unter ihren linken Arm und packte sein Handgelenk mit ihrer Rechten. Sie spürte, wie die Klinge ihren Hals streifte, während er schrie und zurücktaumelte. Sie fing ihn auf, bevor er stürzen konnte, ergriff seinen Arm und verdrehte ihn, sodass seine Schulter auskugelte, bevor sie ihn in den Schnee stieß. Sie stand über ihm, während er heulend und halb begraben in einer Schneewehe lag. Leute, die vorbeikamen, wandten den Blick ab; sie wusste, dass sie sich nicht für die Unterschicht interessierten. Man konnte sich darauf verlassen, dass eine Dienstbotin und ein Gassenjunge sich gegenseitig aus dem Weg räumen würden, und der Gerichtsbarkeit so überflüssige Arbeit ersparen.
Das war ein trostloser Gedanke.
Alizeh holte umsichtig das Messer des Jungen aus dem Schnee und begutachtete seine grobe Machart. Sie nahm auch den Jungen in Augenschein. Sein Gesicht war fast so jung, wie sie geargwöhnt hatte. Zwölf? Dreizehn?
Sie kniete sich neben ihn, und er erstarrte, unterbrach kurz das Schluchzen, das seine Brust schüttelte. »Nek, nek, lotfi, lotfi …« Nein, nein, bitte, bitte.
Sie nahm seine Hand, die heil geblieben war, in ihre, öffnete seine gekrümmten schmutzigen Finger und drückte ihm das Heft des Messers in die Hand. Sie wusste, dass der arme Junge es brauchen würde.
Immer noch.
»Es gibt andere Arten, am Leben zu bleiben«, flüsterte sie auf Feshtoon. »Komm zur Küche von Bazhaus, wenn du Brot brauchst.«
Da sah sie der Junge an, richtete die volle Kraft seines erschrockenen Blicks auf sie. Sie konnte sehen, dass er ihre Augen hinter ihrer Snoda suchte. »Shora?«, fragte er. Warum?
Alizeh musste fast lächeln.
»Bek mefem«, antwortete sie ruhig. Weil ich es verstehe. »Bek bidem.« Weil ich wie du war.
Alizeh wartete nicht auf seine Erwiderung, sie erhob sich und schüttelte ihre Röcke aus. Da spürte sie etwas Nasses an ihrer Kehle und zog ein Taschentuch aus ihrer Tasche, um es auf die Wunde zu drücken. Sie stand noch immer da, reglos, als die Glocke zu läuten begann, um die Tageszeit zu verkünden, und dabei eine Gruppe Stare aufschreckte, deren schillerndes Federkleid im Morgenlicht glitzerte.
Alizeh atmete die eisige Luft tief ein. Sie hasste die Kälte, doch sie war wenigstens belebend, und das fortgesetzte Unbehagen, das damit einherging, hielt sie nachhaltiger wach, als jede Tasse Tee es vermocht hätte. Alizeh hatte in der Nacht zuvor vielleicht zwei Stunden geschlafen, doch sie konnte es sich nicht leisten, sich mit dem Gedanken an ihren Schlafmangel aufzuhalten. Man erwartete von ihr, dass sie in genau einer Stunde die Arbeit für Frau Amina antrat, was hieß, dass sie in den nächsten sechzig Minuten sehr viel zu erledigen hatte.
Und dennoch zögerte sie.
Das Messer an ihrer Kehle hatte sie aus der Fassung gebracht. Es war nicht die Aggression, die sie so verstörte – in ihrer Zeit auf der Straße hatte sie sich mit viel Schlimmerem herumgeschlagen als mit einem hungrigen Jungen, der mit einem Messer herumfuchtelte. Nein, es war der Zeitpunkt. Sie hatte die Ereignisse des Vorabends nicht vergessen, die Stimme des Teufels, das Gesicht des jungen Mannes.
Sie hatte es nicht vergessen – sie hatte es einfach nur hintangestellt. Sich Sorgen zu machen, war eine Profession für sich – die dritte für Alizeh. Es war eine Profession, die ihr die freie Zeit abnötigte, die sie nur selten hatte, daher schob sie ihre Sorgen oft beiseite, bis sie Staub ansetzten und sie einen Augenblick dafür erübrigen konnte.
Doch Alizeh war keine Närrin.
Iblees suchte sie schon ihr ganzes Leben lang heim, hatte sie mit seinen undurchschaubaren Rätseln fast in den Wahnsinn getrieben. Sie hatte sich sein anhaltendes Interesse an ihr nie erklären können. Sie wusste zwar, dass die frostige Kälte in ihren Adern sie selbst innerhalb ihres eigenen Volkes zu jemand Besonderem machte, doch dies schien ein unzureichender Grund zu sein, sie für all diese Martern zu empfehlen. Alizeh hasste es, dass ihr Leben mit den Einflüsterungen eines solchen Ungeheuers verflochten war.
Der Teufel wurde allseits, von Dschinns wie Lehmlingen gleichermaßen, verachtet, doch es hatte die Menschen Jahrtausende gekostet, diese Wahrheit zu erkennen: dass die Dschinns den Teufel vielleicht mehr als alle anderen hassten. Iblees war schließlich für den Niedergang ihrer Kultur verantwortlich, für das lichtlose, gnadenlose Dasein, zu dem Alizehs Vorfahren lange verdammt gewesen waren. Die Dschinns bezahlten teuer für Iblees’ Taten – seine Überheblichkeit – durch die Hände der Menschen, die Tausende von Jahren geglaubt hatten, es sei ihre göttliche Pflicht, die Erde von solchen Wesen zu säubern, Wesen, die in ihren Augen nur Nachkommen des Teufels waren.
Der Makel eines solchen Hasses ließ sich nicht so leicht aufheben.
Eine Gewissheit zumindest war Alizeh wieder und wieder bestätigt worden: Die Gegenwart des Teufels in ihrem Leben war ein Omen, ein Hinweis auf ein bevorstehendes Unheil. Sie hatte seine Stimme vor jedem Todesfall gehört, jedem Kummer, jeder Gelenksentzündung, die sie plagte. Nur wenn sie besonders weichherzig gestimmt war, gestand sie sich einen nagenden Verdacht ein: dass die Botschaften des Teufels in Wahrheit eine verdrehte Form der Gunstbezeugung waren, als glaubte er, er könnte einem unvermeidbaren Schmerz mit einer Vorwarnung die Spitze nehmen.
Stattdessen machte ihn die Angst oft noch schlimmer.
Alizeh verbrachte die Tage damit, zu grübeln, welche Pein auf sie wartete, welche Qual auf der Lauer lag. Niemand vermochte zu sagen, wie lange …
Ihre Hand erstarrte, vergaß sich; ihr blutiges Taschentuch flatterte unbemerkt zu Boden. Alizehs Herz hämmerte plötzlich mit der Kraft von Pferdehufen gegen ihren Brustkorb. Sie konnte kaum Luft holen. Dieses Gesicht, dieses unmenschliche Gesicht. Hier, er war hier …
Er beobachtete sie bereits.
Sie entdeckte seinen Umhang fast zur gleichen Zeit, da sie sein Gesicht entdeckte. Die feine schwarze Wolle war schwer und erlesen verarbeitet; sie erkannte ihre unaufdringliche Herrlichkeit selbst von hier, selbst in diesem Moment. Sie war fraglos das Werk von Madame Nezrin, der Meisterschneiderin aus dem bedeutendsten Atelier des Imperiums. Alizeh hätte die Arbeiten dieser Frau überall erkannt. Tatsächlich hätte Alizeh die Arbeiten fast jedes Ateliers im Imperium erkannt, was bedeutete, dass sie oft nur einen einzigen Blick auf einen Fremden werfen musste, um zu wissen, wie viele Menschen bei seiner Beerdigung so tun würden, als betrauerten sie ihn.
Dieser Mann, entschied sie, würde von einem Haufen von Speichelleckern betrauert werden, denn seine Taschen waren zweifellos tiefer als die von Dariush persönlich. Der Fremde war groß, Furcht einflößend. Er hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sodass es zum Großteil im Schatten lag, doch er war weit entfernt von dem namenlosen Geschöpf, das zu sein er vorzugeben hoffte. Im Wind erhaschte Alizeh einen Blick auf das Futter seines Umhangs: die reinste tintenschwarze Seide, in Wein gelagert, mit Frost behandelt. Es dauerte Jahre, solch ein Kleidungsstück anzufertigen. Tausende Stunden Mühe. Der junge Mann hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was er da trug, genauso wie er keine Ahnung zu haben schien, dass die Spange an seinem Hals – so viel ließ sich selbst aus dieser Entfernung sagen – aus purem Gold bestand, dass das Geld für seine schlichten, schmucklosen Stiefel Hunderte Familien in der Stadt hätte ernähren können. Er war ein Narr, wenn er dachte, dass er sich hier unsichtbar machen könnte, dass er ihr vielleicht überlegen war, dass er womöglich …
Alizeh erstarrte zu Eis.
Eine Erkenntnis dämmerte ihr, begleitet von starkem, verstörendem Unbehagen.
Wie lange stand er schon so da?
Es war einmal ein Mann,
auf jeder Schulter ihm eine Schlange lag.
In Wahrheit hätte Alizeh ihn vermutlich überhaupt nicht bemerkt, wenn er sie nicht direkt angeschaut und mit seinem Blick durchbohrt hätte. Da traf es sie – und sie keuchte –, traf sie mit der Gewalt eines Donnerschlags: Sie sah ihn jetzt nur, weil er es erlaubte. Aber wer war dieser Narr?
Sie.
Panik setzte ihre Brust in Brand. Alizeh löste sich vom Boden, löste sich in Luft auf, um mit jener übernatürlichen Schnelligkeit durch die Straßen davonzujagen, die sie sich gewöhnlich für die schlimmsten Streitigkeiten aufhob.
Alizeh wusste nicht, welche Dunkelheit dieses fremde Lehmlingsgesicht mit sich bringen würde. Sie wusste nur, dass sie ihr niemals entkommen würde.
Und dennoch musste sie es versuchen.
VIER
DERMONDSTANDSO groß am Himmel, dass Kamran dachte, er könnte seine Haut mit dem Finger berühren und Kreise um seine Wunden ziehen. Er starrte auf seine Adern und Strahlenkränze, auf die weißen Pockennarben, die wie Spinnennetze aussahen. Er betrachtete all das, während sein Kopf arbeitete und er im Nachgang einer unmöglichen Halluzination die Augen zusammenkniff.
Sie hatte sich sozusagen in Luft aufgelöst.
Er hatte sie nicht anstarren wollen, aber wie hätte er wegsehen sollen? Er hatte die Gefahr in den Bewegungen des Angreifers wahrgenommen, noch ehe der Bursche sein Messer gezogen hatte; schlimmer noch, niemand schenkte der Auseinandersetzung Aufmerksamkeit. Das Mädchen hätte auf die schlimmste Art und Weise zum Krüppel geschlagen oder entführt oder ermordet werden können – und obwohl Kamran dazu verpflichtet worden war, sich bei Tageslicht nicht zu erkennen zu geben, nötigten ihn all seine Instinkte dazu, eine Warnung zu rufen, einzuschreiten, bevor es zu spät war …
Er hätte sich keine Sorgen machen müssen.
Doch noch immer gab es vieles, das ihm Sorgen bereitete, allem voran der Anschein, dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmte. Sie hatte vor Augen und Nase eine Snoda getragen – einen Schleier aus halb durchsichtiger Seide –, die ihre Züge nicht wirklich verhüllte, aber doch unkenntlich machte. Die Snoda an sich war harmlos genug; sie zu tragen wurde von den Dienstboten verlangt. Das Mädchen war offensichtlich eine Hausangestellte.
Doch man verlangte von Dienstboten nicht, dass sie die Snoda außerhalb der Arbeit trugen. Es war also unüblich, dass das Mädchen ihre zu dieser frühen Stunde angelegt hatte, da die Angehörigen von Adel und königlicher Familie noch im Bett lagen.
Es war viel wahrscheinlicher, dass sie überhaupt kein Dienstmädchen war.
Seit Jahren unterwanderten Spitzel das Imperium Ardunia, doch ihre Zahl war in den letzten Monaten gefährlich angestiegen und hatte eine zermürbende Sorge wachsen lassen, die seit Kurzem Kamrans Gedanken beherrschte und die er auch jetzt nicht abschütteln konnte.
Er seufzte, und in der Kälte wölkte es weiß aus seinem Mund.
Von Sekunde zu Sekunde war Kamran überzeugter, dass das Mädchen die Dienstmädchenkluft gestohlen hatte, denn ihr heimlicher Versuch, sich als Dienstbotin auszugeben, war nicht nur mangelhaft ausgeführt, sondern wurde auch dadurch entlarvt, dass sie die zahlreichen Regeln und Eigentümlichkeiten, die das Leben der unteren Klassen bestimmten, nicht zu kennen schien. Allein ihr Gang wäre Warnung genug gewesen; für eine Hausangestellte war sie zu erhaben gelaufen, indem sie eine fast königliche Haltung an den Tag legte, die man nur in der Kindheit erlernte.
Nein, Kamran war sich jetzt sehr sicher, dass das Mädchen etwas zu verbergen hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand die Snoda benutzt hätte, um in der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben.
Kamran warf einen Blick auf die Uhr auf dem Platz. Er war erst am Morgen in die Stadt gekommen, um mit den Wahrsagern zu sprechen. Sie hatten ihm eine rätselhafte Nachricht zukommen lassen mit der Bitte um ein Treffen, und das, obwohl er seine Rückkehr nach Hause niemals angekündigt hatte. Das heutige Treffen, so schien es, würde warten müssen, denn sehr zu Kamrans Bestürzung wollten seine allzeit verlässlichen Instinkte keine Ruhe geben.
Wie hatte ein Dienstmädchen mit nur einer freien Hand so lässig einen Burschen entwaffnen können, der ihr gerade ein Messer an die Kehle hielt? Woher sollte ein Dienstmädchen die Zeit oder das Geld haben, sich selbst verteidigen zu lernen? Und was in aller Welt hatte sie zu dem Kerl gesagt, dass er nun weinend im Schnee lag?
Er kam erst jetzt wieder wankend auf die Beine. Sein roter Lockenkopf schrie förmlich heraus, dass er aus Fesht kam, einer Gegend, die mindestens eine Monatsreise südlich von Setar, der Hauptstadt, lag; nicht nur, dass der Angreifer weit weg von zu Hause war, er schien auch heftige Schmerzen zu haben und ließ einen Arm hängen. Kamran sah, wie der Rotschopf sich mit der guten Hand den offenbar ausgerenkten, wehen Arm hielt und allmählich sein Gleichgewicht wiederfand. Tränen hatten saubere Bahnen über seine ansonsten schmutzigen Wangen gezogen, und zum ersten Mal konnte Kamran sich den Angreifer genauer anschauen. Hätte er mehr Übung darin gehabt, Gefühle zu zeigen, so hätte sich auf Kamrans Zügen Überraschung abgezeichnet.
Der Bursche war ziemlich jung.
Kamran bewegte sich flink auf ihn zu; im Gehen streifte er eine Kettenmaske übers Gesicht. Er lief gegen den Wind, sodass sein Umhang um die Stiefel flappte, und erst als er fast mit dem Jungen zusammenstieß, blieb er stehen. Es reichte aus, um den feshtischen Jungen einen Satz rückwärts machen zu lassen; er zuckte zusammen, als sich die Bewegung auch in seinen verletzten Arm fortpflanzte. Der Junge barg den Arm schützend am Oberkörper und duckte sich weg, den Kopf auf die Brust gedrückt wie ein Tausendfüßler, während er mit einem unhörbaren Murmeln vorbeizugehen versuchte.
»Lotfi, hejj, bekhshti …« Bitte, mein Herr, entschuldigt …
Die Unverfrorenheit dieses halben Kindes konnte Kamran kaum glauben. Doch es war ein Trost zu wissen, dass er recht gehabt hatte: Der Junge sprach Feshtoon und war weit von der Heimat entfernt.
Kamran hatte gute Lust, den Jungen der Obrigkeit zu übergeben; das war der einzige Grund, warum er an ihn herangetreten war.
Wieder versuchte der Junge, an ihm vorbeizukommen, und wieder versperrte Kamran ihm den Weg. »Kya tan goft et cheknez?« Was hat die junge Frau zu dir gesagt?
Der Junge fuhr zusammen. Wich zurück. Seine Haut war ein oder zwei Schattierungen heller als seine braunen Augen, und ein paar dunklere Sommersprossen sprenkelten seine Nase. Hitze erblühte fleckig und unvorteilhaft auf seinem Gesicht. »Bekhshti, hejj, nek mefem.« Tut mir leid, mein Herr, ich verstehe nicht …
Der Junge winselte fast. Kamran kam noch näher. »Jev man«, sagte er. »Pres.« Antworte mir. Sofort.
Da löste sich die Zunge des Jungen, fast zu schnell und unverständlich. Kamran übersetzte bei sich, was er sagte:
»Nichts, mein Herr – bitte, Herr, ich habe ihr nichts getan, es war nur ein Missverständnis …«
Kamran umschloss die ausgekugelte Schulter des Jungen mit seiner Hand, die in einem Handschuh steckte. Der Bursche schrie auf und schnappte nach Luft, während seine Knie nachgaben.
»Du wagst es, mir ins Gesicht zu lügen …«
»Mein Herr – bitte …« Der Kerl weinte nun. »Sie hat mir nur mein Messer zurückgegeben, mein Herr, ich schwöre es, und dann – bot sie mir Brot an, sie sagte …«
Kamran ließ seine Hand sinken und ging einen Schritt rückwärts. »Du lügst ja immer noch.«
»Beim G-grab meiner Mutter, ich schöre es. Bei allem, was mir heilig …«
»Sie hat dir die Waffe zurückgegeben und angeboten, dir zu essen zu geben«, sagte Kamran scharf. »Und das, nachdem du sie fast umgebracht hättest. Nachdem du versucht hast, sie zu bestehlen.«
Der Junge schüttelte den Kopf, und Tränen sprangen ihm in die Augen. »Sie hat mir Barmherzigkeit erwiesen, Majestät – bitte …«
»Genug.«
Der Junge schloss schnell den Mund. Kamrans Enttäuschung wuchs; er hätte am liebsten jemanden erwürgt. Er suchte den Platz einmal mehr ab, als könnte das Mädchen so leicht noch einmal auftauchen, wie es verschwunden war. Sein Blick kehrte zu dem Jungen zurück.
Seine Stimme war wie Donner.
»Du hast einer Frau ein Messer an die Kehle gehalten wie der schlimmste Feigling, der verabscheuungswürdigste aller Männer. Diese junge Frau mag dir Barmherzigkeit erwiesen haben, aber ich habe keinen Grund, es ihr gleichzutun. Erwartest du etwa, damit davonzukommen? Ohne Verurteilung?«
Der Junge geriet in Panik. »Bitte, mein Herr – ich werde hingehen und sterben, mein Herr … Ich werde mir die Kehle durchschneiden, wenn Ihr das von mir wollt. Nur liefert mich nicht der Obrigkeit aus, ich flehe Euch an.«
Kamran blinzelte. Die Situation wurde immer komplizierter. »Warum sagst du so etwas?«
Da verlor der Junge nur noch mehr die Fassung und schüttelte den Kopf. Seine Augen waren wild und groß, seine Angst war zu spürbar, als dass er sie hätte spielen können. Gleich darauf begann er zu heulen, dass es durch die Straßen hallte.
Kamran wusste nicht, wie er den Bengel beruhigen sollte; seine eigenen sterbenden Soldaten hatten sich eine solche Schwäche in seiner Gegenwart nie erlaubt. Zu spät dachte Kamran daran, den Jungen laufen zu lassen. Der Gedanke hatte kaum Gestalt angenommen, da stieß sich der Junge die roh gearbeitete Klinge tief in den Hals.
Kamran verschlug es den Atem.
Der Junge – dessen Namen er nicht kannte – würgte an seinem eigenen Blut, an dem Messer, das noch immer in seinem Hals steckte. Kamran fing ihn auf, als er fiel, konnte dabei die Rippen des Jungen unter den Fingern fühlen. Er war so leicht wie ein Vogel, denn seine Knochen waren fraglos vom Hunger ausgehöhlt.
Alte Impulse gewannen die Oberhand.
Kamran rief Vorübergehenden Befehle zu mit der Stimme, mit der er eine Legion befehligte, und Fremde erschienen wie aus dem Nichts und stellten ihre Kinder dafür zur Verfügung, seine Aufträge auszuführen. Er war so fassungslos, dass er es kaum bemerkte, als ihm der Junge aus den Armen genommen und vom Platz getragen wurde. Wie er auf das Blut starrte, den gesprenkelten Schnee, die roten Rinnsale, die einen Kanaldeckel umkreisten – es war, als hätte Kamran den Tod noch nie gesehen, ihn nicht schon tausendmal gesehen. Doch das hatte er, das hatte er, er kannte alle Arten von Dunkelheit. Kamran hatte nur noch nie ein Kind Selbstmord begehen sehen.
In diesem Augenblick sah er das Taschentuch.
Er hatte beobachtet, wie die junge Frau es auf ihren Hals gedrückt hatte, auf die Wunde, die ein Junge ihr beigebracht hatte, der nun wahrscheinlich tot war. Er hatte beobachtet, wie dieses seltsame Mädchen mit der Duldsamkeit eines Soldaten verkraftet hatte, dass es fast getötet worden wäre, und Gnade vor Recht hatte ergehen lassen mit dem Mitgefühl einer Heiligen. Er hegte inzwischen keinen Zweifel mehr, dass sie tatsächlich eine Spionin und von einer Scharfsinnigkeit war, die ihn überraschte.
Sie hatte binnen eines Wimpernschlags gewusst, wie sie mit dem Kind umzugehen hatte, nicht wahr? Sie hatte es viel besser angestellt als er selbst, hatte ein besseres Urteilsvermögen an den Tag gelegt. Und nun, als er über ihr Verschwinden nachdachte, wuchs seine Angst noch. Es kam selten vor, dass Kamran sich schämte, doch dieses Gefühl tobte nun regelrecht in ihm und wollte sich nicht mehr zum Schweigen bringen lassen. Mit einem Finger hob er das bestickte Viereck aus dem Schnee auf. Er hatte erwartet, dass das weiße Stück Stoff mit Blut befleckt wäre.
Es war blütenrein.
FÜNF
KAMRANSABSÄTZEKLACKTENungewöhnlich laut über den Marmorboden, sodass es durch die höhlenartigen Gänge des Palastes hallte. Nach dem Tod seines Vaters hatte Kamran entdeckt, dass ihn ein einziges Gefühl durchs Leben bringen konnte. Er hatte es behutsam gehegt, und es war heiß in seiner Brust herangewachsen, bis es lebensfähig war wie ein eigenes Organ.
Zorn.
Zorn hielt ihn lebendiger, als sein Herz es je getan hatte.
Er spürte diesen Zorn immer, aber besonders jetzt, und der Herr mochte jeden Menschen schützen, der ihn verärgerte, wenn er so übellaunig war.
Nachdem er das Taschentuch des Mädchens in seine Brusttasche gesteckt hatte, hatte er auf dem Absatz kehrtgemacht und war schnurstracks zu seinem Pferd zurückgelaufen, das geduldig auf ihn wartete. Kamran mochte Pferde. Sie stellten keine Fragen, bevor sie taten, was man von ihnen verlangte – jedenfalls nicht mit der Zunge. Der kohlrabenschwarze Hengst hatte sich weder um den blutigen Umhang seines Herrn noch um seine Fahrigkeit gekümmert.
Nicht so, wie Hazan es tat.
Der Minister folgte ihm nun mit beeindruckender Geschwindigkeit; seine Stiefel waren das zweite Paar, das auf dem Pflaster zu hören war. Wären sie nicht miteinander aufgewachsen, so hätte Kamran auf eine derartige Unverfrorenheit mit einer uneleganten Methode der Problemlösung reagiert: roher Gewalt. Doch andererseits war es seine Unfähigkeit zur Ehrfurcht, die Hazan für seine Rolle als Minister geradezu prädestinierte. Kamran konnte keine Stiefellecker dulden.
»Ihr seid dümmer als ein Idiot, wisst Ihr das?«, fragte Hazan mit großer Heiterkeit. »Ihr solltet an den ältesten Benzessbaum genagelt werden. Ich sollte Skarabäen das Fleisch von Euren Knochen nagen lassen.«
Kamran erwiderte nichts.
»Das könnte Wochen dauern.« Hazan hatte ihn eingeholt, und nun hielt er mühelos Schritt. »Es würde mich glücklich machen, zu sehen, wie sie Eure Augen verschlingen.«
»Du übertreibst sicher.«
»Ich versichere Euch, dass ich das nicht tue.«