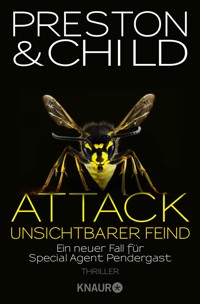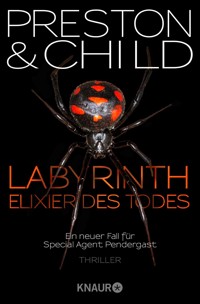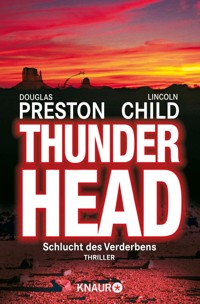
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Tal des Teufels Vor tausenden von Jahren hat im amerikanischen Südwesten ein mysteriöser Indianerstamm Straßen gebaut und Städte errichtet, bis diese Kultur auf rätsel- hafte Weise zusammenbrach. Der Hauptort, die goldene Stadt Quivira, verschwand für immer. Die Expedition, die das Geheimnis aufdecken soll, kämpft nicht nur gegen Hitze und Wüstensand ? ihr Gegner ist das Böse an sich. Eine hochbrisante Mischung aus Archäologie, Technik, Horror und Spannung. "Preston und Child schreiben Klasse-Thriller mit Grusel-Touch und Krimis zum Unter-die Decke-Kriechen." Brigitte "Spannung und Horror pur bis zur letzten Seite". Berliner Morgenpost Thunderhead von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Thunderhead
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Thomas A. Merk
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Epilog
Anmerkung der Autoren
Danksagung
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Tochter Veronicaund der Company of NinePreston Child widmet dieses BuchStuart Woods
1
Die frisch asphaltierte Straße verließ Santa Fe und führte zwischen Pinien pfeilgerade nach Westen. Die Sonne, die gerade bernsteinfarben hinter den schneebedeckten Gipfeln der Jemez-Berge unterging, warf den Schatten einer schmutzig-grauen Wolkenbank über die Landschaft. Nora Kelly saß am Steuer ihres klapprigen Ford-Pick-up und blickte hinaus auf die mit Wüstengestrüpp bewachsenen Hügel und das ausgetrocknete Flussbett neben der Straße, die sie nun schon zum dritten Mal innerhalb eines Vierteljahres entlangfuhr.
Auf dem Weg von Buckman’s Wash nach Jackrabbit Flats – oder dem, was früher einmal Jackrabbit Flats gewesen war – sah sie die kleinen schillernden Regenbogen von über einem Dutzend Rasensprengern, die mit langsamen, rhythmischen Bewegungen ihrer metallisch glänzenden Düsenköpfe fein verteilte Wasserstrahlen in die heiße Wüstenluft sprühten. Aus dem satten Grün eines makellos gepflegten Grasteppichs leuchteten blendend weiße Sandbunker, und dahinter erhob sich das neu erbaute, mit imitierten Lehmziegeln verkleidete Haus des Golfclubs Fox Run. Angewidert wandte Nora den Blick wieder auf die Straße.
Eine Meile hinter dem Golfplatz holperte der Pick-up über ein Viehgitter, und die glatte Teerstraße verwandelte sich in eine ausgefahrene Sandpiste. Ein aufgeschrecktes Kaninchen rannte quer über die Fahrbahn, als Nora an ein paar alten Briefkästen und einem primitiven, wettergebleichten Holzschild mit der Aufschrift Rancho de las Cabrillas vorbeifuhr. Plötzlich erinnerte sie sich an einen Sommertag vor zwanzig Jahren, an dem sie ihrem Vater beim Malen dieses Schildes geholfen hatte. Cabrilla, so hatte ihr Vater damals gesagt, als sie beide mit einem Eimer Farbe in der prallen Sonne gestanden hatten, sei das spanische Wort für Wasserwanze. Denselben Namen hatten Nora und ihr Vater auch dem Sternbild der Plejaden gegeben, weil sie der Meinung gewesen waren, es sehe aus wie Wasserwanzen, die über die Oberfläche eines Teiches liefen. »Zum Teufel mit den Rindviechern«, hatte Noras Vater gesagt und mit einem dicken Pinsel die Buchstaben auf das Schild gemalt. »Ich habe die Ranch eigentlich nur wegen des Sternenhimmels hier draußen gekauft.«
Nora fuhr langsam um die Kurve und einen sanften Hügel hinauf. Die Sonne war jetzt unter dem Horizont verschwunden, und der Himmel über der Wüste verdunkelte sich rasch. Vor Nora lag jetzt das grüne Tal mit dem alten Ranchhaus ihrer Familie, in dem nun schon seit fünf Jahren niemand mehr lebte. Seine Fenster waren mit Brettern vernagelt, und die Scheune neben den leeren Pferdekoppeln zeigte starke Verfallsspuren. In Noras Augen war es nicht allzu schade um das Fertighaus aus den Fünfzigerjahren, das bereits in ihrer Jugend baufällig gewesen war; ihr Vater hatte all sein Geld für das Land ausgegeben und nur ein billiges Haus bauen können.
Kurz vor dem Kamm des Hügels verließ Nora die Straße und warf einen Blick auf das trockene Bachbett daneben, in das jemand eine Ladung Bauschutt gekippt hatte. Vielleicht sollte sie ja doch auf ihren Bruder hören und die Ranch verkaufen. Das Haus ließ sich ohnehin nicht mehr reparieren und die Grundsteuer war – ebenso wie die Grundstückspreise – in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Ein neues Haus konnte sie von ihrem dürftigen Gehalt als Assistenzprofessorin nicht bauen lassen – warum also hing sie noch an dieser Ranch?
Nora sah, wie im eine Viertelmeile entfernten Wohnhaus der Gonzales-Ranch die Lichter angingen. Im Gegensatz zu ihrem Vater, der seine kleine Ranch nur als Hobby betrieben hatte, bestritt Noras Schulfreundin Teresa Gonzales ihren Lebensunterhalt mit Landwirtschaft. Teresa war eine große, gescheite und furchtlose Frau, die nicht nur ihren eigenen Betrieb ganz alleine bewirtschaftete, sondern seit fünf Jahren auch auf der Cabrillas-Ranch nach dem Rechten sah. Jedes Mal, wenn Jugendliche dort eine Fete feierten oder betrunkene Jäger ein Zielschießen auf das Farmhaus veranstalteten, ging Teresa hinüber, um sie zu verjagen, und hinterließ Nora eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, damit diese kam und den Schaden anschaute. In letzter Zeit hatte Teresa ein paar Mal kurz nach Sonnenuntergang einen schwachen Lichtschein in den Fenstern des Kelly-Hauses entdeckt und außerdem bemerkt, wie irgendwelche seltsamen, großen Tiere darum herum geschlichen waren.
Als Nora sah, dass keine Autos vor dem Ranchhaus parkten, hielt sie in einiger Entfernung davon den Wagen an, um es eine Weile zu beobachten. Nichts rührte sich und auch sonst konnte Nora weder einen Lichtschein noch andere Anzeichen für die Anwesenheit von Eindringlingen entdecken. Entweder waren sie nicht mehr hier oder Teresa hatte sich getäuscht, als sie die Lichter gesehen hatte.
Langsam fuhr sie durch das innere Tor und parkte den Pick-up hinter dem Haus. Dort nahm sie eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach und stieg leise aus dem Wagen. Die Haustür hing schief in der einen ihr noch verbliebenen Angel; das Vorhängeschloss, das Nora nach dem Tod ihrer Mutter dort angebracht hatte, war längst einem Bolzenschneider zum Opfer gefallen. Ein Windstoß fuhr durch den Hof, wirbelte eine kleine Staubwolke auf und rüttelte leise an der Tür.
Nora schaltete die Taschenlampe ein und ging auf das Haus zu. Als sie die Tür aufdrückte, bewegte sich diese nur widerwillig. Erst als Nora ihr einen genervten Tritt verpasste, fiel sie mit einem lauten Krach zu Boden. Nachdem das Geräusch in dem stillen Haus verhallt war, trat Nora ein.
Drinnen herrschte wegen der vernagelten Fenster fast völlige Dunkelheit, aber Nora wusste auch so, dass diese Bruchbude nur noch wenig mit dem Haus gemein hatte, in dem sie groß geworden war. Auf dem Boden lagen Scherben und leere Bierflaschen herum, und irgendein Rowdy hatte krakelige Graffiti an die Wände gesprüht. Der Teppich war zerschnitten, die Sofakissen aufgeschlitzt, so dass die Federn überall im Raum herumflogen, und jemand hatte sogar ein paar Bretter von den Fenstern gerissen. In den Wänden bemerkte Nora unzählige Einschusslöcher und die Spuren von wütenden Fußtritten.
Eigentlich hatte sich der Zustand des Hauses seit ihrem letzten Besuch nicht wesentlich verschlimmert. Bis auf die aufgeschlitzten Sofakissen und ein paar weitere Löcher in den Wänden war alles wie gehabt. Noras Anwalt hatte sie bereits wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass das Haus in seinem jetzigen Zustand nur eine Belastung für sie sei. Die Baubehörde würde es, sollte sie darauf aufmerksam werden, ohne Umschweife für unbewohnbar erklären und sie zwingen, es abzureißen. Das Problem dabei war, dass Nora nicht genug Geld für den Abbruch hatte – außer natürlich, wenn sie die Ranch verkaufte.
Sie ging vom Wohnzimmer in die Küche, wo sie den Lichtkegel ihrer Taschenlampe über den alten Kühlschrank gleiten ließ. Er lag noch immer umgeworfen in der Ecke, wo sie ihn bei einem ihrer letzten Besuche entdeckt hatte. Neu war, dass jemand die Gemüseschubladen herausgerissen und dann achtlos irgendwo hingeworfen hatte. Auch war das Linoleum am Boden, das die Feuchtigkeit ohnehin schon aufgeworfen hatte, in langen Fetzen abgerissen worden. An einigen Stellen hatte jemand sogar ein paar Bodenbretter entfernt und den Hohlraum darunter freigelegt. Vandalismus muss ein verdammt harter Job sein, dachte Nora und ließ ihren Blick weiter durch den Raum schweifen. Irgendwie hatte sie auf einmal das seltsame Gefühl, dass etwas anders war als sonst.
Sie verließ die Küche und stieg langsam die Treppe hinauf, auf deren Stufen dicke Knäuel von herausgerissener Matratzenfüllung lagen. Dabei versuchte sie, etwas Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Aufgeschlitzte Sofakissen, in die Wand geschlagene Löcher, abgerissenes Linoleum und fehlende Bodenbretter – irgendwie kamen ihr diese neuerlichen Zerstörungen nicht ganz so willkürlich vor wie die, mit denen sie es bisher zu tun gehabt hatte. Es sah fast so aus, als habe jemand gezielt nach etwas gesucht. Auf halbem Weg die dunkle Treppe hinauf blieb sie plötzlich stehen.
Hatte sie nicht das Knirschen von Schritten auf zerbrochenem Glas gehört?
Nora lauschte ins Dämmerdunkel, aber bis auf das leise Wehen des Windes hörte sie kein Geräusch. Wie sollte sie auch, schließlich war draußen kein Auto vorgefahren. Mit einem leisen Seufzer setzte sie sich wieder die Treppe hinauf in Bewegung.
Oben, wo keines der Bretter von den Fenstern fehlte, war es noch dunkler als im Erdgeschoss. Vom Treppenabsatz aus wandte sie sich nach rechts und leuchtete mit der Taschenlampe in ihr ehemaliges Zimmer. Wie immer, wenn sie die rosa Tapeten sah, die jetzt voller Stockflecken waren und in Fetzen von der Wand hingen, ging ihr ein wehmütiger Stich durchs Herz. In der Matratze ihres alten Bettes hatte sich eine ganze Familie von Packratten eingenistet, und der Notenständer, vor dem sie so oft Oboe gespielt hatte, lag verbogen und rostig auf den gesprungenen Dielenbrettern. Als eine Fledermaus über ihren Kopf hinwegflatterte, fiel Nora ein, wie ihre Mutter sie einmal bei dem Versuch erwischt hatte, eines dieser Tiere zu zähmen. Noras Mutter hatte nie begreifen können, was ihre Tochter an Fledermäusen so faszinierend fand.
Von ihrem Zimmer ging sie hinüber zu dem ihres Bruders, das ebenfalls ein einziges Chaos war. Sieht eigentlich auch nicht viel anders aus als seine jetzige Wohnung, dachte sie. Durch den Moder glaubte sie den schwachen Duft von Blumen riechen zu können. Seltsam, die Fenster hier oben sind doch alle noch dicht, schoss es Nora durch den Kopf, während sie wieder hinaus und über den Gang zum Schlafzimmer ihrer Eltern ging.
Und jetzt hörte sie auf einmal ganz deutlich aus dem Parterre das leise Klirren von Glassplittern. Abrupt blieb Nora stehen. War das eine Ratte, die über den Boden im Wohnzimmer huschte?
Vorsichtig schlich Nora zurück zur Treppe und vernahm ein weiteres Geräusch, ein schwaches Klopfen. Während sie bewegungslos dastand und lauschte, drang ein weiteres, schärfer klingendes Knirschen herauf. Es klang, als ob eine Glasscherbe zertreten würde.
Nora atmete langsam aus und spürte, wie sich ihre Brustmuskeln zusammenkrampften. Diesmal schien ihr Besuch in ihrem alten Elternhaus, der anfänglich wie eine weitere, harmlose Routinekontrolle ausgesehen hatte, eine gänzlich andere Qualität anzunehmen. »Wer ist da?«, rief Nora nach unten.
Keine Antwort. Nur das Geräusch des Windes draußen vor dem Haus.
Nora leuchtete mit der Taschenlampe die Treppe hinunter. Die Jugendlichen, die sich sonst in dem Haus herumtrieben, nahmen normalerweise reißaus, sobald sie Noras Pick-up sahen; diesmal aber offenbar nicht.
»Sie befinden sich in einem Privathaus!«, rief sie mit so fester Stimme wie möglich. »Was Sie hier machen, ist Hausfriedensbruch. Die Polizei ist schon verständigt!«
Unten war es still. Bis auf das Geräusch von leisen Schritten, die sich langsam der Treppe näherten.
»Teresa?«, rief Nora in der verzweifelten Hoffnung, es wäre vielleicht ihre Nachbarin.
Und dann hörte sie noch etwas anderes: ein kehliges, bedrohliches Geräusch, das fast wie ein Knurren klang.
Ein Hund, dachte Nora mit einem Gefühl der Erleichterung. Draußen auf der Farm gab es nämlich viele wilde Hunde, die manchmal im Haus herumstöberten. Nora wollte lieber gar nicht erst darüber nachdenken, warum sie diese Erkenntnis als so tröstlich empfand.
»Hey!«, schrie sie und schwenkte die Taschenlampe. »Raus hier! Hau ab!«
Abermals vernahm sie als Antwort nichts als Schweigen.
Nora wusste, wie man mit streunenden Hunden umging. Absichtlich laut polternd stieg sie die Treppe hinab und redete dabei deutlich vernehmbar vor sich hin. Unten angelangt ließ sie den Strahl der Taschenlampe durchs Wohnzimmer schweifen. Es war leer. Der Hund musste sich aus dem Staub gemacht haben, als er sie hatte kommen hören.
Nora atmete tief durch. Obwohl sie eigentlich noch das Schlafzimmer ihrer Eltern hätte in Augenschein nehmen müssen, fand sie es an der Zeit, das Haus zu verlassen.
Als sie schon auf dem Weg zur Tür war, hörte sie hinter sich einen weiteren vorsichtigen Schritt, dem quälend langsam ein zweiter folgte.
Nora wirbelte herum und leuchtete in die Richtung, aus der die Geräusche gekommen waren. Nun vernahm sie ein leises, pfeifendes Keuchen, gepaart mit einem monotonen Schnurren, und der Geruch nach duftenden Blumen, den sie im oberen Stockwerk schon einmal wahrgenommen hatte, drang, stärker als zuvor, an ihre Nase.
Nora war wie gelähmt von einem ihr gänzlich ungewohnten Gefühl der Bedrohung. Sie fragte sich, ob sie die Taschenlampe ausknipsen und sich verstecken oder einfach aus dem Haus fliehen sollte.
Und dann sah sie gerade noch aus dem Augenwinkel, wie ein großes, behaartes Etwas an der Wand entlang auf sie zurannte. Als sie es anleuchten wollte, wurde sie auch schon von einem heftigen Schlag auf den Rücken zu Boden gestreckt.
Auf dem Bauch liegend spürte Nora, wie eine raue, behaarte Tatze sie am Nacken packte, und hörte ein wildes, geiferndes Knurren, das sie an einen tollwütigen Hund erinnerte. Nora verpasste der Kreatur einen Tritt, so dass sie aufjaulte und ihren Griff lockerte. Nora nutzte die Gelegenheit und strampelte sich frei. Kaum hatte sie sich aber hochgerappelt, da wurde sie auch schon von einer zweiten Kreatur angesprungen und abermals zu Boden gerissen. Dabei fiel die Kreatur auf sie, und als Nora versuchte, sich zu befreien, spürte sie, wie sich ihr Glassplitter schmerzhaft in den Rücken bohrten. Das Wesen drückte sie mit seinem ganzen Gewicht nach unten. Nora sah Haare und Krallen, einen nackten Bauch, auf den leuchtende, an einen Jaguar erinnernde Flecken gemalt waren, und darunter einen Gürtel mit silbernen Conchas. Kleine, stark gerötete Augen starrten sie durch die Schlitze einer speckigen Ledermaske an.
»Wo ist der Brief?«, fragte eine raue Stimme. Nora roch den süßlichen Gestank von verrottendem Fleisch.
Nora brachte keinen Ton heraus.
»Wo ist er?«, wiederholte die Stimme kehlig und stockend wie ein Tier, das die menschliche Sprache nachahmt. Die Klauen schlossen sich wie Schraubstöcke um ihren Hals und ihren rechten Arm.
»Was für ein Brief?«, brachte Nora schließlich krächzend hervor.
»Sag schon, oder wir reißen dir den Kopf ab«, keuchte die Kreatur und verstärkte ihren Griff. Von einer plötzlichen Panik ergriffen, versuchte Nora sich loszustrampeln, aber die Klaue um ihren Hals drückte weiter unerbittlich zu. Nora würgte vor Schmerz und Angst.
Dann zuckte auf einmal ein greller Blitz durch das Wohnzimmer, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall. Nora spürte, wie sich die Klaue um ihren Hals lockerte, und befreite sich mit wilden Kopfbewegungen vollends aus ihrem Griff. Als sie sich zur Seite rollte, erschütterte ein zweiter Schuss den Raum, und ein Schauer aus Holzsplittern und Verputz regnete auf sie herab. Nora rappelte sich hoch und hörte, wie Glasscherben über den Fußboden klirrten. Ohne ihre Taschenlampe, die bei dem Sturz ausgegangen war, hatte sie Schwierigkeiten, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.
»Nora?«, hörte sie eine Stimme rufen. »Nora, bist du das?« Im Rahmen der Eingangstür konnte sie eine dickliche Gestalt erkennen, die eine Schrotflinte in der Hand hielt.
»Teresa!«, rief Nora schluchzend und taumelte ins Licht.
»Alles in Ordnung?«, fragte Teresa und nahm Nora am Arm.
»Ich weiß nicht.«
»Machen wir, dass wir hier rauskommen!«
Draußen ließ Nora sich ins Gras sinken und sog die kühle Luft des Abends tief in ihre Lungen. Das Herz klopfte ihr bis in den Hals. »Was ist denn passiert?«, hörte sie Teresa fragen. »Ich habe irgendwelche scharrenden Geräusche gehört und ein Licht gesehen.«
Nora schüttelte bloß den Kopf und rang nach Atem.
»Diese wilden Hunde sahen ja Furcht erregend aus«, fuhr Teresa fort, »fast so groß wie Wölfe.«
Nora schüttelte abermals den Kopf. »Nein. Das waren keine Hunde. Einer von ihnen hat mit mir gesprochen.«
Teresa musterte sie mit einem seltsamen Blick. »Sieht aus, als hätten sie dich in den Arm gebissen. Ich sollte dich besser ins Krankenhaus fahren.«
»Kommt nicht in Frage.«
Teresa runzelte die Stirn und betrachtete die dunklen Umrisse des Hauses. »Die hatten es ganz schön eilig, von hier zu verschwinden. Zuerst die Jugendlichen, und jetzt diese Viecher. Aber wie können Hunde so schnell …«
»Teresa, einer von ihnen hat mit mir gesprochen!«
Teresa sah sie noch skeptischer an als zuvor. »Das muss ein schlimmer Schock für dich gewesen sein«, meinte sie schließlich. »Du hättest mir sagen sollen, dass du herauskommst, dann hätten Señor Winchester und ich dich an der Straße in Empfang genommen.« Sie streichelte liebevoll den Lauf ihrer Waffe.
Nora blickte der massiv gebauten Frau in ihr zwar etwas mitgenommen, aber immer noch zuversichtlich wirkendes Gesicht. Sie wusste, dass Teresa ihr nicht glaubte, aber ihr fehlte die Kraft, um sie zu überzeugen. »Nächstes Mal sage ich dir vorher Bescheid«, versprach sie.
»Hoffentlich gibt es kein nächstes Mal«, meinte Teresa sanft. »Du musst dieses Haus entweder abreißen lassen oder es verkaufen, damit jemand anders das tun kann. Diese Ranch entwickelt sich langsam zu einem Problem für uns alle.«
»Ich weiß, dass sie kein schöner Anblick ist. Aber ich hasse den Gedanken, sie aufzugeben. Tut mir Leid, wenn sie dir Probleme macht.«
»Na ja, vielleicht bringt dich dieses Erlebnis ja zur Vernunft. Warum kommst du nicht mit rüber und isst einen Happen mit mir?«
»Nein, danke, Teresa«, sagte Nora so bestimmt, wie sie nur konnte. »Mit mir ist schon wieder alles in Ordnung.«
»Na hoffentlich«, entgegnete die Nachbarin. »Aber an deiner Stelle würde ich mir trotzdem eine Tetanusspritze geben lassen.«
Nora sah ihrer Nachbarin noch eine Weile nach, wie sie hinüber zu ihrem Haus ging. Dann setzte sie sich ans Steuer ihres Pick-ups und verriegelte mit zitternden Händen beide Türen. Still saß sie da und spürte, wie sich ihre Brust hob und senkte. Teresa verschwand langsam in der Dunkelheit. Als sie glaubte, wieder volle Kontrolle über alle ihre Glieder zu haben, griff sie nach dem Zündschlüssel. Ein stechender Schmerz fuhr ihr durch den Nacken.
Sie drehte den Schlüssel, aber der Motor wollte nicht anspringen. Nora fluchte. Ihr Wagen musste, wie fast alles in ihrem Leben, dringend erneuert werden.
Nora schaltete die Scheinwerfer aus, um die Batterie zu entlasten, und probierte es noch einmal. Diesmal gelang es dem Anlasser, den Motor nach ein paar leeren Umdrehungen zu asthmatisch keuchendem Leben zu erwecken. Nora ließ sich erleichtert zurück in den Fahrersitz sinken und trat ein paar Mal aufs Gas, bis der Motor endlich rund lief.
Auf einmal sah sie links vom Wagen etwas aufblitzen. Eine große, pelzige Gestalt sprang aus der Dunkelheit auf sie zu.
Nora legte den Gang ein, schaltete die Scheinwerfer an und trat aufs Gas. Der alte Pick-up setzte sich ruckartig in Bewegung und fuhr mit durchdrehenden Rädern aus dem Hof. Als Nora das innere Tor passierte, entdeckte sie zu ihrem Entsetzen, dass die Gestalt neben ihr her rannte.
Nora drückte das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Der Wagen schleuderte, dichte Staubwolken aufwirbelnd, hinaus auf die Straße. Obwohl Nora das pelzige Wesen nicht mehr sehen konnte, beschleunigte sie weiter. In Schlangenlinien raste der Wagen über die ausgefahrene Piste, legte einen Feigenkaktus flach und schoss beängstigend schnell auf das äußere Tor zu. Im nächsten Moment tauchten das Viehgitter und das Brett mit den alten Briefkästen im Licht der Scheinwerfer auf. Zu spät trat Nora auf die Bremse. Der Pick-up schoss üner die Rampe vor dem Viehgitter und landete nach einem kurzen Luftsprung im Sand. Nora hörte das Splittern von Holz und sah, wie das Brett mit den Briefkästen zur Seite geschleudert wurde.
Schwer atmend saß Nora hinter dem Steuer und starrte auf den durch die Scheinwerferkegel wirbelnden Staub. Als sie den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab, drehten zu ihrem Entsetzen die Räder im weichen Sand durch. Bei einem weiteren verzweifelten Versuch, sich zu befreien, würgte sie den Motor ab.
Im Licht der Scheinwerfer besah sich Nora den Schaden, den sie angerichtet hatte. Die alten, an ein langes Brett genagelten Briefkästen, die schon immer eine ziemlich wackelige Angelegenheit gewesen waren, lagen über mehrere Meter verstreut im Sand. Zum Glück waren sie schon vor einiger Zeit durch eine neuere Metallkonstruktion ersetzt worden, die Nora ganz in der Nähe schimmern sah. Da sie nicht mehr zurückkonnte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten. Dazu musste sie aber das Brett, an dem die ausgedienten Briefkästen befestigt gewesen waren, aus dem Weg räumen.
Nora sprang aus dem Wagen und schaute sich ängstlich nach der haarigen Gestalt um, die sich aber nirgends blicken ließ. Dann packte sie das verrottete Brett und zerrte es zur Seite. Als sie wieder einsteigen wollte, sah sie einen Briefumschlag direkt vor dem Wagen liegen. Sie hob ihn auf, las im Licht der Scheinwerfer die Adresse und erschrak.
Rasch stopfte sie den Brief in die Brusttasche ihres Hemdes, sprang in den Wagen und ließ den Motor an. Am ganzen Körper zitternd fuhr sie zurück auf die Straße, gab Gas und nahm Kurs auf die ferne, aber unglaublich einladend wirkende Stadt.
2
Das Santa Fe Archaeological Institute befand sich auf einer niedrigen Mesa zwischen den Sangre-de-Cristo-Hügeln und der Stadt Santa Fe. Das Institut besaß kein der Öffentlichkeit zugängliches Museum, und die angebotenen Lehrveranstaltungen beschränkten sich auf Oberseminare, an denen man nur auf Einladung des jeweiligen Dozenten teilnehmen konnte, sowie spezielle Kolloquien, so dass die Anzahl der hier forschenden Professoren und Gastwissenschaftler die der Studenten bei weitem überstieg. Der Campus des Instituts erstreckte sich über zwölf Hektar. Seine geduckten Lehmziegelgebäude verschwanden fast zwischen den üppigen Gärten mit ihren Aprikosenbäumen, Tulpenbeeten und alten, prächtig blühenden Fliederbüschen.
Zum Institut, das sich neben der Forschung auf die Ausgrabung und Konservierung archäologischer Stätten spezialisiert hatte, gehörte eine der weltbesten Sammlungen zur indianischen Vor- und Frühgeschichte des amerikanischen Südwestens. Es war eine wohlhabende, zurückhaltende und den Traditionen verpflichtete Forschungseinrichtung, die von den Archäologen des Landes ebenso geachtet wie beneidet wurde.
Nora sah zu, wie die letzten ihrer Studenten den niedrigen Saal verließen, und steckte ihre Unterlagen in eine große Aktentasche aus Leder. Es war die letzte Vorlesung mit dem Titel »Gründe und Voraussetzungen für die Aufgabe von Chaco Cañon« gewesen, und wieder einmal hatte Nora sich darüber gewundert, wie ruhig und respektvoll die Studenten ihr zugehört hatten. Manchmal kam es ihr vor, als könnten die meisten von ihnen ihr Glück, einen zehnwöchigen Studienaufenthalt am Institut absolvieren zu dürfen, noch immer nicht fassen.
Sie trat aus dem kühlen Halbdunkel des im Pueblo-Stil erbauten Hauses hinaus ins Sonnenlicht und ging langsam den Kiesweg entlang. Die Sonne des frühen Vormittags tauchte die Institutsgebäude mit ihren organisch anmutenden, ein wenig schief stehenden Wänden und daraus hervorragenden Balken in ein warmes, rötliches Licht. Über den Bergen ballte sich eine Gewitterfront mit unten dunklen und oben schneeweißen Wolkentürmen zusammen. Als Nora hinaufsah, schoss ihr ein stechender Schmerz durch ihren lädierten Nacken, der noch immer nicht in Ordnung war. Sie massierte sich die schmerzende Stelle und beobachtete, wie sich die Wolken langsam vor die Sonne schoben.
Nora ging am Parkplatz vorbei in den hinteren Teil des Campus, wo sie einem kopfsteingepflasterten, von Pyramidenpappeln und alten chinesischen Ulmen gesäumten Fußweg bis zu einem unauffälligen Gebäude folgte, an dem ein kleines Schild mit der einfachen Aufschrift Archiv hing.
Nora zeigte dem Wachmann am Eingang ihren Ausweis, trug sich in ein Besucherbuch ein und betrat das Gebäude. Sie schritt einen kurzen Gang entlang und blieb dann vor der Treppe stehen, die hinunter in den Keller mit den Karten führte.
Beim Anblick der dunklen Stufen zuckte sie zusammen, weil sie an die Vorfälle des vergangenen Abends denken musste: an die Glasscherben, die sich ihr in die Haut gebohrt hatten, den schraubstockartigen Griff der pelzigen Klauen, den ekelhaft süßlichen Geruch …
Nora schob die Erinnerungen beherzt beiseite und stieg die schmale Treppe hinab.
Die Sammlungen des Museums umfassten viele unbezahlbare Artefakte, aber nichts auf dem gesamten Campus war so wertvoll und wurde so gut bewacht wie der Inhalt des Kartenkellers. Obwohl die Landkarten, die hier aufbewahrt wurden, keinen materiellen Wert an sich darstellten, waren sie dennoch unersetzlich, denn sie enthielten die exakten geografischen Angaben einer jeden prähistorischen Fundstätte im Südwesten Amerikas. An manchen dieser mehr als dreitausend Stellen befanden sich lediglich ein paar alte Steine, an anderen jedoch riesige Ruinenstädte mit hunderten von Räumen, aber sie alle waren haargenau auf den topografischen Karten des Instituts eingezeichnet. Nora wusste, dass nur ein Bruchteil dieser Fundstätten schon ausgegraben war; der Rest schlummerte noch immer im Wüstensand oder in verborgenen Höhlen. Jede Nummer auf den Karten entsprach einem Eintrag in der mehrfach gesicherten Datenbank des Instituts, die alles von detaillierten Inventarverzeichnissen über Lagepläne bis hin zu eingescannten Skizzen und Briefen enthielt. Mit diesen Informationen stellte sie eine elektronische Schatzkammer dar, die den Zugang zu prähistorischen Kunstgegenständen im Wert von vielen Millionen Dollar ermöglichte.
Nora hatte es immer ziemlich seltsam gefunden, dass der Kartenkeller ausgerechnet von Owen Smalls bewacht wurde. Owen, ein muskulöser Mann, der meistens abgeschabte Lederhosen trug, wirkte immer so, als wäre er gerade von einer anstrengenden Expedition in eines der entlegensten Gebiete der Erde zurückgekehrt. Nur wer ihn genauer kannte, wusste, dass Owen von der Ostküste kam und an der Brown University mit summa cum laude seinen Doktor gemacht hatte. Er wäre, hätte man ihn irgendwo in der Wüste ausgesetzt, binnen einer Stunde heillos in die Irre gelaufen, wenn nicht sogar umgekommen.
Die Treppe endete an einer Metalltür, neben der ein kleiner Chipkartenleser in die Wand eingelassen war. An dem Gerät brannte ein rotes Licht. Nora holte ihren Institutsausweis aus der Aktentasche und steckte ihn in den Leser. Als das grüne Lämpchen aufleuchtete, drückte sie die Tür auf und trat ein.
Smalls residierte in einem kleinen, stets peinlich aufgeräumten Büro vor dem eigentlichen Kartenkeller. Als er Nora erblickte, stand er auf und legte das Buch, in dem er gerade gelesen hatte, sorgfältig auf dem Schreibtisch.
»Hallo, Dr. Kelly«, sagte er. »Nora, wenn ich mich nicht irre?«
»Guten Morgen«, grüßte Nora so beiläufig wie möglich.
»Sie waren schon eine ganze Weile nicht mehr bei mir hier unten«, bemerkte Smalls. »Schade. Hey, was ist denn mit Ihrem Arm passiert?«
»Ach, das ist nur ein Kratzer, Owen. Ich würde gern einen Blick auf ein paar Karten werfen.«
Smalls blinzelte sie fragend an. »Und auf welche?«
»Auf die Quadranten C-3 und C-4 in Utah. Das Kaiparowits-Plateau.«
Smalls musterte sie weiter, wobei er mit einem lauten Knarzen seiner Lederhose sein Gewicht von einem Bein aufs andere verlagerte. »Projektnummer?«
»Dafür haben wir noch keine Projektnummer. Es handelt sich um eine Art Voruntersuchung.«
Smalls stützte sich mit seinen großen, behaarten Händen auf die Schreibtischplatte und beugte seinen Oberkörper vor. »Tut mir Leid, Dr. Kelly«, sagte er und sah Nora direkt in die Augen. »Ohne Projektnummer kann ich Ihnen leider keine Einsicht in die Karten gewähren.«
»Auch nicht für eine Voruntersuchung?«
»Sie kennen die Regeln genauso gut wie ich«, erwiderte Smalls mit einem geringschätzigen Grinsen.
Nora dachte fieberhaft nach. Es war völlig ausgeschlossen, dass Dr. Blakewood, der als Direktor des Instituts ihr direkter Vorgesetzter war, ihr auf Grund ihrer mageren Informationen eine Projektnummer zuteilen würde. Aber dann erinnerte sich Nora, dass sie vor zwei Jahren in einer anderen Gegend in Utah an einem ähnlichen Projekt gearbeitet hatte, das, obwohl sie schon seit längerem nichts mehr dafür getan hatte, offiziell noch immer nicht abgeschlossen war. Es zählte zu Noras schlechten Angewohnheiten, manche Dinge nicht zu Ende zu bringen. Wie war bloß die Nummer dieses Projekts gewesen?
»Gerade fällt es mir wieder ein«, sagte sie. »Die Nummer ist J-40012.«
Smalls zog erstaunt seine buschigen Augenbrauen in die Höhe.
»Tut mir Leid, ich hatte völlig vergessen, dass die Nummer bereits zugeteilt wurde. Wenn Sie mir nicht glauben, dann rufen Sie doch Professor Blakewood an«, ergänzte Nora, die genau wusste, dass ihr Chef gerade auf einer Konferenz in Window Rock war.
Smalls ging zu dem Computer auf seinem Schreibtisch und tippte etwas auf der Tastatur ein. Kurze Zeit später blickte er wieder zu Nora auf. »Die Nummer scheint in Ordnung zu sein. C-3 und C-4 haben Sie gesagt?« Er drückte weiter auf einige Tasten, die unter seinen dicken Fingern lächerlich klein wirkten. Schließlich löschte er den Bildschirm und trat einen Schritt vom Schreibtisch zurück. »Warten Sie hier«, sagte er, während er zur Tür zum Kartenkeller ging.
»Ich weiß schon Bescheid«, erklärte Nora und blickte ihm in den von Neonröhren grell erleuchteten Kellerraum hinterher, in dem in zwei Reihen viele große Metall-Safes standen. An einem von ihnen gab Smalls einen Code auf dem Ziffernblock ein und öffnete die Tür. In dem Safe hingen zahlreiche mit Plastikhüllen geschützte Landkarten.
»Zu diesen Quadranten gehören sechzehn Karten«, rief Smalls über die Schulter. »Welche davon wollen Sie haben?«
»Alle, bitte.«
Smalls hielt inne. »Alle sechzehn! Das sind achthundertachtzig Quadratmeilen!«
»Wie gesagt, es handelt sich um eine grobe Voruntersuchung. Sie können ja Direktor Blakewood anrufen und …«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Smalls und kam mit den Karten, die er an ihren mit Metallstäben versehenen Kanten hielt, aus dem Keller zurück. Er nickte in Richtung auf den Leseraum und wartete, bis Nora Platz genommen hatte. Dann legte er die Karten vorsichtig auf der zerkratzten Resopalplatte des Tisches vor ihr ab. »Nehmen Sie sich ein Paar von denen«, sagte er und deutete auf eine Schachtel mit Einmalhandschuhen aus Baumwolle. »Sie haben zwei Stunden zur Verfügung. Wenn Sie fertig sind, geben Sie mir Bescheid, damit ich die Karten wieder wegräumen und Sie hinauslassen kann.« Smalls wartete, bis Nora sich ein Paar Handschuhe übergestreift hatte, und begab sich dann lächelnd zurück in den Kartenkeller.
Nora sah zu, wie er den Safe wieder verschloss und in sein Büro ging. Du wirst es schon mitbekommen, wenn ich fertig bin, dachte sie. In dem Leseraum befand sich nur dieser einzige, mit einem Stuhl versehene Tisch, der direkt im Blickfeld von Smalls’ Schreibtisch stand. Es war ein enger Arbeitsplatz, an dem man sich zudem wie auf dem Präsentierteller vorkam. Alles andere als ideal für das, was Nora vorhatte.
Sie atmete tief durch, streckte ihre weiß behandschuhten Finger und legte die Karten in ihren knisternden Plastikhüllen übereinander auf den Tisch. Das U. S. Geological Survey gab diese überaus exakten Karten heraus; sie zeigten ein sehr abgelegenes Gebiet im Südteil des Staates Utah. Das Land, das im Süden und Westen vom Lake Powell und im Osten vom Bryce Cañon begrenzt wurde, befand sich fast ausschließlich in Bundesbesitz und bestand praktisch aus nichts anderem als Wildnis, mit der niemand etwas anfangen konnte. Nora wusste ziemlich genau, wie dieses Land in der Realität aussah: eine riesige Hochebene aus glatt geschliffenem Sandstein, die unzählige, tief eingeschnittene Cañons zu einem Labyrinth aus steilwandigen Tälern und kahlen Plateaus machten.
In diesem gottverlassenen Dreieck war vor sechzehn Jahren Noras Vater verschwunden.
Sie erinnerte sich mit schmerzlicher Intensität daran, wie sie damals als Zwölfjährige flehentlich darum gebeten hatte, sie doch auf die Suchexpedition mitzunehmen, was ihr ihre Mutter jedoch brüsk und ungerührt verboten hatte. Stattdessen hatte sie zwei qualvolle Wochen verbringen müssen, in denen sie über Landkarten gebrütet und immer wieder die Radionachrichten auf Neuigkeiten über ihren Vater hin abgehört hatte. Die Karten waren denen ganz ähnlich gewesen, die sie gerade vor sich hatte. Von ihrem Vater hatte man nicht die geringste Spur finden können. Nach einiger Zeit hatte ihre Mutter ihn für tot erklären lassen, und Nora hatte sich seither nie wieder eine Landkarte dieser Gegend angeschaut.
Nora holte ein weiteres Mal tief Luft und drehte sich so, dass sich ihr Rücken zwischen den Karten und Owen Smalls befand. Jetzt kam der schwierigste Teil ihres Unterfangens. Sie griff mit zwei Fingern vorsichtig in ihre Jackentasche und holte den Brief heraus, den sie in den albtraumhaften Abendstunden des vergangenen Tages gefunden und seitdem ständig bei sich getragen hatte.
Abermals las Nora die mit Bleistift geschriebenen Zeilen auf dem brüchig gewordenen Umschlag, wie sie es schon vor einigen Stunden im Scheinwerferlicht ihres Pick-up getan hatte. Der Brief war an ihre Mutter adressiert, die vor sechs Monaten gestorben war und seit fünf Jahren nicht mehr auf der alten Ranch gewohnt hatte. Langsam, fast widerwillig, ließ sie die Blicke auf den Absender wandern. Padraic Kelly stand da in der großzügigen, geschwungenen Handschrift, die ihr so vertraut war. Irgendwo westlich vom Kaiparowits-Plateau.
Es war ein Brief von ihrem Vater an ihre Mutter, der vor sechzehn Jahren geschrieben und mit einer Briefmarke versehen worden war.
Langsam und vorsichtig zog Nora im Schein der Neonröhren die drei vergilbten Blätter aus dem Umschlag. Sie strich sie neben den Karten glatt und achtete dabei darauf, dass ihr Körper sie vor Smalls’ Blicken verbarg. Noch einmal besah sie sich den roten Aufkleber Nachporto und dann das Merkwürdigste an dem ganzen Brief: den Poststempel, aus dem hervorging, dass das Schreiben erst vor fünf Wochen in Escalante, Utah, abgeschickt worden war.
Mit den Fingern strich sie über das fleckige Papier mit der verblichenen Zehn-Cent-Briefmarke. Der Umschlag wirkte, als wäre er nass gewesen und später wieder getrocknet worden. Vielleicht hatte jemand ihn im Wasser des Lake Powell gefunden, in den ihn eine der Sturzfluten geschwemmt hatte, für welche die Cañons in dieser Gegend gefürchtet waren.
Bestimmt zum hundertsten Mal, seit sie den Brief gefunden hatte, musste Nora einen Anflug von Hoffnung unterdrücken. Schließlich war es vollkommen ausgeschlossen, dass ihr Vater noch am Leben war. Irgendein anderer Mensch musste den Brief gefunden und ihn in einen Briefkasten gesteckt haben.
Aber wer? Und weshalb?
Und noch eine weitere Frage drängte sich ihr auf. War es dieser Brief gewesen, wonach diese entsetzlichen Kreaturen gestern Abend in dem verlassenen Ranchhaus gesucht hatten?
Nora schluckte und spürte, dass ihr Hals trocken war und schmerzte. Es musste so sein, es war die einzige vernünftige Erklärung.
Ein Knarzen drang durch den stillen Raum, als Owen Smalls sich in seinem Stuhl bewegte. Nora zuckte zusammen und versteckte den Umschlag unter einer der Karten. Dann wandte sie sich dem Brief zu und begann zu lesen.
Donnerstag, den 2. August (glaube ich zumindest) 1983
Liebste Liz,
obwohl ich hier hundert Meilen vom nächsten Postamt entfernt bin, kann ich nicht mehr länger warten – ich muss dir einfach schreiben. Ich werde diesen Brief sofort aufgeben, sobald ich wieder in die Zivilisation zurückgekehrt bin. Oder – was noch besser wäre – ich überbringe ihn dir persönlich – zusammen mit vielen anderen guten Nachrichten.
Ich weiß, dass du mich für einen schlechten Ehemann und Vater hältst, und vielleicht hast du damit sogar Recht. Aber bitte, bitte, bitte, lies diesen Brief bis zum Ende durch. Ich weiß auch, dass ich dir schon viel zu oft gesagt habe, dass sich alles ändern wird, aber diesmal verspreche ich es dir. Wir beide werden wieder zusammenkommen, und Nora und Skip werden wieder einen Vater haben. Und wir werden reich sein. Das weiß ich. Diesmal klappt es wirklich, mein geliebter Engel, denn ich stehe kurz davor, die vergessene Stadt Quivira zu betreten.
Erinnerst du dich noch an Noras Schulaufsatz über Coronado und seine Suche nach Quivira, der sagenhaften goldenen Stadt? Ich habe ihr damals bei den Recherchen geholfen und dazu die Legenden einiger Stämme von Pueblo-Indianern studiert. Und dabei bin ich ins Grübeln gekommen. Was wäre eigentlich, dachte ich, wenn all die Geschichten, die Coronado gehört hatte, tatsächlich der Wahrheit entsprächen? Bei Homers Troja war es doch auch so. Die Archäologie kennt viele solcher Legenden, die sich später als harte Tatsachen erwiesen haben. Möglicherweise, so dachte ich, gab es ja wirklich eine Stadt irgendwo da draußen, die voller Gold und Silber war und noch immer auf ihre Entdeckung wartete. Also habe ich in diese Richtung weitergeforscht und bin auf einige interessante Dokumente gestoßen, die mir einen unerwarteten Hinweis gaben. Und so bin ich hierher gekommen.
Natürlich habe ich nicht erwartet, dass ich hier draußen etwas finden würde. Schließlich bin ich, wie niemand so gut weiß wie du, ein unverbesserlicher Träumer. Aber diesmal war das anders, Liz. Diesmal habe ich etwas gefunden!
Noras Augen wanderten hinüber auf die zweite, die entscheidende Seite. Hier wurde die Handschrift immer unleserlicher, so, als wäre ihr Vater vor lauter Aufregung außer Atem geraten und habe kaum mehr genügend Zeit gehabt, um die Worte aufs Papier zu kritzeln.
Ich ritt von Old Paria nach Osten und kam zum Hardscrabble Wash, einem vertrockneten Flussbett, dem ich weiter folgte, vorbei an Ramey’s Hole. Danach weiß ich nicht mehr, welchen Cañon ich wählte, denn ich vertraute einfach meiner Intuition. Ich glaube aber, dass es der Muleshoe Cañon war. Dort fand ich die kaum mehr erkennbaren Überreste einer alten Anasazi-Straße und folgte ihnen. Es war nicht einfach, denn die Spuren waren nur schwach, schwächer noch als die der Straßen zum Chaco Cañon.
Nora blickte auf die Karten, die vor ihr lagen. Nachdem sie Old Paria am gleichnamigen Fluss gefunden hatte, wandte sie ihre Aufmerksamkeit den in der Nähe gelegenen Cañons zu. Es gab dort dutzende von ausgetrockneten Flussbetten und kleinen Tälern, von denen die meisten keinen Namen hatten. Als sie nach einer Weile das Hardscrabble Wash fand, bekam sie starkes Herzklopfen. Es war ein kurzes Flussbett, das in den Scoop Cañon mündete. In der Nähe fand sie auch Ramey’s Hole, eine große, kreisrunde Senke, die von einer Biegung des Flussbettes durchschnitten wurde.
Die Straße führte nach Nordosten und verwandelte sich, nachdem sie – wo genau, weiß ich nicht mehr – den Muleshoe Cañon verlassen hatte, in einen schmalen, aus dem Sandstein gehauenen Pfad. Diesem folgte ich durch drei weitere Cañons, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Ich wünschte, ich hätte mir den Weg besser gemerkt, aber ich war so aufgeregt, und außerdem wurde es schon spät.
Nora fuhr mit dem Finger auf der Landkarte den Muleshoe Cañon nordöstlich von Ramey’s Hole entlang. Wo hatte der Pfad den Cañon verlassen? Auf gut Glück wählte sie einen Seiten-Cañon aus und zählte von diesem aus drei Täler weiter, was sie schließlich zu einem namenlosen, tief eingeschnittenen Cañon brachte.
Den ganzen nächsten Tag zog ich den dritten Cañon hinauf, der nach Nordwesten verlief. Manchmal verlor ich den Pfad, fand ihn aber wieder. Es war ein schwieriges Vorwärtskommen. Dann verschwand der Pfad durch eine Art Durchbruch hindurch in den nächsten Cañon, und hier, liebste Liz, habe ich dann vollständig die Orientierung verloren.
Noras Atem ging schneller, als sie mit dem Finger den namenlosen Cañon quer über die Ecke des nächsten Kartenblattes auf das übernächste verfolgte. Jeder Zentimeter, den ihr Finger dabei zurücklegte, bedeutete in Wirklichkeit eine zweieinhalb Kilometer lange Reise durch lebensfeindliches Wüstengebiet. Wie weit wohl ihr Vater an diesem einen Tag gekommen war? Diese Frage konnte sie erst dann beantworten, wenn sie den Cañon mit eigenen Augen sah. Und wo war der Durchbruch, von dem er geschrieben hatte? Noras Finger hielt inmitten eines Gewirrs von Tälern und Schluchten an, das sich über mehr als tausend Quadratkilometer erstreckte. Ein Gefühl der Verzagtheit stieg in ihr auf. Die Hinweise im Brief ihres Vaters waren so vage, dass es praktisch unmöglich war, seinen Weg auf den Karten nachzuvollziehen.
Der Cañon verzweigte sich immer wieder, Gott allein weiß wie oft. Zwei Tage lang folgte ich dem Pfad hinauf in dieses unglaublich abgelegene Cañon-Land. Wenn man selbst unten in der Sohle eines Cañons steht, sieht man keine markanten Punkte mehr, an denen man sich orientieren könnte. Es ist fast so, als befände man sich in einem Tunnel, Liz. Bei all diesen irremachenden Verästelungen und Verzweigungen wusste ich oft nicht mehr, ob ich noch immer dem alten Anasazi-Pfad folgte, der stellenweise kaum mehr zu sehen war. Erst als ich einen Bergrücken erreichte, den ich Devil’s Backbone getauft habe, war ich mir wieder sicher. Dahinter tat sich ein tiefer, schmaler Slot-Cañon auf.
Nora wandte sich der dritten Seite zu.
Liz, ich bin mir sicher, dass ich die Stadt gefunden habe, und ich weiß auch, weshalb ihre Existenz den Archäologen bisher entgangen ist: Die Anasazi haben ihre Stadt äußerst trickreich verborgen. Der Slot-Cañon führte in ein noch tiefer eingeschnittenes, von außen praktisch nicht sichtbares Tal. Und hier gibt es einen alten Klettersteig, der die senkrechte Felswand hinaufführt. Er ist stark verwittert, aber ich habe ihn trotzdem entdeckt. Weil ich ähnliche Steige schon unterhalb der Klippensiedlungen in Mesa Verde und Betatakin gesehen habe, bin ich mir sicher, dass auch dieser zu einem verborgenen Alkoven führt, in dem ich ein großes Pueblo vermute. Am liebsten würde ich gleich hinaufklettern, aber es wird schon dunkel, und der Steig ist sehr steil. Wenn es überhaupt möglich ist, ihn ohne Kletterausrüstung zu erklimmen, dann nur bei Tageslicht. Ich werde es morgen probieren und dann hoffentlich die Stadt erreichen.
Ich habe noch Proviant für einige Tage, und zum Glück gibt es Wasser in diesem Tal. Ich denke, dass ich der erste Mensch sein dürfte, der es seit achthundert Jahren betreten hat.
Alles, was ich hier finden werde, soll dir gehören, Liz. Unsere Scheidung kann rückgängig gemacht werden, und dann wird wieder alles so sein wie früher. Lass uns die Vergangenheit vergessen. Ich will meine Familie, weiter nichts.
Meine wundervolle Liz, ich liebe dich so sehr. Gib Nora und Skip tausend Küsse von mir.
Pat
Das war’s.
Nora schob den Brief vorsichtig zurück in seinen Umschlag. Es dauerte länger, als sie gedacht hatte, weil ihr die Hände dabei zitterten.
Nora lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und spürte, wie verschiedene, einander widerstreitende Gefühle in ihr hochstiegen. Obwohl sie schon immer gewusst hatte, dass ihr Vater eine Art Glücksritter gewesen war, schämte sie sich jetzt, dass er ganz offenbar gewillt gewesen war, eine sensationelle archäologische Fundstätte für seinen eigenen finanziellen Vorteil zu plündern.
Auf der anderen Seite hatte sie ihren Vater nie als geldgierig erlebt. Was ihn fasziniert hatte, war die Jagd nach neuen Entdeckungen gewesen. Die allerdings hatte er fast so sehr geliebt wie sie und ihren Bruder Skip. Ganz gleich, was ihre Mutter alles über ihren Vater gesagt hatte, Nora war sich sicher, dass sie und Skip für ihn die wichtigsten Menschen auf Erden gewesen waren.
Nora ließ den Blick noch einmal über die Karte vor ihr schweifen. In der von ihrem Vater beschriebenen Gegend war weit und breit keine Ruine eingezeichnet. Das bedeutete, dass die Stadt, die ihr Vater glaubte gefunden zu haben, der Wissenschaft noch immer unbekannt war. Die menschliche Ansiedlung, die dem entlegenen Cañon-Gebiet noch am nächsten lag, war ein kleines Indianerdorf namens Nankoweap, das sich am nördlichen Rand des Labyrinths befand. Laut Karte gab es hier keinerlei Straßen, die in dieses Gebiet führten, sondern lediglich ein paar Saumpfade.
Die Archäologin in Nora verspürte eine seltsame Erregung, aber die Aussicht, womöglich die verborgene Stadt Quivira zu entdecken, hatte für sie auch einen ganz persönlichen Aspekt. Vielleicht konnte sie dadurch ja dem Tod ihres Vaters nachträglich einen Sinn geben und sogar herauskriegen, was mit ihm vor sechzehn Jahren geschehen war. Darüber hinaus, gestand sie sich ein wenig schuldbewusst ein, würde das Auffinden der Stadt ihrer eigenen Karriere nicht gerade hinderlich sein.
Nora setzte sich gerade hin. Anhand der Karten allein war es praktisch unmöglich, den Weg ihres Vaters nachzuvollziehen. Wenn sie Quivira finden und das Geheimnis um das Verschwinden ihres Vaters lüften wollte, musste sie sich selbst in das Cañon-Gebiet begeben.
Sie stand auf und ging zu der Glasscheibe, hinter der sich Smalls’ Büro befand. »Ich bin jetzt fertig«, sagte sie. »Vielen Dank.«
Smalls legte sein Buch auf den Schreibtisch und sah sie an. »Gern geschehen«, erwiderte er. »Hey, es ist schon fast Mittag. Wenn ich hier abgeschlossen habe, gehe ich nach oben und genehmige mir einen Burrito. Hätten Sie vielleicht auch Lust auf einen?«
Nora schüttelte den Kopf. »Danke für die Einladung, aber ich muss leider zurück in mein Büro. Ich habe heute Nachmittag noch eine Menge zu tun.«
»Aufgeschoben ist nicht aufgehoben«, sagte Smalls.
»Wer weiß?«, entgegnete Nora und verließ lächelnd den Kartenkeller.
Als sie die dunkle Treppe nach oben stieg, tat ihr der verbundene Arm weh und erinnerte sie an den Vorfall vom vergangenen Abend. Sie wusste, dass sie den Überfall eigentlich der Polizei melden müsste, aber dann dachte sie an die langwierigen Untersuchungen, die eine solche Anzeige nach sich ziehen würde, und verwarf den Gedanken sofort wieder. Nichts, rein gar nichts, sollte sie von dem abhalten, was sie jetzt zu tun hatte.
3
Murray Blakewood, der Direktor des Santa Fe Archaeological Institute, blickte Nora aus ruhigen, kühlen Augen an. Sein Gesicht unter dem struppigen grauen Haarschopf wies den üblichen Ausdruck distanzierter Höflichkeit auf, und seine gefalteten Hände ruhten auf der Schreibtischplatte aus poliertem Rosenholz.
An den Wänden des Direktorenbüros konnte Nora eine ganze Reihe von Artefakten in diskret beleuchteten Glasvitrinen sehen. Direkt hinter Blakewoods Kopf hing eine vergoldete mexikanische Altarretabel aus dem siebzehnten Jahrhundert, und an der gegenüberliegenden Wand fand sich eine alte, im Eyedazzler Muster gewebte Häuptlingsdecke der Navajos – eines von zwei noch existierenden Exemplaren dieser Art von Textilien. Normalerweise konnte Nora sich an diesen Exponaten gar nicht satt sehen, aber heute würdigte sie die Gegenstände kaum eines Blickes.
»Hier sehen Sie das Gebiet«, sagte sie, während sie eine Landkarte aus ihrer Aktentasche nahm und sie vor Blakewood ausbreitete. »Die bereits existierenden Ausgrabungsstätten sind darauf schon eingezeichnet.«
Blakewood nickte, und Nora atmete tief durch. Was sie vorhatte, würde nicht einfach werden.
»Coronados Quivira muss irgendwo in dieser Gegend sein«, sprudelte sie schließlich hervor. »Vermutlich befindet sich die Stadt in den Cañons westlich des Kaiparowits-Plateaus.«
Blakewood lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sagte, nachdem er Nora eine Weile schweigend angesehen hatte, mit einem leicht spöttischen Unterton: »Irgendwie kann ich Ihnen nicht so ganz folgen, Dr. Kelly. Vielleicht wäre es ja besser, wenn Sie mir die Sache von Anfang erklären würden.«
Nora griff in ihre Aktentasche und zog eine Fotokopie hervor. »Ich würde Ihnen gerne eine Stelle aus dem Bericht der Coronado-Expedition vorlesen, der 1540 abgefasst wurde.« Sie räusperte sich und begann:
»Die Cicuye-Indianer brachten dem General einen Sklaven, den sie in einem fernen Land gefangen genommen hatten. Der General befragte den Sklaven mit Hilfe eines Dolmetschers.
Der Sklave erzählte ihm von einer fernen Stadt mit dem Namen Quivira. Sie sei eine heilige Stadt, sagte er, eine Stadt, in der die Regenpriester lebten. Diese seien die Hüter der geschichtlichen Aufzeichnungen seit dem Beginn aller Zeiten. Er erklärte, dass die Stadt so reich sei, dass selbst einfache Trinkkelche, Teller und Schüsseln aus massivem, glänzend poliertem und reich verziertem Gold bestünden. Er nannte das Gold acochis und sagte, dass man in der Stadt jedes andere Material gering schätze.
Der General fragte den Mann, wo diese Stadt denn zu finden sei. Der Sklave erwiderte, dass eine Reise dorthin viele Wochen dauern und durch die tiefsten Schluchten und über die höchsten Berge führen würde. Auf dem Weg gebe es Schlangen, Überschwemmungen, Erdbeben und Sandstürme, und noch nie sei einer zurückgekehrt, der nach der Stadt gesucht habe. Quivira bedeute in der Sprache seines Volkes ›Haus der blutigen Felswände‹.«
Nora steckte das Blatt zurück in ihre Aktentasche. »Anderswo in diesem Bericht ist von ›den Alten‹ die Rede, was ein klarer Hinweis auf die Anasazi-Indianer ist. ›Anasazi‹ bedeutet …«
»Die alten Feinde«, ergänzte Blakewood mit sanfter Stimme.
»Stimmt«, sagte Nora und nickte. »Wie dem auch sei, der Name ›Haus der blutigen Felswände‹ weist meiner Meinung auf ein Pueblo hin, das sich in einem Cañon mit rötlichem Gestein befinden dürfte. Manche Felsen glänzen, wenn sie vom Regen nass sind, nämlich wie Blut.« Nora tippte mit dem Finger auf die Karte. »Und wo könnte sich eine so große Stadt besser verbergen als in diesen Schluchten? Die Gegend ist berüchtigt für ihre plötzlichen Sturzfluten, die nach einem Unwetter ohne jegliche Vorwarnung durch die Cañons rauschen. Darüber hinaus liegt das Gebiet direkt über dem Kaibab-Vulkanfeld und weist daher eine mäßige seismische Aktivität auf. Alle anderen Gebiete in Utah sind archäologisch ziemlich gründlich erforscht worden, nur dieses nicht. Dabei gilt es als eines der Stammesgebiete der Anasazi. Ich bin mir sicher, Dr. Blakewood, die Stadt muss ganz einfach hier liegen. Außerdem habe ich noch eine andere Quelle, die eindeutig darauf hinweist, dass …« Nora hielt inne, als sie sah, dass der Direktor die Stirn runzelte.
»Was für Beweise haben Sie denn für Ihre Theorie?«, fragte er.
»Was ich Ihnen gerade gesagt habe, sind meine Beweise.«
»Verstehe«, sagte Blakewood und seufzte. »Und jetzt wollen Sie, dass das Institut eine Expedition finanziert, mit der Sie diese Gegend erkunden können.«
»Genau. Ich würde auch den Antrag für die Forschungsgelder schreiben.«
»Das hier, Dr. Kelly«, sagte Blakewood und deutete auf die Karte, »ist kein Beweis. Das ist nichts weiter als wilde Spekulation.«
»Aber …«
Blakewood hob die Hand. »Lassen Sie mich bitte ausreden. Das Gebiet, von dem Sie sprechen, ist etwa tausend Quadratmeilen groß. Nehmen wir einmal an, es gäbe dort wirklich eine große Ruine, wie wollen Sie die denn finden?«
Nora zögerte. Wie viel sollte sie Blakewood erzählen? »Ich habe da einen alten Brief«, begann sie, »in dem von einer Anasazi-Straße durch diese Region die Rede ist. Ich denke, dass diese Straße uns zu der Ruine führen wird.«
»Ein Brief?« Blakewood zog die Augenbrauen hoch.
»Ja.«
»Von wem denn? Von einem Archäologen?«
»Das würde ich im Augenblick noch gerne für mich behalten.«
Ein leicht gereizter Ausdruck huschte über Blakewoods Gesicht. »Dr. Kelly – Nora –, ich möchte, dass Sie sich über ein paar praktische Dinge im Klaren sind. Selbst wenn ich Ihren mysteriösen Brief mit in Betracht zöge, lägen mir einfach nicht ausreichend hieb- und stichfeste Fakten vor, um eine Suchexpedition zu bewilligen, geschweige denn den Auftrag zu einer Ausgrabung zu erteilen. Wie Sie selbst gerade gesagt haben, ist die Gegend bekannt für ihre extrem gefährlichen Gewitter und Sturzfluten, ganz abgesehen davon, dass die Cañon-Systeme in der Gegend des Kaiparowits-Plateaus zu den verschlungensten auf dieser Erde zählen.«
Genau richtig also, um eine große Stadt zu verbergen, dachte Nora.
Blakewood musterte sie kurz, dann räusperte er sich. »Nora, ich würde Ihnen gerne als Fachmann einen Rat erteilen.«
Nora schluckte. So hatte sie sich das Gespräch nicht vorgestellt.
»Die Archäologie, die wir heute betreiben, ist nicht mehr dieselbe wie vor hundert Jahren. Wir gehen langsamer und gewissenhafter vor als damals, tragen die kleinsten Details zusammen und analysieren unsere Funde mit größter Sorgfalt.« Er beugte sich über den Schreibtisch in Noras Richtung. »Sie, Nora, scheinen mir eher zu dem Typ Forscher zu gehören, der ständig auf der Suche nach irgendwelchen sagenumwobenen Ruinenstätten ist, die dann am besten auch gleich noch die größten und ältesten sein sollten, die jemals entdeckt wurden. Aber derartige Stätten gibt es nicht mehr, Nora, nicht einmal am Kaiparowits-Plateau. Seit die Wetherills diese Cañons zum ersten Mal betreten haben, haben sich dorthin mindestens ein halbes Dutzend archäologische Expeditionen aufgemacht.«
Nora hörte zu und kämpfte mit ihren eigenen Zweifeln. Sie wusste ja selbst nicht, ob ihr Vater wirklich die verborgene Stadt gefunden hatte. Aber der Ton seines Briefes war so überzeugt, so sicher gewesen, so voll von dem Gefühl eines triumphalen Erfolgs. Und da war noch etwas, das ihr nicht mehr aus dem Kopf ging: Irgendwie mussten die Männer oder Kreaturen oder was auch immer es gewesen sein mochte, das sie in dem alten Ranchhaus angegriffen hatte, von dem Brief ihres Vaters gewusst haben. Und das bedeutete, dass auch sie einen Grund zu der Annahme hatten, dass die Stadt Quivira wirklich existierte. »Es gibt viele noch unentdeckte Ruinen im Südwesten«, hörte sie sich selbst sagen, »die irgendwo unter dem Sand oder in einem Cañon versteckt liegen. Denken Sie bloß an die Stadt Senecú, von der die Spanier berichteten und die bis heute noch nicht lokalisiert werden konnte.«
Eine Weile schwiegen beide, und Blakewood trommelte mit dem Ende eines Bleistifts auf der Tischplatte herum. »Nora, ich würde gerne noch etwas anderes mit Ihnen besprechen«, sagte er schließlich, während sein Gesicht abermals einen gereizten Ausdruck annahm. »Wie lange sind Sie eigentlich schon hier bei uns? Fünf Jahre, nicht wahr?«
»Fünfeinhalb, Dr. Blakewood.«
»Als wir Sie als Assistenzprofessorin einstellten, war Ihnen doch bewusst, was wir hier von Ihnen erwarten, habe ich Recht?«
»Ja.« Nora ahnte, was jetzt kommen würde.
»In sechs Monaten werden wir über eine Verlängerung Ihres Vertrags zu befinden haben. Um ehrlich zu sein: Ich weiß nicht, ob ich der zustimmen kann.«
Nora sagte nichts.
»Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie eine brillante Studentin, weshalb wir Sie auch zu uns geholt haben. Aber dann haben Sie volle drei Jahre gebraucht, um Ihre Dissertation zu schreiben.«
»Aber Dr. Blakewood, erinnern Sie sich denn nicht mehr, wie viel ich mit der Ausgrabung am Río Puerco zu tun hatte und …« Sie hielt inne, als Blakewood abermals die Hand hob.
»Ja, ich weiß. Aber wie alle gehobenen akademischen Einrichtungen stellen wir nun einmal gewisse Ansprüche an unsere Mitarbeiter. Und zu diesen Ansprüchen gehört es, dass sie wissenschaftliche Veröffentlichungen vorlegen. Da Sie gerade auf die Ausgrabung am Río Puerco zu sprechen kommen, darf ich Sie fragen, wo Ihr schriftlicher Bericht darüber bleibt?«
»Nun, gleich danach haben wir doch diese ungewöhnliche verbrannte Hütte am Gallegos Divide gefunden, die …«
»Nora!«, unterbrach sie Blakewood ein wenig ungehalten. »Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren«, sagte er mit ruhigerer Stimme in die Stille hinein, die sich im Büro ausgebreitet hatte, »dass Sie von einem Projekt zum nächsten springen. In den kommenden sechs Monaten werden Sie beide Hände voll zu tun haben, um die Berichte über Ihre zwei letzten großen Ausgrabungsprojekte zu verfassen, da bleibt keine Zeit, um irgendeiner Chimäre hinterherzujagen, die höchstwahrscheinlich nur in der Fantasie irgendwelcher spanischer Konquistadoren existiert hat.«
»Aber es gibt diese Stadt wirklich!«, platzte Nora heraus. »Mein Vater hat sie gefunden!«
Ein ungewohnter Ausdruck ungläubigen Erstaunens machte sich auf Blakewoods sonst so gelassenem Gesicht breit. »Ihr Vater?«, fragte er.
»Ja, mein Vater. Er ist einer alten Anasazi-Straße gefolgt, die ihn tief in das Cañon-Gebiet am Kaiparowits-Plateau hineingeführt hat. An ihrem Ende hat er einen Klettersteig entdeckt, der hinauf zu der Stadt Quivira führt. Diese Reise hat er schriftlich festgehalten.«
Blakewood seufzte. »Jetzt verstehe ich Ihren Enthusiasmus, Nora. Ich möchte keine Kritik an Ihrem Vater üben, aber er war nie besonders …« Der Direktor ließ den Satz unvollendet, aber Nora wusste, dass das fehlende Wort »zuverlässig« gelautet hätte. Sie spürte, wie ihr ein unangenehmes Kribbeln die Wirbelsäule hinauflief. Sei vorsichtig, sagte sie sich, sonst bringst du dich noch um deinen Job. Sie schluckte schwer.
Blakewood senkte die Stimme. »Nora, wissen Sie eigentlich, dass ich Ihren Vater gekannt habe?«
Nora schüttelte den Kopf. Viele Leute hatten ihren Vater gekannt. Schließlich war die Gemeinde der Archäologen in Santa Fe ziemlich klein. Auch wenn Pat Kelly den Wissenschaftlern ab und zu wertvolle Tipps gegeben hatte, war er bei ihnen allerdings nicht allzu beliebt gewesen. Viele von ihnen hatten es nicht sonderlich geschätzt, dass er als Laie diverse Ruinen auf eigene Faust ausgegraben hatte.
»In vielerlei Hinsicht war Ihr Vater ein bemerkenswerter Mann und ein brillanter Kopf. Aber er war auch ein Träumer, der oft das nötige Interesse an den beweisbaren Fakten vermissen ließ.«
»Aber er hat geschrieben, dass er die Stadt gefunden hat …«
»Sie haben vorhin lediglich von einem prähistorischen Klettersteig gesprochen, Nora, aber davon gibt es unzählige in einem Cañon-Gebiet wie diesem. Hat Ihr Vater denn explizit geschrieben, dass er die Stadt entdeckt hat?«
Nora zögerte. »Nein, nicht direkt, aber …«
»Dann habe ich alles gesagt, was ich zu der von Ihnen vorgeschlagenen Expedition – und zu der Verlängerung Ihres Vertrages – zu sagen habe.« Blakewood faltete seine alten Hände, deren blasse Haut vor dem dunklen Holz der Schreibtischplatte fast durchsichtig wirkte. »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«, fragte er mit sanfterer Stimme.
»Nein«, erwiderte Nora. »Nichts.« Sie schob ihre Papiere zusammen und steckte sie in ihre Aktentasche. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ das Büro.
4
Mit einem Anflug von Bestürzung musterte Nora das Durcheinander in der vollgestopften Wohnung. Es war noch schlimmer, als sie es in Erinnerung hatte. Das schmutzige Geschirr in der Spüle sah so aus, als hätte es schon bei ihrem letzten Besuch vor einer Woche da gestanden, und türmte sich so gefährlich auf, dass man nichts mehr oben auf den Stapel stellen konnte. Auf den unteren Tellern hatte sich bereits grünlicher Schimmel breit gemacht. Da die Spüle voll war, hatte sich der Bewohner des Appartements ganz offensichtlich auf das Bestellen von Pizza und chinesischem Essen verlegt – diesen Schluss legte zumindest der Haufen fettiger Pappschachteln nahe, der wie eine kleine Pyramide aus dem Mülleimer quoll. Ringsum lagen alte Zeitungen und Zeitschriften am Boden und auf dem abgewetzten Mobiliar. Aus Lautsprechern, die unter einem Berg schmutziger Wäsche nur noch zu erahnen waren, drang Pink Floyds »Comfortably Numb« an Noras Ohren, und in einem Regal stand ein vernachlässigtes Goldfischglas, dessen Wasser eine trübbraune Färbung hatte. Nora wandte den Blick ab, um die armen Fische nicht genauer betrachten zu müssen.
Sie hörte ein Husten und Schniefen und wandte sich dem vergammelten, orangefarbenen Sofa zu, auf dem ihr Bruder lümmelte. Skip hatte seine nackten, schmutzigen Füße auf den Couchtisch gelegt und starrte Nora an. Die kleinen bronzefarbenen Locken, die er schon als Kind gehabt hatte, fielen ihm in die Stirn seines jungenhaft glatten Gesichts, und hätte er nicht seinen üblichen verdrießlich-pubertären Gesichtsausdruck zur Schau getragen, hätte man ihn trotz seiner schmuddeligen Kleidung als ausgesprochen gut aussehend bezeichnen können. Manchmal fiel es Nora schwer, sich klarzumachen, dass ihr Bruder jetzt erwachsen war. Obwohl er bereits vor einem Jahr sein Physikstudium an der Stanford University abgeschlossen hatte, gab Skip sich dem Nichtstun hin, und Nora musste immer wieder bei ihm vorbeischauen und sich um dieses verwahrloste Riesenbaby kümmern, das ein unheimliches Talent hatte, seine große Schwester auf die Palme zu bringen. Inzwischen hatte sich Noras Verärgerung über Skip allerdings in tiefe Sorge um sein Wohlergehen verwandelt. Nach dem Tod ihrer Mutter vor einem halben Jahr war er von Bier auf Mescal umgestiegen, und auch jetzt lagen mehrere leere Schnapsflaschen über den Boden der Wohnung verstreut. Skip griff nach der noch ein Viertel vollen Flasche auf dem Couchtisch und goss ihren Inhalt in ein Einmachglas. Dann schüttelte er den kleinen gelblichen Wurm, der in der leeren Flasche verblieben war, auf die Tischplatte. Von dort nahm er ihn mit spitzen Fingern auf und warf ihn in den Aschenbecher, in dem bereits mehrere ähnliche Würmer lagen, die jetzt, nachdem der Alkohol verdunstet war, ganz eingeschrumpelt wirkten.
»Das ist ja widerlich«, sagte Nora.
»Tut mir Leid, dass dir meine Sammlung von Nadomonas sonoraii nicht gefällt«, erwiderte Skip. »Wenn ich nur früher erkannt hätte, wie faszinierend Biologie sein kann, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Physik zu studieren.« Er zog die Schublade des Tisches auf und holte ein flaches Sperrholzkästchen heraus, das er seiner Schwester reichte. Es sah aus wie das Behältnis eines Schmetterlingssammlers, nur dass es anstatt bunter Falter dreißig oder vierzig auf Nadeln gespießte Mescalwürmer enthielt, die Nora an dicke, braune Kommas erinnerten. Ohne ein Wort zu sagen, gab sie Skip das Kästchen zurück.
»Es sieht so aus, als hättest du seit meinem letzten Besuch deine Wohnung ein wenig umdekoriert«, meinte Nora. »Dieser Riss in der Wand da zum Beispiel ist neu.« Sie deutete auf einen breiten Spalt im Verputz, der an einer Wand von der Decke bis zum Boden lief.
»Das war mein Nachbar«, antwortete Skip. »Leider hat er nicht denselben Musikgeschmack wie ich und hat gegen die Wand getreten, der alte Spießer. Du musst mal mit deiner Oboe kommen, das macht ihn bestimmt fuchsteufelswild. Aber jetzt erzähl mir mal, wieso du es dir auf einmal wegen der Ranch anders überlegt hast. Ich dachte schon, du würdest bis zum jüngsten Tag an der alten Bruchbude festhalten.« Er nahm einen tiefen Zug aus seinem Einmachglas.
»Gestern Abend ist mir da draußen etwas Seltsames passiert«, sagte Nora und drehte die Stereoanlage leiser.
»Tatsächlich?«, fragte Skip ohne wirkliches Interesse. »Was war denn los? Haben wieder ein paar Kids die Sau rausgelassen?«
Nora sah ihn durchdringend an. »Ich wurde angegriffen«, erwiderte sie.
Skip setzte sich auf, und der mürrische Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht. »Wie bitte? Von wem denn?«
»Von irgendwelchen Typen, die sich als Tiere verkleidet hatten. Das glaube ich zumindest, aber ganz sicher bin ich mir nicht.«
»Und sie haben dich angegriffen? Bist du denn verletzt?« Skips Gesicht lief vor Zorn und Sorge um Nora noch röter an. Obwohl er als jüngerer Bruder ihre schwesterliche Fürsorge vehement ablehnte, hatte er selbst einen ausgeprägten Beschützerinstinkt ihr gegenüber.
»Teresa kam mit der Schrotflinte und hat mich gerettet. Bis auf ein paar Kratzer am Arm ist mir nichts passiert.«