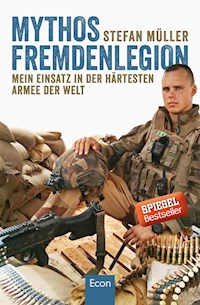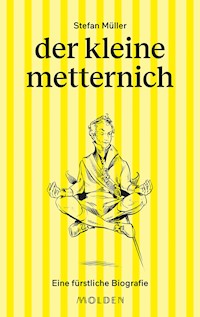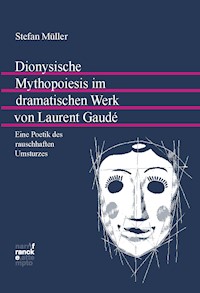9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Ferien haben gerade begonnen, als das Schicksal an Jans Haustür klingelt- oder besser gesagt: Tibor, der sich als neuer Nachbar vorstellt. Obwohl die beiden Jungen sehr unterschiedlich sind, spüren sie sofort, dass sie etwas verbindet, und werden Freunde. Gemeinsam verbringen sie den Sommer, lernen einander kennen und das Leben ein bisschen besser verstehen. Tibor entführt Jan in die Welt der Literatur und gemeinsam begeben sie sich auf die Spuren von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Zum ersten Mal fühlen die zwei 15-Jährigen, was es bedeutet, sich blind auf einen anderen verlassen zu können. Als der Herbst kommt, scheint ihre Freundschaft unerschütterlich, ja geradezu unendlich zu sein. Doch dann taucht in der Schule die hübsche Jennifer auf, in die sich beide Hals über Kopf verlieben. Und so müssen sich Tibor und Jan ganz plötzlich fragen: Wollen sie ihre Freundschaft für ein Mädchen riskieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Stefan Müller
TIBOR UND ICH
Roman
Vorwort
Die Ferien haben gerade begonnen, als das Schicksal an Jans Haustür klingelt – oder besser gesagt: Tibor, der sich als neuer Nachbar vorstellt und Unmengen von Büchern in seinen Umzugskisten hat. Trotz ihrer offensichtlichen Gegensätze werden die zwei 15-Jährigen von einem Tag auf den anderen unzertrennlich.
Sie verbringen gemeinsam einen unbeschwerten Sommer, berauscht vom Glück, einen echten Freund gefunden zu haben. Zum ersten Mal fühlen die zwei Außenseiter, was es bedeutet, sich blind auf einen anderen verlassen zu können. Tibor entführt Jan in die Welt der Literatur und entfacht in ihm, der bisher keine Hobbys hatte, die Lust am Lesen.
Doch als der Herbst kommt, wird ihre Freundschaft bereits auf die Probe gestellt: Beide verlieben sich in die hübsche Jennifer. Und so müssen sie sich plötzlich fragen: Wollen sie ihre Freundschaft für ein Mädchen riskieren?
TEIL EINS
Einen Sommer lang
Liebten nicht alle Tibor? Seine Eltern, seine Nachbarn, seine Lehrer und auch ich. Da waren wir gerade fünfzehn Jahre alt geworden, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Anfang August. Noch gut vier Wochen der Sommerferien lagen vor uns, und damals schienen uns diese vier Wochen wie eine Unendlichkeit; und als sie vorbei waren, packten wir missmutig unsere Schultaschen und fragten uns, wo die Zeit geblieben sei, und eine Angst befiel uns, die Wochen, Monate und Jahre unseres Lebens könnten fortan immer so schnell vergehen. Am ersten Schultag jedoch bewies uns die Uhr, dass Zeit in der Jugend schier unerschöpflich ist wie die Freundschaft zwischen zwei Jungen scheinbar unzerbrechlich, und dass ein Tag weit mehr als vierundzwanzig Stunden besitzt.
Bevor Tibor mit seiner Mutter und seinem Vater in unser Haus zog, wusste ich weder, was ein richtiger Freund war, noch was es bedeutete, wenn jemand sagte: Du kannst auf mich zählen. Es ist nicht dieselbe Art Vertrauen, das dir deine Eltern einflößen, das sie dir praktisch mit dem Frühstück servieren und von dem du glaubst, dass es im wirklich entscheidenden Moment nicht so stark ist, wie du es für nötig hältst – nämlich wenn die Eltern sich auf die Seite der Lehrer schlagen und dich schimpfen, dass deine Leistungen in der Schule nachlassen, du den Kopf in den Wolken trägst und nichts mit herunterbringst als Luft. Am Morgen noch sagen sie: Ich hab dich lieb, hab einen schönen Tag; und am selben Nachmittag warten sie schon im Wohnungsflur, während du möglichst leise den Schlüssel im Schloss umdrehst, um nicht gleich auf dich aufmerksam zu machen. Denn du ahnst, dass es nicht unbedingt ruhig zugehen wird in der nächsten halben Stunde, weil die Eltern den Brief von der Schulleitung bereits gelesen haben dürften. Es ist nicht die Art Vertrauen, das dich nachts ruhig schlafen lässt, weil du dir sicher sein kannst, dein Vater passt auf dich als schlafendes Kind auf, weil du weißt, beide, Mutter wie Vater, würden wohl ihr Leben für dich geben, auch wenn du es nicht ganz begreifen oder fassen kannst, was es wirklich bedeutet, sein Leben für einen anderen zu geben. Die Art Vertrauen ist bedingt durch familiäre Bande, denkst du, Vater und Mutter müssen für dich da sein, es ist ein Naturgesetz, dass sie dich lieben und sich für dich aufopfern. Und vielleicht hast du das Gefühl, beide würden ihrer Wege gehen, stellte sich heraus, dass du nicht aus ihrem Fleisch und Blut bist, als wäre Liebe nur ein niedergeschriebener Begriff, der sich weglöschen lässt wie Tinte von einem Blatt Papier.
Ein Freund liebt dich bedingungslos, und lieben soll nicht meinen, dass er dich küsst oder berührt oder von dir träumt oder all seine unerfüllbaren Wünsche vor dir ausbreitet. In einer Freundschaft wird Liebe nicht vordergründig definiert durch Körperlichkeit, sondern doch vielmehr durch den Verstand. Was Tibor und mich später mit den Mädchen verband, war Freundschaft noch oder schon Liebe, vielleicht aber auch ein Gemisch daraus. Wir wussten beide, es ist etwas anderes, eine dritte, kaum zu bändigende Kraft und doch überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was wir füreinander empfanden. Von einer Brücke in den eiskalten Fluss springen? – für ein Mädchen hätte ich das niemals getan. Ich hätte ihr verständnislos ins Gesicht geblickt und gefragt, warum ich so etwas Dummes tun solle. Tibor hätte nur von mir zur Brücke und hinunter in den Fluss zu blicken brauchen, und ich wäre gesprungen. Wahrscheinlich weil ich wusste, er wäre mir gefolgt, nach nur einem Lächeln und einem Blick, der besagte: Wir beiden Idioten!
Bevor ich Tibor kennenlernte, wusste ich kaum etwas über Freundschaft und ihre Bedeutung. Freunde waren für mich kernige Typen mit Haaren auf der Brust, die in einer Kneipe ein paar Biere zischen, sich dann auf ihre Maschinen setzen und gegen den Sonnenuntergang düsen; der Wind weht ihnen die Haare aus dem Gesicht und alle paar Kilometer heben sie den muskulösen Arm zu einem schnellen Gruß und zwinkern mit dem Auge. Wer Freundschaften nur aus zweitklassigen Filmen kennt und sie dann auch tatsächlich dafür hält, hat sie nie wirklich selbst erfahren. Mir ging es so und nicht anders, und dadurch hielt ich sie nicht für erstrebenswert, und ich hatte auch nicht das Gefühl, auch nur irgendetwas zu verpassen.
Dann klingelte Tibor eines Tages an unserer Tür, meine Mutter rief, kaum dass sie die Tür einen Spaltbreit geöffnet und einen Blick auf den Jungen geworfen hatte, »Für dich!« in Richtung meines Zimmers, verschwand dann in der Küche und ließ den wartenden Tibor zurück. Für mich?, wunderte ich mich, denn für mich klingelte doch nie jemand an der Tür, vor allem keine Gleichaltrigen. War es mütterlicher Instinkt, dass sich meine Mutter im Gegensatz zu mir wenig wunderte, wer da vor der Tür stand? Tibor wollte letztlich nämlich gar nicht zu mir. Ich habe meine Mutter nie gefragt, warum sie glaubte, dass der Junge meinetwegen gekommen sei, denn ich hatte zu dieser Zeit keine Freunde, und meine Mutter wusste das auch. Es hätte sich folglich also genauso auch um einen rüden Bengel handeln können, der mich verprügeln wollte, weil ich in der Schule nicht nach seiner Pfeife tanzen mochte. Für meine Mutter jedoch schien mit einem einzigen Blick die Lage geklärt, der Junge als Freund identifiziert und das Leben des eigenen Sohnes erleichtert.
Mit klopfendem Herzen öffnete ich die Tür meines Zimmers, lugte in den Flur hinaus, ob nicht eine böswillige Überraschung auf mich wartete, und ging dann sehr langsam, fast bedächtig, möchte ich sagen, an die Wohnungstür und zog sie noch langsamer auf, als ich gegangen war, eine Faust ebenso erwartend wie einen wilden Tiger oder die Zeugen Jehovas. Bei Mutter konnte man schließlich nie wissen! Und da stand er: Tibor.
Er trug ein dunkelblaues, ziemlich enganliegendes Achselshirt, das viel von seiner leicht gebräunten glatten Haut zeigte, die im diffusen Licht des Hausflurs schimmerte wie Perlmutt, zumindest da, wo er nicht mit Staub bedeckt war. Rechts über dem Ohr hatte er ein paar Spinnweben kleben, die ich ihm am liebsten, in Überwindung allen Ekels, weggewischt hätte. Den linken Arm hatte er lässig gegen die Wand gelehnt, mit gespreizten Fingern weit über seinem Kopf, in seiner Achsel wuchsen bereits Haare. Verwundert schaute ich zuerst dorthin und dachte vorerst nur, dass mir die noch fehlten. Noch bevor ich ihm ins Gesicht sah, blickte ich auf seine schuhlosen Füße, die ein wenig zu groß schienen für seine schlanken, an ein schnelles Tier erinnernden Beine in kurzen Hosen und die dazu kohlrabenschwarz waren, als käme er direkt aus dem Morast. Sein Blick fiel aus Augen, die aus derselben Farbe waren wie sein Shirt, das Weiße bot einen leuchtenden Kontrast, wissend und vielleicht sogar ein wenig spöttisch musterte er mich, schnalzte mit der Zunge und lächelte. Ihm fehlte ein Stück eines Schneidezahns, die restlichen Zähne sahen für meine Vorstellung nahezu krankhaft gesund aus. Dass die Familie habe umziehen müssen, weil es mit dem Sohn ständig zu Schlägereien gekommen sei, bei denen er schon so manche Gehirnerschütterung davongetragen und nun, zu guter Letzt, auch noch einen Zahn verloren habe, glaubte ich ihm sofort, obwohl es nicht stimmte und Tibor sich vor Lachen auf die Schenkel klopfte, vor lauter Begeisterung über seinen gelungenen Scherz.
Er grinste, und seine schmale Oberlippe zog sich wie eine gerade Linie über seine oberen Zähne; die fehlende Ecke in der Mitte machte ihn weder verwegen noch lustig ausschauend, er wirkte weder wie ein Pirat noch wie ein Clown, vielmehr hatte man das Gefühl, sie mache ihn unvollkommen, als sei sie seiner – der doch schmutzig wie ein Kohlenarbeiter oder wie ein aus einem Film stammender Straßenjunge daherkam – nicht würdig. Nicht immer machen Kleider Leute, auf majestätischer Ebene nicht und eben auch nicht auf der dieses Jungen. Seine Wangen waren noch glatt und beschrieben durch seine gut ausgebildeten Wangenknochen eine flache Delle, sein blondes Haar fiel ihm strähnig ins Gesicht, ein wenig gebleicht, durch die Sonne der letzten Tage vielleicht.
Sein Lächeln verschwand, sein Gesichtsausdruck verwandelte sich in den eines ernsten, nachdenklichen Jungen; er krauste seine schmale Nase, sodass über der Nasenwurzel zwei parallele senkrechte Falten entstanden, und ließ mich wissen, dass seine Familie heute in unser Haus ziehen würde, sie vielmehr schon dabei wäre, und er von seinen Eltern den Auftrag erhalten habe, bei allen Mietparteien zu klingeln, um darüber Bescheid zu geben und sich für den eventuell auftretenden Lärm zu entschuldigen.
»Der Lärm ist übrigens nicht eventuell«, sagte er noch mit halblauter Stimme, nickte flüchtig, machte auf der nackten Hacke kehrt und lief die Stufen hinauf in die nächste Etage. Ich blickte ihm nach, bis er um die Ecke verschwunden war, schüttelte verwundert den Kopf, es blinkte vor meinen Augen, auch weil ich direkt in die Flurlampe gesehen hatte. Mit der linken Hand hielt ich noch unsere Wohnungstür umschlungen wie eine Wäscheklammer einen zu schweren Pullover, war uneins mit mir, was nun und ob überhaupt etwas zu tun sei, blickte ernst in den leeren Hausflur, auf dessen Boden sich die Abdrücke der Füße dieses Jungen befanden. Also doch keine Einbildung, er war wirklich hier, dachte ich, schielte noch einmal die Treppe hinauf, ohne etwas zu sehen, denn das Licht war schon verloschen, schloss unsere Wohnungstür und ging in mein Zimmer.
*
Und das war gleichsam wie das Zurückkehren in eine vertraute und eigentlich nur mir bekannte Welt, zu der niemand sonst Zutritt begehrte und vielleicht auch nicht bekommen hätte, würde auch nur ein Einziger darum gebeten haben. Selbst meine Eltern klopften, seit ich dreizehn geworden war, an die dünne hellbraune Holztür, wenn sie wollten, dass ich ihnen helfe oder sie mit mir zu sprechen wünschten.
Damals hörte ich sie flüstern, spätabends, als wir alle drei schon im Bett lagen und die Türen zu ihrem Schlaf- und meinem Kinderzimmer nur angelehnt waren – doch im Gegensatz zu all den Jahren zuvor wiegte mich dieses Flüstern, diese leise ausgesprochenen Gedanken meiner Eltern über den zurückliegenden und den ihnen bevorstehenden Tag dieses Mal nicht sanft in den Schlaf, sondern ließ mich aufhorchen, und plötzlich sah ich mich mit Dingen und Situationen konfrontiert, die mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ansatzweise aufs Gemüt geschlagen hatten. Dass sie fortan verstärkt meine Privatsphäre achten müssten, erklärte meine Mutter mit vorsichtigen Worten, denn sie wurden zum ersten Mal von ihr ausgesprochen und vermutlich wollte sie sich auf diesem bisher unbetretenen Terrain erst einmal Schritt für Schritt vortasten, als glaubte sie, in unsichtbare Fallen zu geraten oder einen Weg einzuschlagen, der in einer Sackgasse endete, was unermesslich schwer gewogen hätte. Denn dies würde doch bedeuten, dass ich – das Kind – nicht frei und ungezwungen zum Erwachsenen heranreifen würde. Oder genau das trat ein, verbunden mit Pickeln, einer unausgeglichenen Gefühlslage, Rebellion und dem Wunsch, das elterliche Nest zu verlassen, um – im schlimmsten Fall – nie mehr zurückzukehren.
Erste Anzeichen würde es bereits geben, natürlich nicht bei mir, versicherte meine Mutter meinem Vater auf beruhigende Weise, sondern bei dem einen oder anderen Jungen aus meiner Klasse, und dass die Mädchen ohnehin schon viel weiter seien, wisse er ja aus eigener Erfahrung. Dass Frauen auf diesen Unterschied immer so erstaunlich viel Wert legen, flüsterte mein Vater und kniff meiner Mutter wohl in die Seite, denn sie kicherte auf einmal und quietschte leise ein »Finger weg!« zwischen den Zähnen hervor. Was die Mädchen jetzt vorweg wären, sagte meine Mutter dann ernst, holen die Jungs viel zu schnell ein. Darin seien sich die Mütter einig gewesen auf der Elternversammlung. Ich muss dann eingeschlafen sein, weil ich mich nicht mehr darin erinnern kann, dass meine Eltern besprochen hätten, fortan anzuklopfen, bevor sie mein Zimmer betreten – etwas, was sie taten, noch bevor ich »Herein!« sagen konnte und was somit eher wie ein fauler Kompromiss anmutete, was für mich aber doch einem ersten Schnitt gleichkam, dessen Bedeutung man erst sehr viel später zu begreifen fähig ist.
Ich näherte mich meinem Fenster, das auf die Straße hinausging, und blickte aus dem zweiten Stock auf den unmittelbar vor der Haustür geparkten Lkw, aus dem drei Erwachsene nacheinander so beschauliche Dinge wie eine Stehlampe, eine Flurkommode und einen Spiegelschrank fürs Badezimmer, dessen Scheiben mit Stoff umhüllt waren, holten und entweder gleich hinauf in den dritten Stock, in die Wohnung direkt über der unsrigen, brachten oder sie auf dem Fußweg abstellten, um zunächst das Ausladen voranzubringen und später Stufe um Stufe die Möbel hochzutragen.
Die Eltern dieses Jungen wirkten aus meiner Perspektive wie verkleidet. Die Mutter, eine Frau Mitte dreißig, hatte lange, leicht gewellte braune Haare, die sie an den Seiten mit jeweils einer Haarspange zurückgeklemmt trug, an den Füßen hatte sie flache Schuhe, ihre Beine zierte eine dunkelgrüne Hose ohne besondere Auffälligkeiten, als Oberteil hatte sie sich an diesem Morgen für etwas Hellgrünes entschieden – ich war mir nicht sicher, ob es sich dabei um einen Pullover, eine Bluse oder einer Mischung aus beidem handelte. Der Vater – ich hielt ihn vorerst dafür, da er die Frau mehrfach küsste – trug eine dunkle Stoffhose und ein ebenfalls dunkles, dünnes kariertes Hemd, das überraschenderweise an nicht einer einzigen Stelle die Spur eines Schweißfleckes aufwies, obwohl es längst brütend heiß draußen war und das Hinauftragen der Möbel durchaus anstrengend. Mutter und Vater umgab weder ein Heiligenschein, noch trugen sie einen Button mit der Aufschrift »außergewöhnlich« auf der Brust, und doch erkannte ich schon im ersten Augenblick, dass die beiden eine besondere Aura umgab. Das Wort »Aura« hatte ich am Vortag in einem wissenschaftlichen Bericht im Fernsehen gehört, vielleicht hatte ich mich ein wenig beeinflussen lassen. Ich habe lange Zeit darüber gegrübelt, woran es gelegen haben mochte, dass die beiden einen solchen Eindruck auf mich gemacht hatten – vielleicht lag es an der Art, wie sie einander die Kartons und kleinen Möbelstücke vom Lkw hinunterreichten, sich dabei sanft an den Händen berührten und lächelten, möglicherweise lag es an der enormen Blässe der Frau, die sie in gleichen Teilen verletzlich und unnahbar wirken ließ. Eine Frau, die auf Händen getragen wird, und ein Mann, der dafür von ihr bewundert wird – ja, so wirkten sie. Später ging mir auf, dass diese beiden meinen einzigen Freund in die Welt gesetzt hatten, und noch später wurde mir klar, dass sie schon aus diesem Grunde zumindest für mich etwas Besonderes waren.
Einmal lächelte die Mutter hinauf zu meinem Fenster, sie musste die Augen zusammenkneifen, weil die Sonne sie blendete, dann hielt sie schnell die linke Hand wie einen Schirm über die Augen und legte, wie fragend, den Kopf etwas schief. Mechanisch hob ich die linke Hand, ohne zu winken, und als ich mich gerade besinnen wollte, muss ihr der zweite Mann aus dem Inneren des Lkws etwas zugerufen haben, denn sie wandte sich abrupt von mir ab und den Möbeln zu. In dem Moment klingelte es, und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, sie hätte an unserer Tür geklingelt, was natürlich vollkommen unmöglich war. Meine Mutter, anscheinend sicher, dass es für mich war (wie unvorstellbar: zum zweiten Mal an diesem Tag!), machte keine Anstalten, die Tür zu öffnen, und auch ich ging nicht gleich dorthin.
Es hatte nur ganz kurz geklingelt, als hätte es sich der Jemand vor der Tür im Moment des Klingelns anders überlegt. Ich hatte nicht vor, zur Tür zu gehen, und zwei Minuten mochten bereits verstrichen sein, als es mich dennoch in den Flur zog, als würde ich an einen unsichtbaren Faden geknüpft aufgewickelt. Schritt vor Schritt setzte ich auf die Auslegware unseres kleinen Flurs, langsam legte ich die Hand auf die Klinke, drückte sie hinunter und zog die Tür auf. Die Unterkante machte ein schabendes Geräusch auf der Auslegware – das war mir bisher nie aufgefallen.
»Dauert das bei dir immer so lange?«, fragte der Junge und entblößte seine Zahnlücke. Dann pustete er sich mit Luft aus einem Mundwinkel eine Haarsträhne aus dem Gesicht und zog skeptisch die linke Augenbraue in die Stirn. Seine Augen blickten ruhig, seine Hände hatte er an das Treppengeländer neben sich gelegt, alles an ihm schien für diesen Moment vorbereitet, als sei ihm der Ablauf dieses zweiten Treffens innerhalb kürzester Zeit ganz klar.
»Nein«, erwiderte ich und schüttelte eifrig den Kopf. Dabei lehnte ich mich an den Türrahmen und zog die Tür an meine Seite.
»Freunde lässt man nicht warten!«, ermahnte er mich dann und eine Wärme durchfloss mich, als wäre ich in ein heißes Bad gestiegen. Ich war vollkommen verblüfft von seiner Direktheit, von dieser Sicherheit und gleichzeitigen Zufriedenheit. Erkennt man Freunde auf den ersten Blick, wie ein Liebender die Frau seiner Träume erkennt? Wie seltsam, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es uns damals keineswegs sonderbar vorkam, diese Art Vertrautheit so unbedingt und gleich zu spüren; nicht als würden wir uns seit Jahren kennen, denn dafür lebten wir einfach noch nicht lange genug, sondern als wüssten wir, dass die nächsten Monate uns beiden zugedacht sein würden. Wir sollten ein Team bilden, eine – was die Lehrer rätselten und die anderen Jungen und die Eltern und die Frau aus dem Parterre! – wie auch immer geartete Verbindung, die uns das Leben nicht leichter bewältigen ließ, sondern uns veränderte: nämlich unseren Blick auf die Dinge, unser Gespür für Augenblicke, unsere Zuversicht auf eine Zukunft, die wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Farben ausmalten. Und diese Farben, glaubten wir, würden niemals verblassen oder verwischen.
»Freunde lässt man nicht warten!«, wiederholte ich, und es klang wie ein Treueschwur. Der Junge trat auf mich zu, ich richtete mich automatisch auf, er legte mir weltmännisch die linke Hand auf die Schulter und schüttelte mit seiner rechten meine rechte Hand. Seine Haut war weich, sein Händedruck so fest, wie der Händedruck eines Jungen nur sein konnte.
»Tibor«, sagte er dann, und ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass es sich hierbei um seinen Namen handeln musste.
»Jan«, entgegnete ich und lüftete einen imaginären Hut, etwas, was ich vor Kurzem erst in einem Film gesehen hatte. Wieder blies er sich keck eine Haarsträhne aus dem Gesicht, grinste und trat einen Schritt zurück.
»Ich kann dir meine Sachen zeigen, wenn du magst!«, sagte er, machte sich von mir los und rannte, ohne eine Antwort abzuwarten, in Richtung Haustür. Wir kannten die Antwort längst. Nach und nach zeigte Tibor mir nicht nur seine »Sachen«, wie er sie nannte, sondern sein ganzes Leben. Und was zunächst wie das Stöbern in den geheimen Schätzen eines gleichaltrigen Jungen anmutete, entwickelte sich nach der kürzesten Zeit zu einem Helfen beim Einzug. Ich trug Kisten und Kartons, Schubladen und Lampenschirme – ich brachte Tibor und seine Welt in mein Zuhause.
*
Zum Geburtstag schenkte Tibor mir eines seiner Bücher. Keinen Comic, keinen Gutschein fürs Kino, keine Eintrittskarte für den Zoo. Nein, es war ein Buch. Mädchen schenken sich in diesem Alter wohl Bücher über Pferdehöfe und verzogene kleine Gören in von weiblichen Dragonern beherrschten Internaten. Und schenkten sich Jungen nicht Flugzeugmodelle oder Videospiele? Tibor war anders. Das hatte ich gemerkt, als ich ihm zum ersten Mal unsere Tür öffnete, und das war mir immer mehr bewusst geworden mit jedem Gegenstand, den ich aus dem Umzugswagen in die neue Wohnung trug.
Viele der Kisten trugen – mit schwarzem Filzstift gekennzeichnet – Tibors Namen. Ich malte mir während des Hereintragens schon die außergewöhnlichsten Situationen aus: In zwei der Kisten mussten die Utensilien für eine mit Strom betriebene Rennbahn sein, in drei der anderen vielleicht die Ausrüstung für eine elektrische Eisenbahn. Ich sah uns bereits an den kleinen Figuren herumbasteln und immer neue Szenen erstellen. Wir würden vielleicht unser Wohngebiet nachbauen und auch uns und möglicherweise unsere Eltern mit kleinen Holzfiguren zum Leben erwecken. Ich mochte schon jetzt Tibors CD-Sammlung und war mir sicher, dass wir in etwa denselben Geschmack hatten, oder dass er sich gerade nicht glich und wir uns gegenseitig mit immer neuen Bands und Sängerinnen auf Entdeckungsreise schicken würden. In zwei der letzten Kartons vermutete ich eine Fülle von T-Shirts und Pullovern, die er mir sicherlich ausborgen würde. Gleich nachher wollte ich ihm eines meiner T-Shirts holen und freudig zum zeitweiligen Tausch anbieten. Wie ich mich täuschte, wie sehr ich mich täuschte.
Keinen der Kartons hatten wir geöffnet, bevor nicht auch der letzte in Tibors neuem kleinen Zimmer angekommen war. Seine Eltern schickten uns nach ein paar tatkräftigen Stunden in die Pause, denn eine zweite Ladung musste aus dem alten Zuhause geholt werden. Eine Strecke von einigen Kilometern, die der Onkel, Mutter und Vater zurückzulegen hatten. »Ihr macht doch keinen Unsinn?«, fragte die Mutter und strich Tibor durch die blonden Haare. Sie lächelte den Jungen an wie einen kostbaren Schatz, als würde sie nie eine Enttäuschung von ihm erwarten, als wäre er dazu gar nicht fähig. »Ihr macht keinen Unsinn«, sagte sie daraufhin, ohne dass wir etwas erwidert hatten. Tibor lächelte. »Morgen gehst du zum Zahnarzt«, bestimmte sie und nickte dazu unterstreichend.
»Ach, Mama, morgen ist Sonntag«, sagte Tibor und gab gekonnt einen Pfeifton durch seine Zahnlücke ab. Ich konnte noch nicht einmal so pfeifen.
»Ach ja, richtig«, erwiderte sie. »Dann aber am Montag.«
»An meinem Geburtstag?«, fragte er entrüstet.
»Das ist mein spezielles Geschenk für dich!«, lachte seine Mutter.
»Ein bizarres Geschenk«, erwiderte Tibor und ich mochte, wie er das Wort sagte: bizarr.
»Wir werden sehen, ja? Ich hab dich lieb und bis später!« Das sagte sie in einem Atemzug, hauchte mir ein »Tschüss!« zu und verschwand aus der neuen Wohnung. Tibor wurde erlaubt, im neuen Ort zu bleiben und so lange mit mir die Zeit zu verbringen. Die Zeit des Abenteuers konnte sogleich beginnen, eine Hand hatte ich schon – meine Neugier überraschte mich selbst nicht am wenigsten – auf den ersten Pappkarton gelegt. Dass es in Tibors Zimmer roch wie in einem Papierladen oder einem Altpapierhandel wurde mir erst in dem Moment klar, als ich den Karton und Tibor sein Fenster öffnete.
»Hier muss erstmal ein bisschen frische Luft rein«, verkündete Tibor und strich dann mit der flachen Hand über seine eine ganze Wand ausmachenden Regale, die wohl als Erstes aufgebaut worden waren. »Hui, staubig, ich hole mal schnell einen Lappen.« Mit zwei, drei Sätzen sprang er über die Kartons und damit verschwand er aus dem Zimmer. Ich blickte auf und sah staunend die Regale an. Ich selbst hatte auch eines, ein kleines direkt über dem Bett, auf dem ein Foto meiner Eltern, ein kleiner Pokal, den ich mal im Schwimmunterricht bekommen (nicht gewonnen) hatte (denn jeder bekam einen, der eine bestimmte Anzahl von Beckenrunden in keiner festgelegten Zeit schaffte), und mein Wecker standen, der ganz bewusst weit oben platziert war, da sonst die Gefahr bestand, dass ich früh nicht aus den Federn kam.
»Wozu hast du all die Regale?«, rief ich nach draußen. Seltsam, Automodelle oder dergleichen hätte man beim Hereintragen doch sicherlich irgendwie gemerkt. Die hätten doch geklappert und wären nicht so, nun ja, ruhig und geduldig zu transportieren gewesen. Sie hätten doch irgendwie nach draußen zu drängen versucht, glaubte ich.
»Was hast du gesagt?«, fragte Tibor, der mit einem feuchten Lappen hereinkam, den Kopf schüttelte, um sich seiner im Gesicht befindlichen Haarsträhnen zu entledigen, und sich gleich daranmachte, die einzelnen Fächer auszuwischen.
»Wozu brauchst du all die Regale? Ich meine, wäre es nicht irgendwie sinnvoller, sich Schränke ins Zimmer zu stellen, einen Schreibtisch und solche Sachen?«
»Das kommt doch noch«, versicherte Tibor. Dass ich daran nicht unbegründete Zweifel hegte, sagte ich ihm aber nicht. Stattdessen nickte ich zustimmend und fragte mich, wo er den Platz dafür hernehmen wollte. Klar, ein Bett würde schon noch reinpassen und vielleicht auch ein kleiner Schreibtisch, aber ein Kleiderschrank hätte definitiv keinen Platz mehr, und wo er all seine Klamotten unterbringen wollte, die ich ja in den Kartons vermutete, war mir äußerst schleierhaft. Dann öffnete ich den ersten Karton und glaubte zu träumen. In der einen Hand hielt ich ein Buch, in der anderen auch. In meinem Leben hatte ich noch nicht so viele Bücher gesehen, außer natürlich in einer Buchhandlung und der städtischen Bibliothek. Der ganze Karton war voll damit, und Namen traten mir entgegen, die ich meistens noch nie gehört hatte. »Ernst Glaeser?«, sagte ich ein wenig verwirrt; es war der Autor des ersten Buches von Tibor, das ich in der Hand hielt. »Soll das dein Ernst sein?«, fragte ich und kicherte über den für mich gelungenen Witz. Tibor – er war mittlerweile auf einen Stuhl geklettert und wischte nacheinander die oberen Regale aus – drehte sich herum und sah mich strafend an. Darüber macht man also keine Scherze, dachte ich und ließ das Buch sinken. Dann lächelte Tibor.
»Mein Freund«, sagte er, »Jahrgang 1902 – dieses ist eines meiner Lieblingsbücher. In unserer anderen Stadt gibt es ein herrliches Antiquariat, wo man solche alten Bücher erstehen kann. Meine Mutter und ich sind dort regelmäßig hingegangen und dann durfte ich mir ein Buch aussuchen. Schau mal vorn rein, das ist eine frühe Ausgabe von 1929!«
»Aha«, erwiderte ich skeptisch und zuckte ein wenig mit den Schultern; aber nur so viel, dass es Tibor unmöglich hätte auffallen können. Von Antiquariaten hatte ich schon mal gehört. Tibor lachte wieder. »Hey!«, sagte ich mürrisch.
»Du hältst es wie einen Tierkadaver.«
»Einen was? Ach, jetzt hör aber auf. Du tust ja gerade so, als hätte ich noch nie ein Buch in der Hand gehabt. Ich habe eben etwas andere Interessen. Was ist in den restlichen Kartons?« Irgendwie musste sich doch problemlos das Thema wechseln lassen.
»Sieh doch hinein«, erwiderte der staubwischende Tibor. Dann grinste er wieder und ich ahnte Schlimmes. Mit jedem Karton, den ich öffnete, blickten mich immer mehr neue Buchdeckel und -rücken an.
Ordentlich waren sie einsortiert, um mögliche Schäden durch den Transport zu vermeiden. Ohnehin sahen die meisten Bücher ungelesen aus, als hätte Tibor sie zwar gekauft, sie dann aber auch schnell in eines seiner Regale gestellt und nicht mehr angerührt. Höchstens abgestaubt, dachte ich und lächelte in mich hinein. Später sah ich ihm oft beim Lesen zu, meistens hielt ich dafür selbst im Lesen inne, blickte über den Buchrand hinweg zu ihm hinüber, verfolgte seine ruhelos die Zeilen verfolgenden Augen und bemerkte, wie Worte und Sätze in Tibors Kopf eine neue Welt erschufen, fern der unseren.
Nie hätte Tibor eines seiner Taschenbücher unachtsam auseinandergeklappt wie einen toten Fisch beim Grätenentfernen. Er schlug ein Buch immer nur so weit auf, dass sein Rücken nicht beschädigt wurde und es – nach dem Lesen – so aussah wie vorher. Man müsse den Büchern Achtung entgegenbringen, erklärte Tibor mir einmal, als ich seine Pedanterie und Vorsicht kaum länger ertragen konnte. Er sah in der Literatur nie den großen Medienrummel, das Geschäft, das sich zweifellos dahinter verbarg. Die ungezählten Absätze eines jeden Romans waren für ihn Gaben – Gedanken und Gefühle, die der Schriftsteller in diesem Augenblick nur ganz allein mit ihm teilte. Nie und nimmer hätte Tibor – bis auf seinen Namen ganz vorn – etwas in die Bücher geschrieben oder darin angestrichen. Notizen machte er sich bisweilen auf kleinen Zettelchen, die er in der obersten rechten Schublade seines Schreibtisches aufzubewahren pflegte. Den viel größeren Rest an Zitaten und eigenen Reflexionen bewahrte er in seinem Gedächtnis auf. Worte, Sätze, ja ganze Passagen konnte er originalgetreu wiedergeben und die ihn Umgebenden immer wieder aufs Neue verblüffen.
Beinahe zärtlich nahm er jedes einzelne Buch aus den Kartons und stellte es in die ausgewischten hölzernen Regale. Jedes Mal hielt er kurz inne, las den Titel und den Autor vom Buchdeckel ab, dachte kurz nach, wie um sich an den Inhalt, die Figuren, die miteinander verwobenen Schicksale zu erinnern, nickte dann und stellte es zu den anderen. Das musst du unbedingt mal lesen, sagte er bei fast jedem dritten Buch, und ich, der mit Literatur bisher wenig am Hut hatte, sah fasziniert diesem Jugendlichen zu, der sich so sehr von allen mir bis dahin bekannten Jungen abhob – durch die Art zu sprechen, durch seine Hände, die so zielbewusst und doch sanft nach den Büchern griffen, als bedürften sie Schutz und seiner persönlichen Pflege, als wären sie Teil von ihm wie er von ihnen.
»Das hier ist aber ganz schön ramponiert«, sagte ich und hielt ein Buch in die Höhe, das Die BrüderLautensack hieß. Tibor hielt inne und schaute mich fast erschrocken an.
»Das hat seine ganz eigene Geschichte«, sagte er dann, als wollte er die Situation irgendwie überspielen. Er nahm mir das Buch aus der Hand, sah es noch kurz an und stellte es dann zu den anderen.
Tibor ordnete seine Schätze der Größe nach, aneinandergereiht hätten seine Bücher eine endlos lange, sich zum Ende hin verjüngende Schlange ergeben. Auf der ersten rechten Seite eines jeden Buches stand Tibors Name, mit einer schon erwachsen wirkenden Handschrift geschwungen hingezaubert, nicht so krakelig, wie ich in meine Schulhefte klierte, selbst wenn ich versuchte, ordentliche Buchstaben aufs Papier zu schreiben. Ab und zu fuhr er sich mit dem Handgelenk über die Stirn, denn Bücher einzusortieren war für Tibor anstrengend und gleichsam ein Vergnügen, es erforderte Präzision und ein gutes Auge, und wenn Tibor über etwas verfügte, dann waren es Geduld und die Fähigkeit, sich für Sachen zu begeistern, die seine volle Aufmerksamkeit benötigten.
Er sprang auf den Stuhl, legte ein weiteres Buch an die schon stehende Reihe an, schob ein anderes zurecht, zog manchmal eines nochmals heraus, um zurückgebliebenen Staub abzupusten. Tibor machte keine Anstalten, zu fragen, ob ich mich etwa langweilen könnte. Hätte ich mit Ja geantwortet, wäre er gekränkt gewesen, denn offensichtlich bestand sein halbes Leben aus dieser Lese-Leidenschaft. Wahrscheinlich hätte er mich mit hochgezogenen Augenbrauen abschätzig angeblickt, wie manchen Jungen vorher, den er als Freund hatte gewinnen wollen. Eben noch sollte ich Herr der Fliegen ganz unbedingt lesen, da hielt er mir im nächsten Augenblick schon J. D. Salingers Fänger im Roggen unter die Nase. Er ließ mich das Cover betrachten, ich nickte zustimmend, erwiderte, dass dies dann wohl Buch Nummer einhundertvierundzwanzig sein müsse, das auf meinem Nachtschränkchen liegen würde, er lachte und wischte sich die Haare aus dem Gesicht. »Alles nach und nach!«, versicherte Tibor, ließ mir also Zeit und Raum zum Atmen und verschwendete keinen Gedanken daran, dass ich die Bücher nicht lesen würde. Und auch ich tat dies nicht.
*
Es war, als eröffnete mir der neue Freund eine vollkommen unbekannte Welt, die bis dahin zwar allgegenwärtig, aber doch außerhalb meiner Lebensumstände war. Ich wunderte mich stets über die Büchersendungen im Fernsehen, über Menschen, die in Buchläden an den Regalen standen und geflissentlich die Klappentexte mir nicht geläufiger Romane studierten und nicht selten drei oder vier nicht etwa in ihrem Einkaufskorb, denn den gibt es doch in Buchhandlungen nur selten, sondern unter dem Arm, oder besser noch: im Arm trugen wie etwas Kostbares, etwas, was man nicht wie ein Stück Butter oder ein Päckchen abgepackter Wurst in den Einkaufsbeutel warf oder gleiten ließ, sondern was man zumindest vorsichtig hineinlegte, damit es auf dem Weg nach Hause nicht beschädigt und heil an den dafür vorgesehenen Platz gestellt werden konnte. Plötzlich, als wehte mit der frischen Luft, die Tibor hereinließ, als er für ein paar Augenblicke das Fenster aufgezogen hatte, der Hauch von etwas Wunderbarem mit hinein, fand ich mein Interesse für Literatur in mir erweckt. Tibor, der regelrecht sprühte vor Begeisterung, bedachte mich mit anerkennenden Blicken und stieß einmal sogar einen Pfiff aus, als ich sagte: »Der Márai ist doch ein Ungar, richtig?«
»Absolut richtig!«, erwiderte Tibor, hüpfte vom Stuhl, hockte sich neben mich und legte seinen rechten Arm um meine Schultern. Er glühte förmlich und sein Geruch nach frischem Schweiß und Euphorie stieg in meine Nase und machte mich staunen. »Weißt du«, sagte er dann ernst, »ich hatte noch nie einen Freund, der ebenso gern Bücher mag wie ich.« Warum haben Jungen wie Tibor keine Freunde? Dass ich keinen hatte, hatte Gründe genug. Vielleicht war es bei uns beiden so, dass sich der eine für nichts richtig begeistern konnte und der andere für eine bestimmte Sache zu sehr? Mit den beiden Extremen konnte anscheinend kein Kind und kein Jugendlicher etwas anfangen. Und vielleicht bedurften wir gerade deswegen einander und nur einander?
»Ich kann es versuchen«, gab ich verlegen zurück und spürte den Arm, der, eben mich noch fester drückend, langsam seine Kraft verlor. Schüchtern blickte ich zur Seite und sah in Tibors alte Augen voller Weisheit. Er lächelte, ohne seine Lippen auch nur einen Hauch zu bewegen, er strahlte, er war irgendwie glücklich. »Und womit fange ich nun an?«
Da sprang er auf, wuselte herum, griff nach einem Buch, dann nach einem anderen, hielt dann plötzlich inne, als wäre ihm die entscheidende Idee in den Sinn gekommen. »Wir wollen es nicht überstürzen!«, legte er fest. »Das erste richtige Buch muss gut ausgewählt sein.« Tibor war ein Kenner.