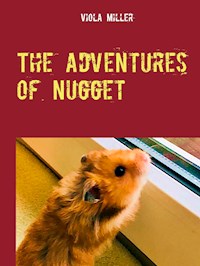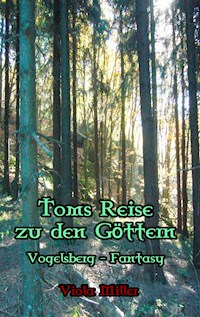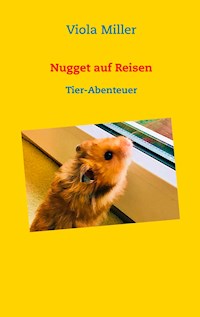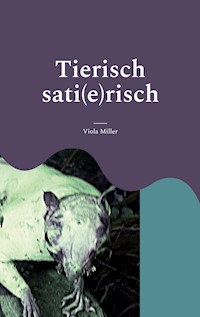
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wesen zwischen Witz, Wahn und Wirklichkeit! Animalische Absurditäten, fischige Fake News, haarige Hintergrundinformationen, karnivore Kuriositäten, amphibische alternative Fakten, nicht zu vergessen der Mensch, die kränkelnde Krone der Schöpfung. Unsere Welt ist voller schöner und schrecklicher Eigenheiten. Da fällt ein wenig Flunkern doch gar nicht auf. Vampirkraken, Reptilienmenschen, Riesenblutegel: Fact or Fiction? Wahr oder erfunden? Smartphone aus! Viel Spaß beim Raten, Richtig- und Danebenliegen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wie es zu diesem Buch kam
Kapitel 1
Verrückte Tiere in der Geschichte
Die Apennin-Eisziege (Capra glacialis)
Der Chinesische Seidenhamster (Mesocricetus sinensis habsburgensis)
Der Vampir-Oktopus (Vampyrotheutis infernalis)
Kapitel 2
Entzückende Heimtiere?
Mexikanischer Querzahnmolch oder Axolotl (Ambystoma mexicanum)
Das Patagonische Riesen-Chinchilla (Chinchilla gigantis patagonensis)
Der Riesenegel (Hirudinea manillensis)
Der Glasfrosch (Sachatamia ilex)
Kapitel 3
Schräge Tiere von nebenan
Badischer Riesenregenwurm (Lubricus badensis)
Der Karpaten-Schnegel oder Blauschnegel (Bielzia coerulans)
Der Grottenolm oder das Menschenfischlein
Der Bombardier-Käfer (Brachinus crepitans)
Kapitel 4
Fieses aus der Ferne
Beton-Schnecke (Patella radula lapis manducans)
Der Amazonas-Krake (Octopus brasiliensis brasiliensis humboldensis)
Der Botox-Giftfrosch (Dendrobates botulismus)
Das Quokka (Setonix brachyurus)
Das Falsche Meerschweinchen (Porcellus marinus)
Giftige Kegelschnecke (Conus striatus)
Kapitel 5
Mahlzeit!
Palmendieb (Birgus latro)
Der Autarke Scarabäus (Scarabaeus autarcus)
Die Cröllwitzer Wut-Pute (Meleagris gallopavo Linnaeus f. domnestica var. furor civii)
Die Weißfußmaus als Pizza - Maus (Peromyscus leucopus)
Grönland-Hai (Somniosus microcephalus)
Kapitel 6
Invasoren – sie sind unter uns!
Die Meerwalnuss (Mnemiopsis leidyi)
Die Reptiloiden (Homo sapiens var. Reptiliensis)
Zum Schluss
Wie es zu diesem Buch kam
Es war einmal in alten Zeiten, als Kinder und Jugendliche noch kein Smartphone besaßen, da konnten sich Urlaubsfahrten als sehr zäh und langweilig erweisen. Daher versuchte ich als engagierte Mutter hin und wieder, die Autofahrt durch Spiele aufzuwerten. Eines dieser sehr häufig gewählten Spiele war das Tier - ABC. Im Grunde war diese Beschäftigung sehr simpel: Man musste nur zu jedem Buchstaben des Alphabets ein passendes Tier nennen.
So einfach, so gut.
A– Affe
B- Bär
C- Chamäleon („Doch, doch, das schreibt man mit C!“)
D- Dromedar
…und so weiter.
Was aber, wenn man das Spiel in mehreren Durchläufen spielen wollte? Dann musste man sich neue Arten einfallen lassen, denn sonst wäre es ja langweilig und doof gewesen.
Also:
A - Ameisenbär
B - Brillenbär ( „Nicht schon wieder einen Bären, außerdem gibt´s den doch nicht, Mama!“)
C - Capybara ( „Was soll das denn sein?“)
D - Degu ( „Was ist das?“)
E - Eisfisch („Ach jaaaa, Mama!“)
Merken Sie etwas? Jetzt lieferte das Spiel einigen Erklärungsbedarf.
Das Capybara zum Beispiel ist das weltgrößte Nagetier, lebt am Amazonas, ist mit dem Meerschweinchen verwandt und ebenso friedfertig wie das beliebte Heimtier. Ich konnte meine Kinder davon überzeugen, dass es diese wunderbaren, skurrilen Tiere wirklich gibt.
Immerhin habe ich es geschafft, die Drei für die Tierwelt zu begeistern. Meinen Mann nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind immer noch verheiratet.
Irgendwann bekam ich folgende Idee:
Wenn es mir bisher gelungen war, skurrile, aber tatsächliche existierende Tierarten zu beschreiben, warum sollte mir das nicht auch bei erfundenen Tierarten gelingen?
Wo war überhaupt die Grenze zwischen wahr und erfunden, wenn man einmal bedenkt, dass Lebensräume wie der Amazonas oder die Tiefsee bislang nur lückenhaft erforscht sind und man schlichtweg nicht weiß, was sich alles in ihren Tälern, Canyons und Flussarmen tummelt?
Was bedeutet überhaupt skurril angesichts der Tatsache, dass der Eisfisch ein Frostschutzmittel in seinem Körper produziert, das ihn daran hindert, zwischen den Eisschollen im Südpolarmeer festzufrieren?
So begann ich Tierarten zu beschreiben, leicht zu lesen, mit merkwürdigen lustigen Anekdoten begleitet. Manche dieser Tiere existieren real, manche habe ich einfach nur dreist erlogen. Als „Versuchskaninchen“ (wir bleiben beim Thema) musste wieder einmal meine Familie herhalten. Ich las meinen Lieben all die kurzen Artikel über Riesen-Blutegel, Chinesische Seidenhamster, Riesenchinchillas und Vampirkraken vor. Immer stellte ich zum Abschluss die Frage:
Wahr oder erfunden?
Kaum jemand bei mir daheim konnte diese Frage sicher beantworten. Nicht, weil es meinen Lieben an biologischem Wissen gemangelt hätte, eher war das Gegenteil der Fall.
Doch das Leben mit all seinen Ausprägungen ist derart vielfältig und merkwürdig, wie es sich eine durchgeknallte Autorin kaum ausdenken kann.
Folgen Sie mir nun in das Universum der Wesen zwischen Witz und Wirklichkeit.
Raten Sie, vertrauen Sie Ihrem Urteilsvermögen und lassen Sie - vorerst - das Smartphone aus der Hand.
Viel Spaß!
1. Kapitel
Verrückte Tiere in der Geschichte
„Was soll schon passieren, ich lauf´ mal zu den zweibeinigen komischen Typen rüber und schnorre ein paar Knochen!“, dachte sich einst ein schlanker, grauer, majestätischer Wolf – und endete einige Jahrtausende später als kläffender Yorkshire-Terrier in einem plüschigen Wohnzimmer mit einem albernen glitzernden MY PRINCE-Halsband.
Um bei der Wandlung vom Wolf zum Hund zu bleiben:
Friedrich der Große liebte seine Windhunde und wollte neben ihnen beerdigt werden (nicht neben seiner Ehefrau). Ob diese eleganten Tiere den Preußenkönig liebten, werden wir nie erfahren.
Worauf will ich mit dieser historischen Randbemerkung hinaus?
Die Beziehung zwischen Tier und Mensch ist uralt und von verschiedensten Gefühlen und Absichten geprägt, sei es Bewunderung, Abhängigkeit, Liebe, Interesse, Abscheu, Hass oder Ausbeutung.
Womöglich ist unsere Beziehung zu Tieren (die unsere Erde schon lange vor unserer menschlichen Existenz bewohnten) eher einseitig.
Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke antwortete auf die Frage, was geschehen würde, wenn wir vor unseren geschätzten tierischen Mitbewohnern stürben, nur knapp und sachlich:
„Kalorien sind die Währung unserer Welt. Katzen sind Feinschmecker. Sie fressen zuerst die Lippen.“
Wir Menschen als Krone der Schöpfung - diese Sichtweise gilt als überholt.
Lernen Sie mit dieser Kränkung zu leben.
Trotzdem wünsche ich viel Spaß bei meinen kleinen Fallbeispielen durch die tierisch-menschliche Geschichte.
Die Apennin-Eisziege (Capra glacialis)
Wer glaubt, dass erst die heutige Zivilisation eine Fülle von Tierarten auf dem Gewissen hat, der irrt sich gewaltig.
Die Ausrottung bedauernswerter Tierarten geht bis in die Antike zurück.
Kaiser Nero, durch und durch römischer Aristokrat, angeödet von einfachen Genüssen wie Feigen oder Datteln mit Honig, ließ sich große Mengen an Eis aus dem Apennin-Gebirge bis nach Rom bringen, damit seine Köche ihm daraus eine Vorform unseren heutigen Speise-Eises zubereiten konnten. Nun muss man sich diese Süßspeise ein wenig anders als unsere Lieblings-Eiscremes vorstellen: Vanille und Schokolade kannten die Römer damals noch nicht und auch die Verwendung von Sahne war nicht üblich. Eher ähnelte Kaiser Neros Gaumenkitzel einem heutigen Sorbet, dekoriert mit Veilchen- und Rosenblüten, äußerst erfrischend im heißen römischen Sommer.
Doch wie war es damals möglich, Eisblöcke von den Höhen des Apennin-Gebirges bis ins etwa vierhundert Kilometer entfernte Rom zu schaffen?
Nun, das Leben von Sklaven zählte damals wenig. Noch weniger zählte das Leben der Apennin-Eisziege. Diese Ziegenart, die von dem römischen Naturforscher Plinius dem Älteren als äußerst sanftmütig und genügsam beschrieben wurde, musste ihr Leben für den Eis-Hunger des unbeliebten römischen Kaisers lassen.
Ähnlich wie Gämse lebten Eis-Ziegen in den kalten Höhenregionen des Apennin-Gebirges. Ihre tägliche Nahrung bildeten Moose und Flechten, die sie unter Schnee und Eis vorfanden. Dazu scharrten und klopften sie mit ihren mächtigen Hufen, sodass sich dicke Eisplacken vom Boden lösten. Irgendwann muss ein geschäftstüchtiger Hirte diese Fähigkeit der wildlebenden Ziegenart beobachtet und damit ihren Untergang eingeläutet haben. Spätestens ab dem Jahr 55 nach Christus muss die systematische Jagd auf die Eisziege begonnen haben. Die bedauernswerten Geschöpfe setzten sich weder zur Wehr noch flüchteten sie vor den römischen Jägern; stattdessen versuchten sie, ihren bedrängten Artgenossen beizustehen.
Was nun geschah, war eine beispiellose Versklavung der friedfertigen Bergbewohner.
Durch Drill und Misshandlung wurden die Tiere dazu gebracht, Eisklotz um Eisklotz aus der Gletscherwelt des Apennin-Gebirges zu lösen. Das Eis wurde anschließend in dicke Schichten aus Leder und Stroh gepackt, auf dem Rücken der Ziegen festgeschnallt und die Tiere mit der oft zentnerschweren Last mit Peitschenschlägen nach Rom getrieben.
Nahezu jede Eisziege verendete in der römischen Hauptstadt, sei es aufgrund von Entkräftung, sei es wegen des ungewohnten heißen Klimas.
„Mir egal!“, wird sich wohl Kaiser Nero gedacht haben, der von seiner Mutter Agrippina gleichermaßen tyrannisiert und verhätschelt wurde, „ich will mein Eis!“
Die Kadaver der toten Eisziegen landeten meist bei den Löwen des Kolosseums oder auch in den Kesseln der Plebejer (eine ebenfalls wenig schmeichelhafte antike Entsprechung für die heute abwertend benannte Personengruppe der „Prolls“ oder „Assis“).
Spätestens im Jahr 59 n. Chr. war die Eisziege ausgerottet. Wurde die Ankunft der schwer beladenen Tiere von Nero laut dem römischen Chronisten Gaius Ponticus stets mit dem Ausruf „Da sind ja meine Agrippinas!“ begrüßt, so finden sich nach 59 keinerlei Hinweise auf die Bergziegen in der römischen Hauptstadt mehr.
Bis heute fehlt von der Apennin-Eisziege jede Spur. Einzelmeldungen von Bergsteigern wurden stets als Gämse identifiziert.
Ab 59 n. Chr. mussten (menschliche) Sklaven das Herausschlagen der Eisplacken übernehmen.
Bezeichnenderweise starb auch im Jahr 59 Kaiser Neros Mutter Agrippina durch einen Mordanschlag, der mit großer Wahrscheinlichkeit von ihrem dekadenten, Eis lutschenden Söhnchen angezettelt worden war.
Eine versklavte antike Ziegenart, wahr oder erfunden?
Wer die eigene Mutter ermorden lässt, der wird sich wohl kaum Gedanken über das Leben von Eisziegen machen, oder?
Nun, man kann Kaiser Nero alles Mögliche anlasten, die Christenverfolgung, die Ermordung der berüchtigten Agrippina, angeblich auch den Brand Roms, doch mit dem Aussterben der Eisziegen hat er nichts zu tun – da es sie nie gegeben hat!
Tatsche ist, dass die römische Aristokratie nur allzu gerne Eis schleckte. Auf das Wohl der Sklaven, die die Eisblöcke herbeischaffen mussten, wurde genauso wenig geachtet wie beim Bau des Forum Romanums, des Kolosseums, der Via Appia… Diese Reihe ließe sich noch unendlich fortsetzen.
Hätten die Eisziegen jemals existiert, wäre eine Ausrottung durch die Römer durchaus möglich gewesen, da diese „Hoch“kultur schon vor über 2000 Jahren munter Wälder abholzte, Moore trocken legte, Tiere aus fernen Ländern zu Unterhaltungszwecken im Circus Maximus niedermetzelte und genüsslich Flamingozungen und Straußenhirne bei zahlreichen Gelagen verspeiste. Allein für die dunkelrote Toga eines römischen Herrschers mussten über zehntausend Purpurschnecken ihr Leben lassen.
Wen hätte da schon das Schicksal einer Bergziegenart gekümmert?
Der Chinesische Seidenhamster (Mesocricetus sinensis habsburgensis)
Hoffentlich tröstetet dies viele Frauen: Die Sorgen um die gute Figur ist uralt. Auch die junge französische Königin Marie Antoinette, vor der Geburt ihrer Kinder noch von magerer Statur, versuchte vor über 250 Jahren, ihrem Ehemann und König zu gefallen. Zum Zeitpunkt ihrer Verlobung gerade einmal fünfzehn Jahre alt und krank vor Heimweh, brachte die junge Marie Antoinette kaum einen Bissen herunter. Ein Drama, da in ihrer Zeit zwar ein schmale Taille, aber auch ein üppiges Dekolleté als begehrenswert galt. Der ganze französische Hof lästerte nun über das junge Mädchen, das zuvor seiner Wiener Heimat entrissen worden war.
Doch der spanische Abenteurer und Naturforscher Meso Cricetus brachte der verzweifelten jungen Dame endlich eine Lösung ihres Problems: Bei einem privaten Treffen im Gemach der hübschen Wienerin präsentierte er ihr zwei entzückende, seidenweiche Nagetiere, die er in den Weiten der chinesischen Steppen eingefangen hatte. Die zarte Marie Antoinette, aus dem Adelsgeschlecht der österreichischen Habsburger stammend, presste die kleinen Pelztiere sofort erfreut an ihre flache magere Brust. Aus dieser Zuneigung entstammt auch der Zusatz habsburgensis im wissenschaftlichen Namen des kleinen Pelzträgers.
Das seidenweiche, cremeweiße Fell, das die gleiche Farbe wie Marie Antoinettes helle Haut hatte, regte die junge Frau an, die beiden Chinesischen Seidenhamster eingeschnürt in ihrem Mieder zu tragen. Da Hamster nachtaktiv sind, störte diese Behandlung die beiden Nagetiere nur wenig. Sie verschliefen den Tag angenehm an der siebenunddreißig Grad warmen menschlichen Haut Marie Antoinettes. Die französischen Hofdamen bemerkten bald die Veränderung der Figur ihrer Herrin. Chinesische Seidenhamster im Mieder zu tragen, wurde bald zur großen Mode am französischen Hof.
Bald darauf erhielt jedoch Marie Antoinettes Koch das Rezept für das Leibgericht der jungen hübschen Königin. Es war der österreichische Guglhupf, reich an Zucker, weißem Mehl und Fett, der die Königin bald beträchtlich zunehmen ließ. Da die Königin aufgrund der Delikatesse aus ihrer Wiener Heimat schnell ihr eng geschnürtes Mieder prall ausfüllte, hatte der Chinesische Seidenhamster nun keine Aufgabe mehr. Glaubt man dem Tagebuch Marie Antoinettes, wurde der letzte Chinesische Seidenhamster, bekannt unter dem Namen Madame Klops, einfach in die Palastgärten entlassen.
Heute ist der Chinesische Seidenhamster als Heimtier nahezu unbekannt, da in den Zoohandlungen meist Gold- und Zwerghamster angeboten werden. Dabei lohnt sich die Anschaffung eines Chinesischen Seidenhamsters durchaus. Da er aus dem kargen trockenen Grenzgebiet zwischen China und der Mongolei stammt, lebt der Chinesische Seidenhamster sehr genügsam. Er benötigt ähnlich wie der Goldhamster Körner, Nüsse und Trinkwasser. Als Frischfutter bevorzugt der Chinesische Seidenhamster Salat und Wildkräuter. Saftiges Obst kommt in seiner Heimat kaum vor und wird meistens liegen gelassen.
Ihren Namen erhielt diese Hamsterart durch ihr besonders weiches und glänzendes Fell. Die Naturfärbung ist hell cremefarben. Es gibt mittlerweile auch schwarze Farbzüchtungen, die sich leider aber nicht so widerstandsfähig wie die Wildform erweisen. Die Lebenserwartung übersteigt die des Goldhamsters um etwa ein Jahr; so werden Chinesische Seidenhamster bis zu vier Jahre alt. Mesocricetus sinensis habsburgensis wird ein wenig größer als ein Goldhamster. Bei allzu guter Fütterung neigt er zu einer schnellen Gewichtszunahme, was durchaus an die letzte französische Königin erinnert.
Im Gegensatz zu allen anderen Hamsterarten lässt sich der Chinesische Seidenhamster am liebsten als Paar halten. Dies dachte sich wohl auch die junge Königin, die jeweils auf der linken und rechten Brustseite ihres Mieders einen Seidenhamster bei sich trug.
Ein seidenweiches Nagetier, getragen im Mieder der letzten französischen Monarchin?
Wahr oder erfunden?
Dreist gelogen! Grundsätzlich sind alle Hamster Einzelgänger, die sich nur zur Paarung zusammenfinden. Ist die Zeugung der Nachkommen erfolgt, verjagt das Weibchen das Männchen mit entschlossenen Bissen. Allein dieser Umstand hätte die junge französische Königin vor Entsetzen zusammen zucken lassen, hätte sich eine solche Auseinandersetzung in ihrem Mieder zugetragen.
Einen Chinesischen Seidenhamster gibt es biologisch gesehen nicht. Manchmal muss dieser Name als klangvolle Handelsbezeichnung für den Dsungarischen Zwerghamster oder den Campbell-Zwerghamster herhalten. Zoohändler sind oft sehr geschäftstüchtig.
In der Zoologie unterscheidet man in Zwerghamster, Mittelhamster (hierzu zählt der allseits beliebte Goldhamster) und in eine einzige, weltweit am größten gewachsene Hamsterart, dem Europäischen Feldhamster, der immerhin fast so groß wie ein Meerschweinchen wird.
Zur Person Marie Antoinettes muss man hinzufügen, dass die lebenslustige Wienerin durchaus auch nachtaktiv sein konnte, denn sie liebte Bälle, Kartenspiel und Opernaufführungen. Dies hätte nicht zur ebenfalls nachtaktiven Lebensweise aller Hamsterarten gepasst.
„Darf ich Sie zu einem Tanz auffordern? Mon Dieu, was krabbelt da in Ihrem Ausschnitt, Madame?“
Peinlicher hatte es für Marie Antoinette während ihrer zahlreichen Maskenbälle kaum werden können.
Der Vampir-Oktopus (Vampyrotheutis infernalis)
Berlin, 1899
„Nanu, sagen Se mal, wat is denn ditte?“, fragte der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. in seinem bekannten Berliner Dialekt.