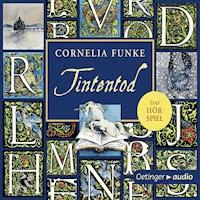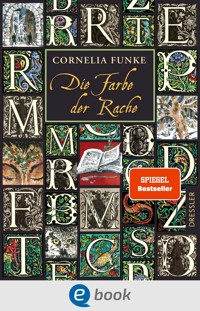
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Von Millionen Fans sehnsüchtig erwartet: Cornelia Funkes Fortsetzung der Tintenwelt-Reihe. Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in "Tintentod" vergangen. Fünf glückliche Jahre. Aber dann wird Eisenglanz gesichtet, der Glasmann von Orpheus, dem erbitterten, silberzüngigen Feind von Meggie, Mo und Staubfinger. Der Grund: Orpheus plant Rache an allen, die ihn zu Fall gebracht haben, doch vor allem an Staubfinger, und er nutzt einen furchtbaren Zauber. Sind Bilder mächtiger als Worte? Staubfinger zieht aus, die Antwort zu finden. Der Schwarze Prinz aber macht sich auf die Jagd nach Orpheus. Staubfinger ist zurück! Eine neues, packendes Abenteuer aus der Tintenwelt. - Der vierte Band der international erfolgreichen Tintenwelt-Reihe, "Die Farbe der Rache", macht aus der Trilogie eine Tetralogie. Endlich geht die Story weiter. - Lass dich noch einmal entführen in diese Welt, in der es möglich ist, die unglaublichsten Geschöpfe und Fabelwesen in Geschichten hinein- und herauszulesen. - Von Cornelia Funke, der weltweit erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin. Ihre Bücher wurden ausgezeichnet und verfilmt und begeistern längst auch eine riesige erwachsene Fangemeinde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Sie wussten nichts. Weil er nichts erzählt hatte. All die Jahre hätte er sie warnen können. Staubfinger schlug den Kopf gegen die Mauer des Hauses, in dem er so glücklich gewesen war, bis ihm die Stirn blutete. Nicht wieder. O Gott, nicht wieder! Was war der Tod dagegen gewesen? Ein Spiel!
Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in »Tintentod« vergangen. Fünf glückliche Jahre. Aber dann wird Eisenglanz gesichtet, der Glasmann von Orpheus, dem erbitterten Feind von Meggie, Mo und Staubfinger. Denn Orpheus plant Rache an allen, die ihn zu Fall gebracht haben, doch vor allem an Staubfinger, und er nutzt einen furchtbaren Zauber. Sind Bilder mächtiger als Worte? Staubfinger zieht aus, die Antwort zu finden. Und wünscht sich, er hätte seine Freunde eingeweiht in das, was ihm vor vielen Jahren passiert ist – in einer anderen Welt.
Das vierte magische Abenteuer der Tintenwelt-Reihe
Für Ben,
der mir erklärt hat, dass es nur eine Kunst schon immer gab.
Und für Anna,
die mir half, diese Geschichte richtig zu erzählen.
Eine Zusammenfassung der Ereignisse, die diesem Buch vorausgingen, findest du hinten. Aber Achtung, sie stammt aus Orpheus’ Feder und ist daher mit Vorsicht zu genießen.
Feuerschatten
Wer will, soll glücklich sein, denn morgen ist uns nichts gewiss.
Lorenzo de’ Medici
Schwarz war die Welt. Es war Nacht in Ombra. Nur die Mauern der Burg färbten sich rot, als hätte die untergehende Sonne sich zwischen ihnen versteckt. Auf den Zinnen standen Wächter aus Feuer zwischen Soldaten aus Fleisch und Blut. Auch unten zwischen den Torbögen und auf dem Hof, wo die Lebenden sich drängten, formten die Flammen die Silhouetten von Frauen, Männern und Kindern. Es herrschte Frieden in Ombra, seit mehr als fünf Jahren. Doch in dieser kühlen Septembernacht gedachte die Stadt all derer, die für diesen Frieden gestorben waren, und wie jedes Jahr gab ihnen ein Mann durch die Flammen eine Gestalt.
Feuertänzer. Staubfinger hörte, wie die Menge den Namen, den sie ihm gegeben hatte, voll Dankbarkeit murmelte. Sein Feuer beschwor jedoch nicht bloß einmal im Jahr Ombras Tote auf der Burg herauf. Es erhellte nachts die Gassen und wärmte sie im Winter, spendete Trost und Freude, wenn er es spielen ließ, und war Staubfingers Dank für all das Glück, das diese Stadt ihm in den letzten Jahren beschert hatte.
Die Fürstin, die nun schon lange Ombras Frieden hütete, stand auf dem Balkon, von dem aus sie ihren Untertanen schon gute und schlimme Nachrichten verkündet hatte. Violante hieß nicht länger die Hässliche. Die Tapfere nannte man sie nun, bisweilen sogar die Gütige. Violante trug gewöhnlich Schwarz, doch in dieser Nacht war ihr Kleid weiß, denn das war die Farbe der Trauer in Ombra.
Staubfingers Tochter stand wie immer an ihrer Seite. Brianna glich Roxane inzwischen sehr, obwohl sie Staubfingers rotes Haar geerbt hatte. Sie lächelte ihrer Mutter zu, als Roxane sich aus der wartenden Menge löste und den Kopf vor Violante neigte.
Roxanes langes Haar war mittlerweile grau, und sie flocht es nun meist, statt es wie früher offen zu tragen, doch die Jahre hatten sie für Staubfingers Augen nur noch schöner gemacht. Es wurde still, als sie zu singen begann, so still wie damals, als er ihre Stimme zum ersten Mal gehört hatte, auf einer anderen Burg, vor Fürsten und reichen Händlern, die über ihrem Gesang sogar ihre Schönheit vergessen hatten.
Das Feuer zeichnete Roxanes Schatten auf die Mauern, als sie von denen sang, die Ombra verloren hatte. Ihre Stimme füllte den Hof mit der Sehnsucht nach ihnen, mit Erinnerungen an ihr Lachen und Weinen, und gab ihnen für eine Nacht, wie Staubfingers Feuer, das Leben zurück.
Verloren und gefunden …
Staubfinger ließ den Blick über die Menge streifen.
So viele Gesichter. So viele Geschichten.
Nicht alle waren mit der seinen verwoben, aber einige von ihnen hatten das Muster seines Lebens für immer verändert. Da stand Fenoglio, dessen Worte ihm so viel Unglück beschert hatten, mit seinem Glasmann auf der Schulter und Dante an der Hand, dem kleinen Sohn von Resa und Mortimer, der so alt wie der Frieden in Ombra war. Resa lächelte Staubfinger zu, als sie seinen Blick bemerkte. Sie teilten Erinnerungen, die dunkler als der Himmel über ihnen waren. Ihre Geschichten hatten sich oft überschnitten, in dieser und in einer anderen Welt. Mortimer war inzwischen wieder ein Buchbinder, doch niemand hatte die Lieder vergessen, die man über ihn gesungen hatte, als er die Maske des Eichelhähers getragen und die eigene Freiheit für das Leben von Ombras Kindern eingetauscht hatte.
Mortimer blickte zu Staubfinger herüber, als hätte er seine Gedanken gehört. Zauberzunge. Mortimers Stimme hatte eine andere Macht als die von Roxane, doch zum Glück machte er schon lange keinen Gebrauch mehr davon. Dass er ebenso wie Fenoglio aus einer anderen Welt stammte, wusste natürlich niemand in Ombra.
Nein. An all das wollte er sich heute Nacht nicht erinnern: an all die Jahre in der falschen Welt, die verzehrende Sehnsucht … Du bist hier, Staubfinger, erinnerte er sich, während sein Blick von Roxane erneut hinauf zu Brianna wanderte. Du hast, was du dir ersehnt hast. Deine Frau, deine Tochter und die Welt, die du liebst. Warum fühlte er trotzdem die alte Rastlosigkeit, die ihn schon in seiner Jugend umgetrieben hatte? »Du willst dich wieder davonmachen, oder?« Roxane hatte ihn das erst gestern halb im Scherz gefragt. Sing sie fort, Roxane!, dachte Staubfinger. Sing sie einfach fort, die Unrast in meinem dummen Herzen.
Ihr Gesang füllte den nächtlichen Burghof mit dem Schmerz, den es brachte, die zu verlieren, die man liebte, aber auch mit der Gewissheit, dass die Liebe den Schmerz immer wert war. Mortimers Tochter Meggie glaubte das derzeit sicherlich. Aus dem Mädchen, das Staubfinger einst so feindselig angestarrt hatte, war eine junge Frau geworden, und ganz Ombra liebte Doria, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Kein Wunder. Wie konnte man einem Jungen widerstehen, der sich Flügel aus Holz und Leinen baute und damit von der Stadtmauer flog? Meggie küsste ihn zärtlich, als Roxanes Stimme verklang, und Staubfingers Flammengestalten wurden zu feurigem Pollen, den der Wind hinauf in den dunklen Himmel trug.
»Roxanes Stimme wird mit jedem Jahr schöner, aber dein Feuer war auch nicht schlecht.« Eine warme Hand legte sich auf seine Schulter.
Der Umhang, den der Schwarze Prinz trug, war so blau, dass er Staubfinger an einen tiefen See oder dunkle Sommerhimmel denken ließ. Nyame liebte Blau. Blau und Gold waren schon immer seine Farben gewesen, lange bevor man begonnen hatte, ihn den Schwarzen Prinzen zu nennen.
Violante winkte der Menge ein letztes Mal zu, bevor sie in ihren Gemächern verschwand, und der Burghof begann sich zu leeren. Es war eine kalte Nacht ohne das Feuer.
»Wo ist dein Marder? Langweilt dein sesshaftes Leben Gwin?« Nyame schenkte ihm ein wissendes Lächeln. Sie waren schon so lange Freunde, dass er wusste, wie sehr der Marder Staubfingers Rastlosigkeit verkörperte. Für den Schwarzen Prinzen hatten die letzten Jahre wenig Frieden gebracht. Es gab immer einen Fürsten, der seine Untertanen schlecht behandelte, und wenn Nyame sich ein paar ruhige Tage im Lager der Spielleute gönnte, tauchte sicher bald eine Abordnung verzweifelter Bauern auf und bat ihn um Hilfe.
»Da! Bist du blind? Dort hinten beim Tor!« Die schrille Stimme von Fenoglios Glasmann schnitt durch die Nacht. Rosenquarz spitzte dem Tintenweber seit vielen Jahren die Schreibfedern. Er fiel fast von Fenoglios Schulter, so aufgeregt wies er mit seinem blassroten Finger dorthin, wo die Menschen an den Wachen vorbei nach Hause strömten.
»Unsinn!«, fuhr Fenoglio ihn an. »Es war irgendein anderer Glasmann, und nun reg dich ab. Du wirst noch eines Tages zerspringen, weil du dich wegen jeder Nichtigkeit aufregst!«
»Nichtigkeit?«, schrillte Rosenquarz’ feine Stimme. »Eisenglanz ist ein Schurke! Und hast du vergessen, wem er diente? Orpheus!«
Staubfinger glaubte zu spüren, wie ihm das Herz zu Eis wurde.
Orpheus.
Nein. Er war tot oder weit, weit fort.
»Schluss!«, rief Fenoglio entnervt. »War Orpheus bei ihm? Nein. Na bitte!«
»Und?«, zeterte Rosenquarz. »Das beweist gar nichts. Und der Kerl, auf dessen Schulter er saß, sah alles andere als vertrauenerweckend aus!«
»Ich sage Schluss!«, fuhr Fenoglio ihn erneut an. »Mir ist kalt, und Minerva hat sicher schon die köstliche Suppe aufgewärmt, die sie heute Morgen gekocht hat.«
Dann war er in der Menge verschwunden, die durch das Burgtor drängte. Staubfinger aber stand da und hielt zwischen all den Menschen Ausschau nach einer Schulter, auf der ein Glasmann mit grauen Gliedern hockte. Wie schmerzhaft schnell sein Herz schlug. So schnell von all der alten Furcht, die der Klang eines Namens zurückbrachte.
Orpheus.
Was, wenn Rosenquarz recht hatte? Was, wenn nicht nur Orpheus’ Glasmann, sondern auch Orpheus selbst in Ombra war? Schrieb er schon in irgendeiner Kammer Worte, die Staubfinger erneut alles rauben würden, was ihn glücklich machte?
»Was?« Nyame schlang ihm den Arm um die Schulter. »Guck nicht so besorgt drein! Selbst wenn es Orpheus’ Glasmann war. Du hast gehört, was Rosenquarz gesagt hat. Er hat längst einen anderen Herrn! Glaubst du allen Ernstes, wir hätten all die Jahre nichts von Orpheus gehört, wenn er noch am Leben wäre?«
Er klang tatsächlich unbesorgt.
Aber für Staubfinger kamen die Erinnerungen zurück, ob er wollte oder nicht. Ein Gesicht, zornrot wie das eines gekränkten Jungen, blassblaue Augen hinter runden Brillengläsern, verschlagen trotz ihrer scheinbaren Unschuld. Und dann die Stimme, so voll und schön, die ihn aus der falschen Welt zurück in diese gebracht hatte. Du hast dich auf die Seite des Buchbinders gestellt, Feuertänzer. Das war grausam, sehr grausam.
Violantes Wachen verriegelten hinter ihnen das Burgtor für die Nacht, und die Menschen, die sich versammelt hatten, um die Toten zu ehren, verloren sich in den Gassen der Stadt. Trug einer von ihnen den Glasmann auf der Schulter, der Staubfinger die Antwort hätte geben können, ob sein Herr noch lebte?
Geh, Staubfinger. Such nach ihm!
Roxane hatte sich den anderen Spielfrauen angeschlossen. Sie wollten sich noch im Lager unten am Fluss treffen. Aber Staubfinger hatte die samtene Stimme im Kopf, die er zum ersten Mal in einer anderen Welt gehört hatte: Mein schwarzer Hund bewacht deine Tochter, Feuertänzer. Aber ich habe ihm befohlen, sich einstweilen nicht an ihrem süßen Fleisch und ihrer Seele satt zu fressen. Die Schrecken der Vergangenheit waren so viel mächtiger als die feurigen Schatten, die er heute Nacht beschworen hatte.
»Nardo! Kommst du?« Nyame blickte sich fragend zu ihm um. Dass ihre Vornamen mit demselben Buchstaben begannen, hatten sie in ihrer Jugend beide als Beweis dafür betrachtet, dass ihre Freundschaft vom Schicksal beschlossen war. Warum hatte er Nyame und Roxane bloß nie die Wahrheit gesagt? Über das Buch und die andere Welt, über all die furchtbaren verlorenen Jahre und den Mann, dessen Stimme ihn zurückgebracht hatte? Hatte das Leben ihn nicht oft genug gelehrt, wie einsam Geheimnisse machten?
Du verstehst nicht!, wollte er Nyame zurufen. Es gibt ein Buch, das von uns erzählt. Nur deshalb ist Orpheus in diese Welt gekommen.
Aber Staubfinger schwieg, wie er es all die Jahre seit seiner Rückkehr getan hatte. Der Glasmann musste sich irren. Orpheus war tot. Oder zurück in seiner Welt, wo der Feuertänzer und der Schwarze Prinz bloß die Helden einer erfundenen Geschichte waren.
Andere Worte
So wie das Leben nun mal ist, träumt man von Rache.
Paul Gauguin
Regen! Regen jeden Tag. Und die Kälte! Orpheus warf noch ein Holzscheit in den zugigen Kamin, der kaum die Hälfte seiner schäbigen Kammer wärmte. Gut, es war Ende September, aber es war seit Wochen kalt!
Grunico … Der Name hatte so verheißungsvoll geklungen, als er halb erfroren durch das Stadttor gestolpert war. All das Silber an den Türen, die gut gefüllten Läden, die Pelzkragen an den Mänteln der besser betuchten Bürger … All das hatte Wohlstand und endlose Möglichkeiten versprochen. Blendwerk. Die Stadt zahlte Steuern an irgendeinen Herzog, der sie nie betreten hatte, und die Fürstenfamilien und die reichen Händler, die in der Stadt den Ton angaben, waren knauserig und engstirnig. Man fand Orpheus’ Worte zu blumig und seine Stimme zu samten. Niemand gab etwas auf seine Talente. Fünf trostlose Jahre hatte er inzwischen damit verbracht, den untalentierten Sprösslingen der Elite der Stadt die einfachsten Regeln der Schreibkunst beizubringen. Perlen vor die Säue, tagaus, tagein … Hatte er dafür die Welt gewechselt? Hatte er dafür der modernen Welt abgeschworen und Heizungen, die sich mit einem Handgriff aufdrehen ließen? Die Frage ist müßig, Orpheus, die Tür ist zu! Er konnte nicht zählen, wie oft er es versucht hatte, aber seine Zunge hatte ihn ebenso verraten wie diese ganze verdammte Welt. Und nun berichtete der Glasmann auch noch, wie üblich, vom Glanz und Wohlstand Ombras!
Eisenglanz verabscheute Reisen. Er fand kein Ende, wenn er sich über die Mühen beklagte, die er auf sich nahm, um seinen Herrn auf dem Laufenden über die Geschicke seiner Feinde zu halten, und Orpheus hasste die Neuigkeiten, die er dank des Glasmanns erfuhr. Trotzdem konnte er es einfach nicht lassen, Eisenglanz an den Ort seiner alten Triumphe zu schicken. Und sich jedes Mal, wenn Eisenglanz berichtete, wie hervorragend es seinen Feinden ging, dieselbe leidige Frage zu stellen: Wie wäre dein Leben verlaufen, Orpheus, wenn deine Mutter nicht ausgerechnet Fenoglios Buch aus dem Regal der schäbigen Leihbibliothek gezogen hätte, in die sie so gern vor den Zornausbrüchen deines Vaters floh? Ja, wie? Er hätte nie von Staubfinger gehört und nie die dumme Idee gehabt, ihm in diese Welt zu folgen. Ja, bloß wegen des Feuertänzers war er hier, und wie hatte der verrußte Dreckskerl ihm das gedankt? Er hatte gemeinsame Sache mit dem Buchbinder und all seinen anderen Feinden gemacht.
Hör auf, Orpheus!
Er schickte den Glasmann inzwischen mit einem Begleiter aus, weil Eisenglanz durch seine lächerliche Größe Monate brauchte, um zu ihm zurückzukehren. Baldassare Rinaldi nannte sich einen Troubadour. Orpheus verabscheute seit seiner Kindheit jede Art von Musik, aber Rinaldis Lieder schmerzten die Ohren mehr als alles, was je in sie hineingedrungen war. Trotzdem war er Orpheus nicht nur wegen seiner schlechten Lieder aufgefallen, sondern vor allem durch die Verschlagenheit, mit der er die Gäste der Weinbar bestahl, in der Orpheus ihm zum ersten Mal begegnet war. Nach einem Krug Wein, den er wie ein geübter Trinker leerte, hatte Rinaldi damit geprahlt, dass er nicht nur schlechte Lieder schrieb, sondern auch ein begabter Mörder war und ihm gegen angemessene Bezahlung jeden Feind vom Hals schaffen konnte. Jeden Feind … Natürlich hatte Orpheus auf der Stelle an Staubfinger gedacht. Aber wie tötete man einen Mann, den die Weißen Frauen hatten gehen lassen und der seither als unsterblich galt? Ganz abgesehen davon, dass eine aufgeschlitzte Kehle oder ein Dolch in den Rücken kaum all die Demütigungen gutmachen würden, die der Feuertänzer ihm beschert hatte.
Eisenglanz zirpte immer noch von all dem Glück und Wohlstand, die die Gassen füllten. Blablabla! Violante nannten sie nun die Tapfere. Ha! Wie verächtlich sie ihn gemustert hatte, als er ihr damals angeboten hatte, gemeinsam über Ombra zu herrschen. Nun verkaufte sie ihre Juwelen, um die Armen zu füttern. Sie hatte eindeutig zu viel Zeit mit dem edlen Dummkopf Mortimer verbracht. Ja, den hätte er natürlich auch gern tot gesehen, ebenso wie dessen Frau und Tochter, von Fenoglio ganz zu schweigen. Doch sein Hass auf sie alle war nur ein glimmendes Streichholz, verglichen mit seinem Hass auf Staubfinger. Wenn er ihn doch nur in mächtige Worte hätte fassen können, Worte, die Staubfinger in seinem eigenen Feuer verbrannten! Aber nein. Er war längst nicht mehr der tragische Held, für den Orpheus ihn einst in einem Buch geliebt hatte. Ombra feierte Staubfinger. Selbst sein Feuer spuckender Lehrling war inzwischen bis nach Lothringen berühmt.
Orpheus wurde so übel, dass er sich in einen Eimer übergab.
Verdammt! Wieso hatte er sie nicht alle in den Tod geschickt, als ihm die Worte noch gehorcht hatten? Fenoglios Worte, Orpheus!, wisperte es in ihm. Und? Seine Zunge hatte sie zum Atmen gebracht. Bevor sie ein nutzloser Klumpen in seinem Mund geworden war. Drei Bücher gefüllt mit Worten des Tintenwebers hatte er Violante gestohlen, doch all die Rachefantasien, die er aus ihnen zusammengeschrieben hatte, waren leblose Tinte geblieben, sooft er sie auch gelesen hatte.
»Er baut sich Flügel und fliegt damit mehr als zweihundert Meter weit, Herr!« Eisenglanz machte kein Hehl daraus, wie beeindruckt er von der Erfindungskunst des Jungen war, der Mortimers Tochter Meggie den Hof machte. Bestens. Hoffentlich brach er ihr das Herz, und sie warf sich von der Stadtmauer. Ohne die Flügel, die ihr Liebster baute.
»Sei endlich still! Ich hab mehr als genug gehört. Spitz ein paar Federn und pack die Tinte ein!«, fuhr Orpheus den Glasmann an. »Wir müssen uns auf den Weg machen. Ich habe eine neue Schülerin!«
»Aber ich muss mich von der Reise erholen!«, zeterte Eisenglanz.
»Ach ja?«, erwiderte Orpheus, während er die Zehen in die ausgetretenen Stiefel zwängte, die er schon allzu oft zum Schuster getragen hatte. »Glaub nicht, dass ich so dumm bin zu glauben, dass deine Erschöpfung vom Reisen stammt! Du treibst dich mit Rinaldi in den Tavernen herum. Warum sonst bringst du jedes Mal nichts als Propagandageschwätz zurück? Schluss! Kein Wort mehr!«
Wenn er sich nur selbst nach Ombra hätte aufmachen können. Aber Staubfingers Feuer war ihm in allzu deutlicher Erinnerung, und dann waren da noch die Weißen Frauen, die so gern Mortimers Schutzengel spielten. Von dessen Geschick mit einem Schwert ganz zu schweigen … Nein! Noch durften sie alle nicht erfahren, wo er sich verbarg. Nicht, solange er so macht- und mittellos war.
Der Regen rann Orpheus in den Kragen, als er auf die Gasse hinaustrat, und schon an der nächsten Ecke war er nass wie ein Straßenhund. Den Mantel, den er trug, hatte der Hofschneider des Natternkopfs genäht, doch inzwischen konnte selbst die geschickteste Glasfrau ihn nicht mehr stopfen, ohne dass man die Flicken sah. Reichtum war eine Droge, die Orpheus erst in dieser Welt gekostet hatte, und die Entwöhnung schmerzte. Was auch immer, Schluss mit dem Klagen! Eisenglanz fand damit auch kein Ende. Er schimpfte auf seiner Schulter allen Ernstes über den Regen. Als ob ihm der etwas ausmachen konnte mit seiner Haut aus Glas! Orpheus fuhr ihn an, still zu sein – und trat in eine Pfütze, die ihm den Stiefel mit wässrigem Ziegenmist füllte. Nein! Ein dreimal verfluchtes Nein! Er hatte Einhörner in diese Welt gelesen, bunte Feen, Blättermänner … Er war der Einzige gewesen, der den Eichelhäher das Fürchten hatte lehren können!
Eine Kutsche ratterte über das Kopfsteinpflaster und tränkte allen, die nur zu Fuß unterwegs waren, die Kleider mit schmutzigem Sud. Der reiche Händler, der aus dem Kutschfenster starrte, warf einen gelangweilten Blick auf Orpheus’ regennasse Gestalt. Ein Niemand, ja, das war er erneut. Ohne Macht, geld- und wortlos, mit einer Stimme, die nicht mal die Mäuse erschreckte, die sein Brot fraßen.
Orpheus blieb vor dem silberbeschlagenen Portal stehen, hinter dem sein neuer Kunde residierte. Natürlich. Alessio Cavole wohnte in einem der prächtigsten Häuser der Stadt, denn er bezahlte seine Weber so schlecht, dass ganz Grunico sie die Hungerweber nannte.
Der Diener, der die Tür öffnete, musterte ihn so herablassend, dass Orpheus sich statt des Glasmanns eine Krähe auf die Schulter wünschte, die dem eingebildeten Stiefelputzer die braunen Augen aushackte. Von den Wänden der Eingangshalle, durch die er Orpheus ungeduldig winkte, starrten die geschnitzten Fratzen, die man überall in Grunico sah. Angeblich hielten sie unerquickliche Berggeister fern, aber Orpheus bescherten sie bloß abscheuliche Albträume. In all den Jahren war es seine einzige Genugtuung gewesen, dass Fenoglios Worte im Umland von Grunico offenbar ebenso wenig zu sagen hatten wie seine eigenen. Die Kreaturen, die hier die Wälder und Schluchten unsicher machten, hatte der Alte nie erwähnt. Orpheus musste es wissen. Schließlich kannte er Fenoglios Buch auswendig. Mandl, Muggestutze und Nörgele, haarige Kobolde, deren Namen niemand auszusprechen wagte, menschenfressende Spinnen und Ziegenböcke … Von ihnen allen fand sich in Tintenherz kein Wort. Was nur erneut ein Beweis dafür war, dass Fenoglio bloß einen unbedeutenden Schnipsel dieser Welt beschrieben und sie keineswegs erfunden hatte.
Der weite Wohnraum, in den der Diener Orpheus führte, hatte fast so hohe Decken wie die Burgzimmer, in denen er als Günstling des Natternkopfs residiert hatte. Geschnitzte Möbel aus Venetia, Teppiche aus Parsien, Wandbehänge, die die kalten Wände wärmten … Für die Reichen dieser Stadt war Grunico ein angenehmer Ort. Es gab Theater für sie, Hauskonzerte, Empfänge und Festmähler, die Tage dauerten. Aber nicht für dich, Orpheus.
Seine neue Schülerin stand mit missmutigem Gesicht in der Mitte des Raumes. Serafina Cavole war die jüngste Tochter des Tuchhändlers. Sie trug ihr aschblondes Haar in straffen Flechten, wie es für ihr Alter Sitte in Grunico war, aber das mit Silberfäden bestickte Kleid verriet erste Anzeichen von Fraulichkeit. Sein Unterricht sollte sicher dabei helfen, sie gut zu verheiraten.
»Setz dich.« Orpheus’ Stimme wurde bei schlechtem Wetter schnell heiser, auch wenn sie immer noch aus Samt war. Nutzloser, verschlissener Samt …
Das Buch, das er für den Unterricht benutzte, stammte aus der Bibliothek eines Bankiers, dessen minderbemittelten Sohn er unterrichtete. Der Diebstahl war wie erwartet unbemerkt geblieben. Die Reichen Grunicos betrachteten Bücher als Statussymbole und verspürten wenig Versuchung, sie aufzuschlagen. Das war in seiner alten Welt zugegebenermaßen nicht anders gewesen.
Seine Schülerin setzte sich wortlos an das Schreibpult, das ein Diener eigens für den Unterricht hereinbrachte, und griff nach der Feder, die Eisenglanz ihr hinschob. Der Glasmann klagte immer öfter, dass seine Talente bei diesen Schreibübungen verschwendet waren. Orpheus hatte Eisenglanz sogar schon dabei ertappt, dass er sich an üppig verschlungenen Initialen und Gesichtern versuchte, aber er bewies wenig Talent und verlor sich mit seinen winzigen Händen sehr leicht in Details.
»Meine Methode funktioniert folgendermaßen.« Orpheus schlug das Buch auf, während Eisenglanz das Tintenfass öffnete. »Falls du dich verschreibst, wird mein Glasmann über die feuchte Tinte laufen. Solltest du trödeln oder ganze Wörter auslassen, gießt er sie dir übers Papier.«
Eisenglanz lächelte böse, während er sich neben das Tintenfass stellte. Die Aussicht auf Strafmaßnahmen tröstete ihn etwas darüber hinweg, dass er bei diesen Stunden kaum mehr als ein Federhalter war.
Serafina Cavole verschrieb sich oft. Bei allen Nachtmahren – ihr Ungeschick übertraf sogar das der Juwelierstochter, die bei jedem Wort mit mehr als drei Buchstaben die Zunge zwischen die Zähne klemmte. Die zwei stellten mit ihren klecksenden Federn sicher, dass Orpheus’ Verachtung für Worte noch tiefer wurde. Einst hatten sie Welten in sich geborgen, Reichtum und Macht herbeigesungen. Worte waren der Anfang und das Ende aller Dinge für ihn gewesen. Nun waren sie bloß noch eine Ansammlung ungelenk geschriebener Buchstaben.
»Der Bauer pflügt, beschützt vom Schwert des Fürsten, dem er dient. Worauf wartest du? Schreib!«
Serafina Cavole setzte die Feder auf das aus Lumpen geschöpfte Papier und warf ihm einen feindseligen Blick zu.
Orpheus fand den Pergamentstreifen zwei Wochen später, als er sein karges Abendessen mit einem Krug billigen Weins hinunterspülte, an demselben Tisch, an dem er so viele Jahre vergebens versucht hatte, Fenoglios Worten Leben einzuhauchen. Die Tischplatte war angesengt, seit er darauf die Eichelhäher-Bücher verbrannt hatte, in der Hoffnung, dass Mortimer, wenn schon nicht die Worte, dann wenigstens das Feuer spüren würde. Aber nein, er band Bücher in Ombra, für die angeblich die halbe Tintenwelt zu ihm kam. Verflucht sollte er sein! Wann kam endlich der Tag seiner Rache? Niemals! Er war nur noch eine Nebenfigur, die keinen Einfluss auf den Verlauf dieser Geschichte hatte. Orpheus füllte sich den Becher so ungestüm mit Wein, dass er ihn über das Buch goss, aus dem er seinen Schülern diktierte. Er war fluchend dabei, die durchweichten Seiten voneinander zu lösen, als er den Streifen Pergament entdeckte. Die winzigen Buchstaben, die ihn bedeckten, waren zu vollkommen gesetzt, um von einer seiner Schülerinnen zu stammen. Und die Worte …
Ein Sud aus Blut und Nesselsaft
Gibt deinem Wunsch die Zauberkraft.
Der Glasmann soll sich winden
Vor Schmerzen wie ein Wurm.
Orpheus hob lauschend den Kopf. Ein gläsernes Keuchen drang hinter dem leeren Weinkrug hervor. Eisenglanz lag dahinter und presste sich stöhnend die Hände auf den Bauch. Er krümmte sich so sehr, dass seine Stiefel Kerben in den Tisch schabten.
Unglaublich!
Der Glasmann soll sich winden … Oh, das war fantastisch. Aber wer hatte den Streifen Pergament in das Buch gesteckt? Orpheus starrte auf die wohlgesetzten Worte. Serafina Cavole … Sie war seine letzte Schülerin gewesen. Ja, sie musste es gewesen sein. Er hatte sie für ein paar Minuten allein gelassen, um ihrer Mutter zu eröffnen, dass ihre Tochter weit mehr Stunden brauchen würde als geplant. Also hatte sie es deshalb mit solchem Gleichmut hingenommen, dass Eisenglanz gleich ein Dutzend Mal seine Fußspuren in ihrer Tinte hinterlassen hatte. Es war die Aussicht auf Rache gewesen!
Aber wer hatte die Worte für sie geschrieben?
Eisenglanz wand sich immer noch, das Gesicht verzerrt vor Schmerz, als Orpheus sich von seinem Diener den Mantel bringen ließ. Eigentlich konnte er sich keine bezahlte Hilfe leisten, aber Rudolf kochte und putzte für einen Hungerlohn und bewahrte wenigstens etwas von der Illusion, dass er immer noch zu den Bessergestellten gehörte.
Draußen war der Himmel zur Abwechslung klar, als Orpheus sich erneut auf den Weg zum Haus der Cavoles machte. Das Licht eines bleichen Mondes streifte das Pflaster der überdachten Säulengänge, die Grunicos Bürger entlang der besseren Straßen vor dem ewigen Regen schützten. Eine alte Bettlerin, die dort schlief, griff nach Orpheus’ Hand, als er vorbeihastete, um ihm die Zukunft zu lesen, aber er stieß sie so grob zurück, dass sie hinfiel. Seine Zukunft war noch nicht geschrieben, o nein, und vielleicht würde sie doch nicht so finster sein, wie sie ihm noch vor einer Stunde erschienen war.
Der missmutige Diener, der ihn auch tagsüber einließ, öffnete die Tür. Er machte kein Hehl daraus, wie unpassend er den abendlichen Besuch fand, aber Orpheus konnte ihn davon überzeugen, dass er seiner Schülerin, zugegeben sehr verspätet, die Schulaufgaben brachte.
Serafina Cavole war nicht so dumm, an diesen Anlass seines Besuches zu glauben. Orpheus sah ihr an, dass sie wusste, weshalb er gekommen war.
»Lass es aufhören!«, fuhr er sie an. »Und zwar auf der Stelle.« Warum sich mit Höflichkeiten aufhalten? »Ich brauche den Glasmann noch, aber ich will wissen, wer dir die Worte geschrieben hat.«
Serafina warf einen Blick zur Tür, die der Diener hinter sich geschlossen hatte. Orpheus war nicht sicher, ob sie es in der Hoffnung tat, ihre Eltern dort zu sehen, oder aus Sorge. In dem stoischen Gesicht war schwer zu lesen.
Schließlich streckte sie ihm auffordernd die Hand hin.
Orpheus zögerte, doch dann zog er den Pergamentstreifen aus der Tasche und reichte ihn ihr. Sie spuckte dreimal auf die geschriebenen Worte und gab ihm den Streifen zurück.
»Das ist alles?«
Ein Nicken.
»Also, wer hat die Worte geschrieben? Was kann er noch geschehen lassen?«
»Sie.« Serafina starrte ihn trotzig an. »Sie hat einen Jungen verliebt in mich gemacht.«
Teufel, Grunico war ein gefährlicherer Ort, als er gedacht hatte. Und ein wesentlich interessanterer!
»Welche Sie? Hast du gehört, wie sie die Worte gelesen hat? Man muss sie laut lesen, damit sie wahr werden, oder?«
Die Tuchhändlertochter runzelte die Stirn.
»Laut lesen?«, erwiderte sie mit aufreizend herablassender Stimme. »Warum sollte man sie laut lesen? Es soll sie ja keiner hören. Außerdem sind die Worte nicht wichtig. Manchmal ist der Zauber auch in einem Saft. Oder in einem Stück Kuchen.«
Saft? Kuchen? Wollte sie ihn veralbern? Nein, sie klang ziemlich überzeugt von dem, was sie sagte. Aber was sollte das heißen: Außerdem sind die Worte nicht wichtig? Es gab keinen anderen Zauber in dieser Welt. Nun ja, vielleicht noch den Feuerzauber von Staubfinger. Aber sonst?
Ein Sud aus Blut und Nesselsaft … Die Worte auf dem Pergamentstreifen hatten sich vollkommen aufgelöst. Nur ein grauer Schleier verriet, wo sie gestanden hatten.
»Diese Sie … Wo kann ich sie finden?«
Diesmal war das Kopfschütteln sehr entschieden. »Niemand weiß, wo sie ist. Man stirbt, wenn man ihr zu nahe kommt. Man trifft nur ihre Schülerin. Eine Freundin hat mir den Zauber besorgt. Ich hab sie mit einem Ring meiner Mutter bezahlt.«
Orpheus drohte, den Pergamentstreifen ihren Eltern zu zeigen, um mehr von ihr zu erfahren, aber Serafina presste die Lippen zusammen und schwieg. Sie hatte tatsächlich Angst. Hatte sein Name oder der von Fenoglio je solche Furcht ausgelöst? Orpheus spürte ein Schaudern auf der fröstelnden Haut.
Als er das dumme Ding bei den Zöpfen packte, um ihr wenigstens den Namen ihrer Freundin zu entlocken, kreischte sie so laut, dass ihre Mutter hereinstürzte. Der Diener versuchte nicht zu verbergen, wie gern er Orpheus am verschlissenen Kragen packte und hinaus auf die dunkle Gasse stieß. Worte, die sich in Spucke auflösten. Blut und Nesselgift. Saft und Kuchen. Orpheus’ Verstand raste, während er sich den Schmutz von den Kleidern wischte und über das regennasse Pflaster heimwärts hastete.
Man stirbt, wenn man ihr zu nahe kommt.
Eisenglanz lebte noch, als Orpheus in seine zugige Kammer zurückkam. Der Glasmann schnarchte erschöpft in der Schublade, in der er sich ein Bett aus Lumpen und Vogelfedern gebaut hatte. Nun gut … die Worte auf dem Pergamentstreifen hatten nichts vom Töten gesagt.
Außerdem sind die Worte nicht wichtig …
Rudolf stand in der schäbigen Küche, die sie sich mit den anderen Bewohnern des Hauses teilten, und kochte eine seiner faden Suppen.
»Zu wem geht man in dieser Stadt, wenn man einen Schadenszauber kaufen will? Und sag mir nicht, so was gibt es nicht.«
Rudolf zog den Kopf ein wie ein Huhn, dem man mit dem Beil drohte. Aber er brauchte die Arbeit. Rudolf hatte vier Kinder durchzufüttern. Das jüngste hatte ihn zum Witwer gemacht.
»Man kann es bei der verwunschenen Erle versuchen«, murmelte er. »Ihr Zauber macht oft krank, aber sonst bleibt nur die Frau im Wald.«
Verwunschene Erlen? Und wer war die Frau im Wald? Beide kamen definitiv nicht in Fenoglios Buch vor. Orpheus war inzwischen ziemlich sicher, dass Tintenherz wie ein Reiseführer nur von einem Land dieser Welt sprach und kein Wort über all die anderen verlor, die sich hinter Meeren und Gebirgszügen verbargen.
»Erzähl mir von dieser Frau im Wald! Nun mach schon!«
Rudolf warf ein paar Wurzeln in die trübe Suppe. »Man spricht nicht über sie. Sie ist eine Schattenleserin.«
»Eine was?«
»Es gibt die bösen und die guten Frauen im Wald. Die Bösen lernen ihre Zauber von den Schatten, die Guten vom Licht.«
Oh, das klang interessant.
»Und? Wo finde ich diese Schattenleserin? Denk an deine hungrigen Kinder!«
Rudolf beugte sich tief über den Topf, in dem er rührte.
»Man hinterlässt eine Nachricht auf dem alten Friedhof«, sagte er schließlich. »Dann kommt ihre Schülerin zu der verwunschenen Erle oben im Wald und nimmt den Wunsch entgegen. Den Wunsch und dann die Bezahlung.«
Er sprach das letzte Wort aus, als könnte es ihm die Lippen verbrennen.
Bezahlung. Nun, darüber konnte man später reden.
Eine Frau, die mit den Schatten sprach. Orpheus spürte, wie sich zum ersten Mal in vielen Jahren so etwas wie Hoffnung in ihm regte. Er hörte sie flüstern. Nein. Sie krächzte wie die Raben draußen auf den feuchten Dächern, heulte wie die Wölfe, die man nachts in den umliegenden Bergen jagen hörte. Wie hatte er nur so schlecht über Grunico denken können? Sie würde ihm seine Rache liefern, durch Zauberei, die nach Nesselsaft und Blut schmeckte, schmutzig und finster und sicher so viel mächtiger als Fenoglios Worte.
Rudolf blickte ihn an mit Augen, denen das Leben die Angst vor der Welt gelehrt hatte. »Handelt nicht mit ihr, Herr! Geht zu den Guten. Ihr Zauber ist voll Licht. Es soll eine nur sechzig Meilen von hier geben. Die andere bringt bloß Dunkelheit. Und Verzweiflung.«
Orpheus’ Herz schlug, als wollte es seine Rache herbeitrommeln. Bestens. Das war doch genau, was er brauchte.
»Vergiss das Licht!«, sagte er. »Ich will die Schatten! Die dunkelsten von allen!«
Neue Wege
Es gibt nur zwei Weisen, die Welt zu betrachten: Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder gibt.
Albert Einstein
Als der Schwarze Prinz wieder nach Ombra kam, war ein Monat verstrichen, seit Staubfingers Flammen die Toten zurückgebracht hatten. Die Bauern pflügten die abgeernteten Felder und pflückten ihre Oliven. Die Märkte rochen nach Trüffeln und Pilzen, und im Haus der Folcharts gab es ein Fest, um Meggie zu verabschieden, die zum ersten Mal gemeinsam mit Doria auf Reisen ging. Was ihrem Vater wohl gar nicht gefiel.
Die Gassen Ombras füllten sich bereits mit der Stille der Nacht, aber das Haus der Folcharts summte wie ein Bienenkorb, als Nyame durch die enge Tür trat. Die halbe Stadt war gekommen, aber Mortimer blickte tatsächlich alles andere als glücklich.
»Sie will mit Doria nach Andaluz. Das ist eine Reise von mindestens drei Wochen«, raunte er Nyame zu, während er ihn in seine Werkstatt winkte. »Denkst du nicht, dass das sehr leichtsinnig ist? Wir haben bereits Oktober! Die Winterstürme kommen bald, und auf der Schiffsroute soll es ein Seeungeheuer geben.«
Nyame war selten einem furchtloseren Kämpfer begegnet als dem Eichelhäher, doch wenn es um seine Kinder ging, machte Mortimer die ganze Welt Angst.
»Ja, von dem Ungeheuer hab ich gehört.« Nyame musste ein Lächeln verbergen. »Aber es soll nicht sehr groß sein. Glaub mir, Meggie hat schon wesentlich schlimmere Gefahren unbeschadet überstanden.«
Er kehrte Mortimer den Rücken zu, bevor der sah, dass seine herzliche Umarmung geschmerzt hatte. Nyame kurierte eine Wunde an der Schulter aus. Sie stammte von einer Lanze. Violantes Sohn Jacopo eiferte immer mehr seinem finsteren Großvater nach und terrorisierte mit seinen Freunden die Dörfer, die im Schatten der Nachtburg lagen. Die Lanze hatte Nyame gestreift, als er einen von ihnen vom Pferd gezerrt hatte, und Mortimer wusste von all dem besser nichts. Meggie und Resa sorgten sich eh, dass die Freundschaft mit ihm eines Tages den Eichelhäher zurückbringen würde. Aber Nyame hatte nicht vor, aus dem besten Buchbinder des Landes erneut einen Räuber zu machen.
Eins der frisch gebundenen Bücher auf Mortimers Arbeitstisch enthielt Resas Zeichnungen von Grasfeen, Glasmännern und Flussnymphen. Die Bilder waren meisterhaft, auch wenn sie sich sehr von denen unterschieden, mit denen Balbulus, Violantes berühmter Illuminator, die Bücher auf der Burg versah. Dem Prinzen gefielen Resas Bilder besser. Sie liebte, was sie zeichnete, während Balbulus beherrschen wollte, was er abbildete.
»Aber sie sind beide noch so jung!« Mortimer strich sich abwesend über den Arm. Die Narbe dort hatte er sich zugezogen, als sie gemeinsam ein Dorf bei der Nachtburg beschützt hatten. Der Buchbinder hatte den Eichelhäher fortgeschickt, aber die Narben auf seiner Haut würden immer von ihm erzählen.
»Jung? Doria muss für sich selbst sorgen, seit er zehn ist. Hat sein Bruder dir je erzählt, was für eine Kindheit die zwei überstanden haben? Glaub mir, dagegen klingt ein Seeungeheuer wirklich nicht schlimm.« Dorias älteren Bruder Lazaro nannten alle seiner Größe wegen nur den Starken Mann, und zum Glück hatte er Doria und seine Mutter irgendwann vor ihrem trunksüchtigen Vater beschützen können.
»Weißt du, warum sie ausgerechnet nach Andaluz wollen?«
Die Königin dort aß angeblich Perlen, damit ihre Haut so weiß wie Schnee wurde, und besteuerte Untertanen mit dunkler Haut doppelt.
»Ein Händler hat Doria erzählt, dass es dort einen Spiegel gibt, durch den man in eine andere Welt kommt.«
Nyame konnte den Blick nicht lesen, den Mortimer ihm zuwarf. Eine andere Welt? Ihm reichte diese eine. Selbst wenn er hundert Jahre leben sollte, würde er nur einen kleinen Teil von ihr kennen.
»Sie sind jung«, sagte er. »Und sie wollen ihren eigenen Ort finden. Einen, der nur ihnen gehört, nicht ihren Eltern. An das Gefühl erinnerst du dich doch bestimmt?«
Mortimer schwieg, als wäre er nicht sicher, ob er das tat. »Na ja, wie auch immer«, sagte er schließlich. »Ich hoffe für Doria, dass er mir meine Tochter heil zurückbringt.«
Meggie hatte schon oft bewiesen, dass sie sehr gut auf sich selbst aufpassen konnte, aber Nyame sprach den Gedanken nicht aus. Sie und Dante waren das Kostbarste, was Mortimer besaß. Er würde Meggie nie ohne Sorge ziehen lassen, selbst wenn hundert Männer seine Tochter bewachten. Nyame schlug das zweite Buch auf, an dem Mortimer arbeitete. Auch hier stammten die Bilder von Resa. Es enthielt ein paar der Märchen, die Fenoglio für die Kinder von Ombra geschrieben hatte.
»Violante hätte Resa bitten sollen, das Buch über den Eichelhäher zu illustrieren. Balbulus war nicht dabei, als du das leere Buch für den Natternkopf gebunden hast.« Nyame verwünschte seine Worte im selben Moment. Er sah den Häher sofort in Mortimers Gesicht. Hatte er sich nicht geschworen, ihn nie an ihn zu erinnern?
»Es ist seltsam, oder?«, murmelte Mortimer. »Die schlimmsten Erinnerungen liefern die besten Geschichten.«
»Nicht immer. Manche sind zu schlimm.« Nyame schloss das Buch und fuhr mit der Hand über den Einband. Mortimer hatte Falter aus Gold hineingeprägt. Niemand machte so schöne Bücher wie Mortimer Folchart, und deren Seiten würden noch Geschichten erzählen, wenn sie alle längst tot und vergessen waren. Es war gut, dass der Häher nun ein Buchbinder war.
»Lass uns zu den anderen gehen.« Nyame öffnete die Tür der Werkstatt und ließ den Lärm des vollen Hauses herein. »Ich habe Meggie etwas mitgebracht, das ihr helfen kann, Seeungeheuern aus dem Weg zu gehen.«
Es dauerte eine Weile, bis sie Meggie fanden, so dicht drängten sich Freunde und Nachbarn in dem Haus, das die Folcharts seit fünf Jahren bewohnten. Nyame war wie Staubfinger unter Spielleuten aufgewachsen, ohne ein Zuhause wie dieses, von Ort zu Ort ziehend. Es gefiel ihm immer noch, so zu leben. Er vermisste die festen Mauern nicht, obwohl sie das Leben bisweilen sicherer machten und er schon viel verloren hatte auf der Reise. Nicht jetzt, Nyame, sagte er sich, während er Mortimer durch die vollen Räume folgte. Er wollte keine Schatten in ein Haus bringen, das so voller Freude war.
Selbst Staubfingers Tochter Brianna war gekommen, obwohl sie die Burg nur selten verließ. Sie stand mit Lazaro zusammen und mit ihrem jüngeren Bruder Jehan, den man in Ombra den Jungen mit den Goldhänden nannte, weil selbst die erfahrensten Kunstschmiede vor Neid erblassten, wenn sie sahen, was aus Jehans Werkstatt kam. Alle Gäste hatten Geschenke gebracht. Lazaro hatte Satteltaschen gemacht, Meggies Freundinnen die Reisekleider, die daneben lagen, und von ihrem Vater stammte natürlich das Notizbuch, in dessen leeren Seiten Meggie gedankenverloren blätterte. Sie sah ihrer Mutter sehr ähnlich, aber Nyame entdeckte trotzdem auch immer Mortimer in Meggies Zügen. Ihre Umarmung war ebenso herzlich wie die ihres Vaters, doch vor Meggie konnte Nyame nicht verbergen, dass er für einen Moment vor Schmerz das Gesicht verzog.
»Es ist nur ein Kratzer«, flüsterte er ihr zu. »Dein Vater muss nichts davon wissen.«
Sie dankte ihm mit einem Lächeln. Meggie hatte oft genug Angst um ihren Vater haben müssen, und es war vielleicht kein Zufall, dass sie sich in einen Jungen verliebt hatte, der sich zwar aufs Kämpfen verstand, aber nicht allzu viel davon hielt. Doria hatte einen sehr gewalttätigen Vater gehabt und sich schon sehr jung lieber auf seinen Verstand als auf seine Kraft oder eine Waffe verlassen.
Nyame hatte den beiden für ihre Reise eine Karte von seinem besten Kundschafter zeichnen lassen. Das Seeungeheuer, das Mortimer Sorgen bereitete, war ebenso darauf zu finden wie ein geflügeltes Pferd, das angeblich nahe der Küste lebte, obwohl seine Existenz sehr umstritten war.
Meggie betrachtete die Karte mit großem Entzücken. »Resa freut sich, dass wir fahren, aber Mo macht sich schreckliche Sorgen«, raunte sie Nyame zu. Meggie hatte ihren Vater immer Mo genannt. Selbst als er für alle anderen nur der Häher gewesen war. »Wir sind nun schon so lange hier in Ombra. Ich glaube, Mo will nichts davon wissen, dass diese Welt so viel größer ist! Aber ich will die Sirenen sehen, die am Bodenlosen See leben, die Wiesen, wo die Glasfrauen goldenes Garn aus Sonnenlicht spinnen. Und hast du von dem Eisenmann gehört, den ein Schmied aus den Schwertern von Gefallenen gemacht hat? Jehan hat Doria von ihm erzählt!«
Die Geschichte kannte Nyame noch nicht. Es war, wie er zu Mortimer gesagt hatte: Diese Welt barg so viele Wunder, dass man sie in einem Leben unmöglich alle entdecken konnte.
Meggie hatte das Notizbuch aus der Hand gelegt. Nyame wusste, wer in der Tür stand, sobald er die Röte auf ihrem Gesicht sah.
Farid war ebenfalls erwachsen geworden. Er war inzwischen fast so hochgewachsen wie Nyame selbst. War die Tochter des Eichelhähers immer noch verliebt in ihn? Es gab Liebe, die ihre Saat jedes Mal neu austrieb, wenn man einander begegnete, er hatte sie selbst schon erlebt, und Doria war fast wie ein Sohn. Doch Meggie umarmte Farid bloß wie einen guten Freund, obwohl sein Anblick ihr noch die Röte ins Gesicht trieb, und Farids Augen suchten den Raum sofort nach seinem alten Lehrmeister ab. Aber Staubfinger ließ auf sich warten.
Farid war gerade dabei, Doria und Meggie vor einem riesigen Stier zu warnen, der in Andaluz sein Unwesen trieb, als Baptista plötzlich mit ihm in der Tür stand. Nyame sah Staubfinger sofort an, dass etwas nicht in Ordnung war. Er begrüßte Farid mit einem Nicken und winkte ihn, Nyame und Mortimer mit sich in die hinterste Ecke des Raumes.
»Dein Bär hat das hier gefunden«, raunte er, während Baptista etwas aus der Gürteltasche zog. Es war ein Hölzchen, kaum länger als Nyames Ringfinger, bedeckt mit feinen Schnitzereien. Das obere Drittel formte Schultern und einen Kopf, dessen Gesicht so lebensecht war, dass Farid ungläubig mit dem Finger über die geschnitzten Züge fuhr. Es war Nyames Gesicht.
»Der Bär hat es unter dem Fell gefunden, auf dem du schläfst«, sagte Baptista. »Er war dabei es zu beschnuppern, um herauszufinden, ob es fressbar ist.«
»Es sieht aus wie die Glücksbringer, die sie auf dem Markt verkaufen«, sagte Farid. »Manche sind geschnitzte Figuren von Violante oder dem Eichelhäher. Von mir und Staubfinger gibt es auch welche«, fügte er nicht ohne Stolz hinzu.
Aber Baptista schüttelte den Kopf. »Kein Mensch kann ein Gesicht so schnitzen. Man sieht keine Spur von irgendeinem Werkzeug. Es sieht aus, als wäre das Gesicht aus dem Holz gewachsen!« Baptista wusste, wovon er sprach. Er verbarg sein von Pocken entstelltes Gesicht meist hinter Masken, die er schnitzte oder aus Leder nähte. Freude, Zorn, Schmerz … Baptistas Masken drückten all das oft beredter aus als ein lebendiges Gesicht.
Mortimer nahm ihm das Hölzchen aus der Hand und betrachtete es sichtlich besorgt von allen Seiten. »Ich habe so ein Ding erst heute Morgen gesehen! Dante hat mir eins mit Meggies Gesicht gezeigt. Ich hab ihm gesagt, er soll es dahin zurücklegen, wo er es gefunden hat, weil ich dachte, es sei ein Geschenk von Doria.«
Dante saß mit vier anderen Kindern um Fenoglio herum und lauschte mit offenem Mund der Geschichte, die der Tintenweber erzählte. Als sein Vater ihn bat, ihnen zu zeigen, wo er das Hölzchen gefunden hatte, das er ihm am Morgen gebracht hatte, lief Dante zu der Treppe, die hinauf unters Dach führte, wo er und Meggie ihre Schlafkammern hatten.
Als Dante Meggies Tür öffnete, schoss ein Glasmann mit grauen Gliedern unter dem Bett hervor, Staubfinger warf ihm eine Schlinge aus Feuer nach, aber er wich ihr wieselflink aus und kletterte aus dem Fenster, bevor sie ihn erreichten. Farid und Staubfinger folgten ihm über die Dächer, aber die Nacht hatte den Glasmann bald verschluckt. Nyame war überrascht, wie viel Furcht er auf Staubfingers Gesicht sah, als Farid und er sich erneut durch das Fenster schwangen. Furcht, Abscheu, Zorn.
»Du verstehst nicht!«, stieß er hervor, als Nyame versuchte, ihn zu beruhigen. »Das war hundertprozentig Orpheus’ Glasmann. Rosenquarz hat sich damals nicht geirrt. Wir müssen ihn finden! Ihn und Orpheus! Da ist irgendeine Teufelei im Gange.«
Sie suchten die ganze Nacht. Nyame rief die Spielleute zu Hilfe, und Meggie und Doria mobilisierten all ihre Freunde. Aber der Glasmann blieb verschwunden. Und mit ihm das Hölzchen, das Dante auf Mortimers Bitte wieder unter Meggies Bett gelegt hatte.
Ein unangenehmer Gefährte
Ein Glaube an einen übernatürlichen Ursprung des Bösen ist nicht notwendig. Menschen sind ganz allein fähig zu jeder Art von Schlechtigkeit.
Joseph Conrad, Under Western Eyes
Der Feuertänzer hätte ihn wirklich fast gefangen! Eisenglanz spürte die Hitze der feurigen Schlinge, die er ihm nachgeworfen hatte, immer noch auf dem gläsernen Nacken, aber er war schnell. O ja, schneller als sie alle mit ihren plumpen, fleischigen Gliedern. Und das Hölzchen unter dem Bett von Zauberzunges Tochter war das letzte gewesen, das er noch hatte einsammeln müssen. Eisenglanz musste zugeben, dass ihm vor den verhexten Dingern grauste. Als Orpheus sie ihm übergeben hatte, waren sie nichts als ein Dutzend schmuckloser Stäbchen gewesen, aber nun hatten sie Gesichter.
»Das geht dich nichts an!«, hatte Orpheus ihn angefahren, als er gefragt hatte, was ihr Zweck war. »Versteckt sie da, wo sie schlafen. Auf die Art sind die Hölzchen auf jeden Fall ein paar Stunden in ihrer Nähe. Nach drei Tagen sammelt ihr sie dann wieder ein. Aber nicht früher.«
![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)



![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)




![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)