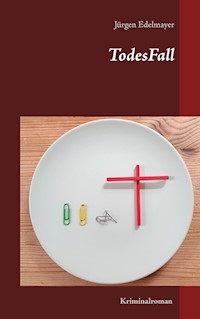
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tim Strecker
- Sprache: Deutsch
Privatermittler Tim Strecker ist nicht begeistert, als ihn die Studentin Lea anheuern möchte. Schließlich kommt die Klientin auf Empfehlung des Lurchs, der für seine windigen Aktionen berüchtigt ist. Lea ist davon überzeugt, dass ihr Mitbewohner Ronnie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Widerwillig nimmt Tim die Ermittlungen auf. Tatsächlich scheint es, als habe die Eigentümerfirma des Hauses, in dem Ronnie umkam, einiges zu verbergen. Das musste auch Journalistin Astrid Schenk erfahren, die nach anfänglichen Recherchen über das Unternehmen kaltgestellt wurde. Auf die professionelle Hilfe seines Freundes, Hauptkommissar Auguste Le Meur, kann Tim in diesem Fall nur bedingt bauen. Dem vom Computerhacker Maschine in den Polizeidienst eingeschleusten Kriminalbeamten droht nämlich der Rausschmiss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Roman spielt in Wiesbaden und Umgebung.
Namen, Personen und Handlung sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real Existierenden sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
„Die Welt der Kunst und Phantasie ist die wahre,
the rest is a nightmare. " Arno Schmidt
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 1
Eine Sekunde nachdem ich das Büro der Anzeigenabteilung des Wiesbadener Lokalblattes betreten hatte, wollte ich diesem Ort bereits wieder den Rücken kehren. Die blonde Frau um die Mitte dreißig, die hinterm Schalter saß, kannte ich und sie war mir nicht in guter Erinnerung geblieben. Zwar wusste ich, dass Astrid Schenk bei der Zeitung, wo ich meine Anzeige aufgeben wollte, beschäftigt war. Allerdings als Journalistin, wenn ich mich recht erinnerte.
Müsste ich ihre herausragendsten Charaktereigenschaften beschreiben, würden mir zuallererst Rücksichtslosigkeit und Karrierebesessenheit einfallen. Sie war zudem der Typ Frau, die Männer ausschließlich in zwei Kategorien einteilte: Potentielle Liebhaber und Idioten. Dazwischen gab es für sie nichts. Diese Dame ließ keinen Zweifel daran, zu welcher Sorte ich ihrer Ansicht nach gehörte. Kleiner Tipp, potentieller Liebhaber wäre die hier falsche Antwort. Zugegeben, sie sah gut aus, war attraktiv und hatte eine tolle Figur. Was ihren Charakter betraf, fiel mein Urteil jedoch deutlich negativer aus. Dass ich ihr hier begegnete, deutete ich als schlechtes Omen für den heutigen Tag, der eigentlich einen angenehmen Ausklang hätte nehmen sollen.
Am Abend wollte ich mich mit Freunden in unserem Stammrestaurant treffen und gemütlich beisammen sitzen. Zuvor wollte ich etwas für meine (ha, ha) Karriere, tun und eine Kleinanzeige aufgeben. Die sollte für mein inoffizielles Unternehmen mit dem schönen Namen info-hunt werben und Arbeiten aller Art offerieren. Die Lust zur Veröffentlichung der Annonce war mir jedoch beim Anblick von Astrid Schenk gehörig vergangen. Mein Trost war, dass ich wenigstens heute Abend von ihr verschont bleiben würde, denn obwohl sie meine Freunde, mit denen ich verabredet war, kannte, wäre keiner von ihnen auf die Idee gekommen, sie einzuladen.
„Was ist los, sind Sie festgewachsen oder was?", begrüßte sie mich mit ihrer ruppigen Art.
„Und Sie, strafversetzt?", gab ich bissig zurück. Der wütende Blick, mit dem sie mich bedachte, verriet, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Ich legte das fieseste Grinsen auf, das mir zur Verfügung stand und genoss meinen augenblicklichen Triumph. Charakterlich war das gewiss keine Glanzleistung, aber was diesen Punkt anging, standen wir uns in nichts nach.
„Wollen Sie jetzt Ihre Annonce aufgeben oder nicht", fuhr sie mich an. Ich habe noch anderes zu tun und außerdem ist bald Anzeigenschluss."
„Na schön, bitte schreiben Sie ..." Ich diktierte ihr meinen Text. Astrid Schenk lachte auf. „Arbeiten aller Art? Haben Sie nichts Anständiges gelernt?"
„Anzeigentippse vielleicht?", gab ich verärgert zurück und registrierte zufrieden, wie es in ihrem Gesicht arbeitete. Mit versteinerter Miene reichte sie mir ein Formular.
„Füllen Sie die Einzugsermächtigung aus, falls Sie überhaupt ein Girokonto haben."
Ich hatte keine Lust mehr auf diesen Streit und füllte das Blatt stillschweigend aus. Innerlich kochte ich aber vor Wut, vor allem darüber, dass mir auf Schenks jüngste Bemerkung keine schlagfertige Antwort einfallen wollte.
Missmutig verließ ich das Redaktionsgebäude und kaufte auf dem Weg nach Hause noch einige Dinge für meinen täglichen Bedarf ein: Keine Zigaretten, keinen Alkohol, keine Wurst und auch kein Fleisch, denn ich ernährte mich rein vegetarisch und Kaffee war das einzige Suchtmittel, das ich mir regelmäßig zu Gemüte führte.
Zu Hause hörte ich als erstes meinen Anrufbeantworter ab. Nichts von Bedeutung. Lediglich eine Aufforderung, Taste eins meines Telefons zu drücken, wenn ich an einem Gewinnspiel teilnehmen wollte. Die Durchforstung meiner E-Mail Konten ergab ein ähnlich niederschmetterndes Ergebnis. Zwei Dutzend Spam-Mails und sonst nichts. Meine finanziellen Reserven waren nahezu aufgebraucht. Ich brauchte dringend einen Job.
Bis zu meiner Verabredung am Abend hatte ich noch etwas Zeit. Ich wollte mich ablenken und schaltete den Fernseher ein. Kaum zu glauben wie schnell ich mich an dieses Gerät gewöhnt hatte. Noch vor wenigen Jahren waren ein simples Tischradio und ein altes Mobilfunktelefon meine einzigen medialen Verbindungen zur Außenwelt gewesen. Dann hatte mich Maschine mit einigen seiner ausrangierten Elektronikgeräte versorgt. So war ich unter anderem in den Besitz dieses Fernsehers gekommen, vor dem ich seither mehr Zeit verbrachte, als mir guttat. Privatsender schaute ich kaum, da mir die ständige Werbung auf den Zeiger ging. Ich zappte durch die öffentlich-rechtlichen Programme und blieb bei der Wiederholung eines Krimis im Vorabendprogramm hängen. Auf dem Bildschirm schleppte sich gerade ein Privatdetektiv in biblisch hohem Alter dahin. Noch so ein Kerl mit Lederjacke, der keinem gescheiten Beruf nachgeht, dachte ich. Mir wurde Angst und Bange. Sah so meine Zukunft aus? Seit mehr als fünf Jahren bot ich meine Dienstleistungen aller Art an und lebte davon mehr schlecht als recht. Von zeitlich befristeten Hilfsarbeiterjobs wurde man nicht reich. Einige Male war ich als Privatermittler tätig gewesen, darunter zweimal in bedeutenderen Fällen. Zwar konnten die unter meiner Mitwirkung aufgeklärt werden, aber es hatte jedesmal Tote gegeben. Hätte ich klüger agiert, könnte mancher von ihnen noch am Leben sein. Die Erinnerung an mein Versagen ließ mich nicht los und bescherte mir in Abständen manch dunkle Stunde.
Ich verfolgte die Handlung auf dem Fernsehbildschirm ohne großes Interesse. Irgendwann bekam der Detektiv eins über den Schädel und flirtete anschließend ungeniert mit einer Frau, die altersmäßig locker seine Enkelin hätte sein können. Zu meiner Überraschung ging die junge Dame auf die Avancen ein. Es war an der Zeit, den roten Knopf der Fernbedienung zu drücken. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass ich mich ohnehin beeilen musste, um pünktlich zu meiner Verabredung zu kommen.
Mit einigen Minuten Verspätung traf ich in meinem in der Schiersteiner Straße gelegenen Lieblingsrestaurant ein. Wenigstens war mir als Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein die lästige Parkplatzsuche erspart geblieben. Sigrid Beck, eine (nicht meine) Freundin von mir, die erfolgreich als selbstständige Fotografin mit eigenem Studio in Taunusstein arbeitete und der ich hin und wieder als Teilkörpermodel meine Knie für Werbeaufnahmen zur Verfügung stellen durfte, saß bereits mit meinem väterlichen Freund Kommissar Auguste Le Meur an einem Tisch. Die beiden ließen sich diverse Antipasti schmecken, die ihnen von den stets gut gelaunten Betreibern des Restaurants, den Zwillingen Winnie und Bodo Watzl, liebevoll dekoriert serviert worden waren.
Ich wurde mit offenen Armen begrüßt und erhielt von Winnie Watzl sogleich eine Auflistung der vegetarischen Gerichte und alkoholfreien Cocktails. Keine Frage, die Brüder verstanden es, Gäste dazu zu bringen, sich sofort bei ihnen heimisch zu fühlen. Die beiden zogen aber auch wirklich eine tolle Show ab. Sie tänzelten durch das Lokal, balancierten Platten und Teller in atemberaubender Zahl auf ihren Händen und Armen, trällerten ihre Erfolgsschlager Komm in die Puschen, Marie und Marie, komm in die Puschen, mit denen sie es sogar in der Fastnachtshochburg jenseits des Rheinufers zu einiger Berühmtheit gebracht hatten, aus vollem Hals und hatten ansonsten stets ein aufmunterndes Wort oder einen kessen Spruch auf den Lippen.
„Wie geht es eigentlich unserem Freund Stefan?", fragte ich Bodo, der gerade unter einer Verrenkung, die einem Kontorsionisten Ehre gemacht hätte, den Gruß aus der Küche, selbstgebackenes Weißbrot und Frühlingsquark mit frischen Kräutern in verschiedener Auswahl, vor mich hinstellte. Das Fastfood-Restaurant der Watzls hatte sich unter ihrer Leitung zu einem regelrechten Gourmettempel gemausert. Nur die einfach gehaltene Einrichtung mit der rustikalen Theke und den schmucklosen Tischen glich noch den Ausstattungen herkömmlicher Anbieter von Schnellgerichten. Wenn ich den regen Unternehmergeist der Zwillinge richtig einschätzte, würde sich auch das in absehbarer Zeit ändern.
„Der Lurch mit der großen Nase steht in der Küche und lässt seine Aggressionen an ein paar Kalbsschnitzeln aus", erklärte Bodo. „Entschuldige, Tim", fügte er bedauernd hinzu.
„Keine Ursache", gab ich zurück. „Ich weiß ja, dass sich nicht alle Welt vegetarisch ernährt und ich einer Minderheit angehöre."
Aber so waren sie, die Watzl-Zwillinge. Kaum hundertsechzig Zentimeter hoch, aber Herzen so groß wie das sprichwörtliche Scheunentor. Ohne sich im Mindesten dafür feiern zu lassen, hatten sie Stefan Rabenacker, der vor einigen Jahren von einem Profikiller gejagt worden war, bei sich aufgenommen. Selbst der stets übel gelaunte Lurch konnte sich dem Charme der Watzls nicht entziehen und war, auch nachdem der Killer gestellt worden war, bei den Zwillingen geblieben. So sehr sich die Brüder auch untereinander zoffen konnten, meist ging es dabei um Winnies ungesunde Vorliebe für Curryketchup, ihren Gästen und Freunden gegenüber legten sie stets das größtmögliche Maß an Taktgefühl an den Tag. Äußerlich unterschieden sich Bodo und Winnie nur dadurch, dass Letzterer über mehr Haupthaar verfügte als sein Bruder Bodo. Stefan, der Lurch, Rabenacker, war inzwischen ein fester Mitarbeiter der Zwillinge geworden. Tatsächlich fielen mir erst jetzt die dumpfen Schlaggeräusche auf, die aus der Küche herausdrangen. Kraftvolle, in schneller Folge ausgeführte Schläge. Kein Zweifel, da stand jemand mächtig unter Dampf.
„Wie geht es ihm denn?", fragte ich noch einmal.
„Im Service können wir ihn leider immer noch nicht einsetzen", antwortete Bodo. „Wir haben es etliche Male versucht, aber stets kam von der Suppe nichts mehr bei den Gästen an. Stefan zitterte so stark, dass alles auf den Boden schwappte."
Ich konnte es dem Lurch ebenso wenig wie die Watzl Brüder verdenken. Das Trauma, kurz nach dem Servieren von Suppe von einem Berufskiller beschossen worden zu sein, saß bei Stefan so tief, dass es ihm wohl für den Rest seines Lebens erhalten bleiben würde.
„Meinst du, ich kann ihm kurz „Hallo" sagen?"
Bodo legte die Stirn in Falten und wog seinen Kopf hin und her. „Ist keine gute Idee, Tim. Stefan scheint es gerade heute nicht so besonders zu gehen. Um ehrlich zu sein, er hat mich sogar gebeten, dass er den ganzen Abend in der Küche bleiben kann, damit er keinem von euch über den Weg läuft. Aber das hast du jetzt nicht von mir, klar?"
Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, aber diese Aussage verletzte mich doch sehr. Ich hatte ernsthaft geglaubt, der Lurch und ich wären im Lauf der Jahre so etwas wie Freunde geworden. Da hatte ich mich wohl getäuscht. Aber vielleicht hatte er nur eine seiner Launen und meinte es nicht ernst. Ich war immer noch fest entschlossen, mir die Stimmung nicht verderben zu lassen.
„Richte ihm bitte meinen Gruß aus", sagte ich zu Bodo und wandte mich wieder meiner Mahlzeit zu. Irgendwie wollte sie mir nicht mehr ganz so gut schmecken, wie noch vor wenigen Minuten.
„Reichst du mir bitte das Salz?", fragte Auguste, der derjenige gewesen war, der damals den Auftragsmörder Sugar erschossen und somit Stefans Leben gerettet hatte. Ich reichte ihm das Salz, richtete meinen Blick auf Sigrid und fragte mich, ob sie die Enttäuschung, sich in den Killer verliebt zu haben und von ihm hinters Licht geführt worden zu sein, über die Jahre hinweg völlig verwunden hatte. Ja, wir hatten alle unsere Geschichte. Jeder Mensch hat eine, mindestens. Im Alltag sind wir von unseren Mitmenschen schnell genervt. Wir regen uns zum Beispiel über den Kerl im Supermarkt auf, der an der Kasse bezahlen möchte und so lange in seinem Portemonnaie nach Kleingeld sucht, bis wir die Geduld verlieren. Oder wir verwünschen den Fahrer im Auto vor uns, der an der Ampel den Motor abwürgt, uns im Weg steht und dafür sorgt, dass wir erneut auf grün warten müssen. Wenn wir aber jemanden so gut kennen lernen, dass er uns vertraut und seine Geschichte oder wenigstens eine davon erzählt, sehen wir diesen Menschen möglicherweise mit anderen Augen, weil wir aufgrund seiner Geschichte verstehen, was ihn so hat werden lassen, wie er sich heute gibt, warum er sich so und nicht anders verhält, und so weiter.
Auch Auguste Le Meur hatte seine Geschichte. Nein, nicht bloß eine. Sein Spitzname war Jelzin, weil er wie der frühere russische Präsident nur noch drei Finger an seiner linken Hand hatte (wobei ich mir nicht sicher war, dass es bei Boris Jelzin wirklich die linke Hand war). Auf welche Weise Auguste seine Finger verloren hatte, wusste ich nicht, wohl aber, dass der Franzose gar nicht hierher gehörte und bei der Wiesbadener Polizei schon gar nichts mehr verloren hatte, dort aber trotzdem bereits seit vielen Jahren seinen Dienst versah. Ursprünglich war Auguste Le Meur im Rahmen eines deutsch-französischen Austauschprogramms zwischen der Polizei beider Länder nach Wiesbaden zum Bundeskriminalamt gekommen, aber nach Ablauf der für seinen Dienst in der hessischen Landeshauptstadt vorgesehenen Zeit schlicht und ergreifend einfach vergessen worden. Aufgrund einer Laune der Bürokratie wurde er auch bei seiner Heimatdienststelle in Frankreich nicht vermisst, weil man dort annahm, dass sein Arbeitsplatz bei der Behörde dem allgemeinen Sparzwang zum Opfer gefallen war. Jemand aus unserer Clique, der heute Abend fehlte, war es gewesen, der mit seinen Computerkenntnissen Auguste eine lupenreine Vita für dessen weiteren Verbleib bei der Wiesbadener Kripo verpasst hatte. Denn Auguste Le Meur gefiel es mittlerweile in Deutschland so gut, dass er, nachdem er viel zu spät gemerkt hatte, dass sein Aufenthalt in Wiesbaden bereits Überlänge hatte, keinerlei Neigung verspürte, nach Frankreich zurückzukehren.
Wir hatten wie gesagt alle unsere Geschichten. Manche waren traurig, andere tragisch, manche zuweilen lustig, aber meine war richtig hässlich.
„He Tim, was ist los mit dir? Du bist so still."
„Entschuldige Sigrid, ich war gerade in Gedanken. Habe ich etwas verpasst?"
„Wenn du es bis jetzt noch nicht probiert hast, dann dieses wundervolle Kartoffelgratin. Keine Angst, es ist kein Dörrfleisch oder Speck drin. Also beeile dich, solange noch etwas davon da ist!"
Ich reichte Auguste meinen Teller und ließ mir von ihm auflegen. Ich riss mich zusammen und bemühte mich, der Unterhaltung meiner Freunde zu folgen. Eigentlich amüsierten sich die beiden auch ohne mich ganz prächtig, was mich besonders bei Le Meur mächtig wunderte. So selbstbewusst und souverän er sonst auftrat, wirkte er im Umgang mit Frauen zuweilen recht unbeholfen, beinahe gehemmt. In seiner ganzen Art erinnerte mich der mittlerweile auf die Mitte seiner fünfziger Jahre zugehende Franzose an die alten Westernhelden, die von John Wayne oder James Stewart dargestellt worden waren.
Sigrid hingegen schien sich in Le Meurs Gegenwart äußerst wohl zu fühlen. Da ich es nicht besser wissen konnte, musste ich annehmen, dass sie mit ihm flirtete, was das Zeug hielt. Arme Sigrid, so erfolgreich sie als freie Fotografin und Geschäftsfrau war, so sehr versagte sie bei der Auswahl ihrer Liebhaber. Ständig war sie auf der Suche. Nicht, dass ich meinen beiden Tischgenossen ihr Glück nicht gegönnt hätte, aber als Paar konnte ich sie mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Der kantige, beinahe hünenhafte Franzose mit dem dichten Schnauzbart wirkte eher wie der Vater von Sigrid, die gerade die zweite Hälfte ihrer dreißiger Jahre erreicht hatte. Zumal die dunkelhaarige Fotografin wegen ihrer Nickelbrille, von der ich vermutete, dass sie sie gar nicht brauchte, beinahe wie ein Teenager aussah.
Es hätte ein unbeschwerter Abend sein können, frei von allen trüben Stimmungen. Aber das galt nicht für mich. Meine Stimmung hatte mit dem einzigen Abwesenden zu tun, der in unserer Runde fehlte. Eigentlich hieß er Henning und war mein bester Freund. Aber seit der Sache damals wollte er nicht mehr bei seinem Taufnamen genannt werden, sondern nur noch Maschine oder Cyborg. Die Sache damals hatte dazu geführt, dass er heute mehr künstliche Körperteile in sich trug, als organisches Leben, und Henning wäre sicher nicht mehr mein Freund, wenn er wüsste, dass ich die Schuld an seinem Zustand trug. Es war eine Schuld, die zu verdrängen ich mich täglich bemühte, die mich aber von innen her auffraß und langsam aber sicher um den Verstand brachte.
Kapitel 2
Diese Sache von damals war also schon viele Jahre her. Henning war Glücksspieler gewesen und schließlich der Spielsucht verfallen. Kein Spieltisch, kein Spielautomat war vor ihm sicher. Er hatte vergeblich gegen die Sucht angekämpft und alles Mögliche versucht, sich sogar selbst bei der Spielbank sperren lassen, aber es hatte alles nichts genutzt. Die Sucht war stärker gewesen, und um sie zu befriedigen, hatte sich Henning schließlich auf illegale Pokerrunden mit dubiosen Typen in dunklen Hinterzimmern eingelassen. Natürlich steckte er bald bis über beide Ohren in Schulden, die er nicht bezahlen konnte. Eines Abends schließlich führte mich mein Nachhauseweg durch die örtliche Albrecht-Dürer-Anlage, einem seitlich der aus der Stadt führenden Aarstraße gelegenen Park. Es war Vollmond und die helle Scheibe beleuchtete eine grauenvolle Szene, deren unfreiwilliger Zeuge ich wurde. Zwei Männer schlugen mit Eisenstangen auf eine am Boden liegende Gestalt ein, die ich bei näherem Hinsehen als meinen Freund Henning oder das, was von ihm noch übrig war, identifizieren konnte. Während der ganzen Zeit war ich untätig geblieben, unfähig, mich zu rühren, im wahrsten Sinne des Wortes erstarrt vor Angst. Damals besaß ich natürlich noch kein Handy und selbst, wenn ich eins gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, es zu benutzen. Ich hockte still und zitternd in meinem Versteck hinter dem Gebüsch und wartete ab, bis die zwei Schläger ihr Gemüt an Henning gekühlt und sich schließlich davongemacht hatten. Dann erst fand ich den Mut, nach meinem Freund zu sehen und eine Ambulanz zu rufen. Damals gab es noch mehr Telefonzellen als heute und glücklicherweise musste ich nicht weit bis zur nächstgelegenen laufen. Der Notarztwagen kam schnell und verfrachtete Henning in die städtischen Kliniken, die er nach rund einem Jahr Aufenthalt mit beinahe mehr künstlichen als organischen Körperteilen wieder verließ. Eines seiner Augen war dermaßen geschädigt, dass es durch ein Glasauge ersetzt werden musste. Sein rechter Arm würde für den Rest seines Lebens steif bleiben. Als Linkshänder hätte es ihn noch schlimmer treffen können, aber Henning mit einem entsprechenden Hinweis trösten zu wollen, würde wohl nur einem Zyniker in den Sinn kommen. Die Schläger hatten auch seine Beine zertrümmert. Fortan konnte Henning sich nur noch im Rollstuhl vorwärts bewegen.
Trotz seines schweren Schicksals kämpfte sich Henning zurück ins Leben, allerdings zu dem Preis, dass er seine frühere Existenz komplett aufgab und sich eine neue Identität zulegte. Cyborg oder Maschine nannte er sich fortan und wollte auch von allen, mit denen er zu tun hatte, so genannt werden. Er wohnte zwar ebenerdig im Wiesbadener Stadtteil Biebrich, ging aber so gut wie nie vor die Tür. Stattdessen bewegte er sich virtuell im weltweiten Computernetz, erlernte das Programmieren und brachte es darin zur Meisterschaft. Für den Cyborg gab es kein Netzwerk, in das er sich nicht einhacken konnte. Selbst die Computerarchive von Behörden waren vor seinem Zugriff nicht sicher und so verschaffte Maschine sich und seinen Freunden, darunter auch dem Kriminalbeamten Auguste Le Meur, nach Belieben jede amtliche Bescheinigung.
Was mich betraf, so wollte ich Wiesbaden endgültig den Rücken kehren. Ich zog in ein kleines Nest im Hintertaunus, wo ich mich für die folgenden Jahre vergrub und verzweifelt versuchte, irgendwie wieder Tritt zu fassen. Ich ging sogar so etwas wie eine feste Bindung ein, scheiterte aber grandios und kehrte wider besseres Wissen doch wieder in die hessische Landeshauptstadt zurück. Da war ich nun, ohne festes Einkommen, brauchte dringend ein Dach über dem Kopf und war nach gut der Hälfte meines Lebens bereits an dessen Ende angekommen. Ich hielt mich seither mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, wobei ich für meine Dienstleistungen aller Art mit solchen Annoncen warb, wie ich sie am Mittag des heutigen Tages bei Astrid Schenk in Auftrag gegeben hatte. Info-hunt, Arbeiten aller Art lautete der Text auf meinen Visitenkarten. Schon kurios, für was ich alles angeheuert wurde. Mein Job als Teilkörpermodell für Sigrid nahm sich gegen andere Aufträge, zu deren Durchführung unter anderem die erwähnten detektivischen Ermittlungsarbeiten vonnöten waren, noch vergleichsweise harmlos aus. Mein Traumjob, ein simpler Botengang, an dessen Ende mich nach erfolgreicher Erledigung ein fürstliches Trinkgeld erwartete, das mich mit einem Schlag aller finanzieller Sorgen entledigte, war mir bisher leider noch nicht untergekommen. Dafür hatte ich, wie ich bald erfahren sollte, trotz der geringen Zahl der von mir bearbeiteten Detektivfälle, in manchen Kreisen anscheinend einen gewissen Ruf als Detektiv ohne Lizenz erlangt. Dabei war mein erster Fall ein einziges Desaster gewesen, bei dem ich beinahe ums Leben gekommen wäre. Meine Rettung verdankte ich ausgerechnet Maschine, der die beiden Männer, die mich in die Mangel genommen hatten, mit zwei Giftpfeilen getötet hatte. Eine Tat, für die mein Freund bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden war.
Wir verließen das Restaurant der Watzl-Brüder weit nach Mitternacht. Le Meur hatte sich allen Avancen Sigrids zum Trotz als äußerst standhaft erwiesen. Daher trennten sich vor dem Restauranteingang unsere Wege. Während Sigrid in ihren blauen Mini Cooper stieg, folgte ich Auguste zu dessen roten Alfa Romeo. Seit ich ihn kannte, fuhr der Franzose nur verschiedene Modelle dieser italienischen Automarke. Wie üblich legte er einen halsbrecherischen Fahrstil an den Tag, der meiner Gesichtsfarbe einen ungesunden Teint verlieh. Nachdem Le Meur mich abgesetzt hatte, ging ich durch einen Hof zu dem Hinterhaus, in dessen obersten Stockwerk sich meine Wohnung befand. Ich hatte gerade die erste Stufe der letzten Treppe betreten, die zu meiner Zweizimmerwohnung ohne Bad, aber mit Toilette im Treppenhaus führte, als ich am oberen Ende eben dieser Treppe eine Gestalt sitzen sah. Sie schien mich gar nicht bemerkt zu haben. Ihr Kopf richtete sich nicht auf, um mich anzusehen, sondern ruhte weiterhin in ihren Händen, während sie die Arme mit den Ellbogen auf ihren Oberschenkeln gestützt hielt. Da dieser Mensch zudem einen Hoodie trug und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte, konnte ich nicht einmal erkennen, ob es sich um ein männliches oder weibliches Wesen handelte. Die Kleidung, Jeans, Jacke und festes Schuhwerk, ließ auch keinen eindeutigen Schluss zu.
„Hallo", sagte ich leise und trat einen Schritt näher an die Person heran. Dabei stieß mein Fuß auf eine Holzstufe, die besonders lauf knarrte. Augenblicklich zuckte die sitzende Person zusammen und ich sah in ein feminines Gesicht, dessen Augen meiner Schätzung nach seit höchstens fünfundzwanzig Jahren in die Welt blickten.
„Wer sind Sie?", fragte die junge Frau und schaute mich argwöhnisch an.
„Ich wohne hier und würde gerne meine eigene Wohnung betreten, ohne über Sie zu stolpern", gab ich missmutig zurück.
„Tim Strecker?", richtete sie erneut eine Frage an mich.
„So steht es auf meinem Türschild", versetzte ich.
„Kann ich reinkommen?" Ihre dritte Frage, der sie gleich eine Forderung folgen ließ. „Ich muss dich nämlich sprechen."
Bevor ich darauf etwas entgegnen konnte, etwa ob das nicht bis morgen Zeit hätte, fügte sie noch hinzu: „Es ist dringend." Dabei stand sie auf und zog sich die Kapuze vom Kopf. Ich erblickte schwarze mittellange Haare und blasse Wangen, dazu braune Augen, die eng beieinander standen und unter denen sich eine zierliche Nase befand. Ihre Figur war schmal. Überhaupt wirkte sie sehr zierlich. Sie sah mich erwartungsvoll an.
„Na schön", sagte ich. „Wenn's nicht zu lange dauert. Ich bin nämlich müde. Wie heißt du überhaupt?"
„Lea", antwortete sie und betrat den Flur zu meiner Zweizimmerwohnung. Vor der ersten Zimmertür, der zu meiner Küche, blieb sie unschlüssig stehen. Hinter ihr erstreckte sich mein langer Flur, von dem noch zwei Türen, je eine zu Wohn- und Schlafzimmer, abgingen. Die Toilette befand sich im Treppenhaus und in der Küche hatte ich bei meinem Einzug eine Duschecke eingebaut. Ich wollte es Lea nicht so bequem machen, dass sich ihr Aufenthalt länger als nötig hinzog. Darum führte ich sie nicht ins Wohnzimmer, sondern in die Küche und bot ihr dort einen Stuhl als Sitzplatz an.
„Magst du etwas trinken?", fragte ich und hoffte, dass sie ablehnen würde, was sie zu meiner Erleichterung auch tat.
„Also, worum geht es?", kam ich gleich zur Sache.
„Ronnie ist tot." Leas Stimme wirkte tonlos. Sie holte ein Papiertaschentuch hervor und schnäuzte sich die Nase.
„Und Ronnie war...?", half ich nach.
„Mein Mitbewohner. Wir leben ... lebten in einer Wohngemeinschaft in einem Haus in der Niederwaldstraße. Ein Altbau, der saniert werden soll."





























