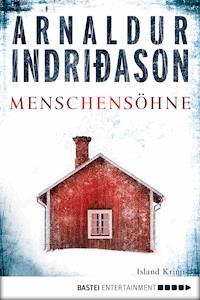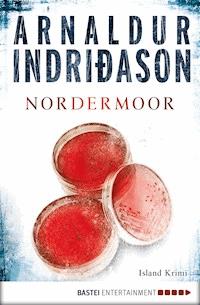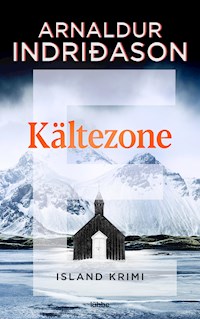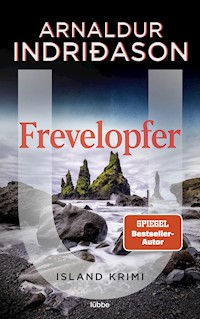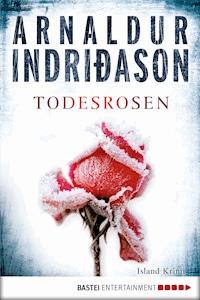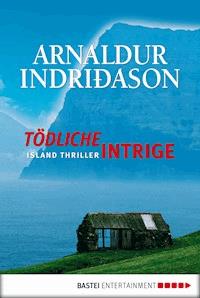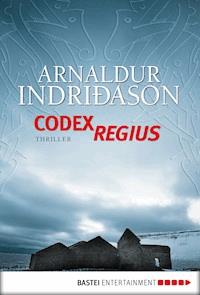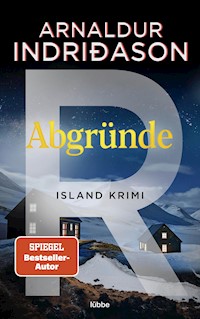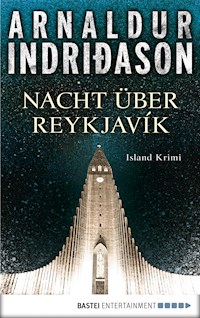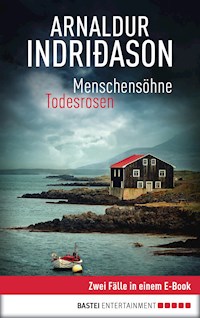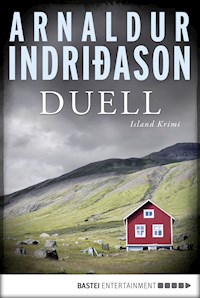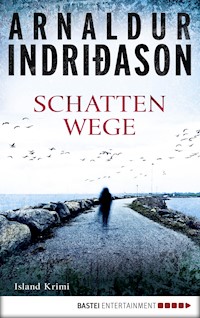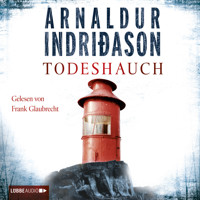
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Erlendur
- Sprache: Deutsch
In einer Baugrube am Stadtrand von Reykjavík werden menschliche Knochen gefunden. Wer ist der Tote, der hier verscharrt wurde? Wurde er lebendig begraben? Erlendur und seine Kollegen von der Kripo Reykjavík werden mit grausamen Details konfrontiert. Stück für Stück rollen sie Ereignisse aus der Vergangenheit auf und bringen Licht in eine menschliche Tragödie, die bis in die Gegenwart hineinreicht.
Während Erlendur mit Schrecknissen früherer Zeiten beschäftigt ist, kämpft seine Tochter Eva Lind auf der Intensivstation um ihr Leben ...
Todeshauch wurde mit dem Nordischen Preis für Kriminalliteratur 2003 ausgezeichnet!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 2 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber den AutorTitelImpressumVorbemerkungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Über den Autor
Arnaldur Indriðason, Jahrgang 1961, war Journalist und Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung. Heute lebt er als freier Autor in Reykjavík und veröffentlicht mit großem Erfolg seine Romane. Sein Kriminalroman NORDERMOOR (Bastei Lübbe 14857) erhielt den »Nordic Crime Novel’s Award 2002«. Todeshauch wurde 2003 mit der gleichen Auszeichnung zum besten nordeuropäischen Krimi gekürt, ein einmaliger Erfolg in der Geschichte des renommierten Krimipreises.
Arnaldur Indriðason
Todeshauch
Isand Krimi
Aus dem Isländischen von Coletta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © © 2001 by Arnaldur Indriðason
Titel der isländischen Originalausgabe: »Grafarþögn«
Originalverlag: Vaka-Helgafell, Rekjavik.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2004/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Claudia Müller
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
Titelbild: Look/Hauke Dressler
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1263-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
In Island duzt heutzutage jeder jeden. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Dies wurde bei den Übersetzungen der Island-Krimis von Arnaldur Indridason beibehalten.
Kapitel 1
Die Kleine krabbelte vergnügt auf dem Boden herum. Als er ihr endlich das Teil, an dem sie zufrieden herumkaute, aus der Hand nehmen konnte, erkannte er gleich, dass es sich um einen menschlichen Knochen handelte.
Kurz zuvor hatte die Geburtstagsfeier unter wildem Juchhei ihren Höhepunkt erreicht. Der Pizzalieferant war gekommen, und die Jungs hatten sich mit Pizza voll gestopft, dazu Cola getrunken und dabei um die Wette gerülpst. Dann waren sie wie auf Kommando aufgesprungen und sausten jetzt wieder durch die Gegend; einige waren mit Maschinengewehren und Pistolen bewaffnet, die Kleineren hatten Autos oder Gummidinosaurier in den Händen. Er konnte nicht sagen, was hier gespielt wurde. Es ging anscheinend nur darum, so viel Krach wie möglich zu machen.
Die Mutter des Geburtstagskinds hatte angefangen, in der Mikrowelle Popcorn zu machen. Sie erklärte ihrem Sohn, dass sie etwas Ruhe in die Rasselbande bringen müsse und deshalb den Fernseher einschalten und ein Video einlegen wollte. Falls das nichts half, würden sie allesamt vor die Tür gesetzt. Der achte Geburtstag ihres Sohnes wurde jetzt bereits zum dritten Mal gefeiert, und so langsam reichte es. Die dritte Feier hintereinander. Zuerst war die ganze Familie in einem nicht ganz billigen Fastfood-Lokal essen gegangen. Dann kam die Einladung für Verwandte und Freunde – und das war schon fast wie bei einer Konfirmation gewesen. Und heute hatte der Junge seine Mitschüler und Freunde aus dem Viertel einladen dürfen.
Sie öffnete die Mikrowelle, holte die prallvolle Tüte mit Popcorn heraus und gab eine neue hinein, und sie dachte bei sich, dass sie sich das nächste Mal die Sache etwas einfacher machen würde. Nur eine einzige Einladung und damit basta. Genau wie früher, als sie klein gewesen war.
Es machte die Sache auch keineswegs besser, dass der junge Mann auf dem Sofa im Wohnzimmer keinen Ton von sich gab. Sie hatte versucht, sich mit ihm zu unterhalten, hatte das aber bald drangegeben. Es machte sie einfach nervös, dass er da in ihrem Wohnzimmer herumsaß. Es wäre allerdings angesichts der lärmenden und tobenden Jungen auch schwierig gewesen, ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Er hatte ihr nicht angeboten, behilflich zu sein. Saß nur rum, starrte vor sich hin und schwieg. Der kommt noch um vor Schüchternheit, dachte sie bei sich.
Sie hatte ihn nie zuvor gesehen. Der Mann war um die fünfundzwanzig. Der große Bruder eines der Jungen, die ihr Sohn zur Geburtstagsfeier eingeladen hatte. Fast zwanzig Jahre Altersunterschied zwischen den Brüdern. Er war sehr schlank und hatte ihr im Eingang seine feuchte, feingliedrige Hand gereicht. Er war äußerst zurückhaltend gewesen, sagte nur, er wolle seinen kleinen Bruder abholen. Doch der Junge war nicht dazu zu bewegen, die Party zu verlassen, die noch in vollem Gange war. Sie hatte ihn gebeten hereinzukommen, weil es wohl nicht mehr lange dauern würde, wie sie sagte. Er erklärte ihr, dass seine Eltern, die in einem Reihenhaus etwas weiter unten in der Straße wohnten, im Ausland seien, und deswegen müsse er auf den kleinen Bruder aufpassen; normalerweise lebte er in einer Mietwohnung im Zentrum. Trat in der Tür verlegen von einem Fuß auf den anderen. Der kleine Bruder war inzwischen wieder ins Gewühl entwischt.
Jetzt saß der junge Mann auf dem Sofa und schaute zu, wie das einjährige Schwesterchen des Geburtstagskinds im Gang vor den Kinderzimmern über den Fußboden kroch. Sie hatte ein weißes Rüschenkleidchen an und eine Schleife im Haar. Sie quietschte vergnügt vor sich hin. Er hingegen verwünschte seinen kleinen Bruder. Ihm war es unangenehm, in diesem fremden Haus zu sein. Er überlegte, ob er seine Hilfe anbieten sollte. Die Frau hatte ihm gesagt, dass ihr Mann bis spät in die Nacht hinein arbeiten müsste. Er hatte genickt und versucht zu lächeln. Und sowohl Cola als auch Pizza dankend abgelehnt.
Er hatte bemerkt, dass das kleine Mädchen irgendein Spielzeug fest umklammert hielt, und als es sich auf den Popo setzte, fing es an, daran herumzunagen, und sabberte dabei gehörig. Wahrscheinlich zahnte sie und kaute deswegen auf dem Ding herum.
Mit diesem Spielzeug im Mund krabbelte die Kleine näher zu ihm hin, und er begann zu überlegen, was sie da wohl in der Hand hatte. Sie hörte auf zu kauen, schob sich auf dem Popo in Richtung Sofa und starrte ihn mit offenem Mund an. Vor lauter Aufregung lief ihr der Sabber schon bis auf das Lätzchen herunter. Dann steckte sie sich das Ding wieder in den Mund und kroch auf allen vieren zu ihm hin. Sie streckte sich vor, verzog dabei das Gesicht und quietschte so, dass ihr das Teil aus dem Mund fiel. Mit einiger Anstrengung bekam sie es wieder zu fassen, und da war sie schon direkt neben ihm, zog sich an der Sofalehne hoch und stand stolz auf unsicheren krummen Beinchen da.
Es gelang ihm, ihr das Ding wegzunehmen, und er betrachtete es. Die Kleine schaute ihn erst an, als würde sie ihren Augen nicht trauen, und dann brüllte sie aus Leibeskräften los. Er brauchte nicht lange, um festzustellen, dass es sich um einen menschlichen Knochen handelte, ein etwa zehn Zentimeter langes Endstück einer Rippe. Gelblich-weiß, länglich und an der Bruchstelle abgeschliffen, sodass es keine scharfen Spitzen mehr gab, und innen an der Bruchstelle waren dunkle Flecken wie von Erde.
Er vermutete, dass er den vorderen Teil einer Rippe in Händen hielt, und gleichzeitig war ihm klar, dass dieser Knochen nicht mehr der jüngste war.
Die Mutter hörte, dass das Mädchen wie am Spieß brüllte, und als sie ins Wohnzimmer schaute, sah sie es bei dem Unbekannten neben dem Sofa stehen. Sie stellte die Schüssel mit dem Popcorn ab, ging zu ihrer Tochter und nahm sie auf den Arm. Sie schaute auf den Mann hinunter, der weder ihr noch dem plärrenden Kind Beachtung schenkte.
»Was ist denn hier los?«, fragte die Mutter besorgt und versuchte, ihr Kind zu trösten. Sie sprach laut, um den Lärm der Kindergesellschaft zu übertönen.
Der Mann schaute zu ihnen hoch, stand langsam auf und reichte der Mutter den Knochen.
»Wo hat sie das her?«, fragte er.
»Was?«, sagte sie.
»Den Knochen«, sagte er. »Wo hat sie diesen Knochen her?«
»Was für einen Knochen?«, fragte sie. Das Gebrüll des Kindes ließ etwas nach, als es den Knochen wieder erblickte. Die Kleine versuchte, nach ihm zu grapschen, und vor lauter Konzentration schielte sie, während ihr der Sabber aus dem weit geöffneten Mund träufelte. Das Kind bekam den Knochen zu fassen und betrachtete ihn fasziniert.
»Ich glaube, das ist ein Knochen«, sagte der Mann.
Das Kind steckte ihn in den Mund und war wieder friedlich geworden.
»Was redest du da von einem Knochen?«, fragte die Mutter.
»Sie nagt daran herum«, sagte er. »Ich glaube, es ist ein menschlicher Knochen.«
Die Mutter hielt ihr Kind fest, das wieder auf dem Knochen herumkaute.
»Das Ding hab ich noch nie gesehen. Was meinst du eigentlich damit, was für ein Menschenknochen?«
»Meiner Meinung nach ist das ein Stück aus einer menschlichen Rippe«, sagte er. »Ich studiere Medizin«, fügte er wie zur Erklärung hinzu, »fünftes Studienjahr.«
»Rippe? Was soll denn der Quatsch? Hast du das mitgebracht?«
»Ich? Nein. Weißt du nicht, woher das Ding kommt?«
Die Mutter blickte auf ihr Kind, fuhr dann zusammen und riss der Kleinen den Knochen aus dem Mund und schleuderte ihn auf den Boden.
»Vielleicht weiß ihr Bruder ...«
Er sah die Mutter an, die ihn ungläubig anstarrte. Dann blickte sie auf ihre Tochter, die wieder angefangen hatte zu brüllen. Dann auf den Knochen, und als Nächstes zum Fenster hinaus, wo man die halb fertigen Häuser ringsum sehen konnte, wieder auf den Knochen und den Unbekannten, und schließlich auf ihren Sohn, der aus einem der Kinderzimmer gelaufen kam.
»Tóti!«, rief sie, aber der Junge schenkte ihr keine Beachtung und lief einfach weiter. Sie stürzte sich hinter ihm her ins Kindergewimmel, und unter einigen Mühen gelang es ihr, ihren Tóti ins Wohnzimmer zu schleifen. Sie standen vor dem Medizinstudenten.
»Gehört das dir?«, fragte sie den Jungen, als der Mann ihm den Knochen reichte.
»Den hab ich gefunden«, sagte Tóti und wollte wieder weg, um nichts auf seiner Geburtstagsparty zu verpassen.
»Wo?«, fragte seine Mutter. Sie setzte das Kind auf dem Boden ab, die Kleine starrte zu ihr hoch und war sich nicht ganz sicher, ob sie erneut losbrüllen sollte oder nicht.
»Draußen«, sagte der Junge. »Das ist ein klasse Stein. Ich hab ihn sauber gemacht.« Der Junge war außer Atem. Ein Schweißtropfen lief ihm an der Wange hinunter.
»Wo draußen?«, fragte seine Mutter. »Wann? Was hast du gemacht?«
Der Junge warf seiner Mutter einen Blick zu. Er war sich nicht bewusst, etwas angestellt zu haben, aber so, wie sie dreinschaute, war es ganz bestimmt der Fall. Er überlegte angestrengt, was es nun schon wieder war.
»Gestern, glaube ich«, sagte er. »Auf dem Grundstück da hinten am Hügel. Ist was nicht in Ordnung?«
Seine Mutter und der Unbekannte schauten sich an.
»Kannst du mir genau zeigen, wo du das gefunden hast?«, fragte sie.
»Och Mensch, und was ist dann mit der Party«, maulte er.
»Los!«, sagte seine Mutter. »Zeig uns, wo du das gefunden hast!«
Sie schnappte sich das kleine Mädchen vom Fußboden und schob den Jungen in Richtung Verandatür. Der junge Mann folgte ihnen auf dem Fuße. Die Rasselbande verstummte, als das Geburtstagskind quasi abgeführt wurde, und die Jungs schauten zu, wie Tótis Mama mit dem kleinen Schwesterchen auf dem Arm ihn mit strenger Miene aus dem Haus bugsierte. Sie schauten einander an und marschierten in gebührendem Abstand hinterher.
Das hatte sich in dem neuen Viertel oberhalb der Straße zum Reynisvatn-See ereignet. Diese neue Wohngegend lief unter dem Namen Millenniumsviertel. Es entstand an einem Höhenrücken, auf dem ganz oben die Speichertanks der städtischen Heißwasserversorgung thronten, braun gestrichene Ungetüme, die die neue Siedlung wie eine Zwingburg überragten. Straßen waren überall am Hang angelegt worden, ein Haus nach dem anderen schoss empor, einige hatten sogar schon den Garten rings um ihr Haus in Angriff genommen, hatten Rollrasen ausgelegt und kleine Bäume gepflanzt, von denen man sich erhoffte, dass sie gedeihen und ihren Besitzern irgendwann einmal Windschutz bieten würden.
Im Laufschritt folgten die kleinen Gäste dem Geburtstagskind in östlicher Richtung, die oberste Straße direkt unterhalb der Tanks entlang. Dort waren Reihenhäuser, und etwas weiter weg in nördlicher und östlicher Richtung schlossen sich alte, verstreut liegende Sommerhäuser an. Wie in allen Neubauvierteln dieser Art fanden die Kinder es herrlich, auf den Baustellen in halb fertigen Häusern zu spielen, Gerüste hochzuklettern, zwischen nackten Wänden Versteck zu spielen oder in neu ausgehobene Baugruben hinunterzurutschen, um in dem Wasser, was sich dort ansammelte, herumzuplanschen.
Zu einer solchen Ausschachtung führte das Geburtstagskind seine Mutter samt Unbekanntem und der ganzen Gästeschar. Tóti deutete auf die Stelle, wo er den komischen weißen Stein gefunden hatte, der so ungewöhnlich leicht und glatt gewesen war, dass er ihn behalten wollte und ihn deshalb in die Tasche gesteckt hatte. Er konnte sich ganz genau erinnern, wo er ihn gefunden hatte, sprang vor ihnen in die Grube hinunter und ging schnurstracks dorthin, wo er den Stein gefunden hatte. Seine Mutter verbot den anderen Jungen, näher zu kommen, und mit Hilfe des jungen Mannes schaffte sie ebenfalls den Abstieg in die Baugrube. Dort nahm Tóti ihr den Knochen ab und legte ihn auf die Erde.
»So hat er dagelegen«, sagte er. Der Knochen war immer noch ein schöner Stein für ihn.
Es war Freitag, am späten Nachmittag, und deswegen arbeitete niemand mehr auf der Baustelle. Die Verschalungen für zwei Seiten des Fundaments standen bereits, aber dort, wo sich noch keine Wände befanden, waren deutlich die verschiedenen Schichten im Boden zu erkennen. Der junge Mann ging näher an diese Erdwand heran und betrachtete sie eingehend oberhalb der Stelle, wo der Junge den Knochen gefunden hatte. Er kratzte ein wenig mit den Fingern herum und legte etwas frei, das ihm wie ein Oberarmknochen vorkam.
Die Mutter sah, wie der junge Mann die Erdwand anstarrte. Als sie seinen Blicken folgte, sah sie ebenfalls den Knochen. Als sie näher hinzutrat, glaubte sie sogar, einen Kieferknochen und ein, zwei Zähne zu sehen.
Sie schreckte hoch, blickte erst auf den jungen Mann und dann auf ihre Tochter, und unwillkürlich begann sie, ihr den Mund abzuwischen.
***
Sie begriff es eigentlich erst, als sie den Schmerz an der Schläfe verspürte. Er schlug ihr ohne jegliche Vorwarnung mit der geballten Faust ins Gesicht, so blitzschnell, dass sie überhaupt nicht sah, was passierte. Oder vielleicht wollte sie nicht wahrhaben, dass er sie geschlagen hatte. Das war der erste Schlag, und sie sollte in den folgenden Jahren noch viel darüber nachdenken müssen, ob ihr Leben ein anderes geworden wäre, wenn sie damals sofort die Flucht ergriffen hätte.
Falls er es zugelassen hätte.
Ihr war überhaupt nicht klar, weswegen er auf einmal zugeschlagen hatte, und sie schaute ihn fassungslos an.
»Hast du mich geschlagen?«, fragte sie und fasste sich mit der Hand an die Schläfe.
»Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du ihn angeschaut hast?«, schnaubte er.
»Ihn? Wen mei...? Meinst du etwa Snorri? Wie ich Snorri angeschaut habe?«
»Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie geil du warst?«
Diese Seite von ihm hatte sie nie zuvor kennen gelernt. Hatte bisher noch nie dieses Wort aus seinem Mund gehört. Geil. Worüber redete er eigentlich? Sie hatte an der Kellertür einen Moment lang ein paar Worte mit Snorri gewechselt, um sich bei ihm zu bedanken, dass er ihr etwas gebracht hatte, was sie in ihrer letzten Stellung als Dienstmädchen vergessen hatte. Sie wollte ihn nicht in die Wohnung bitten, weil ihr Mann den ganzen Tag schon ziemlich abweisend gewesen war und erklärt hatte, dass er keine Lust hätte, diesen Snorri zu treffen. Snorri hatte ihr irgendetwas Witziges über den Kaufmann erzählt, einen der wohlhabendsten Handelsherren der Stadt, bei dem sie angestellt gewesen war, und sie hatten gelacht und sich dann verabschiedet.
»Das war doch nur Snorri. Jetzt hab dich doch nicht so. Warum bist du den ganzen Tag so scheußlicher Laune gewesen?«
»Zweifelst du etwa an dem, was ich sage?«, fuhr er sie an und kam auf sie zu. »Ich habe dich vom Fenster aus beobachtet. Hab gesehen, wie du um ihn herumscharwenzelt bist. Wie eine Hure!«
Er schlug ihr wieder mit der geballten Faust ins Gesicht, und sie wurde an den Geschirrschrank in der Küche geschleudert. Alles ging so schnell, dass sie keine Zeit fand, sich die Hände schützend vors Gesicht zu halten.
»Untersteh dich, mir was vorzulügen!«, brüllte er. »Ich hab gesehen, wie du ihm schöne Augen gemacht hast. Ich habe gesehen, wie du mit ihm geschäkert hast. Hab’s mit eigenen Augen gesehen! Flittchen!«
Noch ein Wort, das er zum ersten Mal verwendete.
»Gott im Himmel«, stöhnte sie. Die Oberlippe war geplatzt, Blut strömte ihr in den Mund, und der Geschmack von Blut vermischte sich mit dem salzigen Geschmack der Tränen, die ihr über das Gesicht liefen. »Warum tust du das? Was hab ich dir getan?«
Er beugte sich über sie, und er schien drauf und dran, weiter auf sie einzuschlagen. Sein Gesicht war vor Zorn entstellt. Er stampfte mit dem Fuß auf, drehte sich um und rannte mit zusammengebissenen Zähnen aus der Wohnung. Sie blieb zurück und konnte nicht fassen, was vorgefallen war.
Später musste sie oft an diese Stunde zurückdenken, und daran, ob es irgendetwas geändert hätte, wenn sie gleich auf die Misshandlungen reagiert hätte, versucht hätte, ihn zu verlassen. Davonzulaufen, um nie wiederzukehren. Stattdessen unternahm sie nichts, außer sich selbst Vorwürfe zu machen. Irgendetwas musste sie wohl getan haben, wenn er so reagierte. Etwas, was ihr selber vielleicht nicht klar war, was er aber sah. Und dass sie darüber mit ihm sprechen könnte, wenn er zurückkäme, versprechen könnte, sich zu bessern, und dass dann wieder alles wie früher wäre.
Sie hatte ihn nie zuvor so erlebt, nie hatte er sich ihr oder anderen gegenüber so benommen. Er war ein ruhiger Mensch, der zu Ernsthaftigkeit neigte. Das wusste sie an seinem Benehmen sehr zu schätzen, als sie sich kennen lernten. Manchmal war er missmutig oder verdrossen. Er hatte sich beim Bruder des Kaufmanns, bei dem sie angestellt war, als Knecht verdingt, und er brachte hin und wieder Sachen vom Bauernhof vorbei. So hatten sie sich vor fast anderthalb Jahren kennen gelernt. Sie waren etwa gleichaltrig, und er sprach darüber, mit der Landarbeit aufzuhören und vielleicht zur See zu fahren. Damit könnte man Geld machen. Er wollte sich ein eigenes Haus kaufen können. Sein eigener Herr sein. Für andere schuften, das machte einen kaputt, war altmodisch und brachte kein Geld.
Sie erzählte ihm, dass sie sich in ihrer Stellung beim Kaufmann nicht wohl fühlte. Der Kaufmann war nicht nur über die Maßen geizig, sondern machte sich auch dauernd an die drei Dienstmädchen heran, und seine Frau, die die Mädchen regelrecht schikanierte, war ein fürchterlicher Drachen. Sie hatte eigentlich keine Pläne, was sie machen wollte. Hatte nie so recht über die Zukunft nachgedacht. Hatte von Kindesbeinen an nichts als harte Arbeit gekannt. Das Leben war nichts anderes in ihren Augen.
Immer öfter ließ er sich auf irgendwelchen Botengängen beim Kaufmann blicken und besuchte sie häufig in der Küche. Eins führte zum anderen, und bald erzählte sie ihm von dem Kind, das sie hatte. Er wusste aber schon, dass sie ein Kind hatte. Er hatte Auskünfte über sie eingeholt. Damals stellte sich zum ersten Mal heraus, dass er Interesse hatte, sie näher kennen zu lernen. Sie erzählte ihm, dass das Mädchen bald drei Jahre alt sei, und dann eilte sie in den Garten hinter dem Haus, um ihre Tochter zu holen, die mit den Kindern des Kaufmanns spielte.
Als sie mit ihr in die Küche zurückkam, fragte er sie danach, mit wie vielen Männern sie sich herumgetrieben hätte. Dabei lächelte er aber so, als wäre es einfach nur ein nett gemeinter Witz. Später aber warf er ihr liederlichen Lebenswandel vor und war immer erbarmungslos darauf aus, sie zu erniedrigen. Ihre Tochter nannte er nie beim Namen, gebrauchte nur Schimpfwörter und bezeichnete sie als Hurenbalg oder Kretin.
Sie hatte sich nie mit Männern herumgetrieben. Sie hatte ihm vom Vater ihres Kindes erzählt, der auf einem kleinen Fischkutter arbeitete und auf See umgekommen war. Er war nur zweiundzwanzig Jahre alt gewesen, als sie zum Fischen ausfuhren, in Seenot gerieten und zu viert mit dem Boot untergingen. Zur gleichen Zeit stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Sie waren nicht verheiratet gewesen, sodass sie sich kaum als Witwe bezeichnen konnte. Sie hatten vorgehabt zu heiraten, aber dann war er umgekommen und hatte sie mit einem unehelichen Kind zurückgelassen.
Er saß in der Küche und hörte ihr zu, und sie bemerkte, dass ihr kleines Mädchen sich nicht in seine Nähe wagte. Normalerweise fremdelte sie nie, aber jetzt klammerte sie sich fest an den Rocksaum der Mutter und traute sich nicht, ihn loszulassen, als er sie zu sich locken wollte. Er nahm ein Stückchen Kandis aus der Jackentasche und reichte es ihr, aber sie vergrub ihr Gesicht in den Rockfalten, fing an zu weinen und wollte wieder hinaus zu den Kindern. Obwohl sie Kandis liebte.
Zwei Monate später machte er ihr einen Heiratsantrag. Von Romantik wie in Büchern, die sie gelesen hatte, konnte keine Rede sein. Sie hatten sich ein paarmal abends und an Wochenenden getroffen, waren durch die Stadt spaziert oder hatten sich im Kino einen Chaplin-Film angesehen. Sie konnte herzlich über den kleinen Vagabunden lachen, aber wenn sie zu ihm hinüberschaute, lächelte er nicht einmal. Eines Abends, als sie aus dem Kino kamen und sie mit ihm an der Haltestelle wartete, fragte er sie, ob sie nicht heiraten sollten. Er zog sie an sich.
»Ich will, dass wir heiraten«, sagte er.
Sie war so überrascht, trotz allem, dass sie sich erst sehr viel später daran erinnerte, und eigentlich erst, als alles schon über die Bühne gegangen war und ihr auf einmal klar wurde, dass das gar kein richtiger Heiratsantrag gewesen war. Und es war überhaupt nicht darum gegangen, was sie wollte.
Ich will, dass wir heiraten.
Sie hatte sich schon Gedanken darüber gemacht, ob er um ihre Hand anhalten würde. Ihre Verbindung hatte eigentlich das Stadium erreicht, und dem kleinen Mädchen fehlte ein Zuhause. Und selbst wollte sie sich auch gern um ein eigenes Heim kümmern. Kinder bekommen. Nur wenige Männer hatten ihr in der letzten Zeit Aufmerksamkeit geschenkt. Möglicherweise wegen des Mädchens. Sie war vielleicht auch keine sonderlich attraktive Frau, ziemlich klein und etwas mollig, das Gesicht hatte etwas grobe Züge, und die Zähne standen vor. Aber ihre kleinen geschickten Hände rasteten nie. Vielleicht würde sie nie einen besseren Antrag bekommen.
»Was sagst du dazu?«, fragte er.
Sie nickte. Er küsste sie, und sie umarmten sich. Kurze Zeit später wurde Hochzeit in der Kirche von Mosfell gehalten. Die Hochzeitsgesellschaft war klein, sie bestand nur aus ihnen beiden, seinen Freunden vom Land und zwei ihrer Freundinnen aus Reykjavík. Der Pfarrer lud sie nach der Zeremonie zum Kaffee ein. Sie hatte sich nach seiner Familie erkundigt, aber er hatte sich dazu kaum äußern wollen. Hatte erklärt, dass er keine Geschwister besäße, sein Vater sei gestorben, als er noch ein Säugling war, und seine Mutter hätte ihn nicht bei sich behalten können; hatte ihn in Pflege gegeben. Er war auf verschiedenen Bauernhöfen gewesen und hatte sich schließlich beim Bruder des Kaufmanns verdingt. Er schien kein Interesse daran zu haben, sie nach ihrer Familie auszufragen. Schien kaum Interesse an der Vergangenheit zu haben. Sie erklärte ihm aber, dass ihre Verhältnisse ganz ähnlich waren; sie wüsste nicht, wer ihre Eltern waren. Auch sie war als Pflegekind von einer Familie zur anderen weitergereicht worden, bis sie schließlich in der Stellung bei dem Kaufmann gelandet war. Er nickte verständnisvoll.
»Jetzt beginnen wir ganz von vorne«, sagte er. »Vergessen die Vergangenheit«, sagte er.
Sie mieteten eine kleine Kellerwohnung an der Lindargata, die praktisch nur aus einem Zimmer und einer Küche bestand. Das Plumpsklo war hinter dem Haus. Sie kündigte beim Kaufmann. Er sagte, sie bräuchte jetzt nicht länger für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Er würde für sie sorgen. Er bekam für den Anfang Arbeit am Hafen, aber er wartete auf die nächste Gelegenheit, um auf einem Boot anzuheuern. Träumte davon, zur See zu fahren.
Sie stand am Küchentisch und legte die Hände über den Bauch. Sie hatte ihm noch nichts davon gesagt, dass sie schwanger war, aber sie war sich ziemlich sicher. Und eigentlich war ja auch nichts anderes zu erwarten gewesen. Sie hatten über Kinder geredet, aber sie wusste trotzdem nicht genau, wie er dazu stand, so verschlossen wie er war. Sie hatte schon einen Namen für das Kind, wenn es ein Junge würde. Sie wollte einen Jungen bekommen. Er sollte Símon heißen.
Sie hatte von brutalen Männern gehört, die Hand an ihre Frauen legten. Hatte von Frauen gehört, die damit leben mussten, dass der Ehemann gewalttätig war. Geschichten gehört. Sie glaubte nicht, dass er zu denen gehörte. Glaubte nicht, dass sie zu denen gehörte. Glaubte nicht, dass er zu so etwas im Stande sei. Dies hier musste etwas Außergewöhnliches sein, eine Ausnahme, sagte sie zu sich selbst. Er hat geglaubt, dass ich mit Snorri geflirtet habe, dachte sie. Ich muss aufpassen, dass sich das nicht wiederholt.
Sie strich sich über das Gesicht und zog die Nase hoch. In was für eine Wut er sich hineingesteigert hatte. Er war davongestürzt, aber er würde bestimmt bald zurückkommen und sie um Verzeihung bitten. So konnte er sich ihr gegenüber nicht verhalten. Konnte er einfach nicht. Durfte er nicht. Sie ging verstört ins Schlafzimmer, um sich um ihre Tochter zu kümmern. Das Mädchen, das Mikkelína hieß, war morgens mit Fieber aufgewacht, hatte fast den ganzen Tag geschlafen und schlief immer noch. Sie nahm das Mädchen in die Arme und spürte, wie heiß es war. Sie zog die Kleine auf den Schoß und fing an, ihr Kinderreime vorzusagen, immer noch schockiert und ganz durcheinander nach der brutalen Attacke.
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der ist in den Brunnen gefallen,
der hat ihn wieder rausgeholt,
der hat ihn ins Bett gelegt,
der hat ihn zugedeckt,
und der kleine Schelm da,
der hat ihn wieder aufgeweckt.
Das Kind atmete schnell. Der kleine Brustkasten hob und senkte sich, und durch die Nase ertönte beim Atmen ein zischendes Pfeifen. Das Gesicht glühte. Sie versuchte, Mikkelína zu wecken, aber sie wollte nicht aufwachen.
Sie jammerte laut.
Das Mädchen war schwer krank.
***
Kapitel 2
Elínborg nahm die Benachrichtigung über den Knochenfund im Millenniumsviertel entgegen. Die anderen waren schon nach Hause gegangen, und sie war eigentlich auch im Begriff, das Büro zu verlassen, als das Telefon klingelte. Sie zögerte einen Augenblick, schaute auf die Uhr und dann wieder auf das Telefon. Sie hatte Gäste zum Abendessen eingeladen und den ganzen Tag appetitliches Hühnchenfleisch in reichlich Tandoori-Sauce vor sich gesehen. Sie seufzte und nahm den Hörer ab.
Elínborg war unbestimmbaren Alters, irgendwo zwischen vierzig und fünfzig, sie war gut gepolstert, ohne dick zu sein, und sie hatte eine Schwäche für gutes Essen. Sie war geschieden und hatte vier Kinder, darunter ein Adoptivkind, das aber nicht mehr zu Hause wohnte. Sie hatte wieder geheiratet, einen Automechaniker, der sie schon allein wegen ihrer Kochkünste sehr liebte. Mit ihm und den anderen drei Kindern wohnte sie in einem Reihenhaus im Grafarvogur-Viertel. Sie hatte früher einmal Geologie studiert und sogar einen Abschluss gemacht, hatte aber dann nie auf diesem Gebiet begonnen. Bei der Polizei hatte sie als Sommeraushilfe gearbeitet und war dann dort hängen geblieben. Sie war eine der wenigen weiblichen Angehörigen der Kriminalpolizei.
Sigurður Óli und Bergþóra zogen eine heiße Nummer durch, als sein Beeper losging. Der wiederum befand sich am Gürtel seiner Hose, die in der Küche auf dem Fußboden lag. Von dort hörte man das unerträgliche Piepen. Um das Ding zum Schweigen zu bringen, musste er aus dem Bett. Er war früh von der Arbeit nach Hause gekommen. Bergþóra war aber schon vor ihm da gewesen und hatte ihn mit einem leidenschaftlichen Kuss in Empfang genommen. Dann ergab eins das andere, seine Hose war bereits in der Küche auf der Strecke geblieben, er hatte gerade noch das Telefon aus der Steckdose reißen und das Handy abstellen können. Den Beeper hatte er aber vergessen.
Sigurður Óli stöhnte auf und schaute zu Bergþóra hoch, die rittlings auf ihm saß. Er schwitzte und war krebsrot im Gesicht. Er sah ihr an, dass sie nicht bereit war, ihn sofort freizugeben. Kniff die Augen zu, legte sich auf ihn und arbeitete ruhig und taktsicher mit den Hüften, bis sie den Orgasmus voll ausgekostet hatte und ihr ganzer Körper sich entspannte.
Sigurður Óli selbst musste auf bessere Zeiten warten. In seinem Leben hatte der Beeper Vorrang.
Er kroch unter Bergþóra hervor, die wie erschlagen in die Kissen zurücksank.
Erlendur saß im Skúlakaffi und aß Pökelfleisch. Er ging hin und wieder zum Essen dorthin, weil es das einzige Lokal in ganz Reykjavík war, wo man deftiges isländisches Essen bekommen konnte, Essen, wie Erlendur es selber zubereiten würde, wenn er sich dazu aufraffen könnte, für sich selber zu kochen. Auch die Inneneinrichtung passte ihm hervorragend, alles mit braunem schäbigen Kunststoff verkleidet, alte Stahlstühle, bei denen teilweise das Schaumgummi aus aufgeschlitzten Sitzpolstern hervorquoll. Abgewetztes Linoleum auf dem Fußboden, das von lkw-Fahrern, Taxifahrern, Kranführern, Handwerkern und Arbeitern zertrampelt worden war. Erlendur saß allein am Tisch, ein wenig abseits vom Gedränge, und beugte sich über fettes Pökelfleisch, Salzkartoffeln, Erbsen und gelbe Rüben, und das alles in einer leicht süßlichen Mehlschwitze. Es war eigentlich keine Essenszeit, aber Erlendur hatte dem Koch dennoch eine Portion traditionelles Pökelfleisch entlocken können. Er schnitt sich einen großen Happen zurecht, den er zusammen mit Kartoffeln und Rüben auf der Gabel zurechtlegte. Zur Krönung des Ganzen strich er mit dem Messer die Sauce darüber, bevor er es sich genüsslich hineinstopfte.
Erlendur hatte bereits eine weitere Ladung auf der Gabel arrangiert und öffnete gerade erwartungsvoll den Mund, als sein Handy klingelte, das neben dem Teller auf dem Tisch lag. Die Hand, die die Köstlichkeiten zum Mund führte, erstarrte auf halbem Weg. Erlendur blickte vom Handy auf die voll geladene Gabel und dann wieder aufs Handy, und die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als die Gabel wieder zurück auf den Teller wanderte.
»Warum wird man nie in Ruhe gelassen?«, knurrte er, noch bevor Sigurður Óli ein Wort hervorbringen konnte.
»Knochenfund im Millenniumsviertel«, sagte Sigurður Óli. »Elínborg und ich sind schon auf dem Weg dorthin.«
»Was für Knochen?«
»Keine Ahnung. Elínborg rief von unterwegs an. Die Spurensicherung ist bereits verständigt worden.«
»Ich bin gerade beim Essen«, sagte Erlendur ohne Hast.
Es hätte nicht viel gefehlt, und Sigurður Óli hätte ihm seine eigenen Aktivitäten auf die Nase gebunden, als er die Nachricht erhielt, aber er konnte sich gerade noch bremsen.
»Wir sehen uns da draußen«, sagte er. »Es ist auf dem Weg zu diesem kleinen See, Reynisvatn oder wie der heißt, an der Nordseite der Heißwassertanks. Nicht weit von der Hauptstraße.«
»Was bedeutet Millennium?«, fragte Erlendur.
»Was?«, fragte Sigurður Óli, immer noch ärgerlich, weil er und Bergþóra gestört worden waren.
»Sind das nicht tausend Jahre? Ich meine ein Jahrtausend? Was soll denn dieses Wort? Millennium. Immer diese dämlichen Fremdwörter. Millennium. Was soll denn das?«
»Herrgott nochmal«, ächzte Sigurður Óli und stellte das Handy ab.
Eine Dreiviertelstunde später steuerte Erlendur seinen klapprigen, zwölf Jahre alten japanischen Kleinwagen in die Straße im Millenniumsviertel und hielt vor der Baustelle beim Grafarholt-Hügel. Die Polizei war bereits eingetroffen und hatte das Areal mit einem gelben Band abgesperrt, unter dem Erlendur durchkroch. Elínborg und Sigurður Óli waren in die Ausschachtung hinuntergestiegen und standen vor der Erdwand. Der junge Medizinstudent, der den Knochenfund gemeldet hatte, war bei ihnen. Die Mutter mit der Geburtstagsparty hatte die Jungs zusammengetrommelt und sie wieder ins Haus gescheucht. Der Amtsarzt von Reykjavík, ein korpulenter Mann um die fünfzig, kraxelte eine der drei Leitern hinunter, die aufgestellt worden waren. Erlendur folgte ihm.
Der Knochenfund schien ein gefundenes Fressen für die Medien zu sein. Journalisten und Reporter hatten sich auf dem Gelände eingefunden, und auch die Nachbarn standen ringsherum. Es waren schon einige in ihre Häuser eingezogen, und andere, die an ihren Rohbauten herumwerkelten, standen mit Hammer und Brecheisen in der Hand da und wunderten sich über den Aufstand. Es war Ende April, und das Wetter war relativ mild, und ein Hauch von Frühling lag in der Luft.
Die Spezialisten von der Spurensicherung waren gerade dabei, die Erde vorsichtig aus der Wand zu kratzen. Sie wurde mittels kleiner Schaufeln in Plastiktüten befördert. Deswegen war der obere Teil des Skeletts schon einigermaßen deutlich zu erkennen. Man konnte einen Arm sehen, einen Teil des Brustkastens und den unteren Teil eines Kiefers.
»Ist das der Millenniumsmann?«, fragte Erlendur und ging zu der Wand.
Elínborg blickte Sigurður Óli fragend an. Der stand hinter Erlendur, tippte sich mit dem Finger an die Schläfe und machte eine Kreisbewegung.
»Ich hab beim Nationalmuseum angerufen«, sagte Sigurður Óli und kratzte sich rasch am Kopf, als Erlendur sich unvermittelt zu ihm umdrehte. »Ein Archäologe ist auf dem Weg hierher. Der kann uns vielleicht sagen, was das ist.«
»Brauchen wir dann nicht auch einen Geologen?«, fragte Elínborg. »Um etwas über den Boden zu erfahren. Was sich daraus über die Knochen ablesen lässt. Beispielsweise aus dem Alter der Erdschichten.«
»Eigentlich müsstest du uns da doch weiterhelfen können?«, fragte Sigurður Óli. »Hast du das nicht studiert?«
»Hab ich alles vergessen«, sagte Elínborg. »Ich weiß bloß, dass das Braune da Erde ist.«
»Der liegt keine sechs Fuß tief, wie vorgeschrieben«, sagte Erlendur. »Höchstens ein bis anderthalb Meter. Ist wahrscheinlich ziemlich hastig verscharrt worden. Und es hat mir fast den Anschein, als ob das hier noch irgendwelche Hautreste sind. Lange hat der hier nicht gelegen. Das ist keiner von den Wikingern, die Island besiedelt haben. Kein Ingólfur.«
»Ingólfur?«, fragte Sigurður Óli.
»Ingólfur Arnarson, der erste Siedler«, erklärte Elínborg.
»Wieso der?«, fragte der Amtsarzt.
»Ich hab doch gerade gesagt, dass er das nicht ist«, sagte Erlendur.
»Ich meine«, sagte der Arzt, »dass das genauso gut eine die sein kann. Warum bist du der Meinung, dass es unbedingt ein Mann sein muss?«
»Meinetwegen auch eine Frau«, erwiderte Erlendur. »Mir ist es egal.« Er zuckte die Achseln. »Kannst du mir was über dieses Gerippe sagen?«
»Ich seh zu wenig davon«, sagte der Arzt. »Am besten sagt man so wenig wie möglich, bevor man es nicht ganz aus der Wand rausgeholt hat.«
»Mann oder Frau? Alter?«
»Unmöglich zu sagen.«
Ein großer, vollbärtiger Mann in einem isländischen Wollpullover, aus dessen großem Mund wie bei einem Säbelzahntiger zwei gelbe Eckzähne durch das graumelierte Bartgewirr drangen, kam hinzu und erklärte, dass er Archäologe sei. Er schaute sich die Methoden der Spurensicherung an und verlangte umgehend, dass sie mit diesen Mätzchen aufhören sollten. Sie trugen weiße Overalls und Gummihandschuhe, und sie hatten Schutzbrillen aufgesetzt. Erlendur konnte sie sich genauso gut als Angestellte in einem Atomkraftwerk vorstellen. Sie schauten ihn an und warteten auf Anweisungen.
»Wir müssen uns von oben herunterbuddeln«, sagte das Säbelzähnchen und war immer noch schockiert über die Vorgehensweise der Spurensicherungsbeamten. »Habt ihr etwa vor, ihn mit diesen primitiven Schaufeln auszugraben? Wer hat hier eigentlich das Sagen?«
Erlendur gab sich zu erkennen.
»Das hier ist zwar kein Fund von archäologischer Bedeutung«, erklärte Säbelzähnchen ihm und gab ihm die Hand. »Skarphéðinn ist mein Name, grüß dich, aber es ist besser, das Ganze mit archäologischen Methoden anzugehen, verstehst du?«
»Ich hab keine Ahnung, wovon du redest«, sagte Erlendur.
»Diese Knochen haben keine unendlich lange Zeit im Boden gelegen. Weniger als sechzig oder siebzig Jahre, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch weniger. Da sind ja noch Kleider dran.«
»Kleider?«
»Ja, hier«, sagte Skarphéðinn und deutete mit seinem wulstigen Finger auf eine undefinierbare Verfärbung in der Erde. »Und wahrscheinlich noch an anderen Stellen.«
»Ich hatte gedacht, das seien Hautreste«, sagte Erlendur etwas betreten.
»Es wäre am vernünftigsten, wenn ihr uns das mit unseren Methoden ausgraben lassen würdet, damit kein Beweismaterial verloren geht. Eure Leute von der Spurensicherung können uns dabei helfen. Wir müssen das Gelände obendrüber absperren und uns zu dem Skelett runtergraben, auf keinen Fall darf von hier aus weitergebuddelt werden. Bei uns dreht sich alles darum, dass kein Beweismaterial oder irgendwelche Indizien verloren gehen. Allein die Tatsache, wie die Knochen liegen, kann uns Diverses sagen. Und was wir ringsherum finden, kann ebenfalls Hinweise geben.«
»Und was ist wohl deiner Meinung nach hier passiert?«, fragte Erlendur.
»Ich weiß es nicht«, sagte Skarphéðinn. »Viel zu früh, um darüber zu spekulieren. Wir müssen hier eine Ausgrabung vornehmen, und dabei kommt hoffentlich etwas zum Vorschein, was Licht in die Sache bringt.«
»Könnte das jemand sein, der allein auf weiter Flur umgekommen ist? Beispielsweise erfroren ist und dann langsam aber sicher in die Erde versunken ist?«
»Niemand sinkt in so kurzer Zeit so tief runter«, sagte Skarphéðinn.
»Dann ist es also ein Grab.«
»Sieht so aus«, sagte Skarphéðinn mit Nachdruck. »Sieht ganz danach aus. Aber was ist jetzt? Sollen wir dann damit anfangen, das Ganze von oben nach unten aufzugraben?«
Erlendur nickte zustimmend.
Skarphéðinn ging mit großen Schritten zur Leiter und kletterte aus der Baugrube. Erlendur war ihm dicht auf den Fersen. Sie standen jetzt genau über dem Skelett, und der Archäologe erklärte, wie die Ausgrabung am besten durchzuführen sei. Er machte einen guten Eindruck auf Erlendur, und das, was er sagte, hörte sich vernünftig an. Skarphéðinn griff nach seinem Handy und rief seine Mannschaft auf den Plan. Er hatte mit den wichtigsten Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte zu tun gehabt und wusste, was er tat. Erlendur vertraute ihm voll und ganz.
Der Leiter der Spurensicherung war anderer Ansicht. Er rastete aus, als er erfuhr, dass hier Archäologen hinzugezogen werden sollten, die keinen blassen Schimmer von einem Ermittlungsverfahren hätten. Man würde viel Zeit sparen, wenn man das Skelett aus der Böschung herauskratzen würde. Dabei gäbe es ausreichend Gelegenheit, die Position festzustellen und andere Indizien über die Gewalttat, falls es welche gäbe. Erlendur hörte sich die Litanei eine Weile an, traf aber trotzdem die Entscheidung, dass Skarphéðinn mit seiner Mannschaft sich von oben zu dem Skelett hinuntergraben sollte, auch wenn es wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde.
»Die Knochen haben hier ein halbes Jahrhundert gelegen, ein paar Tage mehr oder weniger spielen überhaupt keine Rolle«, erklärte er, und damit war die Sache erledigt.
Erlendur ließ seine Blicke über das neue Viertel schweifen, das im Entstehen war. Er schaute zu den rostigbraunen Heißwassertanks hoch und in Richtung Reynisvatn. Dann fielen seine Blicke auf das unbebaute Grasland jenseits der Neubauten.
Vier Büsche erweckten seine Aufmerksamkeit, die in etwa dreißig Meter Entfernung die andere Vegetation überragten. Als er sich diesen Büschen näherte, glaubte er zu sehen, dass es sich um Johannisbeersträucher handelte. Sie standen in gerader Linie dicht nebeneinander. Er strich über die knorrigen, kahlen Äste und überlegte, wer sie dort in diesem Niemandsland eingepflanzt hatte.
Kapitel 3
Die in Fleecejacken und Isolierhosen vermummten Archäologen trafen mit ihren Löffeln und Schaufeln ein. Vom Rand der Baugrube aus zäunten sie ein ziemlich großes Areal oberhalb der Stelle ein, wo das Skelett lag, und um die Abendessenszeit hatten sie angefangen, vorsichtig die Vegetationsdecke zu entfernen. Es war immer noch taghell, denn die Sonne ging erst nach neun unter. Vier Männer und zwei Frauen gingen ruhig und ohne jegliche Hektik vor. Jede Schaufel Erde wurde genauestens untersucht. Irgendwelche Erdbewegungen, die womöglich von demjenigen stammten, der das Grab ausgehoben hatte, waren nicht festzustellen.
Elínborg hatte einen Geologen von der geowissenschaftlichen Fakultät erreicht, der sofort bereit gewesen war, der Polizei behilflich zu sein. Anscheinend hatte er das, womit er sich gerade beschäftigte, einfach stehen und fallen lassen, denn bereits eine halbe Stunde nach dem Gespräch traf er an Ort und Stelle ein. Der schwarzhaarige, schlanke Mann war um die vierzig und hatte eine sonore Stimme. Seinen Doktor hatte er in Paris gemacht. Elínborg begleitete ihn zu der Erdwand. Die Polizei hatte eine Zeltplane aufgespannt, sodass die Fundstelle nicht mehr gesehen werden konnte. Sie führte den Geologen unter das Zelt.
Ein großer Neonscheinwerfer erhellte das Zelt und warf unheimliche Schatten auf die Stelle, wo das Skelett aus der Wand herausragte. Der Geologe ging sehr bedächtig vor. Er untersuchte den Boden, nahm eine Hand voll Erde aus der Wand und zerrieb sie zwischen den Fingern. Er verglich den Boden seitlich des Skeletts mit dem darüber und darunter, und er untersuchte die Dichte des Bodens um die Knochen herum. Selbstgefällig erzählte er, dass er schon früher einmal wegen eines Kriminalfalls zu Rate gezogen worden war, um die chemische Zusammensetzung eines Erdklumpens von einem Tatort zu bestimmen. Und dabei habe er seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Er begann einen Vortrag darüber zu halten, dass es gelehrte Bücher über Kriminalbiologie und Geowissenschaft gäbe, die Pathologie des Erdbodens sozusagen, falls Elínborg ihn richtig verstand.
Sie hörte sich sein Geschwafel an, bis ihr der Geduldsfaden riss.
»Wie lange hat er in der Erde gelegen?«, fragte sie.
»Schwer zu sagen«, erklärte der Geologe mit seiner sonoren Stimme und plusterte sich wichtigtuerisch auf. »Das muss nicht unbedingt lange her sein.«
»Was heißt ›nicht unbedingt lange‹ geologisch gesprochen?«, fragte Elínborg. »Tausend Jahre? Zehn?«
Der Geologe schaute sie an.
»Schwer zu sagen«, wiederholte er.
»Wie exakt lässt sich das bestimmen?«, fragte Elínborg. »In Jahren gesprochen.«
»Schwer zu sagen.«
»Mit anderen Worten, am schwersten ist es, sich festzulegen.«
Der Geologe schaute Elínborg an und lächelte.
»Entschuldige, ich war in Gedanken. Was willst du wissen?«
»Wie lange?«
»Was?«
»Wie lange hat er hier gelegen?«, seufzte Elínborg.
»Schätzungsweise so zwischen fünfzig und siebzig Jahren. Ich werde das noch genauer untersuchen müssen, aber das ist so mein erster Eindruck. Die Dichte des Bodens ... Auf jeden Fall ist es ausgeschlossen, dass wir hier einen der ersten Siedler Islands haben, ich meine, dass das ein heidnischer Grabhügel ist.«
»Das wissen wir«, sagte Elínborg, »es gibt Stoffreste ...«
»Diese grüne Linie hier«, sagte der Geologe und deutete auf eine grünliche Bodenschicht zuallerunterst, »das ist eine Lehmschicht aus der Eiszeit. Diese Streifen hier, die da in verhältnismäßig regelmäßigen Abständen kommen, das sind Tephraschichten, also Spuren von Vulkanausbrüchen. Die oberste stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Das ist die dickste Schicht von vulkanischen Lockerstoffen hier im Großraum Reykjavík, nachdem das Land besiedelt wurde. Dann gibt’s hier noch zwei viel ältere Tephraschichten, die von Ausbrüchen von Hekla und Katla herrühren, aber das führt uns ein paar tausend Jahre weiter zurück. Du siehst hier, dass es nicht sonderlich tief bis zum festen Grundgestein ist. Das ist der so genannte Reykjavík-Basalt, der das gesamte Gebiet in und um die Hauptstadt bedeckt.«
Er schaute Elínborg an.
»Gemessen an dieser ganzen Geschichte ist es den millionsten Teil einer Sekunde her, seit dieses Grab ausgehoben wurde.«
Gegen halb zehn beendeten die Archäologen ihre Arbeit, und Skarphéðinn verkündete Erlendur, dass sie morgen Früh wiederkommen würden. Sie hatten nichts Erwähnenswertes gefunden, da sie gerade mal angefangen hatten, die oberste Vegetationsdecke zu entfernen. Erlendur fragte, ob sie die Arbeit etwas beschleunigen könnten, aber Skarphéðinn schaute ihn mitleidig an und fragte, ob er etwa vorhabe, Beweismaterial zu vernichten. Sie einigten sich schließlich darauf, dass es keine besondere Eile hatte, bis zu den Knochen vorzudringen.
Der Scheinwerfer unter der Zeltplane ging aus. Die Reporter und Journalisten waren längst weg. Der Knochenfund war die Hauptmeldung in den Abendnachrichten gewesen. Das Fernsehen brachte Aufnahmen von Erlendur und seinen Leuten unten in der Baugrube, und ein Sender zeigte, wie ein Reporter versuchte, Erlendur ans Mikrofon zu bekommen, der ihn aber abwies und ihm den Rücken zukehrte.
Jetzt lag wieder Ruhe über dem Viertel. Die Hammerschläge waren verstummt, und die Leute, die in den halb fertigen Häusern gearbeitet hatten, waren verschwunden. Man hörte auch keine Kinder mehr schreien. Zwei Polizisten sollten in der Nacht vom Streifenwagen aus das Gelände überwachen. Elínborg und Sigurður Óli waren auf dem Weg nach Hause. Die Leute von der Spurensicherung waren den Archäologen zur Hand gegangen, aber sie waren jetzt auch schon weg. Erlendur hatte noch mit Tótis Mutter und mit Tóti selbst über den Knochen gesprochen, den der Junge gefunden hatte. Der Kleine war ganz aufgeregt wegen all der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. »Also so was«, stöhnte seine Mama. Dass ausgerechnet ihr Sohn das Skelett eines Mannes gefunden hatte, der irgendwo in der Pampa begraben worden war. »Das ist der tollste Geburtstag, den ich je hatte«, sagte Tóti zu Erlendur. »Cool.«
Auch der junge Medizinstudent war mit seinem kleinen Bruder nach Hause gegangen. Erlendur und Sigurður Óli hatten kurz mit ihm darüber gesprochen, wie er den Knochen entdeckt hatte. Er beschrieb ihnen, dass er das kleine Mädchen beobachtet hatte, aber erst nach einer ganzen Weile bemerkt hatte, dass sie auf einem Knochen herumkaute. Als er das Teil näher in Augenschein nahm, hatte sich herausgestellt, dass es eine zerbrochene Rippe war.
»Und wieso hast du gleich gewusst, dass es ein menschlicher Knochen war?«, fragte Erlendur. »Er hätte ja auch beispielsweise von einem Schaf sein können.«
»Ja, wäre nicht ein Schaf viel wahrscheinlicher gewesen?«, fügte Sigurður Óli hinzu, der ein ausgesprochener Stadtmensch war und keinen blassen Schimmer von Vierbeinern hatte.
»Da konnte überhaupt kein Zweifel bestehen«, sagte der Medizinstudent. »Ich habe an Obduktionen teilgenommen, und ich war mir sofort sicher.«
»Hast du eine Vermutung, wie lange die Knochen hier in der Erde gelegen haben?«, fragte Erlendur. Er wusste, dass er noch die Ergebnisse des Geologen bekommen würde, den Elínborg hinzugezogen hatte, sowie die des Archäologen und des Gerichtsmediziners, aber ihm war auch an der Meinung dieses Studenten gelegen.
»Ich hab mir den Boden ein wenig näher angeschaut, und gemessen an dem Verwesungsstadium würde ich sagen, etwa siebzig Jahre. Nicht viel mehr. Aber ich bin da kein Experte.«
»Nein, genau«, sagte Erlendur. »Der Archäologe tippte auf dasselbe, aber er ist auch kein Spezialist.«
Er wandte sich an Sigurður Óli.
»Wir müssen uns jetzt mal an die Vermisstenmeldungen aus dieser Zeit heranmachen, neunzehnhundertdreißig oder -vierzig. Möglicherweise sogar noch früher. Mal sehen, ob wir da was finden.«
Erlendur stand am Rand der Baugrube und wurde von der Abendsonne angestrahlt. Er blickte Richtung Norden, wo die Häuser von Mosfellsbær und die kleine Meeresbucht Kollafjörður sich zu Füßen der Esja ausbreiteten, noch etwas weiter seitlich des Berges waren die Häuser auf Kjalarnes. Von hier oben sah er die Autos auf der Ausfallstraße unterhalb von Úlfarsfell aus der Stadt strömen. Dann hörte er ein Auto, das an die Baustelle heranfuhr, und ihm entstieg ein Mann in Erlendurs Alter, um die fünfzig und kräftig gebaut. Er trug eine kurze blaue Windjacke und eine Baseball-Kappe. Er knallte die Autotür zu und blickte auf Erlendur und den Streifenwagen, dann auf die freigelegten Stellen und die Zeltplane, die das Skelett verhüllte.
»Seid ihr von der Steuerbehörde?«, fragte er schroff, indem er auf Erlendur zuging.
»Von der Steuerbehörde?«, echote Erlendur.
»Ihr sitzt einem doch dauernd im Nacken. Kommt ihr schon wieder mit so einem Vollstreckungswisch?«
»Ist das dein Grundstück?«, fragte Erlendur.
»Wer bist du eigentlich? Was für ein Zelt ist das? Was geht hier eigentlich vor?«
Der Mann hieß Jón, und Erlendur erklärte ihm, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass Jón sowohl Bauunternehmer als auch Besitzer dieses Grundstücks war, aber kurz vor dem Bankrott stand und eine ziemliche Aversion gegen gewisse Behörden hatte. Die Arbeit am Bau hatte eine ganze Weile geruht, aber er erklärte, er käme ziemlich regelmäßig zur Baustelle, um nach dem Rechten zu sehen. Denn da wären die verdammten Blagen, die hier in diesen Neubauvierteln herumstreunten und alles Mögliche anrichten könnten. Nachrichten über den Skelettfund hatte er weder gehört noch gesehen, und er blickte ungläubig in die Grube hinunter, während Erlendur ihm erklärte, welche Maßnahmen seitens der Kriminalpolizei und der Archäologen in Angriff genommen werden müssten.
»Ich habe nicht das Geringste bemerkt, und die Bauarbeiter bestimmt auch nicht. Ist das womöglich eine historische Grabstätte?«, fragte Jón.
»Das wissen wir noch nicht«, sagte Erlendur und war nicht willens, weitere Auskünfte zu geben. »Weißt du irgendwas über das Gebiet, das sich hier in östlicher Richtung anschließt?«, fragte er dann und deutete in Richtung der Johannisbeersträucher.
»Das ist gutes Bauland, mehr weiß ich nicht«, sagte Jón. »Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich es erleben würde, dass sich Reykjavík bis hierher ausbreitet.«
»Hier grassiert so eine Bauwut, dass es schon an Größenwahnsinn grenzt«, sagte Erlendur. »Weißt du zufällig, ob Johannisbeersträucher wild in Island wachsen?«
»Johannisbeersträucher? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gehört.«
Sie redeten noch eine Weile miteinander, bevor Jón sich verabschiedete und wieder losfuhr. Erlendur hatte ihn so verstanden, dass er möglicherweise das Grundstück an seine Gläubiger verlieren würde, falls es ihm nicht gelingen würde, irgendwo noch ein Darlehen aufzutun.
Erlendur wollte endlich selbst nach Hause. Am westlichen Himmel zauberte die Abendsonne einen schönen rötlichen Schimmer, der sich vom Meer her bis aufs Land erstreckte. Es war kühl geworden.
Er kam jetzt zu der Stelle, wo ausgegraben wurde, und starrte auf das dunkle Erdreich. Mit dem einen Fuß scharrte er an ein paar Stellen herum und fragte sich selbst, wieso er eigentlich noch hier herumhing. Aber so war es halt, wenn einen zu Hause nichts und niemand erwartete, dachte er bei sich, und trat so fest zu, dass die Erde hochflog. Keine Familie, keine Ehefrau, die ihm erzählen würde, wie ihr Tag verlaufen war. Keine Kinder, die ihm berichten würden, wie es ihnen in der Schule ergangen war. Nur ein klappriger alter Fernseher, ein Ohrensessel, ein abgenutzter Teppich, Schachteln und Verpackungen von Take-away-Essen und Fertiggerichten und Wände voller Bücher, die er in seinem Einsiedlerdasein las. Viele handelten von Menschen, die urplötzlich verschwanden, oder von mörderischen Strapazen und Katastrophen in Islands Einöden.
Plötzlich trat er gegen etwas. Es fühlte sich so an, als ob ein kleiner spitziger Stein aus dem Boden herausragte. Er trat mit der Fußspitze ein paarmal vorsichtig dagegen, aber da bewegte sich nichts. Er bückte sich und kratzte vorsichtig mit den Händen die Erde weg. Skarphéðinn hatte ihm eingeschärft, dass in Abwesenheit der Archäologen nichts angerührt werden dürfe. Erlendur versuchte halbherzig, den Stein zu bewegen, aber es gelang ihm nicht, ihn aus dem Boden zu bekommen.
Deswegen grub er tiefer und hatte sich die Hände ganz schön mit Erde beschmiert, als er auf einen weiteren spitzigen Stein stieß, und dann noch auf einen dritten, einen vierten und einen fünften. Erlendur kniete nieder und kratzte so heftig, dass die Erde in alle Richtungen flog. Das vergrabene Objekt kam immer besser zum Vorschein, und bald starrte Erlendur auf etwas, was nichts anderes als eine Hand sein konnte. Fünf Fingerknochen und ein Mittelhandknochen, die aus der Erde herausragten.
Die fünf Finger waren gespreizt, und es hatte ganz den Anschein, als hätte der, der da unten lag, die Hand hochgereckt, um etwas zu greifen oder um sich zu wehren, oder vielleicht hatte er um Gnade gebeten? Erlendur zuckte zusammen. Die Knochen streckten sich ihm aus der Erde entgegen als ob sie um Gnade flehen würden, und in der Abendbrise durchfuhr ihn ein Schauder.
Lebendig begraben, dachte Erlendur bei sich. Er schaute zu den Johannisbeersträuchern hinüber.
»Warst du noch am Leben?«, sagte er laut und vernehmlich.
Im gleichen Augenblick klingelte sein Handy. Völlig gedankenverloren stand er in der Abendsonne da und brauchte eine ganze Weile, um das Klingeln zu registrieren, fischte dann aber den Apparat aus der Manteltasche und nahm das Gespräch entgegen. Zuerst hörte er nichts als Rauschen.
»Hilf mir«, sagte eine Stimme, die er sofort erkannte. »Pliis.«
Dann brach die Verbindung ab.
Kapitel 4
Das Display auf seinem Handy zeigte keine Nummer an, sondern auf dem kleinen Bildschirm stand ›Anonym‹. Das war Eva Lind. Seine Tochter. Er starrte mit schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck auf den Apparat, so, als wäre er ihm wie ein Splitter in die Hand gefahren, aber es klingelte nicht nochmal. Eva Lind hatte seine Nummer, und er erinnerte sich daran, dass sie beim letzten Mal, als sie miteinander gesprochen hatten, ihn angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass sie ihn nie wieder sehen wollte. Er stand ratlos und unbeweglich da und wartete, dass sie sich noch einmal melden würde, aber das war nicht der Fall.
Dann hastete er los.
Seit zwei Monaten hatte er keine Verbindung zu Eva Lind gehabt. Das war im Grunde genommen nichts Ungewöhnliches. Seine Tochter lebte ihr Leben, ohne dass er eine Chance hatte, sich da einzumischen. Sie war Mitte zwanzig und drogenabhängig. Bei ihrem letzten Treffen hatten sie sich wieder einmal heftig gestritten. Das war zu Hause in seiner Wohnung gewesen, und sie war mit den Worten aus der Tür gestürzt, dass er ein Kotzbrocken sei.
Erlendurs Sohn Sindri Snær hatte kaum Verbindung zu seinem Vater. Er und Eva Lind waren sehr klein gewesen, als Erlendur seine Frau verließ und die Kinder ganz ihr überlassen musste. Seine Frau hatte ihm nie verziehen und ihm keinerlei Umgang mit den Kindern gestattet. Er hatte seine Rechte nicht geltend gemacht, aber mit der Zeit bereute er diese Entscheidung immer mehr. Als sie älter wurden, hatten seine Kinder aber von sich aus Verbindung zu ihm aufgenommen.
Die kühle Dämmerung des Frühlingsabends legte sich über Reykjavík, als Erlendur von dem Millenniumsviertel wegfuhr. Er bog auf die Hauptstraße ein und raste zurück in die Stadt. Er kontrollierte noch einmal, ob das Telefon eingeschaltet war, und legte es auf den Beifahrersitz. Erlendur wusste sehr wenig über das Privatleben seiner Tochter und hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte zu suchen. Aber mit einem Mal erinnerte er sich an eine Souterrainwohnung im Vogar-Viertel, wo sie vor etwa einem Jahr gewohnt hatte.