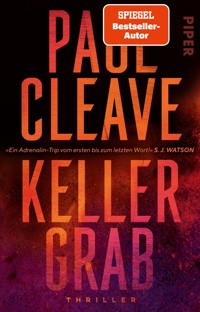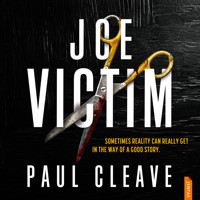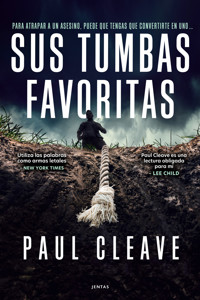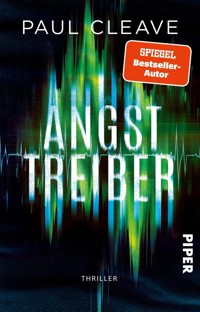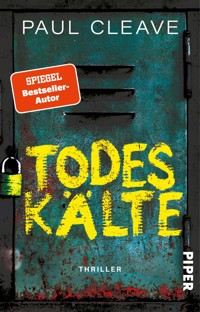
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Acacia Pines wird der Schüler Lucas entführt. Sheriff Cohen übernimmt den Fall und findet heraus, dass Lucas in die Fänge eines Serienmörders geraten ist. Eine erbittere Jagd auf den Täter beginnt in der Hoffnung, Lucas noch lebend zu finden. Doch nicht nur das treibt den Sheriff an, denn sein Leben ist in letzter Zeit völlig aus den Fugen geraten: Er ist pleite, geschieden und droht sein Haus zu verlieren. Die ausgeschriebene Belohnung dafür, den Serienkiller zu fassen, könnte all seine Probleme lösen. Doch ist er, der Sheriff, so verzweifelt, sich dafür außerhalb des Gesetzes zu bewegen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Todeskälte« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Paul Cleave 2023
Titel der englischen Originalausgabe:
»His Favourite Graves«, Orenda Books, London 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025:
Piper Verlag GmbH, München
Redaktion: Peter Hammans
Covergestaltung: www.buerosued.de, München
Covermotiv: www.buerosued.de
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Erster Tag
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Zweiter Tag
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Dritter Tag
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Vierter Tag
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für die Schauspieler und die Filmcrewvon Dark City: The Cleaner …Danke, dass ihr Wunder gewirkt habt.
Erster Tag
Kapitel 1
Der Sarg hat vorne ein paar lamellenartige Lüftungsschlitze, die nach unten zeigen und Lucas einen eingeschränkten Blick auf den Fußboden gewähren. Die Metallwände lassen sich leicht nach außen biegen, wenn er mit den Händen dagegendrückt, schnellen aber gleich wieder in ihre Ausgangsposition zurück und scheinen bei jedem Versuch näher zu kommen, als würde der Raum um ihn herum schrumpfen. Bei dem Versuch, sich zu drehen, stößt er mit Ellbogen und Knien an, und wenn er seinen verspannten Rücken dehnen möchte, stößt er mit dem Kopf gegen die Decke. Mit seinen eins zweiundsiebzig hätte der schlanke und durchaus gelenkige Teenager in einem aufrecht stehenden, eins achtzig hohen Sarg eigentlich genügend Platz, gäbe es da nicht auf drei Viertel der Höhe dieses festmontierte Brett, unter dem er kauern muss. Wäre er nicht so dünn gewesen, hätten die anderen ihn wahrscheinlich gar nicht erst hineinbekommen, aber sie haben es getan und dabei gelacht, während andere Schüler vorbeigegangen sind und seine Hilferufe ignoriert haben. Warum sollte es sie auch interessieren? Er ist schließlich nicht der Erste in der Geschichte von Schulen und Schülern, der in einen Spind gesperrt wird. Er wird sich gleich in die Hose machen, ohnmächtig werden und sterben, und morgen früh wird man seine Leiche in knöcheltiefer Pisse finden. Er konzentriert sich auf die Lüftungsschlitze. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Haben die Mistkerle die Lüftungsschlitze gesehen und sich gedacht, man könne Kinder einfach in Spinde stopfen, ohne dass sie Gefahr laufen, keine Luft mehr zu bekommen, oder hat der Hersteller in weiser Voraussicht in Betracht gezogen, dass Kinder dort hineingesperrt würden, und verhindern wollen, dass sie ersticken?
Er geht jedenfalls davon aus, dass er auf sich allein gestellt ist. Sein Handy ist in der Tasche, die entweder oben auf den Spinden liegt oder in einem Müllcontainer hinter der Schule oder in einer Toilette entsorgt wurde. Seit einer halben Stunde hört er nichts mehr, und bald wird entweder seinem Vater auffallen, dass Lucas nicht da ist, und er wird etwas unternehmen, oder eben nicht. Das hängt davon ab, ob er vor drei angefangen hat zu trinken oder danach. Darin ist sein Dad besonders gut, seit seine Mutter vor zwei Jahren verkündete, die Familie zu verlassen.
In der Ferne vernimmt er ein leises Surren, das lauter wird, je näher es kommt. Von den Lehrern ist niemand mehr da. Montags ist das so: Sie wollen den Tag möglichst schnell im Rückspiegel hinter sich bringen, nach Hause fahren und eine Flasche Wein aufmachen. Was er hört, ist der Hausmeister, der die Bohnermaschine durch die Flure schiebt. Er muss es sein. Er könnte sich durch Klopfen bemerkbar machen, aber der Mann hört ihn bestimmt nicht, jedenfalls noch nicht. Also wartet er, konzentriert sich darauf, nicht in die Hose zu machen, während es immer stickiger wird und sich bei ihm der Gedanke festsetzt, dass er bis morgen hier drinstecken könnte. Würde er das überleben? Er stellt sich seinen Grabstein vor:
Lucas Connor, sechzehn Jahre, viel zu früh von uns gegangen, aber wen kümmert das?
Seine Mutter bestimmt nicht, sie ist gegangen. Seinen Dad auch nicht. Der dürfte sich vermutlich eher in einen Zustand saufen, in dem ihm nicht einmal bewusst würde, dass er jetzt allein lebte.
Er konzentriert sich auf das Surren der Maschine und stellt sich den Hausmeister vor, der sich mit der Bohnermaschine nähert, und als er glaubt, dass er bei ihm angekommen ist, schlägt er gegen die Tür.
Die Bohnermaschine wird nicht langsamer. Wie auch? Der Hausmeister trägt einen Hörschutz, da könnten hundert Kinder in hundert Spinden gegen die Tür hämmern, ohne dass der Typ etwas merkt.
Er hämmert weiter gegen die Tür. Die Bohnermaschine ist jetzt auf dem Rückweg. Er bietet seine letzten Kräfte auf, denn wenn er es nicht tut, wird er hier drin sterben, und wenn er doch nicht stirbt, wird er zumindest verrückt werden, und vielleicht, nur vielleicht, wenn der Hausmeister ihn schon nicht hört, sieht er vielleicht das Scheppern der Tür.
Und genau das könnte gerade passieren, denn die Bohnermaschine bleibt stehen, der Motor wird langsamer und geht aus. Dann hört er Schritte. Durch den Lüftungsschlitz erkennt er schwere braune Arbeitsschuhe, die vor ihm zum Stehen kommen.
Lucas schlägt noch einmal gegen die Tür: »Hilfe, bitte helfen Sie mir!«
Die Füße treten näher, und der Hausmeister fragt: »Was soll das? Willst du mich für dumm verkaufen?« Seine Stimme ist tief. Er spricht langsam und klingt irritiert. Lucas hat mit dem Mann noch nie gesprochen. Er hat immer nur gehört, dass andere Schüler ihn Simple Simon nennen.
»Nein, kein Scherz. Ich bin hier eingesperrt. Bitte, Sie müssen mir helfen.«
»Dummes Pack«, schimpft der Hausmeister und pocht an die Tür.
»Diese hier?«
»Ja.«
»Wie lautet die Kombination?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum nicht?«
»Es ist nicht mein Spind.«
»Wer zum Teufel lässt sich denn von jemandem in einen fremden Spind werfen?«
Jemand ohne Rückgrat, denkt Lucas. Jemand, der minderwertiger ist als die, die ihn hier reinstecken. Jemand, der keine Freunde hat, die ihm zur Seite stehen. Jemand, der schüchtern und lieber für sich allein ist. Jemand, dessen Eltern nicht einmal gerne Zeit mit ihm verbringen. Doch stattdessen sagt er: »Können Sie nicht einfach Hilfe holen?«
»Es ist niemand mehr da, den ich holen könnte«, entgegnet der Hausmeister. Er klopft mit den Fingerknöcheln gegen die Tür, und Lucas stellt ihn sich vor, wie er sie anstarrt, als müsse er eine Art Rätsel lösen. »Ich hole etwas, womit ich die Tür aufbrechen kann. Warte hier.«
Lucas ist sich nicht ganz sicher, ob der letzte Teil des Satzes ein Witz sein soll, kommt aber zu dem Schluss, dass es wohl keiner ist, denn der Typ klingt, als wäre er wirklich verärgert. Die Schritte werden leiser. Er zählt sie, bis sie nicht mehr zu hören sind, dann zählt er zwei lange Minuten runter und vermutet, dass der Hausmeister nicht zurückkommen wird. Doch schließlich kommt er, und Lucas zählt die immer lauter werdenden Schritte.
»Okay. Jetzt wird es laut«, warnt ihn der Hausmeister, und bevor Lucas sich die Finger in die Ohren stecken kann, knallt das Brecheisen mit voller Wucht gegen den Spind. Metall trifft kreischend auf Metall. Auf einer Türseite blitzen Lichtstreifen auf, während sie sich verdreht. Die Lichtstreifen vergrößern sich zu Spalten. Die Spitze des Brecheisens wird sichtbar, verschwindet und erscheint erneut, um jetzt ein größeres Stück herauszubiegen. Noch ein metallisches Kreischen, während sich die Tür um das Schloss verbiegt und schließlich aufspringt. Er muss so dringend raus, dass er in Panik gerät, als es nicht sofort geht. Er kann nicht, weil er schon so lange in dieser Position verharrt hat, dass Rücken und Beine steif geworden sind. Er blickt zu dem Hausmeister hoch.
»Helfen Sie mir.«
Der Hausmeister ist um die dreißig, etwas über eins achtzig groß, aber genauso dünn wie Lucas. Die eingefallenen Wangen sind von einem kurz geschnittenen Bart umgeben. Die langen Finger weisen unter den Nägeln schwarze Ränder auf. Ein in seinen Overall eingenähtes Namensschild verrät der Welt, dass er Simon heißt, sodass die Kinder, die ihn Simple Simon nennen, zumindest zur Hälfte recht haben. Er starrt Lucas einen Moment lang unverwandt an, bis er ihm schließlich eine Hand reicht, an welcher der dritte und vierte Finger fehlen – man munkelt, er habe sie sich in dem Irrenhaus abgebissen, in dem er aufgewachsen ist. Ein Gerücht, an dem natürlich nichts dran ist. Zumindest hofft er das, als er Simons Hand ergreift.
Mit einem Bein ist er raus, kann sich dann aber nicht halten und sinkt zu Boden. Zu schnell, als dass Simon ihn hätte halten können. Lucas schafft es gerade noch, die Hände schützend vor sein Gesicht zu halten, bevor er mit der Nase auf den Boden schlägt. Er will gleich wieder aufstehen, doch die Beine kribbeln, als würden tausend Nadeln auf sie einstechen. Er schafft es nicht. Seine Blase ist zum Platzen voll, und er ist sich bewusst, dass er jetzt endlich die Möglichkeit hat, zur Toilette zu gehen. Er entdeckt seine Schultasche auf dem Schrank. Sein Handy ist dort drin – oder, wenn nicht, in einem Müllcontainer, in einer Toilette oder in tausend Einzelteilen auf dem Feld. Er muss seinen Dad anrufen und ihm sagen, was passiert ist.
Er blickt zum Hausmeister auf, der ihn mit diesem starren Blick mustert, als wäre Lucas von allen Leuten, die er heute schon aus Spinden geholt hat, der seltsamste Mensch.
»Es tut mir leid«, sagt Simon, ohne dass Lucas wüsste, was ihm leidtun könnte. Doch das herauszufinden, bleibt ihm keine Zeit, als ihm ein Lappen fest gegen Nase und Mund gedrückt wird. Er setzt sich gegen den Hausmeister zur Wehr, aber die Dämpfe sind stark, und er atmet sie bereits ein. Er atmet diesen verdreckten Lappen ein, und die Dämpfe verdunkeln die Welt um ihn herum.
Er spürt die Wärme, die sich an der Vorderseite seiner Hose ausbreitet.
Dann nichts mehr.
Kapitel 2
Das Büro ist schlicht und etwas heruntergekommen, passt aber durchaus zu meinem Anwalt. Devon Murdoch steht kurz vor der Rente und sieht aus, als hätte er in seinen Klamotten geschlafen und die Krawatte beim Frühstück als Serviette benutzt. Der günstigste Anwalt der Stadt ist er nicht, aber der zweitbeste und mit Sicherheit der beste, den ich mir leisten kann. Hinter ihm hängen gerahmte Diplome, und in einem davon sehe ich mein Spiegelbild – eine müde Gestalt, die dringend einen Haarschnitt, eine Rasur sowie Nachtruhe benötigt und deren Haar, vor einem Jahr noch überwiegend schwarz, jetzt im Wesentlichen ergraut ist. Das Spiegelbild des ältesten vierzigjährigen Mannes der Stadt.
»Hier irgendwo muss es sein.« Murdoch durchwühlt einen Stapel Papiere auf seinem Schreibtisch. Schließlich hat er gefunden, was er suchte, und sagt, offensichtlich sehr zufrieden mit sich: »Da ist sie ja.«
Er reicht mir die Rechnung, mit der er sich einen Schritt weiter dem günstigen Anwalt nähert, den ich mir nicht mehr leisten kann.
»Meine Güte.«
»Tut mir leid, Sheriff, aber dass es nicht billig werden würde, war doch klar.«
»Ich weiß, aber …«
»Und es kommen noch mehr.«
»Weiß ich auch.«
»Ich versuche, Ihnen die Haie vom Hals zu halten, aber es ist nicht einfach.«
»Die wollen Blut.«
»Natürlich wollen sie das.«
Ich schaue noch einmal auf die Rechnung. Über achttausend Dollar. Genau wie die vom letzten Monat. Vor zwei Monaten waren es zehntausend.
»Hören Sie zu, James, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich gebe Ihnen einen Monat länger Zeit, aber … na ja, die Lage ist für alle schwierig.«
»Wir alle müssen unsere Rechnungen bezahlen, ist mir schon klar.«
»Wie ist es bei der Bank gelaufen?«
»Nicht gut«, sage ich. Vor drei Monaten habe ich zum letzten Mal die Rate für die Hypothek bezahlt. »Letzte Woche kam ein Schreiben mit der Information, dass Schluss ist, wenn ich die nächste Rate nicht zahle. Und wissen Sie, was der Witz daran ist?«
»Sagen Sie’s mir.«
»Wenn ich mich weigere, auszuziehen, dann ist es meine Aufgabe als Sheriff, meine eigene Räumung zu erzwingen. Verdammt, vielleicht sollte ich das einfach tun – mich selbst einbuchten, damit ich mir keine Sorgen machen muss, wo ich bleibe.«
»Tut mir wirklich leid, James. Es ist eine beschissene Situation, eine der schlimmsten, die ich je erlebt habe. Und wenn Sie verkaufen?«
»Ende der Woche kommt ein Immobilienmakler vorbei. Das ist eine Möglichkeit, aber keine gute. Alles, was ich aus dem Haus herausbekomme, fließt in weitere Rechnungen. Außerdem werde ich woanders Miete zahlen müssen, selbst dann, wenn ich es rechtzeitig verkaufen könnte. Außerdem muss ich für meinen Vater sorgen, und das ist nicht billig. Ich warte jetzt mal ab, was sie sagen.«
»Das alles klingt sehr mühsam.«
»Sie machen sich keine Vorstellung.« Tatsächlich habe ich kaum mehr als ein paar Stunden pro Nacht geschlafen, seit das alles angefangen hat.
»Und Cassandra?«
»Sie würde uns sicher helfen, aber bei ihr können wir nicht wohnen. Sie hat uns nicht ohne Grund verlassen.«
Murdoch sieht mich an, als suche er nach etwas, das mir das Leben erleichtern könnte. Ich bin dabei, meine Familie und mein Haus zu verlieren. Wir legen Pflaster auf klaffende Wunden, und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. In einem Monat werde ich wahrscheinlich obdachlos sein.
»Ich weiß immer noch nicht, wie das passieren konnte«, sage ich. »Es war nicht seine Schuld.«
»Ich gebe Ihnen recht. Die meisten sehen das so. Aber es ist jemand umgekommen, James.«
»Ich weiß, dass jemand dabei umgekommen ist.«
»Es ist wirklich tragisch. Aber Ihr Vater hat nun mal das Feuer gelegt, bei dem ein Pflegeheim komplett in Flammen aufgegangen ist. Man kann nur von einem Wunder sprechen, dass nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind. Die ganze Familie leidet. Das ist emotional belastend – sie kämpft.«
Ich sage ihm, was ich ihm schon hundertmal gesagt habe. »Im Pflegeheim hätten sie besser auf ihn aufpassen müssen.«
»Ich weiß, und Sie wissen, dass ich da ganz Ihrer Meinung bin. Das Pflegeheim hat sich auch mit Ihnen geeinigt, aber …«
»Aber die Familie leidet und will, dass auch wir leiden.«
»Genau darauf läuft es hinaus. Nächste Woche habe ich einen weiteren Termin mit dem Anwalt, aber wenn es keinen plötzlichen Sinneswandel gibt, dann müssen Sie sich auf einen gewaltigen Sturm gefasst machen.«
Ich falte die Rechnung zusammen und stecke sie in die Tasche, denn alles, was er mir gerade gesagt hat, ist schon Teil der nächsten Rechnung. Ich muss gehen, bevor die nächste halbe Stunde anbricht, die ich bezahlen muss. »Danke«, sage ich und stehe auf.
Er steht ebenfalls auf. »Ich halte Sie auf dem Laufenden.«
Draußen auf der Straße steht mein Dienstwagen vor einer Bar. Ein weißer Geländewagen mit einem Blaulichtbalken auf dem Dach und einem Bullenfänger an der Front. In blauen Blockbuchstaben steht auf der Seite Acacia Sheriff’s Department. Als ich ihn aufschließe, fällt mein Blick auf die Bar. Ich könnte hineingehen, mich in eine dunkle Ecke verziehen und meine Sorgen ertränken. Das Problem ist nur, dass ich vermutlich einschlafen würde. Das ist das Problem als Borderliner mit Schlafstörungen – nachts bekommt man keinen Schlaf, nickt aber ein, wenn man es nicht gebrauchen kann. Mein Anwalt hat die Sache präzise auf den Punkt gebracht, als er die Lage, in der ich mich befinde, als beschissen bezeichnete. Sein ganzes Arbeitsleben hat mein Vater als Koch gearbeitet und war ab seinem vierzigsten Lebensjahr sogar Besitzer eines eigenen Restaurants. Vor ein paar Jahren fing er an, sich Sorgen darüber zu machen, dass er die einfachsten Dinge vergaß und glaubte, sich an Dinge zu erinnern, die nie passiert waren. Es kam zu paranoiden Schüben und Stimmungsschwankungen, bis er begann, meiner Mutter üble Dinge an den Kopf zu werfen, die sie zutiefst getroffen hätten, wenn sie nicht vor zehn Jahren schon gestorben wäre. Es folgte die Diagnose, dass mein Vater an Alzheimer erkrankt war. Alles nahm einen rasanten Verlauf, bis er schließlich letztes Jahr in ein Pflegeheim zog. Sein Muskelgedächtnis aus den letzten fünfzig Jahren verleitete ihn jedoch immer wieder dazu, sich an den Herd zu stellen. Und genau das geschah Anfang dieses Jahres um drei Uhr nachts. Am Ende hat er das ganze Heim in Brand gesteckt, und jetzt lebt er bei mir und, jede zweite Woche, bei mir und meinem Sohn, Nathan. Zwei Monate nachdem mein Vater eingezogen war, zog Cassandra aus. Sie konnte es nicht länger ertragen, von meinem Vater tagein, tagaus aufs Übelste beschimpft zu werden.
Ich widerstehe der Versuchung, in die Bar zu gehen, und nehme stattdessen ein paar Pillen, um mich aufzuheitern. Mein Arzt hat mir vor ein paar Monaten Adderall verschrieben. Natürlich habe ich versucht, davon nicht abhängig zu werden, nehme es inzwischen aber trotzdem jeden Tag und gehe mit der Dosis hoch. Stolz bin ich nicht darauf, aber es hilft.
Ich fahre nach Hause und stelle mir die kalten Biere im Kühlschrank vor. Als ich gerade in die Einfahrt einbiege, öffnet sich die Haustür, und Deborah, die Pflegerin meines Vaters, kommt mir entgegengelaufen. Deborah ist Mitte sechzig, warmherzig, sehr empathisch und hat mit ihren eigenen Eltern genau das durchgemacht, was ich nun mit Dad durchmache.
»Alles in Ordnung?«
»Alles in Ordnung, ich bin nur etwas spät dran«, erklärt sie. »Bin verabredet«, fügt sie grinsend hinzu.
»Wer ist der Glückspilz?«
»Ich habe ihn online kennengelernt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das heutzutage so funktioniert. Können Sie sich vorstellen, was ich vor vierzig Jahren durchgemacht hätte, wenn es so was schon gegeben hätte?«
»Lieber nicht.«
Sie lacht. »Ihr Vater war heute gut drauf.«
»Danke, Deborah. Viel Spaß noch.«
»Den werde ich haben.«
Sie fährt los, und ich gehe ins Haus. Mein Vater steht vor dem Fernseher und schaut zu, wie ein Typ mit fingerdick hervortretenden Venen an den Armen ein Fitnessgerät anpreist, das natürlich auch bei dir die Venen zum Vorschein bringt, wenn du bereit bist, drei Minuten am Tag dafür zu arbeiten.
»Hey, Dad, wie war dein Tag?«
Dad antwortet nicht.
»Kann ich etwas für dich tun? Möchtest du etwas trinken?«
Keine Antwort. Ich begleite ihn zur Couch und setze ihn hin. Ob er mitbekommen hat, dass ich hier bin, kann ich nicht genau sagen. Aus Nathans Zimmer dringt der Lärm von Schüssen und Explosionen, den die Spiele mit sich bringen, die er an seinem Computer spielt. Ich klopfe an und öffne die Tür. Ein gereiztes »Was?« ist die Antwort, und ich trete ein.
»Wollte dir nur kurz sagen, dass ich zu Hause bin.«
»Von mir aus.«
Nathan ist ein kräftiger Bursche mit kantigen Gesichtszügen. Eigentlich ein ausgesprochen gut aussehender junger Mann, wenn sich nicht Züge von Verschlagenheit darübergelegt hätten, seit seine Mutter ausgezogen ist. Das dunkle Haar trägt er zur Seite gescheitelt, sodass es über sein rechtes Auge fällt. Das andere Auge ist auf einen Computermonitor gerichtet, während seine Hände über die Tastatur fliegen.
»Irgendwelche Wünsche fürs Abendessen?«
»Lass mich am besten einfach in Ruhe.«
Mir fehlt die Energie, darauf zu reagieren. Ich gehe in die Küche und hole mir ein Bier. Gerade will ich es aufmachen, als das Telefon klingelt. Es ist die Dienststelle.
Ich nehme ab. »Was gibt’s, Sharon?« Meine Stimme klingt mürrischer als beabsichtigt.
Bevor ich mich entschuldigen kann, sagt sie: »Sheriff, Peter Connor ist in der Leitung. Er will dich sprechen. Er sagt, es sei dringend.«
Ich kenne Peter aus Kindertagen. Er war in der Schule eine Klasse über mir und als Gitarrist der Schulrockband immer der coolste Typ. Die Musik gab er auf und wurde ein durchaus erfolgreicher Romanautor. Die letzten Jahre liefen allerdings nicht gut für ihn. Von der Kritik an seinem letzten Roman hat er sich nie wieder erholt. Einer sagte, er richte sich an Leute, die die Seiten am liebsten herausreißen und damit Feuer machen würden, und bezeichnete ihn als Schund der untersten Kategorie. Kurze Zeit später verließ ihn seine Frau, nachdem sie auf das gestoßen war, was auch Deborah für sich entdeckt hatte – Online-Dating. Die einzige Beziehung, die Peter einging, seit er Single ist, ist die zur Flasche.
»Stell ihn durch.« Ich frage mich, ob er sich hinters Steuer gesetzt hat und irgendwo im Graben gelandet ist.
Peter redet wie ein Wasserfall. Ich kann gar nicht ausmachen, wo das eine Wort aufhört und das andere beginnt.
»Hey, immer langsam. Sprich nicht so schnell und versuch es noch einmal.«
Es folgt eine weitere Suada von Silben.
»Hol erst mal tief Luft.«
Peter atmet tief ein. Es hört sich an wie ein kurz eingeschalteter Staubsauger. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ihn im Zimmer auf und ab gehen, den Hörer fest umklammert, die Fingerknöchel blutleer und weiß. »Mein Junge«, bringt er allmählich hervor. Nicht viel langsamer, aber gerade genug, dass ich ihn verstehen kann. »Mein Junge ist von der Schule nicht nach Hause gekommen.«
Irgendetwas versetzt mir einen Stich. Ich stelle mir seinen Sohn Lucas vor.
Peter feuert weiter kurze Sätze ab. »Er kommt immer nach Hause. Von der Schule. Er hat Hausarrest. Fünf Uhr. Er weiß, dass er Ärger bekommt, wenn er bis dahin nicht zu Hause ist. Deshalb ist er bis dahin immer zu Hause. Immer. Normalerweise schon um vier. Eigentlich immer um vier. Immer. Außer heute. Du musst ihn suchen. Es ist … du … du musst ihn finden.«
Es ist jetzt kurz nach fünf. Der Sommer steht vor der Tür, die Tage werden länger. Die Sonne geht erst in drei Stunden unter, und nächsten Monat um diese Zeit wird es erst weit nach neun Uhr dunkel. Wir nähern uns der Jahreszeit, die wir den Rest des Jahres herbeisehnen. Es ist auch die Zeit, in der die Jugendlichen notorisch zu spät kommen. Sie gehen in Steinbrüchen schwimmen, rauchen im Wald oder spielen Baseball. Sie setzen sich über die Ausgangssperre hinweg und scheren sich einen Dreck darum.
»Die Kinder tauchen immer irgendwie wieder auf«, sage ich und bedaure im selben Moment meine Wortwahl. Schließlich telefoniere ich mit einem Krimiautor. Und auf eine solche Bemerkung kann ein Krimiautor nur eines antworten.
Was er auch tut. »Ja, manchmal sind sie aber auch tot. Werden in flachen Gräbern gefunden, erstochen oder erwürgt, und in Müllcontainer geworfen. Und, Sheriff, du weißt ganz genau, dass es eine Menge Kinder auf der Welt gibt, die verschwinden und nie wieder auftauchen.«
Er hat recht. Aber trotzdem … »Vielleicht hat er einen Platten. Oder er ist zu einem Freund gegangen. Hast du schon bei seinen Freunden angerufen?«
»Er hat keine.«
»Hast du in der Schule angerufen?«
»Da geht niemand ran, deshalb habe ich dich angerufen.«
»Bist du in der Schule?«
»Außerdem kann er keinen Platten haben. Sein Fahrrad steht hier, und es ist vollkommen in Ordnung. Irgendetwas hat ihn davon abgehalten, nach Hause zu fahren oder mich anzurufen.«
Das Kribbeln in meinem Bauch setzt wieder ein.
Es wird doch wohl nicht wieder wie beim letzten Mal sein?
Kapitel 3
Es geht so schnell – zu schnell. Natürlich tut es das … es war nicht geplant. Hat er etwas falsch gemacht? Was für eine blöde Frage – natürlich hat er das. In dem Moment aber war ihm das egal. Es war, als hätte eine Art biologischer Impuls die Regie übernommen und er wäre nicht mehr Simon Grove, sondern etwas anderes – jemand anderer, jemand, der er in seinem Leben schon öfter war. Er mag diesen Jemand nicht, kann es aber nicht kontrollieren. Die Biologie lässt sich nicht kontrollieren. Es gibt Pillen, Medikamente und Therapien, die versuchen, einen dazu zu bringen, auf eine bestimmte Art zu denken, wenn alles, was man denken kann, etwas ganz anderes ist … doch das reicht nicht, um ein fundamentales Bedürfnis für immer in Schach zu halten. Und im Moment treibt ihn dieses Bedürfnis dazu, die Stadt mit einem Jungen im Kofferraum fluchtartig zu verlassen. Eine Situation, in der er sich weiß Gott nicht zum ersten Mal befindet.
Sie fahren auf der Schnellstraße. Es herrscht nicht viel Verkehr. Er dürfte kaum auffallen. Er ist nur ein Auto unter vielen, trotzdem fragt er sich, ob die anderen Fahrer merken, wie nervös er ist. Heute früh hätte er sich nicht träumen lassen, noch am selben Tag die Brücken hinter sich abzubrechen, und danach sieht es im Moment aus. Umkehren kann er nicht – einerseits, weil er kaum begründen kann, warum er den Jungen in den Kofferraum gesperrt hat, andererseits, weil er es nicht will. Weiterfahren kann er aber auch nicht, denn er ist von demselben Verlangen getrieben, das ihn in diese Misere gebracht hat. Doch es wird nicht lange dauern, bis jemand bemerkt, dass der Junge nicht dort ist, wo er sein sollte. Vielleicht ist das ja schon passiert. Vielleicht hat der Junge aber auch so beschissene Eltern, dass sie es noch gar nicht bemerkt haben – auch wenn Simon sich kaum vorstellen kann, dass sie so sein könnten wie die Eltern, die er als Kind hatte. Er stellt sich vor, wie sie zuerst bei Freunden anrufen, bevor sie sich an die Polizei wenden. Wie die Polizei dann zur Schule fährt und den aufgebrochenen Spind und das Brecheisen entdeckt.
O Gott. Er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, hinter sich aufzuräumen. Konnte er auch nicht, denn das Bedürfnis überkam ihn sehr plötzlich und mit großer Wucht. Und es war schon eine Weile her, und wenn man von der Biologie übermannt wird … nun ja, dann denkt man erst später über die Konsequenzen nach. Dieses Verlangen hat sich über eine längere Zeit aufgestaut, so, wie es das immer tut, und sinnigerweise hat er für die nächste Woche ohnehin Urlaub genommen. Er wollte wegfahren, dieses Verlangen mit irgendeinem Kind in irgendeiner Stadt befriedigen, sodass er ungeschoren davonkäme, und von der Erinnerung zehren kann, bis das Verlangen erneut zu stark würde, um es zu ignorieren. Warum zum Teufel konnte er nicht einfach bis dahin warten?
Biologie. Deshalb. Scheißbiologie.
Vielleicht bekommt er diesen Kuchen als Zugabe – wie seine letzte Mutter immer sagte, was nur ein weiterer Grund war, sie umzubringen. Vor Kurzem hat er sich eine Kamera gekauft, um bei diesen Gelegenheiten zu filmen, aber vielleicht erfüllt sie auch noch einen anderen Zweck.
Ein Stück weiter befindet sich die Abzweigung zum alten Sägewerk. Von der Geschichte dieses Ortes hat er erfahren, als er vor einiger Zeit hergezogen ist. Acacia Pines wurde vor einhundertfünfzig Jahren gegründet. Den Kern bildeten ein Sägewerk und ein paar Kirchen, die darum herum errichtet wurden, um dem Ganzen eine Seele einzuhauchen. Schon bald kamen Geschäfte und Häuser hinzu, der Ort wurde immer größer. Vor sechzig Jahren gab es dann immer mehr Menschen, die Anstoß an den Lastwagen nahmen, die an ihren Häusern vorbeidonnerten und das Porzellan in den Schränken zum Klirren brachten. Also wurde das Sägewerk abgerissen und außerhalb der Stadt auf einem größeren Gelände mit mehr Platz für Erweiterungen wieder aufgebaut. Aber wie das bei Städten nun einmal so ist, zeichnen sich langfristige Prognosen darüber, wie groß ein Ort wohl werden und wie stark sich der Verkehr auf den Straßen entwickeln wird, eher dadurch aus, nicht so weit in die Zukunft zu reichen, wie es besser der Fall wäre. Um das, was in fünfzig Jahren passiert, müssen sich dann eben andere kümmern.
Vor zehn Jahren tauchte Acacia zum ersten Mal in Reisemagazinen auf. Die Wälder wurden ein beliebtes Ziel für Wanderer. Motels mussten gebaut werden. Mehr Restaurants. Mehr Industrie. Der Ort hat sich in den letzten zehn Jahren ständig vergrößert, denn die Menschen kamen zu Besuch und blieben. Vor ein paar Jahren gab es einen sprunghaften Anstieg im Dienstleistungssektor, nachdem ein paar Wanderer gegen Ende des Sommers behaupteten, Bigfoot in den Bergen gesehen zu haben (belegt durch ein unscharfes Foto), auch wenn er eher den Verdacht hat, dass dieses Gerücht vom Besitzer eines der neuen Motels in die Welt gesetzt wurde – Motels, die dann ständig ausgebucht waren, weil Leute aus dem ganzen Land kamen, um Beweise zu suchen. Auch das Sägewerk musste erweitert werden. Doch anstatt es zu erweitern, wurde ein neues Sägewerk gebaut, ein paar Meilen näher an die Stadt herangerückt, während das alte sich selbst überlassen wurde, um allmählich von der Natur zurückerobert zu werden.
Er biegt ab.
Die Straße zum Werk ist kurvenreich und voller Schlaglöcher und Fahrspuren. Tausende von Lastwagen haben den Kies so fest in den Boden gepresst, dass er kaum noch Geräusche produziert, wenn man drüberfährt. Das alte Werk kommt schon bald in Sicht: große, rußgeschwärzte Mauern aus Ziegelstein, hohe Fenster mit teils gesprungenen Scheiben, ein flaches, an einigen Stellen durchgerostetes Dach und große, verbeulte Rolltore an der Vorderseite. Alles umgeben von einem Meer aus Beton, mitten in einem Ozean aus Wald. Vor dem Haupteingang bleibt er stehen. Den Motor lässt er laufen und steigt aus. Er entriegelt eine kleine Seitentür, geht hinein und zieht mit den Ketten das große Rolltor auf. Das Rasseln der Ketten erinnert ihn an diesen Roman von Charles Dickens, in dem Weihnachtsgeister einem einsamen Mann, der im Sterben liegt, Unheil und Finsternis verkünden. Nicht dass er das Buch gelesen hätte, aber mehrere Verfilmungen hat er gesehen.
Nachdem er das Tor vollständig geöffnet hat, geht er zum Auto zurück. Er fährt den Wagen hinein, und die Ketten rasseln erneut, während sich das Tor schließt. Sie sind allein. Ganz allein, mitten im Nirgendwo, wo niemand etwas hört.
Die Erregung nimmt zu.
Kapitel 4
Ich gehe wieder in Nathans Zimmer.
»Ich muss noch mal raus. Pass bitte auf deinen Großvater auf.«
»Ich habe zu tun.«
»Es dauert hoffentlich nicht lange.«
Ohne zu antworten, spielt er das Computerspiel weiter.
»Nathan?«
»Was ist?«
»Ich habe gesagt …«
»Zum Teufel noch mal«, flucht er, steht auf und schaltet den Computer aus.
»Verdammt, Nathan. Ich bitte dich doch nur …«
»Und ich habe gesagt, dass ich es mache, okay? Hast du nicht gerade auch gesagt, du müsstest irgendwohin?«
Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, und starre ihn einem Moment nur an. Das ist in letzter Zeit typisch für Nathan, und all meine Versuche, damit umzugehen, waren zum Scheitern verurteilt. Ich könnte ihm Hausarrest erteilen oder den Computer konfiszieren. Aber all diese Maßnahmen haben es in der Vergangenheit nur schlimmer gemacht. Und im Moment fehlt mir die Zeit, mich damit zu befassen.
»Ich rufe dich zwischendurch an«, sage ich.
Auf dem Weg zur Schule rufe ich Sharon an. Ich bringe sie auf den neuesten Stand und bitte sie, Deputy Hutchison zu mir in die Schule zu schicken und mich mit Direktor Chambers zu verbinden. Sie sagt, sie kümmere sich sofort darum. Ich fahre durch die Stadt. Die Geschäfte schließen, während die Restaurants öffnen. Nachdem sie Bücher, Kleidung und Campingausrüstung gekauft haben, denken die Leute langsam über Essen, Wein und Nachtisch nach. Sharon meldet sich auf dem Handy zurück und sagt, sie habe Chambers in der Leitung. Sie leitet den Anruf weiter. Er klingt besorgt, nachdem ich ihm erzählt habe, worum es geht. Natürlich ist er das. Vor zwei Monaten haben wir so etwas schon einmal durchgemacht. Er will in zehn Minuten in der Schule sein.
An Kreuzungen schalte ich die Sirene ein, die Autos fahren zur Seite. Die Leute auf den Bürgersteigen drehen sich um. Ein seltener Anblick. Die Sonne spiegelt sich in den Schaufenstern und blendet die Autofahrer. Ich komme an einem Schwimmbad, einem Kino, einer Bowlingbahn, einem Einkaufszentrum, weiteren Geschäften, Büros und Motels vorbei, bis ich die Schule erreiche. Eine lange, von Bäumen gesäumte Auffahrt führt von der Straße zu einem zurückgesetzten Bereich, der zu einem Parkplatz führt. Vor der Schule steht eine niedrige Mauer mit dem Schriftzug Acacia High School und Graffiti-Schmierereien. Das Hauptgebäude dahinter besteht aus drei Flügeln, die ein annähernd rechteckiges C bilden. Die Flügel sind lang, schlicht und identisch, als wären sie von einer Fabrik für Fertigbauteile ausgespuckt und komplett mit Fahnen auf die Wiese gesetzt worden, die alle dreißig Meter für einen kleinen Farbakzent sorgen sollen. Peter Connor läuft auf und ab und bleibt erst stehen, als ich mich vor ihm befinde.
Peter ist mit seinen eins achtzig ein paar Zentimeter größer als ich. Kräftig war er immer schon, aber es steht ihm nicht mehr so gut wie damals in der Highschool, als er in engen Klamotten auf der Bühne stand und die Mädchen mit seiner Musik und seinen Muskeln beeindruckte. Die Masse hat sich jetzt umverteilt, vor allem in der Mitte unter seinem verblichenen T-Shirt mit der Aufschrift Cats Against Being Eaten, dem Namen seiner damaligen Band. Die eingefallenen Augen und das ergraute Haar erwecken den Eindruck, er hätte sich kampflos dem Altern hingegeben. Wir reichen uns nicht die Hand. Er wirkt panisch und nervös.
»Wo ist das Fahrrad?«
Wir gehen zu den Fahrradständern, die immer noch an der gleichen Stelle stehen wie früher und wohl noch lange nach dem Abschmelzen der Polarkappen dort stehen werden. Der Besuch meiner alten Schule wirft in mir die Frage auf, wie zwanzig Jahre so schnell vergehen konnten, wobei mir natürlich auch bewusst wird, dass es mit den nächsten zwanzig Jahren nicht anders sein wird. Die Schule hat sich in dieser Zeit vergrößert. Zu den drei Hauptflügeln sind weitere Gebäude hinzugekommen, darunter eine nagelneue Turnhalle und eine größere Aula. Das ist Acacia Pines: eine Stadt, die sich ausdehnt – von den Lebensmittelläden über die Schulen bis hin zu Motels, Farmen und Friedhöfen. Vor zehn Jahren waren es zwanzigtausend Einwohner, heute sind es dreißigtausend.
Die Fahrradständer sind der Witterung ausgesetzt. Sie bieten fünfhundert Stahlrössern Platz, doch im Moment steht dort nur eins, ein einsames blaues Mountainbike, das nur ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Es ist mit einem Schloss gesichert.
»Bist du sicher, dass es Lucas’ Fahrrad ist?«
»Ja.«
»Und das Schloss?«
Er sieht mich verwirrt an. »Was?«
»Ist das sein Schloss?«
»Warum sollte es das nicht sein?«
»Weil ihm jemand einen Streich gespielt haben könnte, indem er das Fahrrad mit einem fremden Schloss sichert.«
Er sieht mich irritiert an. »Dann hätte er sich an einen Lehrer gewandt oder mich angerufen.«
Das habe ich mir schon gedacht, aber fragen musste ich trotzdem. Ein Streifenwagen, identisch mit meinem, nähert sich. Deputy Hutchison. Und hinter ihr eine weiße Limousine. Direktor Chambers.
»Möglich«, sage ich. »Aber ist es Lucas’ Schloss, ja oder nein?«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon.«
Wir gehen zum Haupteingang. Chambers und Hutch unterbrechen ihr Gespräch, als wir bei ihnen sind. Deputy Lisa Hutchison ist dreißig, groß, gut aussehend und grundanständig. Von klein auf wollte sie Polizistin werden, weil ihr Dad Polizist war. Das dunkle Haar trägt sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Daumen hat sie im Holster eingehakt. Chambers ist groß und fast kahlköpfig. Die grauen Haarsträhnen an den Seiten sind nach hinten gekämmt. Die Brille ist zu groß, der Mund zu klein, die Ohren stehen ab, und die Nase ist lang, als hätte Mr Potato den Mann in der Mr-Potato-Head-Fabrik persönlich zusammengebaut. Er war einer meiner Lehrer, als ich in diese Schule ging. Hat Geschichte unterrichtet, und jetzt ist er selbst Geschichte.
Wir verzichten auf einen Handschlag. »Zeigen Sie mir Lucas’ Spind?«
Wenn Lucas’ Fahrrad hier ist, dann gibt es allen Grund zu der Annahme, dass auch er hier ist. Schon damals wurden Kinder in Spinde gesperrt, und ich bezweifle, dass sich an dieser Praxis etwas geändert hat. Gleiches gilt für das Klauen von Essensgeld und Rangeleien im Flur.
»Folgen Sie mir.« Chambers geht voraus.
Kapitel 5
Der Sarg ist aus Metall, eng und nach dreißigminütiger Fahrt endlich zum Stehen gekommen. Mit Hausmeistern kennt sich Lucas nicht besonders gut aus, aber er verfügt über ein ausgezeichnetes Zeitgefühl. In Acacia Pines kann man nicht dreißig Minuten lang unterwegs sein, ohne im Kreis zu fahren. Sie müssen also die Stadt verlassen haben und Richtung Süden gefahren sein, denn man kann nur Richtung Süden fahren. Seit sie die Stadt verlassen haben, fragt er sich, was das Ziel sein könnte. Hier gibt es nur Farmen und Wald, die einen Haufen Möglichkeiten bieten, verloren zu gehen.
In dem Sarg, in dem er sich zusammengequetscht befindet, bohrt sich etwas Kantiges und Hartes in seinen Rücken. Er hat keine Möglichkeit, auszuweichen. Bis auf die Augenblicke, in denen die Bremslichter den Kofferraum in rotes Licht tauchten, war es stockdunkel. Nur das Klopfen und Klirren des Motors drang zu ihm. Gerade vernahm er noch das Rasseln von Ketten und schweren Türen. Seine nassen Jeans haben sich eng an den Körper gelegt. Sie sind kalt und riechen streng. Der Jeansstoff scheuert an den Oberschenkeln. Er hat ein beklemmendes Gefühl in der Brust, das Klebeband über dem Mund lässt ihn nicht tief Luft holen, und die auf dem Rücken zusammengebundenen Hände strapazieren die Schultern. Die Körperteile, die nicht verspannt sind, sind von Schmerzen durchzogen, als säße er auf glühenden Kohlen. In seinem ganzen Leben hat er noch nie so viel Angst gehabt wie jetzt. Hinzu kommen die Kopfschmerzen durch das Mittel, mit dem der Hausmeister ihn außer Gefecht gesetzt hat. Außerdem ist ihm übel. Nicht vor Angst, sondern weil ihm schlecht ist. Er versucht, sich umzudrehen, das Gewicht von der rechten auf die linke Schulter zu verlagern, doch es gelingt ihm nicht. Neben Urin dringt der Gestank von Benzin und Reinigungsmittel zu ihm, und er hat immer noch den Geruch von dem Zeug in der Nase, mit dem ihn der Hausmeister betäubt hat. Die Luft schmeckt, als könnte sie sich entzünden. Aber was auch passiert, er hat beschlossen, nicht zu weinen. Er wird auch nicht um Gnade betteln – zum einen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ein Typ, der Kinder in den Kofferraum wirft, ein Erbarmen haben wird, zum anderen, weil er glaubt, dass Simple Simon das noch einen zusätzlichen Kick gibt.
Wie würde sein Dad eine seiner Romanfiguren aus einer solchen Situation befreien? Das hat er sich auf der Fahrt hierher immer wieder gefragt, jedoch nur Beispiele von Figuren gefunden, die es nicht geschafft haben. Einige müssen natürlich überlebt haben, doch das Bild bleibt leer, wenn er versucht, es sich vorzustellen. Irgendwann wird er nicht mehr beten, dass er überlebt, sondern dass es am Ende schnell geht. Er sieht nicht oft Filme, aber die, die er gesehen hat, reichen aus, um zu wissen, dass es, sobald das Klebeband auftaucht, bis zu dem flachen, von wilden Tieren aufgewühlten Grab nicht mehr weit ist. Und dann geht es nicht mehr darum, ob, sondern in wie viel Teilen sie ihn finden.
Schritte nähern sich und reißen ihn aus seinen Gedanken. Die Autotür wird geöffnet. Dann ein Klicken, und der Kofferraum springt einen Zentimeter weit auf. Im nächsten Moment ist er ganz offen, und Lucas blinzelt in eine schwach beleuchtete Umgebung, die jedoch viel heller ist als das Innere des Kofferraums. Der Hausmeister greift hinein und zerrt Lucas aus dem Kofferraum, bevor er den Gesetzen der Schwerkraft nachgibt und ihn zu Boden fallen lässt. Der Aufprall ist so hart, dass die Zähne aufeinanderschlagen. Er schmeckt Blut und kämpft gegen die Tränen an.
Der Hausmeister sieht auf ihn herab. Er ist anders als vorher. Derselbe Overall, dasselbe Haar, derselbe Bart, aber alles ist düster und schäbig. Dann stimmen die Gerüchte – der Typ hat sich selbst zwei Finger abgebissen und war wahrscheinlich im Irrenhaus, weil er auch anderen Finger abgebissen hat. Er stellt sich die dunkle Seite des Hausmeisters als eine physikalische Einheit vor, als einen Parasiten, der von ihm Besitz ergriffen hat und ihn nun wie eine Marionette steuert, als Bandwurm, der sich im Inneren des Hausmeisters windet und alle Strippen zieht.
Simple Simon durchtrennt das Klebeband zwischen Lucas’ Füßen und richtet ihn auf. Sie befinden sich in einer verlassenen Fabrik. Ein paar Kartons stehen noch in den Regalen, auf dem Boden liegen Drähte und Stahlstücke sowie Sägemehl und Scherben von den Fenstern, die mit Steinen eingeschlagen wurden. Er nimmt den Geruch von Holz, Leim und Schmierfett wahr. An der Wand lehnt ein altes Mountainbike, und eine leere, vollkommen verbeulte Tonne liegt auf der Seite. Beim Anblick der Tonne fragt er sich, ob der Hausmeister in der Vergangenheit nicht schon eine andere unglückliche Seele dort hineingestopft hat. Backsteinwände, Stahlträger und hohe Decken. Das Metalltor ist groß genug, dass Lastwagen rein- und rausfahren können. Im hinteren Teil des Erdgeschosses befinden sich ein paar Büros, weitere im Stockwerk darüber.
Es ist das alte Sägewerk. Er war zwar noch nie hier, aber es kann nichts anderes sein.
Simple Simon schubst ihn in Richtung der hinteren Büros. Die Beine brennen wie Feuer, er schwankt. Der Hausmeister packt ihn, damit er nicht stürzt. Sein Körper war in den letzten Stunden in unmögliche Formen gepresst, und vor seinem geistigen Auge tauchen jetzt weitere Formen auf, die noch kommen können. Sie erreichen das Büro neben der Treppe. Ein Fenster geht in den Wald hinaus. Auf der rechten Seite befindet sich ein Schreibtisch aus Holz, links ein alter Aktenschrank mit einer Kamera darauf. In der Ecke steht ein zerbrochener Kübel mit einer abgestorbenen Pflanze, daneben ein Stapel Telefonbücher, der beinahe Lucas’ Größe erreicht. Auf dem Boden liegt eine verdreckte Matratze, auf die er geschubst wird. Eine Menge Staub wirbelt von der Matratze hoch, als er auf sie fällt, Staub, der vermutlich genügend Bakterien enthält, um eine Pandemie auszulösen. Er kämpft weiter gegen die Tränen an, obwohl er weiß, wozu die Matratze dient, so wie ihm auch klar ist, warum die Kamera mit dem roten Licht auf dem Aktenschrank auf ihn gerichtet ist.
Mit Hilfe kann er nicht rechnen.
Keine Hoffnung.
Lucas fängt an, zu weinen.
Kapitel 6
Die Scheiben der großen Doppeltür am Haupteingang zur Schule bestehen aus jener Art Drahtglas, von der ich mir als Kind immer vorstellte, dass sie einen Menschen in Würfel zerteilen könnte, wenn man ihn hindurchdrückte. Chambers zieht ein faustgroßes Schlüsselbund aus einer Tasche, die verstärkt sein muss, damit sie nicht hindurchfallen. Mindestens dreißig Stück hängen dran, die eine echte Herausforderung an sein Erinnerungsvermögen sind. Er besteht diese Prüfung locker, als er auf Anhieb den passenden Schlüssel findet. Ich fühle mich richtig lebendig, ohne sagen zu können, ob es am Adderall liegt oder an der Situation. Vermutlich ist es eine Kombination aus beidem.
Wir betreten einen mindestens siebzig Meter langen Gang mit grau gestrichenen Ziegelsteinwänden. Das obere Viertel ist hellblau gestrichen, die Spinde sind dunkelblau, und der Boden ist dunkelgrau gefliest. Unsere Schritte hallen durch den Gang. Manches hat sich im Laufe der Jahre verändert, vieles aber auch nicht. Neue Computer, dieselben Klassenzimmer; neue Whiteboards, dieselben Spinde; neue Poster, derselbe Anstrich, derselbe Geruch, dasselbe Gefühl. Durch die Fenster werfe ich einen Blick auf das Footballfeld und die Sporthalle dahinter, alles Einblicke in die Welt von Highschoolschülern, in meine Vergangenheit. Nach meiner Schulzeit war ich ein paarmal hier. Zu Elterngesprächen und als Polizist, um mit den Jugendlichen über die Gefahren von Drogen und Alkohol am Steuer zu sprechen. Ich war hier, um Schüler wegen Vandalismus festzunehmen, und einmal musste ich Chambers die Nachricht überbringen, dass einer der Schüler an jenem Morgen bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Vor zwei Monaten war ich hier, als Taylor Reed am letzten Schultag aufs Dach kletterte und vor aller Augen in den Tod sprang. Wenn ich einzuschlafen versuche, habe ich manchmal das Bild vor mir, wie er zerschmettert und blutüberströmt auf dem Bürgersteig liegt. Ich sehe seine Eltern vor mir, wie sie begriffen, was man ihnen gerade gesagt hatte.
Das letzte Mal war ich am ersten Tag des Schuljahres hier, um möglichst viel über Freddy Holt zu erfahren, einen sechzehnjährigen Jungen, der in den Ferien aus seinem Schlafzimmerfenster in einen Kaninchenbau gekrochen war, der über ihm zusammenbrach. Zwei Jungen – beide tot.
Und jetzt Lucas Connor, vermisst.
Im Vorbeigehen klopfe ich mit den Fingerknöcheln an die Schränke. Jedes Klopfen erzeugt einen Hall.
»Was soll das?«, fragt Peter.
»Er prüft, ob Lucas in einem davon steckt«, erklärt Hutch.
»Moment … du glaubst doch nicht etwa … verdammt«, entfährt es Peter, als er begreift, dass das möglich ist. »Scheiße.« Er geht auf die andere Seite und hämmert gegen die Spinde. Gleichzeitig ruft er nach seinem Sohn. Die Rufe bleiben unbeantwortet.
Die hinteren zwanzig Meter des Gangs sind der Verwaltung vorbehalten. Veraltete Büros mit veralteter Ausstattung. Wir gehen in Chambers’ Büro. Er setzt sich vor einen Computer mit einem alten, klobigen Bildschirm und tippt seine ID und das Passwort ein. Lucas’ Akte erscheint. »Spind zwei-null-sechs«, sagt er. »Das ist gleich um die Ecke.«
Wir gehen hin, verlassen den Verwaltungsbereich und sind wieder bei den Klassenräumen. Dieser Gang ist ein gutes Drittel länger als der vorherige, sieht aber genauso aus: Spinde, Plakate, Klassenräume, nur in größerer Zahl. Mitten im Gang steht eine Bohnermaschine in einer Wasserlache.
»Wie seltsam«, bemerkt Chambers. »Der Hausmeister räumt normalerweise alles weg.« Die Bohnermaschine steht vor Spinden, genauer gesagt, vor einem mit einer verbogenen, offensichtlich gewaltsam geöffneten Tür. Die Brechstange, mit der ganz offensichtlich gearbeitet wurde, liegt auf dem Boden. Es ist nicht der Spind von Lucas, sondern der daneben. Ich streife ein Paar Latexhandschuhe über und nehme die Schultasche vom obersten Regal.
»Die gehört Lucas«, sagt Peter.
Ich lege sie auf den Boden und öffne sie. Darin befinden sich Bücher, Sportklamotten und ein Handy. Ich drücke auf die Home-Taste. Das Display leuchtet auf. Es zeigt ein Bild von einem Hund, einem Deutschen Schäferhund, und den Hinweis auf neun verpasste Anrufe von »Dad«.
»Ich habe doch gesagt, dass etwas nicht stimmt«, sagt Peter.
Ich überlege, was vorgefallen sein könnte. Ein paar Kinder haben Lucas dort eingesperrt. Sie haben sich gedacht, dass er schon rauskommen oder jemand ihn rauslassen würde. Doch das ist nicht passiert. Lucas bleibt länger drin, als sie dachten. Niemand findet ihn, alle verlassen die Schule, dann kommt der Hausmeister vorbei. Lucas hämmert an die Tür. Ein paar Stunden war er schon da drin. Der Hausmeister hebelt die Tür auf.
Und dann?
Warum hat Lucas sein Handy nicht mitgenommen? Warum ist er nicht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren?
Auch Hutch spielt die Möglichkeiten durch und stellt sich die gleichen Fragen. »Ich rufe im Krankenhaus und in den Arztpraxen an. Vielleicht ist Lucas dort aufgetaucht. Vielleicht wurde er bewusstlos, als er befreit wurde.«
»Aber …«
»Aber dann wäre doch die Polizei gerufen worden«, sagt sie. »Wobei eine Überschneidung möglich wäre. Vielleicht sind sie weggefahren, kurz bevor wir gekommen sind, und haben sich deshalb noch nicht gemeldet.«
Sie entfernt sich ein paar Schritte und holt ihr Telefon heraus. Vor ein paar Monaten habe ich mit dem Hausmeister gesprochen. Seinen Namen habe ich vergessen, aber ich weiß noch ungefähr, wie er aussah und dass er sehr verschlossen war. Das Auffälligste war, dass ihm zwei Finger fehlten. Ich habe ihn, wie alle anderen auch, im Zusammenhang mit Taylor Reed und später Freddy Holt befragt. Wir wussten, dass Taylor Reed gesprungen war und davor monatelang im Internet gnadenlos gemobbt worden war. In seinen Social-Media-Konten fanden wir Nachrichten von jemandem, der sich unter dem Namen Everybody At School ein Konto eingerichtet hatte. Everybody At School schickte persönliche Nachrichten über verschiedene Plattformen, in denen er Taylor mit der Behauptung peinigte, dass alle ihn hassen würden und er sich lieber umbringen solle. Dieser Jemand hatte seinen Account mit einem Wegwerfhandy eingerichtet – aber weder den Jemand noch das Wegwerfhandy konnten wir ausfindig machen. Der Hausmeister war unverdächtig. Doch das Verschwinden von Freddy Holt warf die Frage auf, ob die beiden Vorfälle nicht zusammenhingen. Vielleicht steckte Holt dahinter und hat sich aus dem Staub gemacht. Viele Schüler, mit denen wir gesprochen haben, sagten aus, dass Freddy sie in Eingänge schubste, sie als Loser beschimpfte und einige sogar um ihr Essensgeld brachte. Die Schikanierung von Taylor Reed könnte also auf sein Konto gehen.
»Der Hausmeister«, frage ich Chambers. »Wie heißt er doch gleich?«
»Du glaubst, der Hausmeister hat Lucas entführt?«, fragt Peter, und ich wünschte, er würde endlich gehen und im Auto warten, damit ich in Ruhe nachdenken kann.
»Simon Grove«, sagt Chambers.
Simon Grove. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. »Wann macht Grove Feierabend?«
»Gegen sieben. Wenn die Lehrer gegangen sind, ist er der Einzige hier. Er schließt ab, wenn er geht.«
Ich schaue auf meine Uhr. Es ist jetzt fast sechs.
»Kommen die Lehrer nicht an diesem Spind vorbei?«
»Nicht unbedingt«, erklärt Chambers. »Es gibt mehrere Ausgänge.«
»Parkt Simon Grove auch auf dem Lehrerparkplatz?«
»Wir könnten ihm einen Besuch abstatten«, sagt Peter.
Ich lege ihm eine Hand auf die Schulter, und er wehrt es nicht ab. Seine Gesichtszüge sind von Panik gezeichnet. Er schwitzt. »Bitte bleib ruhig und lass uns unsere Arbeit machen«, sage ich.
»Wir sollten …«
»Wir werden hinfahren, aber vorher schauen wir nach, ob sein Auto hier ist.«
Peter will widersprechen, nickt dann aber. »Gute Idee.«
Chambers sagt mir, dass Grove auf dem Lehrerparkplatz steht.
»Dann los.«
Hutch bleibt bei den Spinden stehen und telefoniert. Ich gehe mit Peter Connor und Chambers durch einen anderen Ausgang auf den Parkplatz hinaus. Er ist leer. Chambers zeigt mir Groves Parkplatz.
»Geben Sie mir seine Telefonnummer und die Adresse«, sage ich.
Chambers verschwindet wieder im Schulgebäude. Ich gehe zum Parkplatz. Peter folgt mir. »Glaubst du wirklich, dass der Typ ihn ins Krankenhaus gebracht hat?«, fragt Peter.
»An einem so heißen Tag dürfte es in dem Spind ziemlich warm geworden sein. Schon möglich, dass dein Sohn einen Schwächeanfall oder einen Hitzschlag bekommen hat. Vielleicht wurde er in dem Moment ohnmächtig, als Grove ihn befreite. Das würde erklären, warum er dich nicht angerufen hat. Möglicherweise wusste der Hausmeister nicht einmal, wer Lucas ist. Das Gleiche könnte für das Krankenhaus gelten. Vielleicht ist er dort, und sie können ihn nicht identifizieren.«
»Hätte er dann nicht einen Krankenwagen gerufen?«
»Das hättest du vielleicht getan, ich vielleicht auch, aber das heißt nicht, dass andere das auch tun. Menschen sind verschieden. Sie reagieren unterschiedlich. Vielleicht hat er die Möglichkeiten durchgespielt und es für das Beste gehalten, Lucas schnell ins Krankenhaus zu bringen.«
Am Bordstein von Groves Parkplatz liegt ein zusammengeknüllter, verdreckter weißer Lappen in der Größe eines Taschentuchs. Ich hebe ihn mit meinem Stift hoch und rieche vorsichtig daran. Ein strenger chemischer Geruch steigt mir in die Nase. Aber der Kerl ist schließlich Hausmeister, und Hausmeister haben mit Chemikalien zu tun. Trotzdem trenne ich mich von der Idee, Grove könnte in Panik geraten sein, als er Lucas im Spind fand. Eher glaube ich, dass er sich entzückt die Hände rieb.
»Ich hab’s dir gesagt«, meint Peter, während ich eine Beweismitteltüte aus der Tasche hole und den Lappen hineinlege. »Ich hab’s dir, verdammt noch mal, gesagt.«
Ich gehe den Weg zurück, den wir gekommen sind. Er folgt mir und stellt pausenlos Fragen, die ich ihm nicht beantworten kann. Wir treffen Hutch bei den Spinden.
»Ich habe im Krankenhaus angerufen und Sharon gebeten, die Arztpraxen anzurufen. Bisher ohne Ergebnis. Vielleicht hat unser Mann Lucas nach Hause gebracht.« Sie sieht mich eindringlich an, als wollte sie mir etwas Bestimmtes sagen. Ich weiß, was es ist, denn ich will dasselbe – Peter soll von hier verschwinden. Ich nicke ihr zu, und sie wendet sich an Peter. »Sie sollten nach Hause gehen. Dorthin würde Lucas sicher als Erstes gehen. Oder anrufen.«
Bevor er etwas entgegnen kann, füge ich hinzu: »Hier in der Schule ist alles erledigt. Du kannst hier nichts mehr tun. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn du nach Hause gehen und uns auf dem Laufenden halten würdest.«
»Das erklärt aber nicht den Lappen«, sagt Peter.
»Lappen?«, erkundigt sich Hutch.
»Ein mit Chloroform getränktes Stoffstück«, antwortet Peter.
»Das wissen wir noch nicht«, wende ich ein.
»Wenn Lucas ins Krankenhaus oder nach Hause gebracht worden wäre, hätte er mich angerufen.«
»Bitte, Peter«, sagt Hutch. »Sie sind Lucas eine größere Hilfe, wenn Sie nach Hause gehen und ein paar Anrufe machen.«
»Lass uns unsere Arbeit tun, Peter.«
Schweigend dreht er sich um und geht, nicht ohne gegen den letzten Spind am Ende der Reihe zu hämmern, bevor er um die Ecke verschwindet. Ich hocke mich neben die Wasserpfütze.
»Das ist kein Wasser«, sagt Hutch.
»Nein, ich weiß.« Der Uringeruch ist am Boden strenger. Was immer hier passiert sein mag, Lucas Connor hat sich vor Angst in die Hose gemacht.
Kapitel 7
»Wehr dich nicht. Das macht es nur schlimmer.«
Der Anblick des Jungen ist jämmerlich. Das Gesicht ist verheult und rotzverschmiert. Die Hose nass, und er sieht aus, als stünde er kurz vor einem Herzinfarkt. Nicht dass er kein Mitgefühl mit dem Kind hätte – denn er weiß, wie es sich anfühlt, in solch einer Situation auf der anderen Seite zu stehen.
»Hast du verstanden?«
Der Junge nickt. Und schluchzt. Und wischt sich die Tränen an den Knien ab.
»Ich nehme jetzt das Klebeband ab, und du versprichst mir, nicht zu schreien. Hören würde dich sowieso niemand, aber ich hasse das Geräusch. Okay?«
Wieder nickt er.
Simon zieht ihm das Klebeband vom Mund. Der Junge schnappt nach Luft, und obwohl er den Eindruck macht, als hätte er eine Million Fragen, sagt er nichts. Ihn beschleicht das Gefühl, der Junge könnte renitent werden. Wäre schön, wenn es so ist. Auch für Simon, denn eine kleine Rangelei könnte ganz lustig sein.
»Wie heißt du?«
»L…«, fängt er an, muss husten, holt Luft und versucht es erneut. »Lucas.«
»Okay, Lucas. Es muss dir nicht peinlich sein, dass du dir in die Hose gemacht hast. Na ja, also mein Vater, der hätte dich dafür ausgelacht, aber ich nicht. Deshalb habe ich ihn so sehr gehasst.«
Lucas windet sich mit dem ganzen Körper, als Simon ihm die Knöchel mit Klebeband zusammenbindet.
»Was habe ich gerade gesagt?«
Lucas rührt sich nicht. Simon macht das Klebeband fest und setzt eine Schere am Saum von Lucas’ Jeans an. Ruckartig zieht Lucas die Füße weg. Verdammt, ist dem Jungen nicht klar, dass er es ernst meint?
Er hält die Spitze der Schere unter Lucas’ Kinn. »Was zum Teufel habe ich gerade gesagt?«
»Ich … tut mir leid.«
»Ich verstehe, dass es nicht einfach für dich ist. Aber ich verspreche dir eins, wenn du dich nicht benimmst, wird es noch schlimmer für dich. Hast du jetzt verstanden?«
»Tut mir leid.«
»Gut«, sagt er, setzt die Schere erneut am Hosensaum an und schneidet nach oben. »Ich glaube, er wusste, wie sehr ich ihn hasste, als er verbrannte.«
»Was?«
»Mein Vater. Als ich ihn umgebracht habe.«