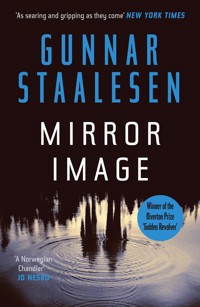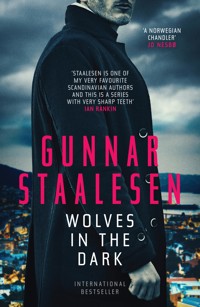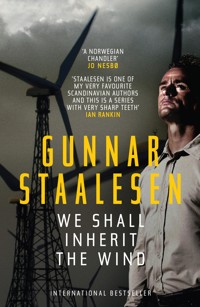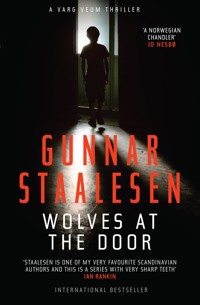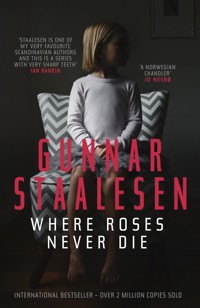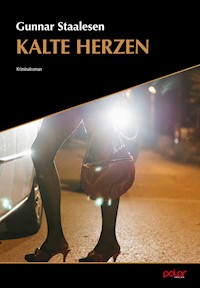17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der Privatdetektiv Varg Veum in seinem Büro ein Telefongespräch führt, ist er plötzlich um 25 Jahre in seine Vergangenheit zurückversetzt. In seine Jahre als Sozialarbeiter und in den Fall eines kleinen Jungen, den er unter tragischen Umständen von seiner Mutter getrennt hat. Derselbe Junge ist in mehreren anderen Fällen aufgetaucht, in Verbindung mit einem plötzlichen Tod bei seinen Pfllegeeltern und, einJahrzehnt später, in einem dramatischen Doppelmord in Sunnfjord. Jetzt ist dieser Junge ein Erwachsener auf der Flucht in Oslo, der entschlossen ist, sich an denjenigen zu rächen, die für die Zerstörung seines Lebens verantwortlich sind - darunter Privatdetektiv Veum. So erzählt es Cecilie, eine Kollegin aus früheren Zeiten in Bergen. Offene Fragen aus seiner Vergangenheit tauchen wieder auf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Gunnar Staalesen
Todesmörder
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen vonGabriele Haefs und Nils Hinnerk SchulzHerausgegeben von Jürgen Ruckh
Wir danken NORLA für die finanzielle Unterstützung der Übersetzung aus dem Norwegischen.
Originaltitel: DØDENS DRABANTER
© Gyldendal Norsk Forlag AS 2006
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2019
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs und Nils Hinnerk Schulz
© 2019 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Susanne Wallbaum
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © damien/adobestock
Autorenfoto: © Helge Skodvin
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
ISBN: 978-3-945133-89-7
eISBN: 978-3-945133-90-3
Da dieses Buch teilweise in einem geografisch begrenzten und leicht erkennbaren Gebiet spielt, soll hier betont werden, dass – mit Ausnahme des Berichtes über Trodals-Mads – alle Geschehnisse und Personen erdichtet sind. Bei irgendwelchen Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder wirklichen Ereignissen können wir deshalb nur um Entschuldigung bitten.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
1
Es kam ein Anruf aus der Vergangenheit. »Hier ist Cecilie«, sagte die Frau, und als ich nicht reagierte, fügte sie hinzu: »Cecilie Strand.«
»Cecilie! Wir haben ja ewig nichts voneinander gehört. Wie geht es dir?«
»Gar nicht so schlecht.«
»Bist du noch immer beim Jugendamt?«
»Einige von uns haben bis heute durchgehalten, ja.«
»Aber wir haben uns doch mindestens zehn Jahre nicht mehr gesehen?«
»Ja, ich bin auf die andere Seite des Gebirges gezogen. Wohne seit fünf Jahren in Oslo. Seit dem Sommer neunzig.«
»Du rufst also aus Oslo an?«
»Nein, ich bin gerade in Bergen. Ich besuche meine alte Mutter in Munkebotn. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst?«
»Nein, ich …«
»Na ja, das ist ja eigentlich kein Wunder, aber … ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen.«
»Ach was.«
»Falls du Zeit hast?«
»Wie ich so gern sage, Zeit habe ich in Massen.«
»Können wir uns treffen?«
»Gern. Hast du einen Vorschlag, wo?«
»Was ist mit – im Fjellvei?«
Ich schaute aus dem Fenster. Der Morgenregen war nur ein kurzer Vorgeschmack des Herbstes gewesen. Jetzt floss der Septembersonnenschein wie flüssiger Honig über die Stadt hinweg. Grün und einladend lag Fløifjellet da, mit dem Fjellvei als Äquator, und weit und breit war keine Spur von einem nahenden Unwetter zu entdecken. »Wo denn?«
»Können wir nicht einfach abwarten, wo wir uns über den Weg laufen? Ich breche hier draußen in einer knappen halben Stunde auf.«
Ich schaute auf die Uhr. »Von mir aus. Dann machen wir das so.«
Fünf Minuten später schaltete ich den Anrufbeantworter ein, schloss die Bürotür ab und machte mich auf den Weg. Ich überquerte den Fisketorg, kam unten an Vetrlidsalmenningen an der Markthalle Kjøttbasaren vorbei und stieg dann die Treppen nach Skansen und zu der alten weißgestrichenen Feuerwache hoch. Die ersten gelben Blätter des Jahres hatten sich eingefunden, aber es waren nicht sehr viele, noch dominierte das Grün. Vom Kindergarten im Skansenpark her waren fröhliche Rufe von Kindern zu hören, die frischgebackene Schlammkuchen aus ihren Sandkasteneimern klopften. Das letzte Elsternpaar des Sommers zwitscherte wütend in einem Kastanienbaum, der seine Früchte noch für sich behielt. Am Ende folgte ich der kleinen Querstraße zum Pferd und befand mich dann am vereinbarten Ort, im Fjellvei.
Der Fjellvei war für die Menschen in Bergen die Promenade Nr. 1. Dort oben hatte eine Generation nach der anderen den Sonntagsspaziergang absolviert, hatte den Blick auf die geliebte Stadt genossen, hatte auf ihr Haus gezeigt und gesagt: Da wohnen wir, als sei das ein Staatsgeheimnis, das sie einander anvertrauten. »Pferd« ist die volkstümliche Bezeichnung für das Schild mit der Ermahnung: »Nicht vergessen, Ihr Pferd bedarf der Ruhe«, das zum hundertsten Geburtstag des Fjellvei beim Trinkwasserbrunnen angebracht worden war, da, wo früher einmal ein Wassertrog für Pferde gestanden hatte.
Ich ging weiter. Ein Rentner in Kniebundhose und Anorak stieg mit geschmeidigen Schritten den Berg hinauf. Hinten beim Oberförsterhaus war eine Schulklasse, angeführt von einer überaus beweglichen Lehrerin für Leibesübungen, beim Joggen. Die jungen Menschen wogten mir in einer langsamen Wellenbewegung entgegen, wie die Kräusel, die sie jetzt noch auf dem Meer des Lebens darstellten, noch immer in erträglicher Entfernung von den sturmumtosten Höhen. Ich trat zur Seite, um nicht in einen vergeblichen Traum von Jugend, die Sehnsucht nach erfolgreichen Rundenzeiten und den Duft durchparfümierter T-Shirts hineingezogen zu werden.
Beim Mon Plaisir, dem alten, tempelförmigen Lusthaus, das dem Fjellvei den Rücken zukehrt und auf das Meer hinabblickt, schaute ich auf die Uhr. Jetzt hätte sie eigentlich hier sein müssen. Vor mir lag nur noch das letzte Stück des Fjellvei, vorbei an Wilhelmineborg und Christineborg, Namen aus einer Zeit, als jeder Mann befugt war, den Namen seiner Gattin ins Stadtbild einzumeißeln, wenn er es sich nur leisten konnte. Hier erhoben sich die Steilhänge von Sandviksfjellet zum Pfeil auf dem Gipfel, der mitteilte, woher der Wind gerade wehte, sofern man auf diese Entfernung scharf genug blicken konnte. Hier waren die Bäume hoch und gerade, mit Stämmen wie braungestrichene Säulen, und Baumstümpfe und Geröllhalden kündeten von Windbruch und Lawinengefahr, die vom Berg her drohten.
Erst bei dem grüngestrichenen Transformatorhaus gleich oberhalb von Sandvikslien sah ich sie. Sie kam auf mich zu, in Jeansjacke und Hose, mit Sonnenschein in den Haaren und einer Schultertasche, die an ihrer Seite baumelte. Als sie mich entdeckte, blieb sie stehen und wartete auf mich, während sie kurzsichtig hinter den ovalen Brillengläsern die Augen zusammenkniff, wie um sich davon zu überzeugen, dass ich es wirklich war. Ihre Haare waren kurzgeschnitten und dunkelblond, mit einem grauen Firnis, der bei unserer letzten Begegnung noch nicht vorhanden gewesen war.
Wir umarmten einander kurz und wechselten einen leicht verwunderten Blick, wie alte Freunde das eben tun, wenn es unmöglich ist, die von der Zeit hinterlassenen Tätowierungen wegzudiskutieren, da sie mit scharfem Messer ins Gesicht und andere Stellen eingekerbt sind.
Sie lächelte rasch. »Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät komme. Meine Mutter … Manchmal braucht das Zeit.«
»Wir sind ja noch im Fjellvei. Kein Problem.«
Sie zeigte auf eine Bank. »Vielleicht sollten wir uns setzen? Es ist schön in der Sonne.«
»Warum nicht?«
»Du möchtest sicher wissen, warum ich dich angerufen habe.«
»Ja, nach so vielen Jahren.«
»Das waren doch nur zehn.«
»In meinem Leben ist in diesen zehn Jahren viel passiert.«
»Ach?«
Sie sah mich abwartend an, aber ich sagte nicht mehr dazu. »Du wolltest etwas Wichtiges mit mir besprechen?«
»Ja.« Sie legte eine kleine Pause ein, während wir uns setzten. »Erinnerst du dich an Janni?«
Ich zuckte zusammen. »Und das fragst du?«
»Na ja … das war eigentlich eine rhetorische Frage.«
»Ein halbes Jahr lang war es ja fast, als ob er … unser Kind wäre.«
Das ließ sie erröten, aber ich hatte es nicht deshalb gesagt. Es war schließlich so gewesen.
Janni. Sechs Jahre alt, siebzehn, und jetzt …
»Was willst du mir erzählen?«
Sie seufzte leise. »Er ist in Oslo auf der Flucht. Wird wegen Mord gesucht.«
»Oh, verdammt. Schon wieder? Woher weißt du das?«
»Ja, Varg. Schon wieder. Und das ist noch nicht alles.«
»Ach?«
»Er hat eine Art Todesliste hinterlassen.«
»Eine … was hat er?«
»Oder … jedenfalls hat er einige Namen von Leuten genannt, an denen er sich rächen will.«
»Ach?«
»Und einer davon bist – du.«
»Was? Ich?«
»Ja.«
Ich brachte kein Wort heraus. Ließ meinen Blick langsam wandern, hinüber zum Byfjord und ein Vierteljahrhundert zurück in der Zeit. Vage merkte ich, wie die Sonne mein Gesicht wärmte, aber innerlich spürte ich den Frost, den Frost, der auf irgendeine Weise immer da war, der niemals ganz losließ. Den Frost aus dem vergeblichen Jahr.
2
Ich begegnete Janni zum ersten Mal an einem drückenden, heißen Julitag des Jahres 1970. Elsa Dragesund und ich waren auf Hausbesuch in eine Wohnung im Rothaugskomplex geschickt worden, dieser massiven grauen Wohnanlage, die die nächste Nachbarin der Rothaugenschule darstellt. Einige Nachbarn hatten die Gemeinde informiert, und das Sozialamt hatte den Fall an uns weitergereicht.
Elsa war unter uns beim Jugendamt diejenige mit der längsten Fahrtzeit. Sie war eine überaus kritische, aber gutmütige Frau, knapp vierzig Jahre alt, mit karottenroten Haaren und einer Tendenz, sich in allzu knallige Farben zu kleiden. Ich selbst war damals ganz neu in der Branche.
Das Treppenhaus war dunkel und sogar an einem solchen Tag mit an die 25 Grad im Schatten feuchtkalt. An der braungestrichenen Tür im ersten Stock war kein Namensschild angebracht. Durch die Mattglasscheibe im Türfenster hörten wir laute Musik. Wir mussten wiederholt auf die Klingel drücken, ehe hinter der Tür schlurfende Schritte zu hören waren. Dann wurde die Tür einen winzigen Spaltbreit geöffnet, und ein fahles Gesicht starrte uns an.
»Wollt’n ihr hier?«
Elsa lächelte liebenswürdig und sagte: »Mette Olsen, sind Sie das?«
Die Frau in der Türöffnung sah uns mit leerem Blick an. Sie war blond, aber ihre Haare waren fettig und ungepflegt. Sie trug ein löchriges T-Shirt und Jeans, die in diesem Monat noch keine Waschmaschine von innen gesehen hatten. Sie war sehr mager und beugte sich vor, als müsse sie chronische Magenschmerzen betäuben. Ihre Lippen waren trocken und rissig, und unter dem dünnen T-Shirt-Stoff zeichneten sich die kleinen Brüste ab wie von Kindern gebackene Rosinenbrötchen, flach und uneben.
»Wir kommen vom Jugendamt«, sagte Elsa. »Dürfen wir kurz eintreten?«
Für eine oder zwei Sekunden loderte in den Augen der Frau Angst auf. Dann schloss sich dieses Fenster, sie trat willenlos zur Seite und hielt die Tür für uns auf.
Der Geruch, der uns entgegenschlug, als wir die enge, unbeleuchtete Diele betraten, war die delikate Mischung von saurem Zigarettenrauch, Müll und Suff. Außerdem roch es – und daran sollte ich mich in meinen Jahren beim Jugendamt deprimierend schnell gewöhnen – nach unversorgtem Kleinkind.
Ohne auf die Hausherrin zu warten, folgten wir dem Klang der lauten Musik ins Wohnzimmer, wo ein Kofferradio mit einer kratzigen Musikkassette voll aufgedreht war. Die Musik war für mich nicht zu identifizieren, Rock mit dröhnendem Rhythmus, der die Wände zum Singen brachte. Elsa ging resolut hinüber, warf einen Blick auf das Radio und drückte auf den richtigen Knopf.
Die Stille war ohrenbetäubend. Mette Olsen war hinter uns her geschlurft. Sie fuchtelte mit den Armen. Ihre Augen waren blank und glasig. Die Erklärung war nicht schwer zu finden. Auf dem zerkratzten Couchtisch stand eine muntere Mischung aus leeren Flaschen: viele Bierflaschen, aber auch Schnaps und die typischen Plastikkanister von den Lieferanten hier in der Stadt, die sich auf Schwarzgebrannten spezialisiert hatten. Auf einer kleinen Kommode lagen mehrere Pillenröhrchen, umgedreht und ohne Verschluss, wie nach einer letzten verzweifelten Suchaktion.
»Wo ist Ihr Kleiner?«, fragte Elsa.
Mette Olsen schaute sich hilflos um, dann nickte sie in Richtung einer halboffenen Tür auf der anderen Seite des Zimmers. Wir blieben einen Moment lang stehen und horchten, doch von dort war kein Laut zu hören. Wir gingen hinüber, Elsa vorweg, und schoben vorsichtig die Tür auf.
Ein ungemachtes, breites Bett füllte die eine Querwand. In einer Ecke stand ein mit Kleidungsstücken überladenes hölzernes Trockengestell. Im ganzen Zimmer lagen Kleider herum, offenbar ohne irgendein System oder Muster. An der anderen Wand stand ein Kinderbett, und darin saß ein kleiner Junge, zweieinhalb bis drei Jahre alt, soweit ich das beurteilen konnte, in einem fleckigen Hemdchen, das irgendwann einmal weiß gewesen war, und mit einer aufgequollenen, nassen Papierwindel unter einer Plastikhose. Er zeigte kaum eine Reaktion, als wir hereinkamen, er sah uns nur aus blanken, apathischen Augen an. Sein Mund war halb offen und feucht, und in der einen Hand hielt er ein zusammengeklapptes Butterbrot mit etwas in der Mitte, das aussah wie Schokolade. Aber das Schlimmste war die Stille. Von ihm war nicht der kleinste Laut zu hören.
Elsa ging ein paar Schritte auf den Kleinen zu, dann fuhr sie herum und starrte Mette Olsen an, die hinter uns in der Türöffnung stand, schmal und unscheinbar und mit einem beleidigten Gesichtsausdruck.
»Ist das Ihr Kind?«, fragte Elsa mit hörbarem Vibrieren der Stimmbänder.
Mette Olsen nickte und schluckte.
»Wie heißt er?«
»Janni.«
»Jan?«
»Jan Elvis.«
»Wann haben Sie ihm zuletzt die Windel gewechselt?«
Die Frau sah uns vage an und hob die Arme. »Gestern? Weiß nich mehr.«
Elsa seufzte laut. »Sie wissen doch, dass das so nicht geht? Dass wir etwas – unternehmen müssen?«
Die junge Frau sah uns traurig an, reagierte aber nicht weiter, als begreife sie kaum, was hier gesagt wurde.
Elsa sah mich an. »Klassischer Paragraph fünf. Mutter muss zur Behandlung, das Kind sofort in eine Pflegefamilie.«
Die Wohnungstür fiel krachend ins Schloss, und eine grobe Stimme hallte durch die Wohnung. »Meeeette! Bist du da?«
Wir schwiegen allesamt, und gleich darauf hörten wir aus dem Nachbarzimmer laute Verwünschungen und das Geräusch von kullernden Flaschen. »Wo zum Teufel steckste denn?«
Wir drehten uns zur Türöffnung hin, die Mette inzwischen geräumt hatte, um verängstigt in unsere Richtung zurückzuweichen.
»Isn das für ne Scheißversammlung? Wer seid ihr? Was wollter hier?«
Der Mann war groß und kräftig, eher vierzig als dreißig, und hatte Tätowierungen an beiden Unterarmen. Er trug ein dunkelbraunes Polohemd und eine helle Hose. Die Adern an seiner Stirn traten deutlich hervor.
»Wir kommen vom Jugendamt«, sagte Elsa kühl. »Haben wir es vielleicht mit dem Vater des Kindes zu tun?«
»Das kann dir ja wohl scheißegal sein«, bellte der Mann und betrat das Zimmer.
Elsa blieb stehen. Ich trat einen Schritt vor, zwischen die beiden. Daraufhin wandte er sich mir zu.
Er ballte die Fäuste und starrte mich wütend an. »Was willsten du? Willste Prügel?«
»Terje«, wimmerte Mette Olsen. »Nich …«
»Geht euch dochn Scheißdreck an, ob ich dem Kind sein Vater bin! Sind wir vielleicht nich gemeldet, oder was?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das Sozialamt hat uns gebeten …«
»Das Sozialamt kann mich sonst wo. Verpisst euch, aber sofort, alle beide.«
Ich sah Elsa an. Sie hatte schließlich die längere Erfahrung. Sie holte ihre geballte Autorität hervor und sagte: »Dieses Kind ist in einer kritischen Situation, Herr …« Sie blickte ihn einen Moment lang fragend an, aber als er nur mit einem Schnauben reagierte, fügte sie hinzu: »Es muss sofort in Behandlung, und wir werden es jetzt mitnehmen. Deine Frau … braucht ebenfalls Hilfe, soweit ich sehe. Wenn du etwas dagegen hast, dann reich bitte formell und korrekt Widerspruch ein, damit wir die Angelegenheit erörtern können.«
Ihm klappte das Kinn herunter. »Sach ma, verstehste selbst, wasde da alles aus deinem glitschigen Maul rutschen lässt? Wenn ihr, du und der Wichser da, nich in Nullkommanix von hier verschwindet, kriegste das hier zu kosten.« Er hob eine Faust. »Kapiert?«
Ich merkte, wie ich innerlich zu sieden begann. »Du Großkotz … ich bin vielleicht nicht so schön tätowiert wie du, aber ich war lange genug auf See, um die richtigen Tricks zu lernen, wenn du also hier losschlagen willst …«
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf mich, jetzt war sein Blick ein wenig unsicherer. Rasch taxierte er meinen Körperbau.
Elsa schaltete sich ein. »Ich gehe davon aus, dass wir es vielleicht mit Herrn – Olsen zu tun haben?«
»Ich heiß verdammt noch mal nich Olsen! Olsen is die da, und meine Alte is die auch nich. Hammersten heiß ich. Merk dir das«, sagte er und blickte drohend in meine Richtung.
»Wenn es nicht freiwillig geht, müssen wir die Polizei verständigen«, sagte Elsa.
»Terje«, flehte Mette Olsen wieder. »Nicht!«
»Aber zuerst braucht er trockene Windeln«, sagte Elsa und sah Mette an. »Wenn es hier welche gibt.«
Mette nickte. »Im Badezimmer.«
»Dann gehe ich sie holen.«
Elsa schob sich an Terje Hammersten vorbei und ging aus dem Zimmer. Wir anderen blieben stehen. Ich spürte die Spannung im ganzen Leib und war auf alles vorbereitet. Doch er schnaubte nur verächtlich, versetzte der Luft einen Tritt, drehte sich um und verließ den Raum. Ich ging hinterher, um mich zu vergewissern, dass er Elsa in Ruhe ließ, aber nichts geschah. Sie kam mit einer Packung unbenutzter Windeln zurück, und gleich darauf hörten wir die Wohnungstür krachend ins Schloss fallen.
»Ihr seid also nicht verheiratet?«, fragte Elsa.
Mette Olsen schüttelte den Kopf.
»Aber er ist der Vater des Kindes?«
Mette Olsen zuckte mit den Schultern.
Elsa seufzte. »Na gut … hier müssen wir offenbar mit kleinen Schritten weitergehen.«
Am selben Abend wurde Janni, oder Jan Elvis Olsen, wie sein offizieller Name lautete, im Säuglingsheim im Kalfarvei untergebracht. Die Mutter wurde bis auf Weiteres in die Entzugsklinik in der Kong Oscars gate eingewiesen, wo man mit großem Eifer versuchte, ihr Einverständnis zu einer länger währenden Behandlung zu erlangen.
Als ich an dem Abend nach Hause nach Møhlenpris kam, blickte Beate mich über den Rand ihres Buches hinweg ironisch an. »Essen steht im Kühlschrank«, sagte sie.
»Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wenn du wüsstest, wie manche Leute ihre Kinder behandeln …«
»Meinst du, das wüsste ich nicht?«
»Doch, doch …« Ich beugte mich vor und küsste sie. »Hattest du einen guten Tag?«
»Ging so.«
Im Oktober erfuhr ich, dass Janni in einer Pflegefamilie untergebracht worden war. Er leide an erheblichen emotionalen Verletzungen, hieß es, und es sei schwer, mit ihm zu kommunizieren. Der Mutter ging es offenbar auch nicht so gut, und Terje Hammersten stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Das Urteil lautete dann auf sechs Monate ohne Bewährung.
Außerhalb der Mauern ging das Leben weiter. Ich rechnete nicht damit, jemanden von den dreien wiederzusehen. So kann man sich irren.
3
Bei unserer nächsten Begegnung war Janni sechs. Es war Anfang 1974, Beate und ich hatten uns kurz zuvor getrennt, und ich hatte schon bessere Zeiten erlebt. Das Jugendamt wurde an einen Tatort gerufen, um sich um ein kleines Kind zu kümmern, und dieser Auftrag fiel an Cecilie und mich.
Damals hatte ich noch meinen alten Mini, und wir quetschten uns auf dem Vordersitz, ich hinter dem Steuer, Cecilie neben mir. Mit dem Mini zu fahren kam mir vor, wie in einer viel zu kleinen Badewanne durch die Gegend zu rollen, auf so kleinen Rädern, dass ich das Gefühl hatte, die Bergenser Pflastersteine mit dem Allerwertesten zu streifen, sobald ich beschleunigte. Du hingst gefährlich dicht über dem Asphalt, und bei einer eventuellen Frontalkollision war die Chance auf ein weiteres Dasein im Gemüsemodus beträchtlich. Andererseits konntest du dich fast immer in eine Parklücke manövrieren, egal, wie eng sie aussah, und der Benzinverbrauch lag nicht viel über dem eines mittelgroßen Feuerzeugs.
Der Tatort befand sich auf Wergelandsåsen, einer mit großen Einfamilienhäusern bebauten Anhöhe, die sich wie ein Puffer zwischen Landås und Minde erhob. Landås mit seinen Wohnblocks aus den 1950er und 60er Jahren, Minde mit seinen prachtvollen Villen aus den 1920ern. Das Haus, zu dem wir gerufen worden waren, hatte einen braunen Anstrich und einen wintergrauen Garten mit abgeblühten Rosensträuchern, Schneeflecken in Staudenbeeten, Apfelbäumen mit Alterspilzbefall an der Rinde und einer Rhododendronvegetation, die sich jetzt im Ruhestadium befand, mit hängenden Blättern und braungrünen, überwinterten Knospen.
Vor dem Gartentor standen mehrere Autos. Die Haustür war offen, und auf der Treppe hatte sich eine Handvoll Leute versammelt. Ich erkannte mehrere Angehörige der Bergenser Polizei, die dort über mageren, selbstgedrehten Kippen ihre ersten Schlussfolgerungen zogen. Wir öffneten das Tor und gingen hinein.
Cecilie hatte mich unterwegs über den Fall informiert. Ein sechs Jahre alter Junge war mit seinem Vater allein zu Hause gewesen. Als die Mutter nach Hause kam, fand sie den Kleinen weinend in der Diele vor, und als sie nach ihrem Mann rief, bekam sie keine Antwort. Sie machte sich auf die Suche und entdeckte ihn am Fuße der Kellertreppe. Er hatte sich das Genick gebrochen. Der Mann war tot. Sie hatte es noch geschafft, telefonisch Hilfe zu holen, dann war sie zusammengebrochen. Im Moment lag sie im Krankenhaus Haukeland, mit schweren Medikamenten ruhiggestellt, und eine Polizistin saß bei ihr am Bett für den Fall, dass sie beim Aufwachen jemanden zum Reden brauchte. »Wie heißen die Leute?«, hatte ich gefragt. »Skarnes, Svein und Vibecke.« – »Hintergrund?« – »Mehr weiß ich nicht, Varg.«
Wir gingen ins Haus, wo uns Kommissar Dankert Muus mit mürrischer Miene begrüßte. Muus war ein hochgewachsener Mann mit grauer Haut, einem etwas zu kleinen Hut und einer ausgebrannten Kippe wie ein abgeschnittenes Körperteil im Mundwinkel. Ich war ihm vorher erst einmal kurz begegnet, aber er erkannte uns offenbar. Jedenfalls zeigte er auf eine Tür links in der weißgestrichenen, freundlichen Diele. »Er ist dort drinnen.«
Wir betraten ein Wohnzimmer mit schlichten, modernen Möbeln, dunklen Bücherregalen, einer Fernsehtruhe an der einen Querwand, Topfblumen vor den Fenstern und hellen, leichten Vorhängen. Eine Polizistin mit aschblonden Haaren und rundem Gesicht saß mit einem kleinen Jungen im Arm auf dem Sofa. In den Händen hielt sie eine blaue Fernsteuerung mit einem roten Knopf, und auf dem Boden vor dem Sofa fuhr eine kleine Märklin-Bahn auf einem ellipsenförmigen Schienenstrang, der mit großer Sorgfalt zwischen den restlichen Möbeln angelegt war. Der Junge sah dem Zug ohne erkennbare Begeisterung hinterher. Er ähnelte eher einer Puppe als einem Kind.
Die Polizistin lächelte erleichtert und erhob sich. »Hallo. Seid ihr vom Jugendamt?«
»Ja.«
Als sie die Fernsteuerung weglegte, blieb der Zug stehen. Der Junge sah reglos zu. Er schien die Fernsteuerung durchaus nicht übernehmen zu wollen.
Wir stellten uns vor. Die Polizistin hieß Tora Persen. Ihr Akzent verriet, dass sie aus Hardanger stammte, möglicherweise aus Kvinnherad. »Und das ist Janni«, fügte sie hinzu und legte dem kleinen Jungen die Hand an den Hinterkopf.
»Hallo«, sagten wir wie aus einem Munde.
Janni?
Der Junge sah uns nur an.
Wieso kam dieser Name mir bekannt vor?
Cecilie war vor ihm in die Hocke gegangen. »Du kannst jetzt mit uns kommen. Wir haben ein wunderschönes Zimmer für dich, und das hast du dann ganz für dich allein. Da sind auch liebe Leute, und ein paar andere Kinder, mit denen kannst du spielen, wenn du willst.«
Dann kam mir der Gedanke: Aber es kann doch nicht sein … das wäre einfach zu übel.
Die Skepsis in seinem Blick wurde nicht geringer. Er hatte die Lippen fest aufeinandergepresst, und die Augen waren groß und blau, wie erstarrt in einem Ausruf, einem Entsetzen, das noch nicht losgelassen hatte.
»Hast du denn auf irgendetwas Lust?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf.
Ich sah Tora Persen an. »War er die ganze Zeit so?«
Sie nickte, drehte sich halbwegs von ihm weg und sagte leise: »Wir haben kein Wort aus ihm herausholen können. Das ist wohl der Schock.«
»Als ihr gekommen seid, war er allein mit der Mutter?«
»Ja. Eine grauenhafte Situation natürlich.«
Der Junge rührte sich nicht. Er saß da und starrte die elektrische Eisenbahn an, als erwarte er, dass die sich von allein in Bewegung setzte. Nichts ließ annehmen, dass er auch nur ein Wort von unserem Gespräch gehört hatte. Bei ihm war nicht die allergeringste Reaktion zu entdecken.
Ich merkte, wie sich alles in mir zusammenkrampfte. Genauso war es bei dem anderen Jungen gewesen, der ebenfalls Janni geheißen hatte.
Aber es konnte doch nicht …
Ich sah Cecilie an. »Was meinst du? Sollten wir Marianne einschalten?«
»Ja.«
Ich ging zurück in die Diele. Neben der Kellertreppe stand ein Streifenpolizist.
»Ist es hier passiert?«
Der Mann nickte. »Sie haben ihn da unten gefunden.«
»Liegt er noch da?«
»Nein, nein. Sie haben ihn schon weggebracht.«
»Wann ist es passiert?«
»Gegen Mittag.« Er sah auf seine Uhr. »Wir sind um 14.30 informiert worden.«
Ich schaute mich um. »Gibt es hier ein Telefon?«
Er musterte mich skeptisch. »Ich glaube, da müssen Sie zu einem unserer Autos gehen und das Funktelefon benutzen. Wir haben den Apparat hier noch nicht untersucht. Auf Fingerabdrücke.«
»Ich verstehe.«
Die Tür war noch immer offen. Ich ging zu einem der vor dem Haus stehenden Wagen und bat den Zivilpolizisten, der darin saß, um das Funktelefon.
Er musterte mich abweisend. »Und mit wem habe ich die Ehre?«
»Varg Veum. Jugendamt.«
»Veum?«
»Ja.«
»Sieh an, sieh an. Ich mach eine Leitung für Sie frei.«
Er wählte auf dem Funktelefon einige Ziffern und reichte es mir durch die halb geöffnete Tür. »Jetzt können Sie wählen«, erklärte er.
Ich hatte inzwischen die Nummer der Psychologin Dr. Marianne Storetvedt in meinem Adressbuch gefunden, und die wählte ich.
Nach einigen wenigen Klingeltönen meldete sie sich. »Dr. Storetvedt.«
»Marianne? Hier ist Varg.«
»Hallo, Varg. Was kann ich für dich tun?«
»Wir haben eine Akutsituation.« Ich schilderte ihr die Lage in aller Kürze.
»Und die Mutter?«
»Liegt in Haukeland. Zusammenbruch.«
Sie seufzte. »Ja, ja … was habt ihr für Pläne mit ihm?«
»Wir wollten ihn nach Haukedalen bringen. Da haben sie ja Plätze für Notfälle.«
»Klingt vernünftig. Aber kommt gern vorher mit ihm vorbei. Wie schnell könnt ihr hier sein?«
»Wenn nichts Unerwartetes passiert, dann … in einer halben Stunde?«
»In Ordnung. Ich warte. Ich habe heute keine Klienten mehr, das ist also kein Problem.«
Wir beendeten das Gespräch, und ich reichte dem Beamten im Auto das Telefon zurück, woraufhin er die Verbindung kappte. Danach ging ich zurück ins Haus. In der Diele blieb ich bei einer schmalen Kommode stehen. Auf der Kommode stand ein gerahmtes Bild. Es war ein Familienfoto von drei Personen. Ich erkannte Janni in der Mitte. Die anderen waren dann sicher seine Eltern. Svein Skarnes sah älter aus, als ich ihn geschätzt hätte. Er war fast kahl und hatte ein schmales, etwas abweisendes Gesicht. Seine Frau war dunkelhaarig und hatte ein hübsches, regelmäßiges Lächeln, eine durchschnittliche Schönheit von der Art, von der ungefähr sechs aufs Dutzend gehen. Janni sah ein wenig hilflos aus, wie er zwischen ihnen saß: mit einem Blick, der von unterdrücktem Trotz sprach.
Die Lage im Wohnzimmer war unverändert. Cecilie hatte sich mit Janni aufs Sofa gesetzt. Jetzt ließ sie die Eisenbahn fahren, ruckelnd und in Sprüngen, da sie an solche Aktivitäten nicht gewöhnt war. Die Polizistin stand mit verlegener Miene daneben.
»Alles klar«, sagte ich. »Wir können gleich zu Marianne fahren.«
»Und das ist?«, fragte Tora Persen.
»Eine Psychologin, die wir in Notfällen konsultieren. Dr. Storetvedt.«
»Wir müssen erst Hauptkommissar Muus fragen. Ob Sie den Jungen mitnehmen dürfen, meine ich.«
»Natürlich.«
Sie verschwand. Ich sah Janni an. Sechs Jahre. Ich hatte einen Sohn von zweieinhalb, Thomas, der jetzt bei seiner Mutter wohnte, nachdem meine und Beates Beziehung ein halbes Jahr zuvor in die Brüche gegangen war. Derzeit lebten wir getrennt, aber was nach der vorgeschriebenen Wartezeit passieren würde, lag auf der Hand. Ich hatte versucht, sie umzustimmen, doch sie hatte mich resigniert angesehen und gesagt: »Ich glaube nicht, dass du verstehst, was der Grund ist, Varg. Ich glaube nicht, dass du überhaupt irgendetwas verstehst.« Und damit hatte sie recht. Ich verstand in dieser Angelegenheit rein gar nichts.
Ich sah seine leere, apathische Miene und versuchte, das Bild des kleinen Jungen aus Rothaug vor drei, vier Jahren in mir hervorzuholen. Aber mein erster Eindruck war zu vage gewesen. Ich erinnerte mich an die unbehagliche Stimmung in der kleinen Wohnung, an den großkotzigen Kerl, der dort hereingeplatzt war, an den verzweifelten Blick der Mutter und an den kleinen Jungen im Kinderbett. Aber sein Gesicht … Das hatte damals seine Form noch nicht gefunden, hatte es jetzt ja eigentlich noch kaum.
Ich ging neben dem Sofa, auf dem die beiden saßen, in die Hocke, um ebenfalls mit ihm auf Augenhöhe zu kommen. Dann legte ich ihm eine Hand aufs Knie und sagte: »Hast du Lust, mit meinem Auto zu fahren, Janni?«
Zum ersten Mal wurden seine Augen ein wenig lebendig. Aber er sagte nichts.
»Dann können wir eine liebe Frau besuchen und ein bisschen mit ihr reden.«
Er gab keine Antwort.
Ich nahm seine Hand. Die war schlaff und leblos, und er griff nicht zu. »Komm.«
Cecilie erhob sich, fasste ihn vorsichtig unter den Armen und hob ihn behutsam auf den Boden. Er blieb einfach stehen, und als ich mit ihm zur Tür ging, leistete er keinen Widerstand. Unsicher stellte er einen Fuß vor den anderen, als wage er sich auf einen vereisten Weiher hinaus und wisse nicht, ob das Eis trägt.
Dann kamen wir nicht weiter. Hauptkommissar Muus füllte die Tür. Hinter ihm ahnte ich Tora Persen. Der hochgewachsene Polizist musterte den Jungen mürrisch. »Redet er jetzt?«
»Noch nicht.«
»Na gut«, brummte Muus. »Und wo wollt ihr mit ihm hin?«
»Zuerst zu einer Psychologin, die wir in solchen Fällen hinzuziehen, dann in ein Bereitschaftsheim in Åsane.«
Er nickte. »Sagt uns nur Bescheid, wo das ist. Es ist ja nicht unmöglich, dass jemand von uns eine Vernehmung mit ihm durchführen muss.«
»Vernehmung!«, rief Cecilie.
»Er ist der einzige Zeuge.« Muus musterte sie streng.
»Sie werden informiert«, sagte ich. »Aber jetzt müssen wir an Janni denken. Dürfen wir durch?«
»Nicht so hastig und lustig, junger Mann. Wie war noch gleich der Name, haben Sie gesagt?«
»Veum. Aber das habe ich nicht gesagt.«
»Veum. Das merke ich mir«, sagte er mit einem leichten Lächeln um die Mundwinkel. »Wir haben sicher noch viel Spaß zusammen, wir beide.«
»Aber nicht heute. Können wir jetzt gehen?«
Er nickte und trat zur Seite. Cecilie und ich führten Janni hinaus in die Diele und dann rasch zur Tür. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Muus auf dem Absatz kehrtmachte und zur Kellertreppe zurückkehrte, während Tora Persen mitten in der Diele stehenblieb wie ein auf einer Übungsstrecke umgefahrener Kegel.
Draußen auf der Treppe nahm ich den Jungen auf den Arm, um ihn das letzte Stück zu tragen. Er wehrte sich nicht, ich hätte genauso gut einen Sack Kartoffeln tragen können. Beim Auto sagte ich zu Cecilie: »Ich glaube, du musst dich mit ihm nach hinten setzen.«
Sie nickte. Ich stellte Janni auf den Boden und klappte die rechte Rücklehne nach vorn, damit die beiden nach hinten rutschten konnten. Cecilie stieg ein und konnte sich hinter dem Fahrersitz auf die Rückbank manövrieren. Ich hob Janni hoch, und sie streckte die Hände nach ihm aus. Plötzlich wandte er den Kopf und schaute mir zum allerersten Mal in die Augen. »Das war Mama«, sagte er.
4
Die Psychologin Dr. Marianne Storetvedt wirkte wie eine etwas altmodische Schönheit von etwa vierzig Jahren. Die Haare fielen ihr in lockeren Wellen auf die Schultern. Sie hatte ein schmales Gesicht mit klaren Zügen und hohen Wangenknochen. Ihr scharfer Blick wurde gemildert durch die deutlichen Lachfältchen, die ihn einrahmten. Sie war schlicht gekleidet, in ein helles Twinset und einen braunen Rock, und trug eine Perlenkette um den Hals.
Ihre Praxis lag am Ende des Strandkai und bot Blick auf Bryggen, den Rosenkrantzturm und die Håkonshalle, oder auf Skansen und Fløien, wenn sie in die andere Richtung schaute. Hätte jemand mir eins geschenkt, ich hätte durchaus nichts gegen ein solches Büro einzuwenden gehabt.
Draußen auf Bryggen staute sich der Verkehr in Richtung Åsane, wie fast immer um diese Tageszeit, und auf dem Grabungsgelände, das der Brand von 1955 hinterlassen hatte, nahm das neue Museumsgebäude am Hang unterhalb der Marienkirche Gestalt an.
Marianne Storetvedt empfing uns im Wartezimmer. Sie nahm sofort Blickkontakt zu Janni auf, der seit seiner einen Äußerung, als ich ihn ins Auto gehoben hatte, wieder stumm war wie ein Stufenbarren. »Hallo«, sagte sie und lächelte ihn an, dann legte sie ihm eine freundliche Hand auf die Schulter. »Wir werden bestimmt gute Freunde, du und ich.«
Er sah sie stumm und ohne sichtbare Reaktion an.
Sie drehte sich zu Cecilie und mir um. »Ich glaube, ich würde lieber mit ihm allein sprechen, aber … wollt ihr mir vorher etwas sagen?«
»Ja«, antwortete ich. »Wenn wir einen Moment ungestört reden könnten.«
»Ich kann mich so lange um Janni kümmern«, sagte Cecilie. »Es gibt doch sicher eine Zeitschrift, die wir uns ansehen können, oder?«
Sie setzte sich mit ihm auf ein Sofa und zog eine Illustrierte aus dem Fach unter dem Couchtisch hervor. Ich folgte Marianne Storetvedt in ihr Sprechzimmer.
Das war ebenso schlicht gehalten wie Mariannes Kleidung: ein Schreibtisch mit Stuhl, ein sehr bequemer Ledersessel auf der anderen Seite des Schreibtisches und eine Couch vor der einen Wand, für die Klienten, die beim Gespräch lieber lagen. An den Wänden hingen einige wenige anspruchslose, schöne Landschaftsbilder – Meer, Gebirge und Wald –, unterbrochen nur durch ein großes Astrup-Gemälde aus Jølster, das bekannte Frühlingsmotiv, ein Mann und eine Frau, die ein Feld bestellen, während der Apfelbaum blüht und der Mond sich unter ihnen im See spiegelt.
Wir blieben stehen, und sie sah mich mit einem kleinen Lächeln an. »Na?«
»Na ja, wir wissen nicht sehr viel. Er war allein zu Hause, mit dem Vater, der tot am Fuße der Kellertreppe gefunden wurde. Der Junge stand in der Diele und weinte, als die Mutter nach Hause kam. Er hat kein Wort zu uns gesagt, außer …«
»Ja?«
»Na ja … als wir uns gerade ins Auto setzen wollten, um herzufahren, sagte er …«
»Ja? Was denn?«
»Das war Mama.«
»Das war Mama?«
»Ja.«
»Habt ihr die Polizei informiert?«
»Nein, das haben wir nicht. Sie ist doch im Krankenhaus und … Es wird nach und nach sicher alles ans Licht kommen. Außerdem …«
»Ja? Gibt es noch mehr, das ich wissen sollte?«
»Ich muss das erst mal überprüfen, aber ich frage mich, ob Janni vielleicht … ob er nur ihr Pflegekind ist und ob ich ihn schon einmal gesehen habe.« Ich erzählte ihr kurz, woran ich mich aus der Wohnung in Rothaug noch erinnerte, von jenem Julitag dreieinhalb Jahre zuvor.
»Welchen Hintergrund haben diese Pflegeeltern? Kannst du darüber etwas sagen?«
»Nein. Wir haben noch gar nichts erfahren. Sie heißen Skarnes. Svein und Vibecke. Mehr weiß ich nicht. Aber sie wohnen in einem Einfamilienhaus auf Wergelandsåsen, von einer in irgendeiner Hinsicht mittellosen Familie kann also nicht die Rede sein.«
»Sonst niemand? Keine Geschwister, meine ich?«
»Nein, meines Wissens nicht.«
»Na, dann legen wir jetzt los. Ich werde sehen, ob ich ihn dazu bringen kann, sich zu öffnen. Aber ich will ihn auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Wenn ihr draußen warten könntet …«
Wir gingen zurück ins Wartezimmer. Es dämmerte bereits. Die Straßenlaternen waren eingeschaltet, und die Autoscheinwerfer auf Bryggen bildeten eine zerrissene Perlenkette, deren Perlen eine nach der anderen in Richtung Åsane rollten. Nach einem weiteren erfolglosen Versuch, Kontakt zu Janni aufzunehmen, ging Marianne mit ihm in ihr Sprechzimmer und zog die Tür hinter sich zu.
Cecilie und ich blieben draußen sitzen. Sie blätterte weiter in der Illustrierten. Die war wohl kaum nach ihrem Geschmack. Ich kannte Cecilie seit dem Sommer 1970, und eine Zeitschrift wie Sirene hätte ihren feministischen Vorlieben sicher eher entsprochen.
Manche hätten sie zweifellos als klassische Sozialarbeiterin bezeichnet, mit kurzgeschnittenen Haaren, ovaler Nickelbrille, ohne Schminke und gekleidet in eine weiße Hemdbluse mit einer hellen kleinen Weste, die, wie ich annahm, aus einem Land am Mittelmeer stammte, dazu eine leicht abgenutzte Cordhose und knöchelhohe schwarze Stiefel. Ihr Akzent verriet, dass sie aus dem Süden des Regierungsbezirks stammte, eher aus Røldal als aus Odda. Wir hatten eine gute, kollegiale Beziehung, die sich in beide Richtungen bewegte, seit Beate die Trennung durchgesetzt hatte. Einerseits waren wir auf einer fast persönlichen Ebene vertrauter miteinander geworden, andererseits hatte sich eine Distanz ergeben, weil Cecilie in ihrer Frauensolidarität davon ausging, dass Beate recht hatte. Aber wenn Beate sich darüber beklagt hatte, dass ich aus beruflichen Gründen zu viele Nächte außer Haus verbrachte, dann hatte ich diese Nächte fast immer mit Cecilie verbracht, und zwar wirklich dienstlich; auf den Straßen der Stadt, auf der Suche nach durchgebrannten Kindern und Jugendlichen.
»Was glaubst du?«, fragte ich.
Sie schaute auf und ließ ihren Blick für einen Moment in meinem ruhen, als sehe sie in meinen Augen auf den Grund, dann zuckte sie mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er sich das nur ausgedacht hat.«
»Das mit der Mutter?«
»Ja.«
»Wissen wir etwas über – die Eltern?«
»Nein. Das ging alles so schnell.«
»Wir sollten vielleicht ein paar Nachforschungen anstellen.«
»Eigentlich sollten wir ihn wohl nur in Haukedalen abliefern, oder nicht?«
»Das schon, aber …«
Sie deutete ein Lächeln an. »Du musst dich immer so tief in den Fällen vergraben, du, Varg.«
»Na ja. So bin ich eben. Ein bisschen zu neugierig vielleicht. Außerdem …«
»Ja?«
»Nein. Ich fürchte, ich bin ihm vielleicht schon einmal begegnet.«
»Ihm begegnet – Janni?«
»Ja.« Noch einmal erzählte ich von jenem heißen Julitag des Jahres 1970.
Als ich fertig war, sagte sie: »Ja, das müssen wir auf jeden Fall klären. Da bin ich ganz deiner Meinung.«
Sie blätterte weiter in der Illustrierten, ohne jedoch zu lesen. Es war deutlich, dass ich ihr etwas zu denken gegeben hatte. Ich selbst sah mir die Bilder an der Wand an. Hier draußen hingen historische Fotos aus Bergen, die meisten aus der Umgebung des Hafens, einige auch von Murebryggen und von Torget. Es war eine Stadt in Schwarz-Weiß mit geschäftigen Menschen in Bewegung, etwas, das die Kameras jener Zeit nicht immer hatten einfangen können, so dass einige dieser Menschen verschwommene Umrisse aufwiesen, wie Wiedergänger. Im Hafen verrieten die Mastspitzen, dass die Boote dicht an dicht lagen, unten am Kai liefen Boten und Träger mit Säcken über der Schulter und Tonnen auf ihren Handkarren aneinander vorüber. Eine andere Stadt und eine andere Zeit, mit anderen Arten von Problemen.
Fast eine Stunde verging, bis sich die Tür des Sprechzimmers öffnete. Marianne Storetvedt führte Janni vorsichtig durch die doppelte Zwischentür ins Wartezimmer. Sie sah uns über seinen Kopf hinweg an und schüttelte kurz den Kopf. Dann sagte sie freundlich, während sie seine Schulter streichelte: »Janni möchte heute nicht mit uns reden. Das muss er auch nicht. Ich glaube, was er jetzt vor allem braucht, ist etwas zu essen und vielleicht eine Tasse heiße Schokolade.«
Ich nickte. »Wenn ich kurz telefonieren dürfte …«
Sie zeigte auf ihr Sprechzimmer. »Natürlich.«
Ich ging allein hinüber. Der Schreibtisch war sauber und ordentlich, und nirgendwo lagen Notizen von ihrem Gespräch mit Janni herum. Ich schlug mein Adressbuch auf und fand die Nummer von Haukedalen Barnesenter, einer Einrichtung, in der vor allem Kinder in akuten Notsituationen untergebracht wurden.
Der Leiter war selbst am Telefon, ein Kollege namens Hans Haavik. Ich schilderte ihm die Lage und sagte, wir seien unterwegs. Er versprach, bei unserem Eintreffen eine warme Mahlzeit bereit zu haben.
Ich nutzte die Gelegenheit, um in Mariannes Telefonbuch nachzusehen.
Skarnes, Svein stand dort ohne Berufsangabe. Seine Ehefrau Vibecke war nicht verzeichnet. Direkt darüber fand ich eine Firma namens Skarnes Import, deren Geschäftsführer Svein Skarnes mit Privatadresse und Telefonnummer aufgeführt war. Was er importierte, war der Eintragung nicht zu entnehmen.
Ich ging zurück zu den anderen. Marianne Storetvedt und Cecilie standen, in ein leises Gespräch vertieft, vor dem Fenster. Janni stand gleich hinter ihnen, mit dem bekannten leeren Gesichtsausdruck. Als ich hereinkam, sah er mich an, und für einen Moment schien er etwas sagen zu wollen. Ich lächelte aufmunternd und nickte, aber er brachte keinen Ton heraus.
»Hast du Hunger?«
Er deutete ein Nicken an.
»Sollen wir vielleicht wieder Auto fahren?«
Wieder nickte er, diesmal etwas kräftiger.
»Ich habe mit einem Mann gesprochen, der Hans heißt. Er wird das Essen fertig haben, wenn wir kommen«, sagte ich und ließ diese Information zugleich den beiden Frauen zukommen.
Cecilie sagte: »Ja, ich hätte auch nichts gegen einen Imbiss.«
Marianne Storetvedt sagte, sie würde gern wieder mit Janni sprechen, »wenn er selbst Lust hat«, wie sie sich ausdrückte. Wir dankten ihr und verabschiedeten uns, dann gingen wir zum Auto, das ich am Kai schräg gegenüber abgestellt hatte.
Nicht lange danach hatten wir uns der Autoschlange nach Åsane angeschlossen, aus der es nun einmal kein Entrinnen gab. Die ewige Sehnsucht nach Auswanderung, die den Menschen im Blut steckt, hätte ein Ethnologe das vielleicht genannt.
Wir waren wie eine kleine Familie, als wir losfuhren, und typisch: Niemand sagte ein Wort. Ich hatte mehr als genug zu bedenken. Nicht zuletzt versuchte ich – aber vergebens –, mich an den Namen von Jannis wirklicher Mutter zu erinnern. Wenn es nun derselbe Janni war.
5
Haukedalen Barnesenter lag diskret zurückgezogen vom Hesthaugveg am Höhenzug in Richtung Myrdalskogen und Geitanuken, einem der Berge, die den zentralen Teil von Åsane zum Meer hin abschirmen. Der Stadtteil, vor nicht allzu langer Zeit noch Bauernland, war 1972 eingemeindet worden. Für den Moment war er geprägt von großen Bauprojekten, von Einfamilienhäusern in Reihen bis zu Hochhäusern, Schulgebäuden und Einkaufszentren. Der Straßenbau hatte mit dieser Entwicklung absolut nicht Schritt halten können, und den Vorschlag einer Stadtbahn, der im Stadtrat vorgelegt worden war, hatte die Mehrheit als finanziell unverantwortlich abgelehnt. Stattdessen wurde beschlossen, lieber Schnellstraßen zu bauen. Bis diese Pläne in die Tat umgesetzt sein würden, standen wir alle im Stau, falls wir in diese Richtung wollten. Erst oben im Åsaveg, bei der Abzweigung nach Tertnes, glitt der Verkehr ohne weitere Verzögerungen dahin, und als wir in Haukedalen ankamen, hatte Hans Haavik reichlich Zeit gehabt, die Mahlzeit vorzubereiten.
Hans Haavik war Mitte dreißig, er war um die eins neunzig, breit wie ein Scheunentor und hatte ein sonniges Gemüt, das bei allen, die aus irgendeinem Grund unter seinen Fittichen Zuflucht suchten, augenblicklich Zutrauen erweckte. Cecilies Wunsch nach einem Imbiss wurde erfüllt. Er hatte im Speisesaal gedeckt, einem hellen Raum mit großen, lebhaft dekorierten Eternitplatten an der grauen Betonwand. Auf dem Weg hierher waren wir an zwei Jungen von dreizehn oder vierzehn vorbeigekommen, die auf dem Parkplatz vor dem Eingang Fußball spielten. Aus einem Aufenthaltsraum hörten wie die charakteristischen Geräusche eines Eishockeyspiels, bei dem der Puck wie eine Gewehrkugel zwischen den winzigen Miniaturspielern hin und her schoss.
Das Essen war ein dickflüssiger Kartoffeleintopf, serviert mit frischen Graubrotscheiben mit guter Butter. Wir bekamen kaltes Wasser aus einer Kanne, und Hans versprach uns heiße Schokolade, Kaffee und selbstgebackene Plätzchen zum Nachtisch.
Janni aß nicht viel. Er stocherte im Essen herum, musterte die Fleischstücke mit skeptischer Miene, kostete aber die Wurstscheiben. Wir ließen ihn in Ruhe, aber so lange er dort saß, konnten wir nicht über ihn sprechen.
Also unterhielten wir uns mit leiser Stimme. Wir kamen ja alle drei aus der Sozialarbeit. Hans hatte zehn Jahre Fahrtzeit. Cecilie und ich waren eher frisch geschlüpft, sie zwei Jahrgänge vor mir. Als wir mit dem Essen fertig waren, schaute Hans uns vielsagend an und meinte: »Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn einer von euch bleibt, bis er eingeschlafen ist.«
Cecilie nickte und sah mich an. »Das kann ich machen. Du hast doch …«
Sie verstummte, und ich lächelte steif zurück. Ich wusste, was sie hatte sagen wollen, aber das hatte ich eben nicht mehr. Menschen, die auf mich warteten.
»Schön«, sagte Hans.
Ich sah Janni an. Sechs, sechseinhalb. Thomas war zweieinhalb. Es war seltsam, wie abhängig man von solchen kleinen Wesen werden konnte. Sowie der tägliche Umgang unterbrochen wurde, entstand im Dasein ein Leerraum, ein Loch, das sich bestenfalls mit etwas anderem füllen ließ, aber nicht zwangsläufig und schon gar nicht immer.
Ich seufzte, und Cecilie lächelte ein wenig resigniert, wie um sich für ihren kleinen Versprecher zu entschuldigen.
»Na, dann bin ich weg.«
Ein Telefon klingelte, und Hans ging hinüber, um den Anruf anzunehmen. Cecilie kam zu mir. »Das tut mir leid, Varg. Ich wollte nicht … alles wieder aufwühlen …«
»Nein, nein. Keine Panik. Du kannst nichts dafür, dass …«
Hans kam zurück. »Das ist die Polizei. Sie wollen wissen, ob ihr eine Mitteilung entgegennehmen könnt.«
Ich sah Cecilie an, und sie nickte mir zu.
»Okay, das mache ich.« Ich ging hinaus in die Eingangshalle, wo an der Wand ein Münzfernsprecher befestigt war. »Ja, hier ist Veum.«
»Hauptkommissar Muus hier.«
»Ja?«
»Die Situation hat sich verändert.«
»Ach?«
»Diese Frau. Vibecke Skarnes. Wir sind zum Krankenhaus gefahren, um zu fragen, ob sie ansprechbar ist. Aber das war sie nicht.«
»Wie ist das zu verstehen?«
»Das soll heißen … sie war nicht mehr da. Sie war weg.«
»Weg?«
»Verschwunden, ohne viel mehr zu hinterlassen als ihren Abdruck im Bett.«
»Aber ihr sucht doch jetzt sicher nach ihr?«
»Wofür halten Sie uns eigentlich? Für Idioten?«
»Nicht alle.«
»Was haben Sie gesagt?«
»Nein.«
»Aber wir glauben, dass es sich vielleicht empfiehlt, den Jungen besonders gut im Auge zu behalten. Bis sie wiederaufgetaucht ist.«
»Ich verstehe. Ich werde mit Haavik reden. Wenn er das nicht übernehmen kann, bleibe ich eventuell selbst hier. Haltet uns auf dem Laufenden.«
»Gut.«
Ich legte auf, ging zurück zu den anderen und lächelte Janni an. »Willst du jetzt wohl schlafen gehen, was meinst du?«
Er sah mich von weit her an, aus einem Land, zu dem Erwachsene keinen Zutritt hatten. Manchmal fragte ich mich, ob dieses Land nicht ein besserer Aufenthaltsort wäre. Aber der Weg zurück war verschlossen, für die meisten von uns für immer.
Während wir Teller und Suppentopf in die Küche brachten, informierte ich Hans und Cecilie über die neueste Entwicklung. Wir kamen überein, dass Cecilie nicht nur bleiben, sondern auch im selben Zimmer übernachten sollte wie Janni, während Hans die Nachtwache, die bald den Dienst antreten würde, ins Bild setzte.
»Aber sie kann doch nicht wissen, wo er ist?«, fragte Cecilie.
»Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich frage mich, ob ich nicht noch mal nach Wergelandsåsen fahren sollte, für den Fall, dass sie dort auftaucht.«
Sie sah mich überrascht an. »Aber ist das nicht die Aufgabe der Polizei?«
»Doch.«
Sie verdrehte die Augen.
Wir gingen beide mit, als Hans Janni nach oben brachte, um ihm zu zeigen, wo er übernachten würde. Es war ein Zimmer im ersten Stock, mit zwei Betten, einem Tisch und zwei Stühlen in der Mitte, einem doppelten Kleiderschrank und Aussicht auf den Felshang hinter dem Haus. Das einzige Bild an der Wand stammte aus einem Kinderbuch, an das ich mich aus meiner eigenen Kindheit vage zu erinnern glaubte. Es zeigte einige verirrte Kinder in einem Wald aus riesigen Fliegenpilzen, die ihnen hoch über die Köpfe wuchsen. Ich war durchaus nicht sicher, wie beruhigend das war.
Janni aber schien nun zur Ruhe zu finden. Er wirkte weiterhin fast apathisch, und ich sagte zu Cecilie, wenn sein Zustand am nächsten Tag unverändert sei, müssten wir um medizinische Unterstützung bitten. Sie nickte nachsichtig, wie um klarzustellen, dass das eine absolut überflüssige Bemerkung gewesen war.
Cecilie blieb oben, um Janni zu helfen, sich bettfertig zu machen. Ich kehrte mit Hans in den Speisesaal zurück. Die Eishockeygeräusche aus dem Nachbarzimmer waren verstummt. Jetzt hatte der Fernseher übernommen, aber die Sendung konnte ich nicht identifizieren.
Ehe ich ging, war ich ein letztes Mal oben und sagte Janni gute Nacht. Er trug einen Schlafanzug, der in einem Kleiderschrank gelegen hatte. Cecilie hatte im Regal über dem Bett ein Buch gefunden und las ihm daraus vor. Der Junge lag mit offenen Augen da, starrte zur Decke und zeigte absolut nicht, ob er zuhörte.
»Gute Nacht, Janni«, sagte ich.
Er gab keine Antwort.
Ich hob die Hände, verpasste Cecilie ein aufmunterndes Schulterklopfen und zog mich zurück.
Hans brachte mich zur Tür. Er lachte, als er mein Fahrzeug sah. »Passt du wirklich in diese Sardinenbüchse, Varg?«
»Besser, als du glaubst«, antwortete ich. »Aber für dich wäre die wohl eine Nummer zu klein.«
Er blieb stehen und sah mir beim Einsteigen zu. Ich schaute zu ihm hoch. Er machte ein besorgtes Gesicht.
»Macht dir irgendwas zu schaffen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Das ist wohl eher eine Berufskrankheit, Varg. Die kriegst du auch noch, nach einigen Jahren in dieser Branche.«
»Und wie sieht diese Krankheit aus?«
»Eine ständig wachsende Desillusion im Hinblick auf das, was manche Erwachsenen den Kindern, die sie in die Welt gesetzt haben, zumuten.«
»Tja …«
Wir nickten einander zu, ehe ich schaltete und losfuhr. Ich warf ihm noch einen Blick im Rückspiegel zu, als ich den Parkplatz verließ. Er wirkte seltsam verlassen, wie er dort stand; ein großer, lieber Bär, vergessen von einem Kind, das längst erwachsen und gar nicht wenig im Streit mit seiner Zeit ist.
Die Wohnung in Møhlenpris hatte Beate behalten. Ich hatte in Fjellsiden, in der Gasse Telthussmauet, zwei Zimmer mit Küche gefunden. Aber ich fuhr nicht dorthin. Ich fuhr, wie ich es Cecilie angekündigt hatte, wieder nach Wergelandsåsen.
6
Der Februar in diesem Jahr war schwarz und schneearm. Es war auch nicht kalt. Es war ein ungewöhnlich milder Winter gewesen, und im Januar war der Föhn so ausgiebig über die Stadt gestrichen, dass Volk und Vieh viel zu früh von Frühlingsgefühlen heimgesucht worden waren. Niemand hätte sich gewundert, wenn die Zugvögel schon einen oder zwei Monate früher eingetroffen wären als sonst.
Wergelandsåsen war an diesem Abend eine fast lärmfreie Zone. Alles, was man hörte, waren das ferne Rauschen im Storetveitveg, eine Katze, die wütend in einem Garten miaute, und ein Flugzeug, das hoch über der Stadt zum Flughafen Flesland unterwegs war.
Hinter den Hecken lagen beleuchtet und friedlich die Häuser. Ich fuhr an die Seite, stieg aus dem Auto und drückte leise die Tür zu. Dann schaute ich mich um.
Die Straße war schmal und umrahmt von braunwelken Hecken, die meisten getrimmt und gepflegt. Auf der einen Straßenseite standen einige Autos. Ich beugte mich vor, um zu sehen, ob in einem jemand saß, konnte aber niemanden entdecken.
Ich schloss das Auto ab und ging los. Um das braungestrichene Haus stand keine Hecke, es gab jedoch große dunkelgrüne Rhododendren, von denen die umfangsreichsten mindestens zwanzig Jahre alt waren. Beim Tor blieb ich stehen. Die Polizei hatte das ganze Grundstück mit rot-weißen Plastikbändern abgesperrt, eine Maßnahme, die den Zugang nicht verhinderte. Ich sah zum Haus hinüber. Dunkel und verlassen stand es da. Eine Außenlampe brannte. Das war alles.
Weiter hinten auf der Straße wurde eine Autotür zugeschlagen. Zwei Männer kamen auf mich zu. Keiner von ihnen trug Uniform, aber das war auch nicht nötig. Ich erkannte sie am Gang, und als sie mich fast erreicht hatten, sah ich, dass es sich um Ellingsen und Bøe handelte. Ellingsen kannte ich, weil er mit einer früheren Schulkameradin von mir verheiratet war, Bøe hatte ich auf der Wache gesehen.
»Können wir Ihnen irgendwie behilflich sein?«, fragte Bøe, der Ältere von beiden, er hatte ein schmales Gesicht und wirkte mager und gelenkig.
»Den kenne ich«, sagte Ellingsen, der ein wenig rundlicher war, dunkelhaarig und mit sichtlichem Bartwuchs.
»Hallo, Elling«, sagte ich. »Wie geht’s denn zu Hause?«
»Ja, danke.«
»Du kennst ihn, hast du gesagt?«, fragte Bøe.
»Nur vom Hörensagen.«
»Seine Frau«, fing ich an.
»Die waren in einer Klasse«, sagte Ellingsen eilig.
Ich deutete ein Lächeln an, als wüsste ich etwas, das er lieber nicht wissen wollte.
»Und was zum Teufel, haben Sie um diese Tageszeit hier zu suchen?«, wollte Bøe wissen.
Ich sah ihn an. »Es ist so, dass ich heute schon mal hier war, und zwar dienstlich. Jugendamt, wenn Sie das interessiert. Ich dachte nur, ich wollte mal – sehen, wie es abends hier so aussieht.«
Ellingsen schnaubte, und Bøe musterte mich misstrauisch. »Und wie sieht es aus?«
Ich öffnete den Mund, um zu antworten, aber nun bog ein weiteres Auto in die schmale Stichstraße ein. Erst, als der Fahrer uns bemerkte, schaltete er das Fernlicht aus. Einen Moment lang stand die Zeit still. Dann gingen die beiden Polizisten auf den Neuankömmling zu. So viel ich sehen konnte, war es ein BMW von der eher sportlichen Sorte, so muskulös wie protzig und in einer geschmacklosen, unecht wirkenden Farbe. Ehe sie ihn erreichten, öffnete der Fahrer bereits die Tür und stieg aus. Es war ein schlanker Mann in einer kurzen Jacke, vorerst nur als Silhouette zu sehen.
Ich ging hinter Ellingsen und Bøe her.
»Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen?«, fragte der Mann in scharfem Ton und mit natürlicher Autorität in der Stimme.
»Das wollten wir Sie auch gerade fragen«, sagte Bøe und zeigte seinen Dienstausweis.
»Ich bin Anwalt Langeland. Ich vertrete die Familie.«
»Welche Familie?«
»Skarnes. Was haben Sie denn gedacht?«
Ellingsen machte ein verlegenes Gesicht. »Na ja, wir mussten doch fragen, nicht wahr?«
»Nicht unbedingt.«
Die beiden Polizisten stellten sich vor. Langeland sah mich an. »Und das ist?«
Ellingsen und Bøe drehten sich überrascht um, als hätten sie mich noch nie gesehen.
»Veum«, sagte ich. »Jugendamt.«
»Ihr seid das also, die sich um Janni kümmern?«
»Der ist in guten Händen.«
»Das höre ich immerhin gern. Wo denn?«
»Dazu darf ich nichts sagen.«
»Wie ich schon den Herren von der Polizei mitgeteilt habe … ich bin der Anwalt der Familie. Mir dürfen Sie alles sagen.«
»Ich habe gelernt, dass man Anwälten so wenig wie möglich sagen darf.«
Bøe grinste. »Vielleicht sollten Sie mit Herrn Veum eine Autofahrt unternehmen. Und ihm ein Angebot machen, dass er nicht ablehnen kann.«
»Du hast den Film offenbar auch gesehen?«, fragte ich.
»Was ist hier das Problem?«, fragte Langeland.
»Problem womit denn?«
»Was wollen Sie hier?«
»Ich könnte vielleicht dieselbe Frage stellen. Rechnen Sie etwa damit, hier Ihre Mandantin anzutreffen?«
Er musterte mich mit kühlem Blick. »Meine Mandantin?«
»Vibecke Skarnes. Haben Sie nicht gesagt, Sie seien der Anwalt der Familie?«
»Doch, aber … ist sie nicht im Krankenhaus?«
»Dann wäre es doch eher natürlich, dass Sie sie dort aufsuchen – und nicht hier?«
Beide Polizisten musterten Langeland aufmerksam. Sie schienen meine Sicht der Dinge zu teilten.
Er blickte uns verärgert an. »Ich bin hergekommen, um mir ein Bild der Lage zu machen. Ich bin erst heute Abend über das informiert worden, was hier geschehen ist. Hatte einen Auftrag in Kinsarvik«, fügte er mit einem Seitenblick zu den Polizisten hinzu. »Aber ich begreife ja, dass es hier nichts zu holen gibt.«
»Man soll nie nie sagen«, sagte ich.
»Und was soll das bedeuten?«
Ich drehte mich wieder zu Bøe um. »Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Daher überlasse ich diese Einschätzung sicherheitshalber unseren Freunden hier.«
Bøe musterte Langeland forschend. Dann sagte er kurz: »Es ist nun so, dass Frau Skarnes verschwunden ist.«
»Was? Verschwunden?«
»Ja.«
»Etwa aus dem Krankenhaus?«
Bøe nickte nur stumm.
Für einen Moment stand Langeland wie gelähmt da. »Ich muss schon sagen!« Dann drehte er sich wieder zu mir um. »Haben Sie etwas davon gewusst?«
»Nicht mehr, als eben gesagt worden ist.«
Ein offenbar ratloser Anwalt war ein so seltener Anblick, dass ich für einen Moment abgelenkt war. Schließlich riss er sich zusammen. »Na, dann fahre ich selbst mal hoch und erkundige mich, was passiert ist.« Er sah wieder die Polizisten an. »Und Sie?«
Bøe musterte ihn unter etwas müden Augenlidern. »Unser Auftrag ist es, das Haus zu überwachen. Falls sie hier auftaucht. Veum kann nach Hause gehen und schlafen.«
Ich zwinkerte Ellingsen zu. »Ja, wenn Elling hier ist, dann …«
Er lief dunkelrot an. »Veum! Ich hab dich schon mal gewarnt!«
»Hast du. Aber hat mir das Angst gemacht? Bisher nicht.«
»Eines Tages werde ich dich dermaßen verprügeln, dass du …«
»Dass wir in die Zeitung kommen?« Ich sah die beiden anderen an. »Jetzt habe ich immerhin Zeugen. Übernehmen Sie den Fall, Langeland?«
»Ja, ja, schon gut«, sagte Bøe ungeduldig. »Da ihr beide keinen offiziellen Grund habt, hier zu sein, schlage ich vor, dass ihr verschwindet – und zwar sofort.«
»Von mir aus«, sagte ich und warf einen langen Blick auf den dunklen Garten, der das Haus umgab.
»Ich fahre zum Krankenhaus«, sagte Langeland.
Ich begleitete ihn zu seinem Auto, das Seite an Seite mit meinem stand, eine passende Demonstration des Unterschiedes unserer respektiven Monatsgehälter. Der Mini errötete an seinen Rostflecken und schaute demonstrativ in die entgegengesetzte Richtung, als ich bei ihm stehen blieb.
Ehe er sich in sein eigenes frischgewienertes Fahrzeug setzte, drehte sich Langeland noch einmal um. »Warum wollen Sie mir nicht sagen, wo Janni ist?«
»Meine Güte, Langeland. Das ist doch keine große Affäre. Er ist in Haukedalen, da im Kinderheim.«
»Bei Hans Haavik?«
»Ja. Kennen Sie den?«
»Wir sind alte Freunde. Aus Studienzeiten.«
»Na, dann wissen Sie jedenfalls, wo er ist. Aber ehe Sie fahren, Langeland …«
»Ja?«
»Könnte es sein, dass Vibecke und Svein Skarnes nicht Jannis biologische Eltern sind?«
Er musterte mich feindselig. »Wie kommen Sie denn auf die Idee?«
»Sie haben doch gehört, in welcher Branche ich arbeite? Ich glaube, dass ich Janni schon einmal begegnet bin, da war er zwei oder drei. Und hatte ein ganz anderes Zuhause.«
Langeland wandte sich ab und ließ seinen Blick über das Autodach zu den beiden Polizisten wandern. »Na ja … ich kann keinen Grund erkennen, das abzustreiten. Aber Vibecke und Svein haben ihn adoptiert. Sie haben alle elterlichen Rechte.« Nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: »Ja, jetzt hat Vibecke die.«
»Weiß er das selbst, was glauben Sie?«
»Dass er adoptiert ist? Das bezweifle ich. Aber da müssten Sie eigentlich … Vibecke fragen. Warum wollen Sie das überhaupt wissen?«
»Na ja, ich … war nur so ein Gedanke.«
»Gut … dann empfehle ich mich.«
Mit einem letzten Nicken setzte er sich ins Auto, zog die Tür hinter sich zu, ließ den Motor an und glitt im Rückwärtsgang aus der Stichstraße, so leise, dass man die Reifen auf dem Asphalt kaum hörte. Ich blieb stehen und sah ihm hinterher, ehe ich mit einem leicht unbehaglichen Gefühl in meinem eigenen Auto Platz nahm.
Das war Mama, hatte er gesagt. Aber welche Mama hatte er gemeint?
7
Es wurde eine unruhige Nacht. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, konnte ich mich nur an Bruchstücke eines Traumes erinnern, in denen der Junge, der mir gegenüber an meinem Küchentisch saß, Thomas war, plötzlich sechs Jahre alt und mit dem Blick von Janni, ausdruckslos und gerade deshalb vorwurfsvoll.
Ich rief in Haukedalen an und hatte Hans Haavik am Apparat. »Wie geht es denn so?«
»Er ist jedenfalls aufgestanden. Er und Cecilie sitzen beim Frühstück.«
»Und die Mutter … ihr habt nichts von ihr gehört?«
»Keinen Mucks. Möchtest du vielleicht mit Cecilie sprechen?«
»Ja, ganz kurz, das wäre nett.«
Ich wartete, während er sie holte.
»Hallo«, sagte sie.
»Gut geschlafen?«
»Nein, ich konnte nicht einschlafen. Ich hatte so ein Gefühl, dass er dann versuchen würde, wegzulaufen.«
»Aber das hat er nicht?«
»Nein. Er hat geschlafen wie ein Stein. Wirklich. Zwischendurch hatte er ein paar Albtraumphasen, da hat er gewimmert und um sich geschlagen, aber er ist nicht aufgewacht. Nicht einmal, als ich mich auf die Bettkante gesetzt und seine Haare gestreichelt habe.«
»Und jetzt? Hast du ihn dazu bringen können, etwas zu sagen?«
»Nein. Er ist genauso abwesend wie gestern. Wenn sich das nicht bessert, dann ist die Kinderpsychiatrie die nächste Station, fürchte ich.«
»Wir können es doch noch mal bei Marianne versuchen. Ich frage sie, ob sie nicht nach Haukedalen fahren kann. Und dann werde ich mich auf die Suche nach seiner Mutter machen. Um nicht zu sagen, nach seinen Müttern.«
»Hast du das denn schon überprüfen können? Ob es sich um denselben Jungen handelt?«
»Nein, aber es steht ganz oben auf meiner Liste. Es wäre natürlich nützlich zu wissen, ob er selbst weiß, dass er adoptiert ist. Aber das bezweifele ich. Und wenn er ohnehin nichts sagt, dann …«
»Demnach haben wir es doch mit seiner Adoptivmutter zu tun?«
»Allem Anschein nach, ja.«
»Hast du der Polizei erzählt, was er zu dir gesagt hat, Varg?«
»Nein. Noch nicht.«
»Aber … warum nicht?«
»Ich weiß nicht. Die Schweigepflicht, vielleicht.«
»Aber … Ja, ich verstehe. Aber in einem möglichen – Mordfall.«
»Aller Wahrscheinlichkeit nach war es ja wohl doch ein Unfall, oder nicht?«
»Das schon, aber … trotzdem.«
»Ich möchte nur vorher noch einige Erkundigungen einziehen.«
»Du bist einfach so unglaublich wissbegierig, Varg! Das ist doch weit außerhalb unserer … geh lieber zur Polizei, du – und sag ihnen alles. Dafür haben wir sie doch.«
»Ich werd’s mir überlegen.«
»Wenn nicht, tu ich es.«
»Aber gib mir erst noch ein paar Stunden.
»Na gut. Du bist einfach hoffnungslos.«
Ich dankte ihr für ihr Vertrauen, und wir beendeten das Gespräch. Ich versprach, später zurückzurufen. Sie selbst wollte bei Janni bleiben.
Von Telthussmauet fuhr ich auf dem schnellsten Weg nach unten in die Stadt, schräg in Richtung Vetrlidsalmenningen und vorbei an der Fløibahn. Das Wetter war umgeschlagen. Es war schneidend kalt, und Frost lag in der Luft. Die Wolkendecke spannte sich wie ein straffes Trommelfell über das Tal von Bergen, eine einsatzbereite Paradetrommel.