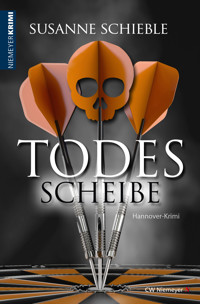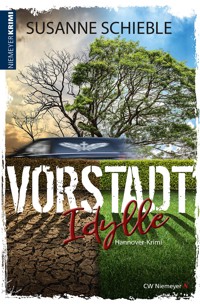9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wo immer Du hingehst, ich sehe Dich! Ein junger Mann wird in der Leinemasch tot aufgefunden. Man hat ihn erstochen. Die eilig herbeigerufene Hauptkommissarin Williamson erkennt in dem Toten sofort einen Bekannten ihrer Kollegin Elena Grifo, den beide einige Monate zuvor zufällig getroffen hatten. Wer nicht am Tatort erscheint, ist Elena Grifo selbst. Sie ist auch nicht zu erreichen. Schwer belastet von den Sorgen um die junge Oberkommissarin nimmt Williamson mit ihrem ungeliebten Kollegen Sascha Cohen die Ermittlungen auf. Was sie dabei zutage fördert, erschüttert sie zutiefst. Anscheinend verband Elena Grifo eine problematische Beziehung mit dem Mordopfer, die sie nun unter Verdacht geraten lässt. Auch Williamsons Ehemann Bernd-Karl spielt eine Rolle in der unheilvollen Verbindung des Toten und der jungen Polizistin. In dem Geflecht von Liebe, Hass, Eifersucht, Besessenheit und Begierde kommt Williamson dem Mörder immer näher und gerät so selbst in tödliche Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Für Barbara, die mich gelehrt hat, wie ein Stern leuchtet.
Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2024 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-9771-9
Susanne SchiebleTodesVisier
Every breath you takeAnd every move you makeEvery bond you breakEvery step you takeI'll be watching you(Bei jedem AtemzugUnd bei jeder Bewegung,Bei jedem gebrochenen Versprechen,Bei jedem Schritt,Ich werde dich beobachten)The Police
Kapitel 1
Kein Zweifel: Der Herbst hatte Einzug gehalten. Quecksilbrige Nebelfäden erhoben sich über den Wiesen in der Ricklinger Masch und verwischten die Konturen der Landschaft, die zu einer gestaltlosen und dadurch mystischen Umgebung verschmolz. Ein Rascheln der Blätter, die sich dem Jahreszyklus nicht entziehen konnten und kurz davor waren, zu Boden zu fallen, ließ den Mann, der sich geschmeidig auf den Pfaden der Masch bewegte, aufhorchen. Ein leichter Wind spielte mit seinem modisch geschnittenen Haar. Er hob den Kopf, als nähme er Witterung auf. Er war bald da, es waren nur noch ein paar Schritte.
Eine fiebrige Erregung hatte ihn erfasst und rann durch seine Adern. „'Cause I got too much life, Running through my veins, Going to waste”, summte er den Song von Robbie Williams vor sich hin und verzog seine Lippen zu einem erneuten Grinsen. Er liebte die Songs der frühen 2000er, insbesondere der britische Sänger hatte es ihm angetan. Nein, heute nicht, Robbie, dachte er. Heute werde ich mein Leben nicht verschwenden. Auch er spürte, wie so viel Leben durch seine Adern rann, zu viel. Er wusste oft nicht, wohin damit. Aber heute Nacht würde das Leben nicht sinnlos durch ihn hindurchrinnen. Heute Nacht würde sich sein Leben erfüllen.
Er war angekommen und füllte seine Lungen mit der klaren, reinen Nachtluft, die merklich abgekühlt war. Seine Aufregung war kaum zu zügeln. Er verkrampfte seine Hände ineinander und spähte in die Dunkelheit. Die Schatten lauerten am Rand seiner Wahrnehmung und spielten ihm einen Streich. Immer wieder glaubte er, eine Gestalt schäle sich aus ihnen und käme auf ihn zu, weil seine Seele dies seit so langer Zeit gewollt hatte und seine Sehnsucht ins Unermessliche gestiegen war.
Plötzlich hörte er ein Knacken, und er breitete voller Hoffnung die Arme aus. Sein Körper zitterte vor Erregung. Endlich, dachte er, endlich bin ich am Ziel. Das ist die Erfüllung all dessen, wovon ich immer geträumt habe.
Ein Gesicht tauchte vor ihm auf. Ein Keuchen entrang sich seiner Kehle. Er stand erstarrt, mit ausgebreiteten Händen, sein Körper versagte ihm den Dienst. Hypnotisiert starrte er es an. Dann kehrte das Leben in ihn zurück, doch er stand wie festgewachsen und konnte sich nicht mehr bewegen. Spitzer Stahl schoss durch die Luft und traf ihn mitten ins Herz.
Die Gestalt vor ihm kniete sich nieder und murmelte einen Abschied. Frei! Sie war endlich frei.
Nie wieder würde verschwendetes Leben durch seine Adern rinnen.
Kapitel 2
Hauptkommissarin Williamson stand am Herd und rührte in einem Erbseneintopf. Ihr Mann Bernd-Karl hatte sich vor ihr aufgebaut und schrie sie an: „Mehr Salz, du musst mehr Salz hinzugeben!“
Hektisch drehte sie an den Herdknöpfen, das Blubbern des Erbseneintopfs dröhnte in ihren Ohren. Und noch etwas anderes, denn der Herd fing, gerade als sie ihn ausgestellt hatte, an zu singen: „Ja, wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat …“
Sie lag auf dem Bauch, das Gesicht tief in ihrem Kissen vergraben. Wie immer war sie in ihren Decken verstrickt, und es dauerte einen Moment, bis sie sich daraus befreit hatte.
„Hmmmmpf“, machte sie, als sie auf die Tasten ihres Handys gehämmert hatte.
„Guten Morgen, Chefin“, tönte die tiefe und zugleich näselnde Stimme ihres ungeliebten Mitarbeiters Cohen aus dem Lautsprecher. „Tut mir leid, Sie zu wecken, aber wir haben einen Toten.“
„Wo?“, brummte sie kurz angebunden und schaute gleichzeitig auf ihren Wecker. Kurz nach fünf. Nicht ihre Zeit.
„In der Ricklinger Masch“, antwortete Cohen.
„Wat is‘ dat?“, fragte Williamson, während sie sich schwerfällig aus dem Bett erhob und nach ihren Hausschuhen tastete.
„Die Ricklinger Masch ist ein Teil der Leinemasch, die wiederum ein großes Augebiet an der Leine ist“, erklärte Cohen. „Ich erkläre Ihnen, wie …“
„Ich finde dat schon, ansonsten melde ich mich noch mal!“, schnaubte die Kommissarin und unterbrach die Verbindung. Sie hatte in Hannover noch alles gefunden, was sie wollte! Na ja, fast alles. Sie hatte mal den Maschsee mit dem Maschteich verwechselt, aber sonst …
Die Hauptkommissarin wandte sich zur anderen Bettseite und zuckte zusammen. Sie war leer. Williamson fuhr sich über die Stirn. Bernd-Karl war nicht da. Warum vergaß sie das nur immer wieder! Er war zusammen mit Nicola, ihrer jüngeren Tochter, zu einer Vogelkundetour an die Ostsee aufgebrochen. Da Herbstferien waren und er das schon immer hatte machen wollen, hatten Williamson und die älteste Tochter Carola Nicola mit sanftem Druck, Versprechungen und Verlockungen dazu gebracht, ihren Vater zu begleiten. Es war nicht einfach gewesen, hatte die Kommissarin ein paar neue Markenturnschuhe, zwei Manga-Kurse und einen Satz neuer Klamotten gekostet, aber letztlich war Nicola mitgefahren.
„Weil ich Papa ja so lieb habe!“, hatte sie gezwinkert und war mit breitem Grinsen in den Familienwagen gestiegen.
Womit die Kommissarin nicht gerechnet hatte, war die Tatsache gewesen, dass sie beide so sehr vermissen würde. Bernd-Karl war ihr Ruhepol, und Nicola mit ihrer sanften, ausgleichenden Art war nicht nur ein Abbild von Bernd-Karl, sondern auch der Puffer zwischen ihr und ihrer temperamentvollen ältesten Tochter Carola, die charakterlich ihr ähnlich war. So waren Mutter und Tochter, seitdem Bernd-Karl und Nicola gen Ostsee aufgebrochen waren, schon mehrfach aneinandergeraten. Zumeist drehte es sich um Carolas Freund Ubbo. Oder hieß er Udo? Ulf? Williamson konnte sich den Namen von Carolas Freund einfach nicht merken. Das war einer der Streitpunkte, ebenso, dass die beiden Verliebten wie zwei Hennen zusammengluckten und einfach nicht die Hände voneinander lassen konnten. Entweder schmusten sie im Haus der Familie Williamson miteinander herum, oder aber sie hielten sich im Haus der Eltern von Olaf – hieß er nicht so? – auf. Jedenfalls gab es Carola im Moment nur im Doppelpack mit ihrem Freund, und das gefiel ihrer Mutter ganz und gar nicht.
All diese familiären Verwicklungen schossen Williamson durch den Kopf, als sie sich in ihre Klamotten schmiss. Wie immer trug sie ein unförmiges Kostüm, darunter einen Rollkragenpullover, kombiniert mit einer blickdichten Strumpfhose und flachen Halbschuhen. Im Bad spritzte sie sich Wasser ins Gesicht, fuhr sich durch ihr Strubbelhaar und schaute skeptisch ihr Konterfei an.
„Ich kenn‘ dich zwar nit, aber ich wasch‘ dich trotzdem“, sagte sie zu sich selbst und streckte ihrem Spiegelbild die Zunge heraus.
Mit ihren Haaren war wie immer nicht viel los. Es stand vor dem Kämmen ab und auch danach.
Sie war überrascht über sich selbst, dass sie zu so früher Stunde schon über Familienprobleme nachdenken konnte. Wahrscheinlich lag das daran, dass Bernd-Karl, der nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr bester Freund und Gesprächspartner war, nicht da war. Im Moment musste sie diese Dinge mit sich selbst ausmachen. Darin war sie nicht besonders gut, weil sie dazu neigte, sich in ihren Gedankengängen zu verstricken. Insbesondere, was private Dinge betraf.
Aber sie hatte ja noch ihre Marianne. Ihrem Ford Fiesta konnte sie alles berichten. Meistens war es ein Vorteil, dass Marianne nicht antworten konnte – sie war ja ein Auto. Manchmal war es aber auch ein Nachteil, denn Williamson vermisste den Austausch, das Beleuchten von einer anderen Seite, den Wechsel der Perspektive, um neue Aspekte hervorzubringen – und sie damit auch ein Stück weit zu erden. Genau das konnte Bernd-Karl perfekt. Die Eheleute waren sehr selten getrennt, und auch jetzt war es nur eine Woche, aber Williamson wurde klarer als je zuvor, dass sie zwei Seiten derselben Medaille waren.
Umso tröstlicher war es, ihre Marianne zu haben. Mit einem kleinen Seufzer ließ sie sich in den Sitz ihres Autos plumpsen und schauderte. So früh am Morgen war es Mitte Oktober ganz schön kalt.
„So, Mariannchen, et geht wieder los!“, freute sie sich und startete den Wagen. Natürlich verabscheute sie es, wenn ein Mensch starb, und das, wenn sie und ihre Leute gerufen wurden, meist auf gewaltsame Weise. Dennoch spürte sie, wie sie von einem spannungsgeladenen Kribbeln erfasst wurde. Hauptkommissarin Williamson war gut in ihrem Job, sehr gut sogar. Nicht nur sie wusste, dass sie am richtigen Platz war, auch den Kollegen im Zentralen Kriminaldienst der Landeshauptstadt Hannover war klar, dass die rheinische Urgewalt der Motor des gesamten Kommissariats war. Sehr zum Missfallen ihres Kollegen Hauptkommissar Balustreit. Ihr Team und sie hatten, seitdem die Kommissarin aus Köln nach Hannover gekommen war, schon zwei komplizierte Mordfälle gelöst. Das war nicht ohne emotionale Verwerfungen vonstattengegangen, hatte sie und ihr Team aber auch zusammenwachsen lassen. Na ja, zumindest Elena Grifo und sie. Cohen war eine andere Sache …
Williamson lächelte, als sie an ihre Oberkommissarin dachte. Elena Grifo, von ihrer Vorgesetzten in Gedanken und manchmal nicht nur in Gedanken, in Anlehnung an die Kinderbuchreihe des haarigen Monsters „Grüffelo“ genannt, war ihre Lieblingskollegin. Ein Monster war Elena Grifo allerdings ganz und gar nicht, oh nein. Sie ließ die Herzen der Menschen, die in Kontakt mit ihr standen, höher schlagen, denn sie war nicht nur außerordentlich attraktiv, sondern mit einer hohen Intelligenz gesegnet, die sich in schneller Auffassungsgabe und einer Wahrnehmung auch der kleinsten Gefühlsregungen bei allen Menschen, denen sie begegnete, ausdrückte. Ihre größte Stärke aber war ihre Feinfühligkeit, sodass sie es schaffte, auch noch die unzulänglichsten Gesprächspartner „zu knacken“. Grifo war es auch, die Williamson zu Beginn ihrer Zusammenarbeit unverzichtbare Tipps im Umgang mit der Mentalität der Hannoveranerinnen und Hannoveraner gegeben hatte. Ohne Elena Grifo wäre Williamson in ihrer neuen Heimat kläglich gescheitert. Auch wenn sie nie darüber gesprochen hatten – sie wussten es beide.
Die Kommissarin war so in Gedanken versunken, dass sie sich hoffnungslos verfahren hatte, weil sie es versäumt hatte, das Navi von Marianne einzustellen. Sie kämpfte immer mit dem Ding, wie sie grundsätzlich mit allen technischen Sachen kämpfte, mit denen sie konfrontiert wurde und die das Leben erleichtern sollten. Ihr Leben wurde nicht erleichtert, überhaupt nicht! Aber wat soll et? Sie konnte sich ja schlecht in die Zeit der Höhlenmenschen zurückwünschen. Hatte es da schon Mordfälle gegeben? Bestimmt! Aber noch keine Kommissare, die sie gelöst hatten.
Williamson seufzte und hielt am Straßenrand gegenüber der wuchtigen Fußballarena unweit des Maschsees an. Sie musste feststellen, dass ihre Gedankengänge nicht nur wieder einmal davongaloppiert waren, sondern dass sie im Kreis gefahren war. Hier war sie vor zehn Minuten schon einmal gewesen.
„Verdamp!“, fluchte sie und wählte die Handynummer von Grifo. Diese würde ihre Chefin bis zur Ricklinger Masch und zum Fundort lotsen, ohne dass es die Kollegen mitbekommen würden, vor allem Cohen nicht. Insbesondere Cohen nicht!
Die Mailbox von Grifos Handy sprang sofort an. Wahrscheinlich war sie schon vor Ort und beschäftigt. Dennoch runzelte Williamson ungehalten die Stirn. Normalerweise war Grifo immer erreichbar, nicht nur, wenn sie wusste, dass die Hauptkommissarin zu einem Einsatz unterwegs war und nicht genau wusste, wo er war. Auch sonst.
„Also jut, Marianne, da müssen wir jetz‘ alleine durch!“, murmelte die Kommissarin, setzte den Blinker und fuhr wieder auf die Straße. Cohen würde sie nicht nach dem Weg fragen, oh nein! Das bekam sie schon noch alleine hin, irgendwie. Und irgendwann.
Williamson blickte angestrengt abwechselnd auf das Navi und die Straße. Sie bog in die Stammestraße ab und brauste sie geradeaus durch, um dann nach links in die Düsternstraße einzufahren.
Ein erstes meerfarbenes Blau, das die Dämmerung ankündigte, zog in Schlieren am Horizont herauf und tauchte die Umgebung in ein silbernes Licht, als Williamson endlich vor sich die blinkenden Einsatzwagen erkannte. Mit einem erleichterten Seufzer stellte sie ihre Marianne hinter den letzten Wagen in der Reihe ab, tätschelte kurz das Lenkrad und grinste in sich hinein. Sie hatte den Ort gefunden! Es hatte ein wenig länger gedauert, aber sie hatte ihn gefunden! Ohne Grifo und ohne Cohen. Sie konnte stolz auf sich sein, und das war sie auch. Ging doch!
Schwungvoll stemmte sie sich aus ihrer Marianne und marschierte hinter das Auto zum Kofferraum. Aus diesem zog sie ein Paar Gummistiefel hervor. Es ging „in die Botanik“, wie sie zu sagen pflegte, was ihr als Stadtkind gar nicht behagte. Da war man besser vorbereitet.
Sie streifte ihre Halbschuhe ab und schlüpfte in ihre Gummistiefel, besser: Sie versuchte hineinzuschlüpfen. Mit einiger Mühe gelang es ihr unter Brummen und Fluchen. Waren die Stiefel immer schon so klein gewesen?
„Fertig“, murrte sie und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Hatte sie es vorhin nicht noch als frisch empfunden? Gerade als sie sich aufrichten wollte, traten ein paar Füße mit wohlgeformten Beinen, die in dunklen Hosen steckten, in ihr Sichtfeld. Williamson wollte schon: „Ach nee, an dat Handy gehen Sie nit, aber hier stehen Sie rum!“, entschlüpfen, weil sie sicher war, dass es sich um Elena Grifo handelte.
„Morgen, Chefin, Herr Cohen meinte, ich soll hier auf Sie warten und Sie zum Fundort bringen, weil Sie es nicht direkt … also, jedenfalls: Hier bin ich!“, schallte eine ebenso energische wie weibliche, aber nicht Grifo zuzuordnende Stimme an ihr Ohr.
Die Hauptkommissarin zuckte zusammen und richtete sich langsam auf. Blitzende blaue Augen, rosige Wangen und ein weizenblonder Pferdeschwanz, die allesamt zu der jungen Polizistin gehörten, deren Namen Williamson immer wieder vergaß, waren vor ihr wie aus dem Nichts aufgetaucht.
„Äh … danke, Frau … Dings, ja, dat is‘ jut. Dann sparen wir Zeit“, antwortete sie und trippelte auf ihren kurzen Beinen hinter der jungen Beamtin her, die forschen Schrittes voranlief. Die Kommissarin hatte Mühe, an ihr dranzubleiben, und geriet nach kürzester Zeit außer Atem.
Die hat ein Tempo, dachte sie und konzentrierte sich auf den wippenden Pferdeschwanz vor ihr, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Die junge Polizistin führte Williamson durch das Fluttor an der Düsternstraße direkt zum Fundort der Leiche, der nicht zu übersehen war. Ein Menschenkreis stand auf einer kleinen betonierten Fläche, an der sich mehrere Wege kreuzten, umgeben von Bäumen, deren Blätter im auffrischenden Wind rauschten.
Ein friedlicher Ort, dachte die Kommissarin – und dazu noch wunderschön. Als sie sich näherte, blickte Cohen auf. Die anderen Personen aus der Runde drehten sich langsam um.
„Morgen, Chefin, da sind Sie ja“, tönte der Oberkommissar.
Sofort stellte Williamson die Stacheln auf.
„Wie, wat? Haben Sie mich so vermisst?“, schoss sie zurück, sodass Sascha Cohen den Kopf einzog und sich mit einem großen Taschentuch über die Stirn wischte, die trotz der morgendlichen Kühle schweißnass war. Da er Sascha Cohen hieß, wurde er im Kommissariat nur „der Baron“ genannt nach dem Schauspieler Sacha Baron Cohen. Die Ähnlichkeit hörte allerdings beim Namen auf.
Williamson vertraute ihrem Mitarbeiter immer noch nicht ganz. Bei ihrem letzten gemeinsamen Fall hatte es einige Ungereimtheiten gegeben, an denen Cohen vermutlich nicht ganz unschuldig war. Die Hauptkommissarin hatte nie herausgefunden, ob und wie stark er darin verwickelt gewesen war. Zudem steckte er nur zu gern mit ihrem größten Feind im Kommissariat, Hauptkommissar Balustreit, die Köpfe zusammen. Es hatte sich über die Monate, in denen sie im Zentralen Kriminaldienst in der Waterloostraße tätig war, etabliert, dass Williamson eng mit Grifo zusammenarbeitete, während Cohen hauptsächlich die Recherchearbeit übernahm, was er zugegebenermaßen sehr gut machte. Und solange sie das Gefühl hatte, ihrem Mitarbeiter nicht zu einhundert Prozent vertrauen zu können, würde das auch so bleiben.
Die Hauptkommissarin holte tief Luft, schob zwei junge uniformierte Kollegen zur Seite und nickte Cohen kurz zu.
„Na schön, dann wollen wir mal, nütz‘ ja nix. Wat haben wir?“
Schnell streifte sie sich Handschuhe über, die sie in großer Stückzahl immer in ihrer Manteltasche mit sich führte.
„Ein junger Mann liegt hier, alle viere von sich gestreckt …“
„Dat sehe ich!“, schnauzte Williamson und besah sich die männliche Leiche genauer. Cohen redete weiter, aber sie hörte seine Worte nur noch aus weiter Ferne. Das attraktive Gesicht, auf dem sich ein Ausdruck des Erstaunens breitgemacht hatte, kam ihr vage bekannt vor.
„… sein Name ist Erik Schneider, sechsundzwanzig Jahre alt, Informatikstudent“, schloss Cohen schließlich und hielt ihr eine modern aussehende Geldbörse entgegen. Mechanisch nahm sie sie in die Hand, sah aber weiterhin auf den leblosen Körper.
„Erik Schneider“, wiederholte sie, sah dann auf die Geldbörse in ihrer Hand und runzelte die Stirn. Sie klappte sie auf und besah sich den Personalausweis, der unberührt darin steckte, genauer. Dann blickte sie wieder auf die Leiche.
„Ja“, bestätigte Cohen und runzelte nun seinerseits die Stirn. „Was ist los, Chefin?“ Nicht nur Grifo, sondern auch der Oberkommissar kannte die Reaktionen seiner Vorgesetzten inzwischen. Diese hier passte nicht in das gewohnte Schema.
Erik Schneider. Auch der Name kam ihr vage bekannt vor.
Langsam beugte sich die Kommissarin über die Leiche, so tief, dass ihr Kopf mit dem eines blonden jungen Mannes zusammenstieß, der sich ebenfalls über den Toten gebeugt hatte.
„Au!“, riefen beide gleichzeitig aus und rieben sich unisono die Stirn.
„Mensch, Michel!“, motzte Williamson. „Wat soll denn dat?“
Der blonde Schlaks richtete seinen langen Körper auf und bekam ein schiefes Lächeln zustande.
„Frau Kommissarin, also wirklich! Sie wissen doch, dass sich ein Rechtsmediziner hier zu schaffen machen muss!“
Es handelte sich um Dr. Sven Michellsen, leitender Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover, von Williamson nur liebevoll „Michel“ genannt. Die beiden verband eine enge Beziehung, die von großer Sympathie und Vertrauen geprägt war. Ihr Geplänkel gehörte zu ihrer Freundschaft dazu.
„Wenn et sein muss!“, brummte Williamson und beugte sich wieder über die Leiche. Der Wind spielte mit dem dunkelbraunen, gut geschnittenen Haar des Toten. Auf seiner modischen Steppjacke war nur wenig Blut zu sehen. Interessant.
„Wat kannst du mir sagen?“
„Ein Stich ins Herz“, antwortete der Rechtsmediziner schlicht. „Präzise ausgeführt. Es muss sich um einen scharfen und sehr spitzen Gegenstand gehandelt haben. Genaueres kann ich erst …“
„… nach der Obduktion sagen“, ergänzte die kleine Polizistin und grinste. „Na klar. Todeszeitpunkt?“
„Ach Mensch, Frau Kommissarin, auch hier gilt: Genaueres erst nach der Obduktion. Wenn Sie mich aber nach dem ungefähren Zeitpunkt fragen, den ich vage eingrenzen kann …“
„Dat reicht mir erst mal vollkommen!“, fuhr sie dazwischen.
Michel grinste.
„Gut, also dann würde ich sagen: irgendwann zwischen ein und vier Uhr nachts.“
„Na, geht doch. Danke, Michel!“
Sie legte eine Hand auf den Unterarm des Rechtsmediziners und richtete sich auf.
„Frau Grifo, mir kommt der Name irgendwie bekannt vor. Sind wir dem Mann schon mal begegnet? Et kommt mir jedenfalls so vor.“
Sie hatte mit dem Blick auf die Leiche gesprochen, ohne sich umzudrehen. Die nachfolgende Stille bekam sie erst gar nicht mit, so sehr war sie in den Anblick des Toten vertieft. Sie kramte in ihrem Gedächtnis, wo und in welchem Zusammenhang sie ihn schon einmal gesehen hatte. Erst als auch nach einer ganzen Weile niemand antwortete, drehte sie sich langsam um. Alle starrten sie an.
„Frau Grifo? Wo sind Sie, Herrjott noch mal?!“
Immer noch antwortete – niemand. Betreten schauten die Kollegen zur Seite, bis sich Cohen schließlich räusperte.
„Ähem, Chefin, also, ähm, Frau Grifo ist nicht hier.“
„Nit hier?“, echote Williamson verständnislos. „Wat soll dat heißen: nit hier?“
Sie drehte sich um die eigene Achse, als ob ihre Kollegin allein dadurch plötzlich aus dem Boden schießen und vor ihr stehen würde.
„Sie ist nicht gekommen. Wir konnten sie auch nicht erreichen, ihr Handy scheint ausgeschaltet zu sein.“
„Dat kann nit sein“, kam es sofort von der Kommissarin. „Sie is‘ bestimmt auf dem Weg oder so. Versuchen Sie et noch mal. Frau Grifo is‘ immer da, wenn man sie braucht, oder nit? Immer!“
In dem Moment, als sie diese Worte ausstieß, machte sich eine Unruhe in ihr breit, wie sie sie noch nie gefühlt hatte. Es war nicht nur das bekannte Kribbeln unterm Zwerchfell, das sie so oft heimsuchte, wenn sie Ungereimtheiten witterte, es war noch etwas anderes: ein Gefühl der Furcht, das ihr Rückgrat hochkroch und sich im ganzen Körper breitmachte.
Wenn Grifo nicht an einem Leichenfundort erschien und zudem nicht erreichbar war, dann stimmte etwas nicht. Ganz und gar nicht. Williamson fiel ein, dass sie vom Auto aus versucht hatte, die Oberkommissarin zu erreichen, aber auch kein Glück gehabt hatte. Das unbehagliche Gefühl der Angst verstärkte sich.
Die Hauptkommissarin holte tief Luft. Es nützte ja nichts. Sie mussten weitermachen. Ihr Blick fiel wieder auf das Gesicht des Toten, und plötzlich wusste sie, warum ihr der junge Mann bekannt vorgekommen war. Sie war ihm schon einmal begegnet.
Es war während ihres ersten Falls in Hannover gewesen, am Anfang des Jahres. Das war jetzt ungefähr –Williamson rechnete kurz nach – zehn Monate her. War sie wirklich schon so lange mit ihrer Familie in Hannover? Und arbeitete fast ebenso lange mit Grifo und Cohen zusammen? Einerseits kam es ihr viel kürzer vor, weil sie einige schwierige Fälle in Atem gehalten hatten. Andererseits aber auch viel länger, weil sie inzwischen so vertraut mit ihren Mitarbeitern und dem Zentralen Kriminaldienst, kurz ZKD, war. Ob es die verdampte Kaffeemaschine war, mit der sie notorisch auf Kriegsfuß stand, der Geruch nach Putzmitteln in den Gängen, die beständigen Auseinandersetzungen mit ihrem Vorgesetzten, Kriminalrat Dr. Rico Habernickel, oder, noch schlimmer, mit Balustreit – all das gehörte inzwischen so selbstverständlich zu ihrem Alltag, dass sie immer seltener an ihre alte Heimat Köln mit ihrem alten Arbeitsplatz, dem so geliebten Präsidium, dachte. Inzwischen hatte sie den ZKD, das Kommissariat und ihre Kollegen … lieb gewonnen. Der Gedanke rann durch ihren Kopf, bevor sie ihn aufhalten konnte.
Bei ihrer ersten Ermittlung war sie davon noch weit entfernt gewesen. Alles an Hannover, seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, ihren Kolleginnen und Kollegen, dem Wetter, dem Essen und … ach, einfach alles, hatte sie blöd gefunden und abgelehnt. Bis auf Elena Grifo, die ihr von Anfang an sympathisch gewesen war. Dann hatte die junge Oberkommissarin sie mitgenommen in ein wunderbares Schlaraffenland namens Belg… Holländische Kakao-Stube, verbesserte sich Williamson in Gedanken. Dieses traditionsreiche Café hatte alles, was ihr Herz begehrte und was sie ab und zu brauchte, insbesondere, wenn es anstrengende Ermittlungen erforderten, dass ihre Synapsen auf Hochtouren liefen: großartige Kuchen und Torten, die Williamsons Stimmung schlagartig hoben. Nach einem belastenden Besuch bei der Familie ihres ersten Mordopfers in Hannover hatte Elena Grifo sie geradewegs in die Kakao-Stube geführt, und dort, ja, genau dort, so erinnerte sich die Hauptkommissarin jetzt, waren sie Erik Schneider begegnet.
Kapitel 3
Elena Grifo war die Begegnung nicht angenehm gewesen, erinnerte sich die Hauptkommissarin. Sie war ihr sogar außerordentlich unangenehm gewesen. Es hatte eine Weile gebraucht, bis die Oberkommissarin ihre Haltung wiedergewonnen hatte. Williamson hatte das nur am ganz feinen Mienenspiel der jungen Frau feststellen können, aber sie hatte ihre Mitarbeiterin schon so gut einschätzen können. Wenn sie wollte, konnte sie mehr Feingefühl aufbringen als gedacht, außerordentlich mehr Feingefühl sogar.
Erik Schneider war von hinten an Grifo herangetreten und hatte ihr die Augen zugehalten. Während der anschließenden, an sich belanglosen Unterhaltung war Williamson das Gefühl nicht losgeworden, dass ihre Kollegin angespannt und zudem sehr vorsichtig war, was sie sagte und was nicht.
Danach waren die beiden Polizistinnen ins Kommissariat zurückgefahren, und währenddessen hatte sich Williamson gefragt, was wohl zwischen Grifo und Erik Schneider stand, das ihrer Kollegin so ein Unbehagen bereitete. Aber dann hatte sie der Fall so sehr in Beschlag genommen, dass sie die Begegnung wieder vergessen hatte. Seitdem hatte sie nie mehr daran gedacht.
Bis heute. Bis zu diesem nebligen Oktobermorgen, an dem sie vor der Leiche eines jungen Mannes stand, der vor zehn Monaten ihre junge Kollegin angestrahlt und Williamson selbst kurz die Hand geschüttelt hatte.
„Frau Kollegin!“
Die Kommissarin erwachte aus ihrer Starre. Die Stimme neben ihr war etwas schärfer als gewöhnlich. Ihr wurde bewusst, dass Alina Walter, die Leiterin der Kriminaltechnik, sie wohl schon mehrere Male angesprochen haben musste, ohne dass sie reagiert hatte. Sie war so sehr in ihre Erinnerungen vertieft gewesen, dass sie um sich herum nichts mehr wahrgenommen hatte.
Energisch hielt ihr Alina Walter einen Asservatenbeutel hin. Mechanisch ließ Williamson die Geldbörse, die sie immer noch in der Hand hielt, hineinfallen. Dann starrte sie Alina Walter an, von ihr wanderte ihr Blick zu Cohen.
„Ich kenne den Mann“, stieß sie hervor und wedelte mit ihrer Hand in Richtung des Toten. „Ich bin ihm begegnet, damals, mit Grifo.“
Cohen, Walter und Michel starrten sie überrascht an. Schnell berichtete sie von der damaligen Begegnung in der Holländische Kakao-Stube. Ihre drei Kollegen hörten wortlos zu. Schließlich schüttelte Cohen ungläubig den Kopf.
„Meinen Sie, das hat etwas zu bedeuten, Chefin? Das kann doch ganz harmlos sein!“
„Herrjott, et kann wat bedeuten oder auch nit, ich weiß et nit!“, platzte Williamson der Kragen. „In jedem Falle war et eine komische Begegnung! Frau Grifo war dat nit angenehm!“
„Und sie ist nicht hier“, kam es leise von Michel, während er seine Mitarbeiter heran winkte, die die Leiche abtransportieren und in die Rechtsmedizin bringen sollten. „Und erreichbar ist sie auch nicht.“
Sein Blick begegnete dem von Williamson, in dem sich ihre eigenen Sorgen spiegelten. Irgendetwas stimmte nicht, das spürte die Hauptkommissarin in ihren Knochen und vor allem in ihrem Zwerchfell. Michel mochte die junge Oberkommissarin, sehr sogar, das wusste sie. Kein Wunder, dass er sich Sorgen machte. Elena Grifo blieb nicht ohne Grund von einem Fundort fern. Und dann kannte sie auch noch den Toten!
Alina Walter, die sich erneut über die Leiche gebeugt hatte, erhob sich wieder. Sie hielt ein Handy in der Hand, das sie nun anstarrte, dann den Asservatenbeutel in ihrer anderen Hand.
„Halten Sie mal!“, forderte sie Cohen auf und drückte ihm das Handy in die Hand, die genau wie die seiner Kollegen in dünnen Handschuhen steckte.
Dann öffnete sie den Asservatenbeutel, holte den Geldbeutel hervor, klappte ihn auf und besah sich den Personalausweis genauer.
„Die meisten Leute sind nicht sehr einfallsreich“, murmelte sie, nahm das Handy wieder an sich und gab das Geburtsdatum als Code zur Entriegelung auf das Touchpad des Mobiltelefons ein.
„Drin“, verkündete sie eine Sekunde später und lächelte. „Klappt meistens!“
„Sie sind ein Genie, Frau Walter“, lobte Williamson und haute der zierlichen Frau auf die Schulter, dass diese zusammenzuckte.
„Für einen Informatikstudenten nicht sehr einfallsreich“, kommentierte Cohen trocken.
„Aber für uns von Vorteil“, gab seine Vorgesetzte zurück und wandte sich dann an Alina Walter. „Un‘, wat haben wir?“
Der Gesichtsausdruck der Kriminaltechnikerin hatte sich schlagartig verändert. Sie war blass geworden und runzelte die Stirn.
„Das … das müssen Sie sich ansehen, Chefin“, stammelte die sonst so beherrschte, nüchtern denkende Frau.
„Wat is‘ los, Frau Walter? Sie sehen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen!“
Energisch nahm Williamson ihrer Kollegin das Mobilgerät aus den Händen.
„Wat haben Sie denn gef…“
Die Hauptkommissarin verstummte. Ihre Hand, die das Handy hielt, fing an zu zittern. Jetzt drängten sich auch Cohen und Michel um ihre Kolleginnen.
„Was ist denn?“, schnaufte der Baron. „Ich kann gar nichts erkennen!“
„Elena“, stand da in der Anrufliste, die Alina Walter aufgerufen hatte. Und das nicht nur einmal.
Elena.
Elena.
Elena.
Wohl Dutzende Male hatte der junge Mann den Kontakt mit Namen „Elena“ angerufen. Der Name war meistens rot geschrieben, das hieß, „Elena“ hatte nicht abgenommen. Zitternd drückte Williamson auf „Kontakte“ und scrollte bis zum Namen „Elena“. Schwarz und geradezu anklagend stach ihr die Mobilnummer entgegen. Nach zehnmonatiger Zusammenarbeit kannte selbst sie die private Handynummer ihrer Mitarbeiterin.
„Das ist ihre Nummer“, sagte Alina Walter leise.
Williamson konnte nicht antworten. Ihre Beunruhigung machte einem Anflug von Panik Platz. Wo war ihre Grifo da nur hineingeraten?
Alina Walter nahm der Hauptkommissarin das Handy aus den zitternden Händen, atmete tief durch und scrollte durch die Anrufliste.
„Sie hat nur selten die Anrufe entgegengenommen“, murmelte sie und schaute auf. „Der letzte Anruf von Erik Schneider an Grifo war um zwei Uhr fünfzehn heute Morgen.“
Alle Köpfe fuhren in Richtung des Leichensacks, der gerade in einen Leichenwagen geschoben wurde. Der Körper des jungen Mannes darunter zeichnete sich nur schemenhaft ab.
„Hat sie ihn angenommen?“, fragte Williamson. Ihre eigene Stimme kam ihr fremd vor, zittrig und viel dünner als sonst, worüber sie sich ärgerte.
Die Kriminaltechnikerin blickte auf und sah sie mit weit aufgerissenen Augen an.
„Ja“, antwortete sie schließlich leise, ließ dann das Handy in einen weiteren Asservatenbeutel gleiten und gab diesen einem ihrer Mitarbeiter. Dann straffte sie sich, ging entschlossenen Schrittes auf die Hauptkommissarin zu und nahm sie kurzerhand in die Arme.
„Es wird sich alles aufklären!“, erklärte sie mit fester Stimme und drückte Williamson an sich. Diese dachte absurderweise daran, was für ein kurioses Bild die beiden Frauen abgeben mussten: Die korpulente Hauptkommissarin lag in den Armen der zierlichen Kriminaltechnikerin.
„Jaja, danke, Frau Walter schon jut, schon jut, et geht schon wieder“, schnaufte Williamson und lächelte leicht.
„Es sah so aus, als ob Sie das jetzt gebraucht hätten“, sagte Alina Walter und lächelte ebenfalls.
Die ältere Polizistin nickte.
„Ja, dat stimmt, aber wir müssen weitermachen, nütz‘ ja nix. Wenn wir Elena helfen wollen, mit aller Kraft, die wir zur Verfügung haben, dann müssen wir uns ranhalten.“
Sie befreite sich aus der Umarmung von Alina Walter und straffte sich.
„Haben Sie noch wat bei dem Toten gefunden?“
Die Kriminaltechnikerin sah zu der Leiche des jungen Mannes.
„Ja, einen Schlüsselbund. Ich dachte, den erwähne ich Ihnen gegenüber lieber mal nicht.“
Die beiden Frauen grinsten sich an. Ein bisschen Humor tat in der angespannten Situation so gut! In ihrem letzten Fall hatte eine Reihe von Schlüsseln eine entscheidende Rolle gespielt, sodass die Kommissarin ein Schlüssel-Trauma davongetragen hatte.
„Hören Sie mir damit auf, Frau Walter!“, wehrte sie dementsprechend ab, ein leichtes Lächeln in den Mundwinkeln. „Davon habe ich ein für alle Mal die Nase voll!“
Dann blickte sie in die Runde. Alle starrten sie an. Ihr war klar, dass ihre nächsten Worte sitzen mussten, wollte sie das Vertrauen der Kollegen in die Oberkommissarin nicht erschüttern.
Williamson räusperte sich.
„Wir haben hier ein paar Ungereimtheiten, dat is‘ klar. Und dat beschönige ich auch nit, zumal unsere Kollegin Elena Grifo nit hier is‘. Aber eins is‘ auch klar: Sie alle kennen Frau Grifo seit Jahren. Sie is‘ die korrekteste und loyalste Mitarbeiterin, die et gibt. Dat wissen Sie, und dat weiß ich. Et wird eine Erklärung für alles geben, davon bin ich überzeugt. Un‘ Sie …“, die Hauptkommissarin fuhr ihren molligen Zeigefinger aus und stach damit in die Runde, „… wissen dat auch, dat dat klar is‘. Wir werden jetz‘ alle gemeinsam dat Verbrechen an dem jungen Mann aufklären un‘ damit gleichzeitig beweisen, dat Frau Grifo nix, aber auch gar nix damit zu tun hat. Is‘ dat klar!?“ Es war mehr ein Befehl als eine Frage.
Zögernd nickten die Beamten in der Runde. Gegen die rheinische Urgewalt hätte sich ohnehin niemand aufzulehnen gewagt, und schon gar nicht in dieser heiklen und emotional aufgeladenen Situation.
Williamson drehte sich um die eigene Achse.
„Jut!“, stieß sie zufrieden aus. Sie hatte ihre Selbstsicherheit wiedergefunden. Und ihre Zuversicht, zumindest für den Moment.
„Cohen!“, bellte sie. Eilig kam ihr zweiter Mitarbeiter herangewatschelt. Williamson senkte die Stimme.
„Versuchen Sie noch mal, Frau Grifo zu erreichen.“
Niedergeschlagen wackelte der Baron mit dem Kopf, dass seine Hängebacken flogen. Zum ersten Mal fiel der Hauptkommissarin auf, dass er wie ein trauriger Bassett aussah.
„Hab ich gerade gemacht, während Sie und Frau Walter … na ja, jedenfalls ist sie nicht erreichbar. Es springt sofort die Mailbox an. Und bei ihr zu Hause hebt auch niemand ab.“
Williamsons Zuversicht fing an zu bröckeln, aber das wollte sie sich nicht anmerken lassen. Sie zog die Schultern hoch.
„Jut. Daran können wir im Moment nix ändern. Wer sind die nächsten Angehörigen von dem Erik Schneider?“
Cohen schaute auf seine Notizen. Schon mehrfach war Williamson aufgefallen, dass sie akkurat geführt waren, so auch dieses Mal, was sie aus irgendeinem Grund immer wieder aufs Neue erstaunte.
„Das ist seine Mutter, Ruth Schneider. Sie wohnt in Döhren.“
„Döhren – is‘ dat auch in Hannover?“
Williamson kannte auch nach zehn Monaten in der Landeshauptstadt noch nicht alle Stadtteile.
Cohen sah sie mit seinen riesigen, blauen Augen, die sie immer an einen Karpfen denken ließen, ausdruckslos an.
„Ja“, brummte er schließlich, „liegt ziemlich im Süden der Stadt.“
„Macht ja nix“, versuchte seine Vorgesetzte die Situation ein wenig zu entspannen, was gründlich misslang. Niemand lachte.
„Na jut, da fahren wir als Erstes hin, wir müssen die Mutter informieren, nütz‘ ja nix.“
Normalerweise überbrachte die Hauptkommissarin solche Nachrichten immer mit Grifo, die aufgrund ihrer Einfühlsamkeit die perfekte Partnerin für so heikle Aufgaben war. Sie wusste immer das Richtige im passenden Moment zu sagen, ganz im Gegensatz zu Williamson – oder zu Cohen, der die Empathie eines Nashorns hatte.
Aber vielleicht sind Nashörner sehr empatische Tiere, sinnierte Williamson auf dem Weg zum Auto. Dann straffte sie sich und rief sich selbst zur Räson. Immer wenn sie überreizt war, neigte sie dazu, sich mit völlig sinnlosen Gedanken zu beschäftigen, die dann schon mal schnell davongaloppierten. Das durfte ihr nicht passieren, bei diesem Fall schon mal überhaupt nicht. Sie machte sich große Sorgen um ihre junge Kollegin, die ihr so ans Herz gewachsen war, verdamp große Sorgen.
Kapitel 4
Während der Fahrt schwiegen Williamson und Cohen und hingen ihren Gedanken nach. Im Bauch der Hauptkommissarin kribbelte es wie verrückt, ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, wobei dafür kein Bauchkribbeln nötig gewesen wäre, um das zu erkennen. Schließlich war ein Bekannter von Williamsons engster Mitarbeiterin tot, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, die Kommissarin selbst war verschwunden und nicht erreichbar. Ganz offensichtlich hatten das Opfer und besagte Polizistin miteinander in Kontakt gestanden, und das unmittelbar vor dem Tod des Mannes. Das war selbst für die gestandene Hauptkommissarin ein bisschen viel für den frühen Morgen.
In diesen starrte sie jetzt. Williamson hatte den rechten Arm aufgestützt, ihr Kinn darauf gelegt und sah in den trüben, immer noch nebligen hannoverschen Morgen hinaus, ohne etwas zu sehen. Das Bauchkribbeln hatte sich in eine leichte Übelkeit verwandelt. Lag das nun daran, dass sie noch nichts gefrühstückt hatte, oder an der vertrackten Situation, in der sie sich befanden, vor allem Grifo? Williamson wusste es nicht.
„Wat wissen wir von der Frau?“, fragte sie Cohen, der sie schweigend durch den erwachenden hannoverschen Verkehr kutschierte. Dann und wann entfuhr ihm ein Schnaufen, wenn er scharf bremsen oder vor einer Ampel halten musste. Williamson ging es auf die Nerven, ebenso sein Fahrstil. Diesen als rumpelig zu bezeichnen, war die Untertreibung des Jahres. Der Baron fuhr unsicher, sehr schnell, um gleich darauf scharf zu bremsen und dann mit einem harten Ruck wieder anzufahren, sodass die Hauptkommissarin abwechselnd in ihren Sitz gepresst oder nach vorne geschleudert wurde und nur der Sicherheitsgurt sie daran hinderte, mit dem Kopf gegen das Armaturenbrett zu schlagen. Der Gurt schnitt sich dann tief in ihren Oberkörper, was wiederum ihr einen Schnaufer entlockte. Kein Wunder, dass Cohens Privatwagen, ein alter Audi, so aussah wie er aussah: ziemlich zerbeult. Wenn das so weiterging, sah der Dienstwagen bald nicht besser aus.
Mehr denn je sehnte sich Williamson ihre Kollegin herbei, die sie sanft und sicher durch den Stadtverkehr schaukelte. Dabei besprachen sie oft ihre Fälle. Diese Reflexionen halfen beiden, ihre Gedanken zu sortieren und klarer zu sehen.
Williamson seufzte innerlich. Sie wollte nicht ständig Vergleiche zwischen ihren beiden Oberkommissaren anstellen, jetzt schon gar nicht. Sie wusste, dass sie auf Cohens Mitarbeit angewiesen war. Es nutzte gar nichts, wenn er blockierte, weil sie ihre Abneigung gegen ihn offen zur Schau stellte. Also schluckte sie ihr Unbehagen hinunter und wiederholte die Frage, die er noch nicht beantwortet hatte; er war zu sehr damit beschäftigt gewesen, eine junge Autofahrerin vor ihnen zu beschimpfen, weil sie nicht sofort angefahren war, als die Ampel auf Grün sprang.
„Entschuldigung, Chefin, was haben Sie gesagt?“, grunzte Cohen, während er das Gaspedal durchtrat und einen Kaltstart hinlegte, dass Williamson sich am Seitengriff der Tür festklammern musste, um nicht einen Hüpfer nach vorne zu machen.
„Herrjott noch mal, Cohen, fahren Sie so, dat wir lebend bei der Mutter ankommen, dat is‘ ja nit zum Aushalten!“, entfuhr es der Kommissarin. So viel zu ihren Vorsätzen. Sie hielten mal gerade zehn Minuten. „Ich habe Sie gefragt, wat wir von der Mutter wissen!“
„Ah, so, ja … blöde Kuh!“
Irritiert schaute Williamson ihren Mitarbeiter von der Seite an. „Wie bitte?“
„Nicht Sie, Chefin, die da!“
Wild gestikulierend zeigte der Baron durch die Frontscheibe nach draußen. Eine Frau hatte sich erdreistet, im letzten Moment über die Straße zu laufen, obwohl die Fußgängerampel gerade auf Rot sprang. Unerhört, wirklich.
Nun riss seiner Vorgesetzten endgültig der Geduldsfaden. Sie spürte, wie das Magma in ihr hochkroch und einen ihrer gefürchteten Ausbrüche ankündigte.
„Verdamp noch mal, Herr Cohen, et reicht. Hören Sie auf, wie ein wildgewordener Stier durch Hannover zu brausen un‘ die Leute zu beleidigen, sonst halten Sie auf der Stelle an, un‘ wir tauschen! Dann fahr‘ ich!“
Cohen sah nun seinerseits sie von der Seite an und schluckte. Williamson beobachtete, wie sein Adamsapfel auf und ab hüpfte. Immerhin mäßigte er seine Fahr- und auch seine Ausdrucksweise etwas. Seine Chefin am Steuer war der ultimative Endgegner. Jeder im Kommissariat wusste, dass sie überhaupt keinen Orientierungssinn besaß und auch trotz des Navis oft nicht am gewünschten Ziel ankam, ganz abgesehen davon, dass sie so schnell fuhr wie „das Tier mit Haus auf dem Rücken“. Diese Bezeichnung für eine Schnecke hatte Cohen einmal in einem Theaterstück gehört und so darüber gelacht, dass es ihm seither nicht mehr aus dem Kopf ging.
„Die Mutter!“, erinnerte Williamson ihn scharf und trommelte voller Ungeduld auf das Armaturenbrett.
„Ja, also, Ruth Schneider“, begann Cohen und schluckte nervös. Es war das erste Mal, dass er zusammen mit seiner Vorgesetzten auf dem Weg war, eine Todesnachricht zu überbringen. Wahrscheinlich war es aber nicht nur das, was ihn nervös machte, dachte die Kommissarin und betrachtete mit einem Seitenblick die Schweißtropfen, die sich auf seiner Stirn gebildet hatten. Ihre Nähe brachte ihn so aus der Fassung, davon war sie überzeugt.
„Wie gesagt, sie wohnt in Döhren. Sie ist neunundfünfzig Jahre alt, Frührentnerin und lebt allein. Ihr Mann ist vor zehn Jahren gestorben.“
„Dann hat sie mit Erik Schneider ab seinem sechzehnten Lebensjahr allein gelebt“, meinte Williamson nachdenklich und speicherte diese Tatsache in ihrem Gedächtnis ab. Sie würde sich später damit beschäftigen.
Cohen antwortete nicht. Wenigstens fuhr er nicht mehr so schnell und schnaufte auch nicht mehr so angestrengt.
Dennoch vermisste Williamson Grifo.
„Schön hier“, kommentierte die Hauptkommissarin und blickte sich anerkennend um, als sie aus dem Wagen stieg. Rote Backsteinhäuser, die eine zusammenhängende Siedlung bildeten, säumten die Straße, in die sie kurz zuvor eingebogen waren und den Wagen abgestellt hatten.
„Döhrener Jammer“, erklärte Cohen knapp und umfasste mit einer ausholenden Geste die Backsteinsiedlung.
Fragend hob Williamson eine Augenbraue.
„So nennt man das hier: Döhrener Jammer. Ein Beispiel für den Siedlungsbau für die Arbeiter während der Industrialisierung. Die ganze Siedlung steht unter Denkmalschutz und ist heute von Privatpersonen bewohnt – so wie Ruth Schneider eine ist.“
„Aha“, brummte Williamson trocken. „Wat Sie alles wissen, Herr Cohen, bemerkenswert.“
Wieder schaute ihr Kollege sie mit seinen blauen Glubschaugen ausdruckslos an. Wäre die Situation nicht so ernst, hätte die Kommissarin laut aufgelacht oder aber Elena Grifo zugezwinkert, die mit einem leichten Schmunzeln geantwortet hätte. Aber die junge Oberkommissarin war diesmal nicht an ihrer Seite.
Williamson straffte ihre Schultern und ging entschlossenen Schrittes auf die Tür des Hauses zu, das laut Cohen lange Jahre das Zuhause von Erik Schneider gewesen war, bevor er ausgezogen war, und das seine Mutter nunmehr allein bewohnte. Cohen hatte seine Chefin im Schlepptau. Gerade als sie das kleine Gartentörchen aufstieß und den geplättelten Weg Richtung Haustür einschlug, fuhr ein kleiner VW Polo vor, aus dem eine Frau mit einem langen dunkelblonden Zopf stieg. Es war Dr. Tanja Meineke, die Polizeipsychologin, die die Kommissare bei der Überbringung der Todesnachricht unterstützen würde. Cohen hatte sie noch vom Fundort der Leiche aus informiert. Es war nie vorauszusehen, wie Angehörige auf so schreckliche Neuigkeiten reagierten, daher war es besser, eine geschulte Psychologin an ihrer Seite zu haben. Die Hauptkommissarin hatte bei ihrem letzten Fall mit Dr. Meineke zusammengearbeitet und sie sehr zu schätzen gelernt. Sie nickte der Psychologin kurz zu, die fröstelnd die Arme um sich geschlungen hatte. Es war immer noch ziemlich kühl an diesem Oktobermorgen. Auch hatte sich der Nebel immer noch nicht ganz verzogen.
Entschlossen marschierte die Kommissarin zum Hauseingang an einem massiven Geländewagen vorbei, der in der Einfahrt stand, und drückte auf den Klingelknopf rechts neben der Tür. Es nützte nichts, die unausweichlich zu überbringende Nachricht aufzuschieben.
Zu ihrer Überraschung wurde die Tür, schon kurz nachdem sich Williamson bemerkbar gemacht hatte, mit einem heftigen Ruck aufgerissen. Es war noch früh am Morgen, kurz vor halb acht, daher hatte sie erwartet, eine Weile warten zu müssen, weil Ruth Schneider vielleicht gerade aufgestanden war. Die Hauptkommissarin sah sich Aug in Aug mit einer sehr kompakten Frau mit rundem Gesicht gegenüber, dessen rosige Farbe davon zeugte, dass sie sich oft an der frischen Luft aufhielt. Ihre stechenden blauen Augen, die von feinen Fältchen umgeben waren, sahen sie durchdringend an.
„Ja?“, herrschte sie die Hauptkommissarin an, die tatsächlich einen Schritt zurückwich. Das passierte ihr nicht oft. Entweder war sie von Grifos seltsamem Verschwinden und der Tatsache, dass diese mit dem Toten in Kontakt stand, noch mitgenommener, als sie dachte, oder aber die Erscheinung der Frau beeindruckte sie mehr, als sie vorausgesehen hatte – oder beides.
Doch sie fing sich rasch und machte einen großen Schritt nach vorn.
„Williamson, Kripo Hannover. Dat sind meine Kollegen Sascha Cohen und Elen… Tanja Meinecke. Sie is‘ Psychologin. Sind Sie Ruth Schneider?“
Die Frau starrte sie wieder mit ihren irritierend stahlblauen Augen unter einem rotbraunen, praktischen Kurzhaarschnitt an. Die Kommissarin registrierte, dass die Frau vollständig bekleidet war. Sie trug ein rot-schwarz kariertes Holzfällerhemd, eine grüne Knickerbockerhose aus Cord und dicke Wollsocken, aber keine Schuhe. Die Frau antwortete immer noch nicht, stattdessen fiel ihr Blick auf die Gummistiefel, die die Hauptkommissarin trug.
Sie sah auf.
„Ja, die bin ich. Was wollen Sie?“ Die Frage war harsch gestellt. Das würde nicht einfach werden, ahnte die Hauptkommissarin.
„Dürfen wir reinkommen? Dat, wat wir zu sagen haben, sollte nit unbedingt an der Haustür …“
„Kommen Sie rein“, unterbrach Ruth Schneider sie und wandte sich abrupt um, um ins Innere des Hauses voranzugehen. Dann wandte sie sich noch einmal kurz um.
„Aber ziehen Sie die Stiefel aus, ich habe keine Lust, Ihren Dreck wegzumachen!“
Freundlichkeit sah anders aus.
„Ist wohl nicht so der mütterliche Typ“, kommentierte Cohen trocken, als er sich an Williamson vorbei in den kleinen Eingangsbereich des Reihenhauses drängte und Tanja Meineke ins Innere des Hauses folgte.
„Eher nit“, schnaufte die Kommissarin und versuchte, auf einem Bein hüpfend, sich von den Stiefeln zu befreien.
Als sie schließlich schlitternd ihren beiden Kollegen in den Wohnraum gefolgt war, atmete sie noch immer schwer. Die verdampten Stiefel hatten sich geradezu an ihre Beine gesaugt!
Der Wohnbereich war sehr klein. Cohen und Tanja Meineke hatten sich auf ein Zweiersofa gezwängt, das im Biedermeierstil gehalten war. Die schlanke Polizeipsychologin wurde von der massigen Gestalt des Barons ganz an den Rand des Sitzmöbels gezwängt. Ihnen gegenüber, nur getrennt durch einen zierlichen Holztisch, saß Ruth Schneider breitbeinig auf einem schmalen Stuhl, einen Kaffeebecher in beiden Händen haltend. Ganz offensichtlich hatte sie Cohen und Tanja Meineke nichts angeboten, was natürlich auch nicht nötig war. Dennoch registrierte die Kommissarin diese Tatsache und speicherte sie ab. Die massige Frau hockte wie ein Raubtier Cohen und Meineke gegenüber, die verunsichert aussahen. Wäre die Situation nicht so ernst, hätte Williamson angesichts des Anblicks, der sich ihr bot, laut aufgelacht.
Für sie selbst war kein Stuhl übrig. Sie sah sich um und holte sich aus der offenen Küche, die sich direkt ans Wohnzimmer anschloss, einen wackligen, weiß lackierten Holzstuhl, dessen Farbe schon stark abgeblättert war. Ruth Schneider machte keine Anstalten, ihr einen Sitzplatz anzubieten oder den Stuhl zu holen.
Williamson setzte sich und sah sich um. Der Raum war düster. Dunkle, von massiven Messingrahmen umrandete Bilder mit Jagdmotiven und einige Geweihe hingen an den Wänden, die mit einer vergilbten Tapete bespannt waren. Das Zimmer wirkte dunkel, muffig und verlebt. Die Hauptkommissarin schüttelte sich und fragte sich unwillkürlich, ob Erik Schneider sich hier in seiner Jugend wohlgefühlt hatte, ganz abgesehen davon, dass seine Mutter der wohl weniger einfühlsame Typ war. Sie selbst war auch nicht die klassische Mutter aus dem Bilderbuch, aber sie liebte ihre Kinder heiß und innig, kämpfte wie eine Löwin für sie, wenn es sein musste, und zeigte das auch. Ob das Eriks Mutter ebenso getan hatte?
Ruth Schneider hockte immer noch reglos auf ihrem Stuhl, beobachtete Williamson aber mit ihren eigenartig stechenden Augen ganz genau. Die Kommissarin bemerkte, dass die Kompaktheit der Frau von starken Muskeln herrührte, die sich deutlich unter dem Holzfällerhemd, das an den Ärmeln aufgekrempelt war, und auch unter der Haut abzeichneten. Ihre Hände, die die Tasse umklammert hielten, waren tellergroß und breit wie Männerhände, ebenso groß wie die ihres Kollegen Sascha Cohen. Diese Frau war körperliche Arbeit gewohnt.
„Also, warum sind Sie hier?“, hob Ruth Schneider an und durchbrach die Stille. Die Mutter machte nicht den Eindruck, verunsichert zu sein, ganz im Gegenteil, eher von einer leichten Ungeduld erfasst. Auch das war eine interessante Beobachtung.
„Frau Schneider, wir müssen Ihnen eine traurige Mitteilung machen“, fing Williamson an, schluckte und verstummte. Verdamp, sie konnte so etwas einfach nicht! Mehr denn je vermisste sie Grifo an ihrer Seite.
„Ja?“, fragte Ruth Schneider und sah sie von unten nach oben an. „Nun sagen Sie schon, was Sie zu sagen haben. Das Rumgeeiere von Ihnen macht einen ja wahnsinnig!“
„Ihr Sohn wurde heute am frühen Morgen in der Leinemasch gefunden, er is‘ Opfer eines Gewaltverbrechens geworden un‘ wurde vermutlich erstochen.“
So, jetzt war es heraus. Williamson hatte die Nachricht in einem Satz ausgestoßen und war immer schneller geworden. Ruth Schneider hatte sie unter Druck gesetzt, und das war dabei herausgekommen. Nicht sehr einfühlsam und schon gar nicht wie aus dem Lehrbuch. Das war jetzt nicht mehr zu ändern.
Tadelnd blickte Tanja Meineke sie an.
„Frau Kommissarin!“, mahnte sie. Dass diese Vorgehensweise der Polizeipsychologin nicht gefiel, war klar.
Die Mutter sah eine Weile auf ihre großen Hände, lehnte sich dann in ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor ihrer Brust. Die Muskelstränge an ihren Unterarmen traten deutlich hervor. Aus halb geschlossenen Augen beobachtete sie Williamson und schwieg.
Tanja Meineke war aufgesprungen und trat neben die Mutter, die sie von schräg unten ansah.
„Was wollen Sie?“, fragte sie barsch.
„Ich … also, wenn Sie Hilfe brauchen …“ In einer fahrigen Geste spreizte Tanja Meineke die Finger und streckte den Arm in Richtung der Mutter aus, die sie ruhig betrachtete.
„Sehe ich hilflos aus?“, entgegnete die massige Frau und blickte sie immer noch ganz ruhig an.
„Na ja, also …“, stammelte die Psychologin und brach dann ab. Ratlos blickte sie zu Williamson, die mit den Schultern zuckte. Nein, hilflos wirkte Erik Schneiders Mutter nicht, das konnte man wahrlich nicht behaupten.
Still und mit einem leicht resignierten Ausdruck im Gesicht setzte sich Tanja Meineke wieder neben Cohen, der sein Notizbuch gezückt hatte, das er auf den zusammengedrückten Knien balancierte.
Langsam wandte Ruth Schneider den Kopf und fixierte Williamson mit ihren tief liegenden, seltsam hellblauen Augen. Wieder ging sie in die Haltung einer sprungbereiten Löwin: Breitbeinig, nach vorne gebeugt, die Unterarme auf den Oberschenkeln mit ineinander verschränkten Händen, saß sie ganz ruhig da und betrachtete die Hauptkommissarin. Cohen und Meineke ignorierte sie vollständig.
„Wenn Sie glauben, dass ich jetzt in Tränen ausbreche oder hysterisch zu schreien anfange, haben Sie sich getäuscht“, sagte sie mit ihrer rauen und für eine Frau ungewöhnlich tiefen Stimme.
Langsam, ganz langsam kroch eine Gänsehaut Williamsons Rückgrat hoch. Sie hatte schon viele Reaktionen von Angehörigen beim Überbringen von Todes- oder Schreckensnachrichten erlebt, die von Ruth Schneider war definitiv etwas Neues. Und ziemlich unheimlich. Als erfahrene Kriminalkommissarin sollte Williamson nichts mehr überraschen, aber manchmal kam sie in Situationen, die selbst für sie erstaunlich waren. So wie diese hier.