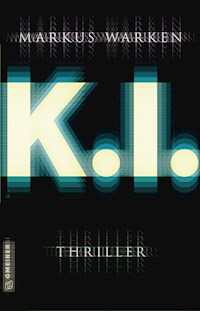
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jana Loewe
- Sprache: Deutsch
Die Studentin Jana sitzt vor ihrem Computer und kann es nicht fassen: Terroristen kennen nicht nur ihre private E-Mail-Adresse, sondern auch ihren echten Namen, ihren echten Wohnort. Und das, obwohl sie nur online und mit falscher Identität für ihre Seminararbeit über Propaganda recherchiert hat. In Panik wendet sie sich an ihren Schulfreund Nils, einen begnadeten Hacker. Er löscht einen Virus von ihrem PC, doch Jana ahnt nicht, dass damit der Albtraum erst richtig beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Warken
Tödliche K.I.
Thriller
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Lutz Eberle
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6356-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Freitag, 4. August 2017 – »Crypto City«, Fort Meade, Maryland, USA
Das zentrale Gebäude von »Crypto City« wirkt von Weitem wie die monströs vergrößerte Kaaba – ein mächtiger, schwarz verspiegelter Würfel. Der vor Unbefugten hermetisch abgeschirmte Bau beherbergt das Hauptquartier des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA, in dem die Fäden des weltumspannenden Überwachungsnetzes der USA zusammenlaufen und »top secret« eine der mittleren Geheimhaltungsstufen ist. Für die einen hütet der schwarze Würfel den Gral der Freiheit, für die anderen umschließt er das Herz der Finsternis, ist er ein Hort der Kontrolle und Unterdrückung.
Lässt man die Mystik und Legenden beiseite, die sich um dieses Machtzentrum ranken, bleibt lediglich ein Bürokomplex, ähnlich dem Entwicklungszentrum eines großen Technologieunternehmens, in dem gewöhnliche, fehlbare Menschen arbeiten. Einer davon, Major Ulmer, hetzte am 4. August 2017 durch den letzten der schier endlosen Gänge, der ihn noch von seinem Ziel trennte: dem Büro seiner Arbeitsgruppe, dem Epizentrum des ADONIS-Programms. Die Blicke seiner Kollegen folgten ihm – manche neugierig, andere sensationslüstern, mitleidig oder schadenfroh. Nichts verbreitete sich schneller als schlechte Nachrichten. Der Spießrutenlauf ging bis zur Bürotür seiner Dienststelle. Ulmer flüchtete sich hinein und warf die Tür krachend hinter sich ins Schloss. 14 Augenpaare wandten sich ihm zu.
»Der Vizepräsident tobt – und wir sind schuld, weil unser System Bockmist gebaut hat!« Major Ulmer hielt die neueste Ausgabe einer Washingtoner Zeitung mit der rechten Hand hoch und klatschte mit der linken dagegen. »Lagebesprechung«, befahl er knapp und durchquerte das Büro mit schnellen Schritten, um zum Forum zu gehen, wo sie alle größeren Besprechungen abhielten. Er nutzte die wenigen Sekunden, die vom Lärm rückender Stühle und eilender Füße beherrscht wurden, um sich zu sammeln. Nachdem alle im Kreis um ihn herum standen, durchbrach nichts außer dem Surren der Klimaanlage die Totenstille.
»Vertrauliche Daten vom Dienstrechner des Vizepräsidenten sind an die Öffentlichkeit gelangt«, eröffnete er seinen Mitarbeitern. »An die einschlägigen Journalisten, allen voran diese Hyäne Vivian Lee. Die politische Laufbahn des Vizepräsidenten hängt am seidenen Faden und das Schlimmste: Die undichte Stelle ist eins unserer ADONIS-Cooties. Der Vizepräsident wird uns durch den Fleischwolf drehen, wenn wir das nicht mit Lichtgeschwindigkeit glattziehen!«
Ulmer fühlte Schweiß aus seinen Achselhöhlen tropfen.
»Kann man das Datenleck denn sicher auf ein ADONIS-Cootie zurückführen?«, fragte Sergeant Rodriguez, seit Jahren seine rechte Hand und engster Vertrauter. »Sonst kann uns keiner etwas wollen.«
Bevor Ulmer antworten konnte, flog die Tür auf, und Colonel Harris betrat den Raum. »ADONIS wird terminiert!«, blaffte er barsch.
Major Ulmer knirschte mit den Zähnen. In den Augen seiner Mitarbeiter stand blankes Entsetzen. Colonel Harris’ Miene ließ keinen Zweifel daran, dass er es bitter ernst meinte. Ulmer straffte sich und ging langsam auf seinen Vorgesetzten zu. Im Rücken spürte er die Blicke seiner Männer wie stumme Hilferufe. Bislang war ADONIS von jedem als nächste Generation geheimdienstlicher Überwachungstechnologie gepriesen worden. Sollte das Missgeschick mit den Daten des Vizepräsidenten auf einen Schlag alles infrage stellen? Ulmer atmete tief ein und öffnete den Mund, um sein Lebenswerk zu verteidigen.
»Ich bin nicht gekommen, um zu diskutieren«, schnitt Harris ihm das Wort ab, bevor Ulmer einen Ton hervorbringen konnte.
»Das kann nicht Ihr Ernst sein«, begehrte Ulmer auf. »Mit ADONIS können wir jeden überwachen, der ein elektronisches Gerät benutzt. Wir sind um Größenordnungen effizienter als jedwede andere Form geheimdienstlicher Personenüberwachung, weil alle 4D-Schritte komplett automatisiert sind.«
Harris reagierte nicht, sodass Ulmer einen weiteren Vorstoß wagte. »Colonel, wir können jeden überwachen, jeden gottverdammten Menschen auf der ganzen Welt – und gegebenenfalls bekämpfen. Jeden – jederzeit – überall – und das bei lächerlich geringen Kosten.«
»Genau in dieser Automatisierung liegt das Problem«, knurrte Harris. »Sie haben sich verrannt! Lesen Sie eigentlich keine Zeitung? Nein? Holen Sie das bei Gelegenheit nach und ersparen Sie mir, Ihnen im Einzelnen erläutern zu müssen, was der Vizepräsident von automatisierten 4D-Schritten hält. Deny, disrupt, degrade, deceive – verleugnen, unterbrechen, herabsetzen und täuschen –, das wollen Sie allen Ernstes automatisieren?«
»Natürlich wissen wir, was in der Zeitung steht«, erwiderte Ulmer eifrig. »Die Schwierigkeiten des Vizepräsidenten könnten wir leicht ausbügeln. Warum bringen wir diese Schmierfinken nicht einfach zum Schweigen? Ein Wink an Sergeant Rodriguez, und die Abendzeitung wird heute noch melden, dass die verehrte Vivian Lee einer bedauerlichen Fehlinformation aufgesessen ist, sie alles widerruft und im Übrigen unbekannt verreist ist. Die restlichen Journalisten wittern, was die Stunde geschlagen hat, niemand hackt mehr auf dem Vizepräsidenten herum, und die Sache hat sich.«
»Ulmer, werden Sie größenwahnsinnig?«
Major Ulmer schoss das Blut ins Gesicht. Für ihn bedeutete die Einstellung von ADONIS das Ende seiner Karriere. Für Colonel Harris, der erst seit Kurzem mit dem Programm zu tun hatte, lag die Sache anders. Aus seiner Warte war die Einstellung von ADONIS die Lösung. Ulmer mit seinen Männern waren die geeigneten Bauernopfer, denen man die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Außerdem handelte er sicher nicht ohne Weisung oder zumindest Deckung von ganz oben. Eigenmächtig das ADONIS-Programm zu beenden überschritt todsicher seine Kompetenzen.
Ulmer beschloss, seine Strategie zu ändern. »Ich schlage natürlich nicht vor, Lee und den anderen Journalisten körperlich etwas anzutun«, erklärte er. »Wir könnten die ganze Journaille mundtot machen. Eine Routineaufgabe für ADONIS.«
»Und wenn das rauskommt?«, zischte Harris.
»Wir könnten ihnen auch ein freundliches Angebot unterbreiten. Eines, das keiner von ihnen ausschlagen wird.«
Der Einwand zeigte Wirkung. Ulmer beobachtete, wie Harris schweigend nachdachte. Die linke Augenbraue des Colonels zuckte. Dann schien etwas in Harris zu explodieren und sein Vorgesetzter zertrümmerte Ulmers aufkeimende Hoffnung mit einer abfälligen Geste gefolgt von der Feststellung: »Nein, alles zu unsicher. Sie haben Ihr System nicht im Griff! Oder wie kommt es, dass ADONIS den Vizepräsidenten ans Messer liefert?«
Das war der wunde Punkt. Ulmer stierte Harris’ obersten Uniformknopf an, als könnte er dort die Antwort ablesen.
»Sehen Sie, dafür haben Sie keine Erklärung! Und jetzt sorgen Sie dafür, dass ADONIS der Vergangenheit angehört und zwar so, dass das Programm spurlos getilgt wird, als hätte es nie existiert. Und das sofort, verstehen Sie? SOFORT!«
Ohne Ulmer eines weiteren Blickes zu würdigen, verließ Colonel Harris den Raum. Seine Schritte hallten auf dem Flur wie die Schläge einer Marschtrommel.
Ulmer beantwortete Rodriguez’ stummes Hilfeersuchen mit einem Schulterzucken. Mit dem Kinn deutete er zu Rodriguez’ PC und schickte seinen Mitarbeiter damit an die Arbeit. Gefolgt von den Übrigen schlich Sergeant Rodriguez an seinen Platz und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Dort knurrte er etwas Unverständliches, knüllte eine Handvoll Zettel mit Aufzeichnungen zusammen und pfefferte sie in den Papierkorb. Dann gab er eine Folge kurzer Kommandozeilenbefehle in seinen Rechner ein. Eine Weile hörte man nur das Klacken der Tastatur unter seinen Fingerkuppen. Auf einem großen Wandbildschirm erschien eine Weltkarte, übersät mit Millionen und Abermillionen grünen Punkten, die recht genau die Bevölkerungsdichte der Erde widerspiegelten – ein Punkt für jede über ADONIS aktiv überwachte Zielperson. Einige Sekunden geschah nichts. Rodriguez, Ulmer und alle anderen im Raum starrten wortlos den Wandbildschirm an. Erste vereinzelte Punkte begannen sich rot zu verfärben und kurz darauf zu verschwinden. Weitere Punkte folgten, bis lediglich vier übrig waren, die sich allem Anschein nach dem Löschbefehl widersetzt hatten.
»Wiederholen«, ordnete Ulmer an, und Rodriguez’ Finger flogen erneut über die Tastatur. Drei weitere Punkte verschwanden. Der vierte Punkt zeigte sich unbeeindruckt und widerstand selbst drei weiteren Löschversuchen. Rodriguez zoomte heran. Es handelte sich um eine Zielperson des Servers Palo Alto ME2Z.
»Sandro, was ist da los?«, flüsterte Ulmer so leise, dass niemand außer Rodriguez ihn hören konnte.
»Keine Ahnung«, antwortete Rodriguez genauso leise. »Das System reagiert nicht wie spezifiziert. Ich, ähm, ich wollte es dir schon länger sagen: Gelegentlich bekommen wir Nachrichten von einzelnen Leviathanen, die wir nicht dekodieren können.«
Ulmer schauderte bei dem Gedanken an die Tragweite von Rodriguez’ Satz, als der letzte Punkt erlosch. »Na also, geht doch!«, entfuhr es ihm erleichtert.
Rodriguez drückte sich an der Schreibtischkante vom Bildschirm weg und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich befürchte, nein«, erwiderte er und schluckte. Rodriguez deutete auf seinen Bildschirm. »Schau, die letzte Nachricht war ›connectionRelease‹, nicht ›instanceShutDownConfirm‹.«
»Das heißt?«
»Das heißt, der Leviathan hat von sich aus den Kontakt mit uns abgebrochen.«
Kapitel 1
Freitag, 9. Oktober 2020 – Humboldt-Universität, Berlin
Jana staunte, als sie den Hörsaal betrat. Gut 25 Kommilitonen hatten sich bereits eingefunden, obwohl heute der letzte freie Tag vor dem Beginn der Vorlesungszeit war und es nur um ein paar Seminarthemen ging – Seminarthemen allerdings, von denen sie unbedingt eines ergattern musste. Wenige Sitzreihen vor sich entdeckte sie Wibke, die sie am Montag auf der Einführungsveranstaltung nach ihrer Immatrikulation kennengelernt hatte. Froh, zumindest ein bekanntes Gesicht zu finden, stieg Jana zu ihr hinunter und setzte sich neben sie.
»So viele Themen, dass wir alle eins abbekommen können, gibt es doch gar nicht«, flüsterte Jana ihr statt einer Begrüßung zu und deutete mit dem Kinn auf die Sitzreihen vor ihnen.
»Jetzt mach dir nicht schon vorher Stress!« Wibke strich sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre langen Fingernägel waren im Farbton ihrer Bluse lackiert, Mauve diesmal. »Berlin ist eine schöne Stadt.« Wibke zwinkerte verschwörerisch. »Notfalls machen wir eben ein Semester mehr!«
»Du kannst dir das vielleicht leisten, ich nicht.«
Jana schloss kurz die Augen und schüttelte den Kopf, als müsse sie sicherstellen, nicht zu träumen. Wibke und Jana kamen aus grundverschiedenen Welten, und sie hatten sich eher zufällig kennengelernt. Eine ihrer neuen Kommilitoninnen – eine Gothic mit Piercings im Gesicht – wollte während einer Einführungsveranstaltung für Neulinge an der Humboldt-Uni einfach nicht aufhören, über Wibkes schicke Kleidung zu lästern. Jana verabscheute kleinkarierte Leute, die anderen Vorschriften machen wollten, und brach spontan eine Lanze für Wibke, mit der sie bis dahin kein Wort gewechselt hatte. Die Gothic suchte schnaubend das Weite, und Jana kam mit Wibke ins Gespräch. Weil sie sich sofort sympathisch gewesen waren, hatten sie sich seither ein paar Mal auf einen Kaffee getroffen, und letzte Nacht hatte Wibke sie in eine der angesagten Discos von Berlin geschleppt; sonst nicht ihr Ding, doch Wibke wollte nicht alleine gehen. Beide waren sie erst kürzlich nach Berlin gezogen, allerdings unter ganz verschiedenen Vorzeichen. Als Tochter eines reichen Hamburger Kaufmanns kannte Wibke finanzielle Sorgen nur vom Hörensagen, und darüber hinaus sah sie aus wie eine junge Heidi Klum.
Entschlossen zog Jana ihren Laptop aus der Tasche. »Ich muss den Master in vier Semestern durchziehen. Und dafür brauche ich definitiv einen dieser Vorträge heute.«
»Für jemand, der über knappe Kasse jammert, hast du da ein verdammt schickes Gerät!« Wibke hob die Augenbrauen. »Wenn es dir echt so schwerfällt, das Geld für das Studium zusammenzukratzen, warum kaufst du dir so ein Edelteil?«
»Drei Wochen Kellnern auf einem Ausflugsschiff«, brummte Jana und startete den Rechner. »Gut bezahlt, aber ein Scheißjob. Kellnern auf einem Schiff, meine ich. Du musst mal so einen Kegelclub in voller Fahrt erleben. Und wenn ich drei Wochen ranklotze, muss es etwas Ordentliches sein, sonst ärgere ich mich schwarz. Hast du eine Ahnung, wie lange die Veranstaltung hier dauert? Ich muss gleich nach Friedrichshain, mich in einer Whiskybar vorstellen.«
»Du jobbst doch schon auf einem Schiff? Wie viele Nebenjobs willst du denn noch machen?«
»Im Winter fahren die Schiffe nicht. Außerdem war das in Köln.« Jana sah auf, weil um sie herum ein Raunen anschwoll. Der Professor hatte den Hörsaal betreten.
»Hammer!«, entfuhr es Wibke. »Ist der überhaupt schon 30? Sieht echt gut aus, der Knabe.«
»Wie er aussieht, ist mir egal«, murmelte Jana. »Hauptsache, ich greife einen Vortrag ab.«
Der Professor blieb vor der Tafelwand stehen und musterte die Anwesenden mit einem Lächeln. Jana folgte seinem Blick und stellte fest, dass inzwischen weit über 30 Studenten die Bänke füllten.
»Mein Name ist Lüneburger, wie Sie sicher mitbekommen haben«, stellte er sich vor. »Nein, ich habe nichts mit der Heide oder Hermann Löns zu tun, und wir wollen es kurz machen, damit Sie sich weiter ungestört dem letzten Tag Ihrer Semesterferien widmen können.«
Ein Lächeln umspielte seine Lippen, bevor er fortfuhr.
»Die Themen kennen Sie ja, sodass wir keine Zeit verschwenden müssen. Wer möchte uns mit dem ersten Vortrag zu ›Personalisierte Bannerwerbung in Suchmaschinen‹ in der Kalenderwoche 48 beglücken?«
Mindestens zehn Hände schossen zeitgleich mit Janas in die Höhe. Das Rennen machte ein Student namens Berblinger in der zweiten Reihe.
»Mist«, zischte Jana. »Ich dachte, der erzählt noch etwas zu den Themen. Hast du dir die Liste angesehen?«
»Nee«, antwortete Wibke. »Ich lasse das Ganze auf mich zukommen.«
Jana versuchte hektisch, die Informationen zu dem Seminar auf ihren Bildschirm zu bekommen und gleichzeitig mit hochgerecktem Arm »Emotionalität durch die Farbkombination Rot-Schwarz« zu erhaschen. Auch diesmal hatte sie kein Glück. Unzufrieden mit sich selbst kniff sie die Lippen zusammen und bearbeitete den Laptop. Als die Liste der Themen endlich auf dem Bildschirm erschien, atmete sie erleichtert aus. »Was hältst du von ›Werbe-Ikonen im Internet‹? Das kommt als Nächstes.«
Wibke schien sie nicht zu hören. Lieber irgendein Thema als gar keins, schärfte sich Jana ein und ließ erneut ihren Arm hochschnellen, kaum dass Professor Lüneburger den Mund aufgemacht hatte, um das Thema aufzurufen. Erneut hatte sie Pech und hieb enttäuscht mit der Hand auf das schmale Pult.
»Mann, ich brauche den Schein …«, knurrte sie. Nur noch vier Themen standen auf der Liste. Wie ein Sprinter in den Startklötzen lauerte sie darauf, dass der Professor das nächste Thema aufrief.
»Sag mal, kannst du dir etwas unter ›Propaganda in asymmetrischen Kriegen‹ vorstellen?«, riss Wibke sie aus ihren Gedanken. »Das kommt als Nächstes. Hört sich echt schräg an.«
Jana lugte neben sich und sah, dass Wibke ihren Bildschirm wie ein exotisches Tier betrachtete.
»Nicht wirklich«, erwiderte sie, ohne Lüneburger aus den Augen zu lassen. »Könnte Terrorkrieg sein, weil Staaten ja viel stärker sind als Terroristen, eben kein normaler Krieg.«
»Propaganda in asymmetrischen Kriegen«, tönte es in diesem Moment von vorn. Reflexartig schoss Janas Hand in die Höhe. Als sie merkte, dass sich sonst niemand meldete, schluckte sie. Warum kneifen die alle bei dem Thema? Sie zwang sich, die Hand oben zu lassen.
»Es freut mich, dass zumindest Sie sich dem Thema gewachsen fühlen. Das zeigt mir, dass Sie keine Angst vor Herausforderungen haben! Okay, Zuschlag, Frau …« Der Professor betrachtete Jana interessiert.
»Loewe«, Jana räusperte sich, »Jana Loewe.«
»Das Thema ist zweifelsohne sehr anspruchsvoll – und wenn Sie einen überzeugenden Vortrag halten, können Sie es gern in Ihrer Masterarbeit fortführen.«
Als sie das Wort Masterarbeit hörte, hüpfte Janas Herz vor Freude. Lüneburger bot ihr an, in seiner Arbeitsgruppe ihren Studienabschluss zu machen!
»Wir sehen uns in vier Wochen wieder hier zur selben Zeit«, schloss der Professor wenige Minuten später die Veranstaltung. »Ich bin gespannt darauf, was uns Herr Berblinger zum Thema ›Personalisierte Bannerwerbung in Suchmaschinen‹ berichten wird. Alle Vortragenden kommen bitte noch kurz zu mir nach vorne. Ich habe einige Unterlagen zu Ihren Vorträgen vorbereitet.«
Jana ging mit den anderen, die einen Vortrag ergattert hatten, zum Dozentenpult. Wibke folgte ihr, vermutlich, um sich den jungen Professor aus der Nähe anzusehen. Vor Lüneburgers Tisch bildete sich eine Schlange. Weil sie ganz oben gesessen hatten, waren Jana und Wibke die letzten in der Reihe. Lüneburger drückte jedem eine Mappe in die Hand.
Schließlich war von den Vortragenden nur noch Jana übrig. Lüneburger hielt inne und sah sie prüfend an.
»Frau Loewe, in der Mappe finden Sie ein paar Zeitungsausschnitte zum Start. Das Thema lässt Ihnen große Freiheiten in der Gestaltung. Asymmetrische Kriege verstehen Sie bitte im weitesten Sinne als alle Konflikte zwischen ungleich starken Gegnern. Natürlich denkt man heutzutage zunächst an Konflikte der Art USA gegen Al Qaida oder IS, Russland gegen Tschetschenien, Israel gegen die Hamas, meinetwegen auch Türkei gegen die PKK, Spanien gegen die ETA und Großbritannien gegen die IRA. Welchen Konflikt Sie sich aussuchen, ist ganz Ihnen überlassen. Wichtig ist Folgendes: Je nach Sichtweise hat man entweder ›rechtmäßiger Staat gegen Terroristen‹ oder ›Unterdrücker gegen Freiheitskämpfer‹. Solche Konflikte werden dadurch entschieden, dass eine Seite die öffentliche Wahrnehmung für sich gewinnen kann, das heißt ihre Sichtweise zur allgemein anerkannten, herrschenden Meinung macht. Sie sollen verdeutlichen, wie die beiden Seiten die Öffentlichkeit davon zu überzeugen suchen, dass sie ›die Guten‹ sind.«
»Verstanden«, sagte Jana und nickte. »Das hört sich spannend an.«
Lüneburger räusperte sich. »Wahrscheinlich werden Sie sich eine der laufenden Auseinandersetzungen aussuchen, und ich bitte Sie eindringlich, in dem Fall bei Ihren Recherchen äußerste Vorsicht walten zu lassen. Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema überhaupt stellen soll. Es gibt da draußen üble Zeitgenossen. Sehen Sie zu, genügend Abstand zu halten, wenn Sie etwa herausfinden wollen, wie die Innensicht des IS ist. Besser, Sie gehen weiter zurück, meinetwegen kommen Sie mit Che Guevara, Andreas Hofer oder Spartakus. Die können Sie zwar nicht mehr selbst fragen, aber es gibt Bibliotheken voller Material dazu. Es steht Ihnen frei, das Thema auf die Wirtschaft zu beziehen und zu beleuchten, welche Rolle etwa Facebook und Google spielen – Wohltäter der Menschheit oder skrupellose Datenkraken.«
»Schon klar«, entgegnete Jana und versuchte, unbefangen zu wirken. »Aber ein weit zurückliegendes oder ein Wirtschaftsthema erscheint mir im Augenblick weniger ergiebig.« Was soll denn diese Warnung?, überlegte sie gleichzeitig. Traust du mir nichts zu? Und wenn ich dir mit Andreas Hofer komme, kann ich meine Masterarbeit gleich in den Wind schreiben.
»Seien Sie unbesorgt«, winkte Wibke ab. »Jana wird sicher nicht nach Afghanistan oder in den Irak reisen und sich ein Schild um den Hals hängen, dass sie wegen einer Seminararbeit dringend mit Abu Dschihad reden will.«
Lüneburger sah Wibke verärgert an. »Es gibt Dinge, über die man keine Späße machen sollte!«
Jana erschrak über seinen alarmierten Gesichtsausdruck. »Keine Sorge«, beschwichtigte sie ihn. »Ich finde das Thema hochspannend und werde sicher jede Menge Material finden, ohne mich in Gefahr zu bringen.«
»Ich meine das ernst«, schärfte der Professor Jana ein. »Halten Sie genügend Abstand zu gefährlichen Leuten. Es gibt davon leider mehr, als man denkt – und zwar nicht nur in Afghanistan, sondern auch bei uns.«
Jana schluckte. »Reicht denn das, was ich über das Internet und Bibliotheken herausbekomme?«
»Völlig! Sie werden sogar viel mehr finden, als Sie brauchen, um die Mechanismen zu verstehen und erstklassig illustrieren zu können.«
Erleichtert lächelte Jana den Professor an, verabschiedete sich und wollte sich umwenden.
»Nur, damit keine Missverständnisse aufkommen«, gab er ihr mit auf den Weg, »wenn ich erstklassig sage, meine ich das auch so. Ich erwarte eine herausragende Arbeit von Ihnen!«
Kapitel 2
Freitag, 9. Oktober 2020 – Wilhelmsruh, Berlin
Von der Uni machte sich Jana direkt auf den Weg zu ihrer Wohnung in Wilhelmsruh im Norden Berlins. Die halbe Stunde in der S-Bahn nutzte sie, um die Unterlagen durchzusehen, die sie von Lüneburger bekommen hatte. An einem Artikel über einen islamistisch motivierten Terroranschlag las sie sich fest. Das Bekennerschreiben war von einer Splittergruppe um einen Mann, der sich »Fackel der Gerechtigkeit« nannte. Er hatte bereits vor diesem Anschlag zweifelhafte Berühmtheit erlangt: Zwei Jahre zuvor hatte er in Jordanien eine Familie aus Großbritannien entführt, Touristen, die im Nahen Osten unterwegs gewesen waren. Er hatte sie eigenhändig vor laufender Kamera enthauptet und die Videos über das Internet verbreitet. Nun brüstete sich der Terrorist mit einem Bombenanschlag auf eine Mädchenschule in Syrien, bei dem über 50 Kinder getötet oder schwer verletzt worden waren. Beim Betrachten der beiliegenden Fotos von toten und verstümmelten Kindern würgte es Jana im Hals. Sie klappte die Mappe zu und starrte bis zum Bahnhof Wilhelmsruh aus dem Fenster, allerdings gelang es ihr nicht, die schrecklichen Szenen zu verdrängen. In Wilhelmsruh angekommen stieg sie aus. Auf dem Bahnsteig blies ihr ein kräftiger Nordwind ins Gesicht. Jana fröstelte und schlug den Kragen ihrer Jacke hoch. Die frische Luft lenkte sie ab und ließ die Bilder in ihrem Kopf verblassen. Ihre Gedanken wanderten zum Vortrag. Außer Frage stand, dass sie etwas zum islamistischen Terror bearbeiten musste. Sie beschloss, ihren Vortrag mit einem Propagandavideo der ›Fackel‹ einzuleiten, um ihre Zuhörer durch den Schock vom ersten Augenblick an zu packen. Dann ein paar Daten und Fakten, um die Dimension der Auseinandersetzung klarzustellen, gefolgt von den verschiedenen Sichtweisen der Parteien auf den Kernkonflikt. Je länger sie sich ausmalte, die kruden Hirngespinste zu entwirren, aus denen sich die Weltsicht solcher Terroristen zusammensetzen musste, desto stärker berauschte sie die Vorstellung, wie Professor Lüneburger ihren Vortrag gebannt verfolgen würde. Ein Glücksgefühl durchströmte sie bei dem Gedanken, mit glasklarer Logik die Anschauungen der Terroristen zu sezieren. Im gleichen Moment verstand sie, auf welchen Abwegen sich ihre Fantasie befand, und der Rausch verschwand genauso schnell, wie er gekommen war.
Sie blieb stehen, sah nach oben in die Kronen der Linden, die am Straßenrand standen. Als sie sich gesammelt hatte, ging sie langsam weiter.
Laut Lüneburger ging es darum, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass man »die Guten« war. Die »Fackel« – einer »der Guten«? Jana schüttelte den Kopf. Die Islamisten behaupteten von sich, einen heiligen Krieg zu führen. Konnte irgendjemand glauben, dass Gott es guthieße, Unschuldige umzubringen? Wodurch fühlte sich die ›Fackel‹ von Gott beauftragt, auf bestialische und heimtückische Art Kinder zu töten? Ging es gar nicht um Gott, sondern bloß um Macht? Darum, die Leute durch Angst gefügig zu machen?
Jana merkte, dass sie es drehen und wenden konnte, wie sie wollte: Um die Denkweise der »Fackel« zu verstehen – irgendeine innere Logik musste es ja geben –, konnte sie nicht umhin, mit seinesgleichen zu reden. Sie sah das Bild vor sich: die »Fackel«, der abgeschlagene Kopf der Engländerin, ein Lächeln für die Kamera. Nein, diesen Menschen tatsächlich gegenüberzutreten, von Angesicht zu Angesicht mit einem von ihnen zu sprechen, kam nicht infrage. Aber sie musste irgendwie mit ihnen in Kontakt kommen. Sicher würde man ihr gehörig auf den Zahn fühlen, was sie denn bezwecke. Und ebenso sicher war, dass sie besser nichts von ihrer Seminararbeit erzählte, weil diese Leute sich an fünf Fingern abzählen konnten, dass Jana darin kein Loblied auf sie singen würde – und im gleichen Moment wurde ihr noch etwas klar: Genau dies war die Art von Recherche, vor der Professor Lüneburger sie gewarnt hatte. Auch wenn es bloß um einen Seminarvortrag in der Uni ging: Diese Menschen gingen über Leichen, und Jana hatte keine Lust, die Nächste zu sein. Auf welche Art kam man an die ›Fackel‹ und ähnliche Leute heran, und vor allem, wie tat man das, ohne sich in Gefahr zu bringen?
Kurz darauf erreichte Jana den fünfgeschossigen Altbau aus DDR-Zeiten, in dem sich ihre Wohnung befand, schloss die Eingangstür auf und stieg die Treppe zum zweiten Stock hinauf. Oben angekommen steckte sie den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn zweimal, trat durch die schmucklose Wohnungstür, hängte ihren Mantel auf einen Haken und drückte die Tür mit dem Ellbogen zu. Dann ging sie ins Wohnzimmer, wo sie ihren Rechner in der Dockingstation einrastete und anschaltete, und von da aus weiter in die Küche.
Zur Feier des Tages einen Tarrazú aus Costa Rica, sagte sie sich, schüttete die Bohnen in die Kaffeemühle und drehte den Startknopf. Den habe ich mir verdient.
Genießerisch sog sie den Duft des frisch gemahlenen Kaffees ein und leerte den Siebträger der Espressomaschine mit einem harten Schlag auf den Rand des Mülleimers. Anschließend füllte sie den Metalleinsatz mit frischem Pulver, presste das Kaffeemehl sorgfältig an und schraubte das Sieb ein. Die Zeit, in der die Maschine auf die nötige Temperatur heizte, nutzte sie, um schnell bequeme Sachen anzuziehen und ihre Whatsapp-Nachrichten zu überfliegen. »Cocktailparty heute Abend im Hoppegarten – ganz schick«, stand da von Wibke. »Wann soll ich dich abholen?«
»Mensch, Wibke, ich muss arbeiten!«, stöhnte sie, vertagte das Absagen aber auf später und schob das Telefon zurück in ihre Gesäßtasche, weil in diesem Moment die grüne Lampe an der Espressomaschine aufleuchtete. Jana zapfte ihren Kaffee in ein kleines Tässchen und balancierte es auf einer Untertasse zu ihrem Rechner. Routinemäßig sah sie noch schnell bei Facebook und in ihren E-Mails nach, ob etwas Wichtiges anlag, doch außer der Nachricht, dass ihre Vorstellung in der Whiskybar auf morgen verschoben war, fand sie nur Belangloses und Spam. Jana trank einen Schluck von ihrem Espresso und atmete tief durch.
»Dann wollen wir mal!«, erklärte sie dem Rechner.
Die nächsten Stunden vertiefte sie sich derart in die Durchforstung des Internets nach Begriffen wie »asymmetrischer Krieg«, »Mudschahedin«, »Terroristen«, »Freiheitskampf« und »Guerilla« in allen möglichen Kombinationen mit Begriffen wie »Propaganda«, »Image« oder »Zustimmung«, dass sie sogar vergaß, ihren Kaffee auszutrinken. Dennoch fand sie nichts, was ihr nützlich erschien. Allmählich bezweifelte sie Lüneburgers Aussage, dass sie mit konventioneller Recherche viel mehr fände, als sie brauchte. Im Augenblick wäre sie froh, wenn sie überhaupt etwas Verwertbares im Netz zutage fördern würde. Ernüchtert schob Jana den Rechner von sich, rieb sich die Augen und blies die Backen auf. In ihren Ohren summte es, was ihr auch nicht dabei half, nützliche Ideen zu entwickeln.
Ihr Handy begann zu vibrieren. Sie zog es aus der Gesäßtasche und sah auf der Anzeige, dass es Wibke war. Mit schlechtem Gewissen nahm sie den Anruf an.
»Mensch Jana, hast du meine Nachricht nicht gelesen?«, beschwerte sich Wibke.
»Doch, aber …«
»Weißt du schon, was du anziehst?«, erstickte ihre Freundin jeden Widerstand im Keim. »Am besten wäre ein scharfes Cocktailkleid und ein abgefahrener Hut. Wart mal, bis du mich siehst!«
Dass sie absagen könnte, fand Wibke offenbar undenkbar.
Wahrscheinlich tut mir ein wenig Abwechslung sogar gut, um auf andere Gedanken zu kommen, überlegte Jana. Hier bin ich sowieso in einer Sackgasse.
»Einen Fummel, der als scharfes Cocktailkleid durchgehen kann, hätte ich sogar«, sinnierte sie laut. »Aber ich habe in meinem Leben noch keinen Hut getragen!«
»Ohne Hut bist du auf der Rennbahn quasi nackt. Das geht gar nicht. Aber mach dir keine Gedanken. Ich bringe dir einen mit.«
Das Telefon noch in der Hand blickte Jana an sich herunter. Die Schlabberklamotten waren bequem, aber außerhalb der eigenen Wände unpassend. »Uuups, so kannst du unmöglich auf der Rennbahn auftreten, liebe Jana!«, kicherte sie. Mit einem Mal verspürte sie richtig Lust auf die Party.
Sie trällerte »Jour 1« von Louane, tänzelte gut gelaunt unter die Dusche und schlüpfte anschließend in ein figurbetontes, enggeschnittenes Kleid. Ihre dunkelbraunen Haare föhnte und bürstete sie, bis sie glänzten. Die Frisur hatte sie bei Sandra Bullock abgeschaut, mittellang, glatt, offen, mit Seitenscheitel – ohne großen Aufwand und doch so hübsch, dass sie sich wohlfühlte. Sie schminkte sich gerade, als die Anzeige ihres Handys wegen einer neuen Nachricht aufleuchtete. Wibke wartete unten vor der Tür. Schwarze Pumps vervollständigten ihr Outfit und Minuten später glitten sie in Wibkes Sportwagen durch Berlin in Richtung Osten.
Der Roadster war kein halbes Jahr alt, roch fabrikneu, und die cremefarbenen, unglaublich bequemen Ledersitze zeigten nicht die geringsten Gebrauchsspuren. Auf Jana, die nach der Trennung ihrer Eltern in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen war, wirkte das Ganze geradezu unwirklich. Das Gefühl verstärkte sich, als sie auf der Rennbahn eintrafen. Wibkes riesigen, mit Reiherfedern geschmückten Hut auf dem Kopf schwebte Jana neben ihrer Freundin in die Bar des Rennklubs. Drinnen tummelten sich elegante Damen, die allesamt exotische Kopfbedeckungen trugen, neben Herren in Tweed-Jacketts. Die Atmosphäre wirkte eine Spur aus der Zeit gefallen. Sie kam sich vor wie eine Komparsin in einer Filmszene, die in Ascot spielte. Die Bedienung empfing sie mit der Frage: »Champagner? Roederer oder Krug?«
Jana fühlte sich in der fremden Welt der jungen Berliner Oberschicht wie auf einer Safari. Wibke stellte sie anfangs einigen Bekannten vor, verschwand aber bald in der Menge, um Freundinnen mit Küsschen zu begrüßen und vermutlich den jüngsten Tratsch und Klatsch auszutauschen. So ließ sich Jana die längste Zeit des Abends allein durch die Glitzerwelt der Reichen treiben und kostete zum ersten Mal in ihrem Leben Champagner. Sie fand es anregend, aber sie scheute sich, die Sicherheit ihres imaginären Safari-Jeeps zu verlassen, bevor sie die Gefahren dieser Wildnis einschätzen konnte. Für diesmal, tröstete sie sich und griff sich ein neues Glas vom Tablett eines Kellners, der gerade an ihr vorbeikam. »Türen stehen dir offen, Jana. Ob du hindurchgehst, wird sich finden!«, sagte sie leise zu sich selbst, schnupperte an ihrem Glas und trank einen Schluck. Krug-Champagner ist meine Marke, beschloss sie und lächelte glücklich.
Später am Abend schwebte Wibke auf sie zu.
»Jana, da bist du ja! Ich suche dich die ganze Zeit.« Wibke kam ganz dicht an ihr Ohr. »Würde es dir etwas ausmachen, dir eine andere Fahrgelegenheit für die Rückfahrt zu besorgen? Es kostet dich ein Lächeln – lauter gute Partien um dich herum!«
»Kein Problem, ich finde alleine heim!« Jana machte eine großzügige Geste, bei der sie kurzzeitig ein wenig das Gleichgewicht verlor. Der Champagner war tückisch.
»Soll ich dir Per vorstellen?«, unterbrach Wibke ihre Gedanken und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Den kenne ich aus Hamburg. Ganz nett, schließt gerade sein BWL-Studium ab und steigt später bei seinem Vater in die Reederei ein. Er hat mich eben gefragt, wer denn meine schöne Freundin wäre. Der Gute hat uns zusammen reinkommen sehen und traut sich nicht, dich anzusprechen – weil du so unnahbar wirkst und alle abblitzen lässt.«
Über Wibkes Schulter hinweg sah sie einen schmalgesichtigen Mann, der ihr schüchtern zulächelte. Er sah nicht schlecht aus und hatte in jedem Fall auf eine plumpe Anmache verzichtet. Einen Moment lang spielte sie mit dem Gedanken, die Recherche für den Vortrag zu verschieben und sich mit Per einen schönen Abend zu machen, verwarf den Gedanken jedoch sofort. Ihr Studium abzuschließen, um auf eigenen Füßen zu stehen, war wichtiger als Kontakte in die High Society. »Du, danke, ein anderes Mal gerne. Ich nehme die S-Bahn. Wollte sowieso noch etwas arbeiten, und das passt bestimmt nicht in Pers Pläne.«
Als Jana kurz nach Mitternacht ihre Wohnung aufschloss, fühlte sie sich ausgelassen und unbeschwert. Der Schampus war ihr im Laufe der Fahrt noch mehr in den Kopf gestiegen. »… irgend so ein Schnucki mit ’ner Riesenjacht …«, trällerte sie den Ohrwurm, der sich im Hoppegarten in ihrem Kopf festgesetzt hatte, warf ihren Mantel mit Schwung auf den Haken in der Diele und ging ins Wohnzimmer. Dort klappte sie ihren Rechner auf, ließ sich auf ihren Bürostuhl plumpsen und drückte den Startknopf. Ihr war ein wenig schwindlig. Sie massierte ihre Stirn, zog die Hände bis zu den Wangen nach unten und spähte über die Fingerspitzen auf den Bildschirm. Er zeigte verschiedene Artikel zur »Fackel der Gerechtigkeit«.
»Na, ›Fackel‹, wie bist du so drauf?« Ihre Ängste vom Nachmittag kamen ihr kleinmütig vor. Sie dachte an die gelassen zur Schau getragene Selbstsicherheit der Partygäste im Hoppegarten. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, hieß es schließlich nicht umsonst. Ja, natürlich musste sie ausreichenden Sicherheitsabstand halten. Das änderte nichts an der Tatsache, dass sie herausfinden musste, was solche Leute zu derartig abscheulichen Taten trieb. Jana griff nach der Espressotasse, die vom Nachmittag noch halbvoll neben ihrem Rechner stand. Der Kaffee war natürlich längst kalt. Es schüttelte sie, als die bittere Flüssigkeit durch ihre Kehle rann.
»Wir gehen auf Nummer sicher.« Erfüllt von Zuversicht, das Richtige zu tun, rief sie »web.de« auf, um sich eine neue E-Mail-Adresse anzulegen. Mit einer unauffälligen Adresse bei einem der größten Anbieter kostenloser E-Mail-Kennungen würde sie kein Aufsehen erregen. Welchen Namen geben wir der Kennung?
»Wer bin ich, ›Fackel der Gerechtigkeit‹?«, murmelte Jana. »Wer bin ich? Jedenfalls geht dich das nichts an.«
Tante Greta sagte immer, egal ist 88, erinnerte sich Jana. Zweimal 88 ist scheißegal.
Mit der Kennung »wbi8888« – wer bin ich? Scheißegal! – konnte sie die »Fackel der Gerechtigkeit« aus sicherer Entfernung ausforschen und herausfinden, wie er und seine Anhänger tickten.
Das Anlegen der E-Mail-Kennung dauerte keine zwei Minuten. Die Anmeldemaske fragte nach ihrem Namen, ihrer Adresse und ihrem Geburtsdatum. Jana kicherte, als sie »Joachim Müller«, »5.6.1987« und »München« eintrug.
»Jana, du hast einen Schwips«, gluckste sie, nachdem sie die Maske fertig ausgefüllt hatte, und ließ ihren rechten Zeigefinger mit einer weit ausholenden Bewegung am gestreckten Arm auf die Enter-Taste fallen. »So, ›wbi8888‹, die Jagd kann losgehen!«
Anschließend richtete sie sich ein weiteres Postfach auf ihrem Rechner ein, um bequemer auf die Nachrichten der neuen Mailadresse zugreifen zu können. In mehreren einschlägigen Foren stellte sie ihre Fragen und forderte die Fackel und seine Unterstützer auf, »[email protected]« Rede und Antwort zu stehen. Dann klappte sie den Rechner zu und ging schlafen. Es war Viertel nach drei, und ihr Kopf brummte nicht nur vom Alkohol.
Als Jana am nächsten Morgen auf ihren Wecker blickte und sah, dass es schon fast elf war, war sie schlagartig hellwach. Hektisch sprang sie auf, duschte und schlüpfte mit nassen Haaren in ihre Kleider. Um zwölf war ihr Vorstellungsgespräch in der Whiskybar »Fàilte!«, wozu sie auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Sie hatte schon den Mantel in der Hand, um hinaus in Richtung S-Bahn zu stürzen, als sie wieder an ihre Anfragen aus der letzten Nacht dachte. Hin- und hergerissen spähte sie ins Wohnzimmer, wo der Laptop zusammengeklappt auf dem Schreibtisch lag.
»Okay, zwei Minuten«, genehmigte sie sich und flitzte zu ihrem Arbeitsplatz, um unter »[email protected]« nachzusehen, ob sich bereits etwas getan hatte. Ihr fiel auf, dass der Rechner eigenartig heiß war und der Lüfter auf vollen Touren lief. Dabei war sie sich sicher, dass sie ihn wie immer in den Bereitschaftsmodus heruntergefahren hatte. Mit fliegenden Fingern rief sie das neue Postfach auf und stellte fest, dass sie tatsächlich zwei E-Mails erhalten hatte. Ihr Herz klopfte, als sie die erste öffnete.
von: Abu Mujahed <[email protected]>
Betreff: Streiter für die gerechte Sache!
Du willst für die Sache Gottes kämpfen? Schließ dich uns an! Wer bist du? Wo wohnst du?
Allahu akbar
Jana schluckte. Mit so einer Antwort hatte sie nicht gerechnet. Und sie würde mit diesen Leuten ganz sicher nicht direkt verkehren, selbst wenn sie nichts in Erfahrung brächte. Mit geringeren Erwartungen öffnete sie den zweiten Eingang.
von: Kameradschaft Achatz Hilger <[email protected]>
Betreff: Treffen
Kamerad, willst du mit uns für die gemeinsame Sache eintreten und die Ehre Deutschlands wiederherstellen?
Schließ dich uns an! Antworte auf diese E-Mail, damit wir wissen, wo wir dich treffen können.
HH, Achatz
Jana schüttelte den Kopf und löschte die beiden E-Mails. Sie stellte den Laptop auf Stand-by und klappte den Deckel zu. Der Lüfter schaltete auf höchste Drehzahl und pustete heiße Luft gegen ihre linke Hand, die auf der Schreibtischplatte lag. Der neue Rechner war doch nicht etwa kaputt? Um das herauszufinden, hatte sie jetzt keine Zeit. Wollte sie rechtzeitig zu ihrem Vorstellungsgespräch in der Bar sein, musste sie sich sputen.
Als Jana die Wohnung verließ, hatte sie das merkwürdige Verhalten des Rechners schon vergessen. Auf dem Weg nach unten rief sie ihre Tante Greta an, um von ihr noch schnell so viel wie möglich über Whisky zu erfahren. Greta war die einzige Person, die sie kannte, mit der sie über Kaffee fachsimpeln konnte, und Jana wusste, dass sie auf den Gebieten Käse, Wein und eben Whisky ähnlich gut beschlagen war.
Kapitel 3
Samstag, 10. Oktober 2020 – Friedrichshain, Berlin
Als Jana an der Whiskybar ankam, blieben ihr fünf Minuten Zeit bis zum vereinbarten Termin. Im spiegelnden Rauchglas der Eingangstür überprüfte sie ihr Äußeres und zupfte den Schal zurecht, mit dem sie für diesen Anlass frische Farben in ihre übliche bequem-lässige, eher schlichte Kleidung aus Kuschelpullover und Jeans brachte. Du hast genau eine Gelegenheit, einen guten ersten Eindruck zu machen, sagte Tante Greta immer. Neben der Tür hing die Getränkekarte. Jana stellte fest, dass das »Fàilte!« 117 verschiedene Whiskys, neun verschiedene Mineralwasser und drei reinsortige Kaffees führte. Entweder war das ein Laden ganz nach ihrem puristischen Geschmack oder völlig abgedreht. Sie sah auf die Uhr: zwei Minuten vor zwölf. Jana atmete tief durch und öffnete die Tür. Drinnen empfing sie eine gediegene Atmosphäre: dunkles Holz, lederne Clubsessel, Bilder von Golfspielern und Fliegenfischern.
Das sieht nach guten Trinkgeldern aus, freute sie sich.
»Fàilte, Jana!«, rief eine rauchige Stimme vom Tresen. »Ciamar a tha thu?«
»Wie bitte?« Jana krauste die Stirn und spähte zur Theke, doch sie konnte niemanden entdecken. Hinter dem Ausschank stand eine Tür offen, die in einen Lagerraum führte. Sie wollte gerade darauf zugehen, als ein Mann Anfang 40 in der Tür auftauchte, die Theke umkurvte und mit ausgestrecktem Arm auf sie zukam.
»Das ist Gälisch, die Sprache meiner Heimat Islay, und heißt ›Willkommen, Jana, wie geht es dir?‹«
Sein Deutsch war fehlerfrei, wenngleich mit einem starken Akzent, wobei sein gutturales R am meisten auffiel. Er überragte Jana fast um einen Kopf, seine roten Haare wallten ihm offen über die Schultern – und er trug einen Kilt. Seine Pranke packte ihre Hand, und Jana unterdrückte einen Schmerzenslaut.
»Danke, mir geht es gut«, erwiderte sie und knetete verstohlen ihre Fingerknöchel. »Und ich bin beeindruckt: Sie haben ja eine imposante Karte, Herr Bayne. Ich bin wirklich beeindruckt.«
»Das freut mich zu hören! Nenn mich bitte Iain und sag du zu mir. Förmlichkeiten vertragen sich nicht mit dem Genuss edlen Whiskys.«
Iain und seine Bar gefielen Jana immer besser, und sie hatte den Eindruck, dass auch er sie mochte. Er bat sie mit einer einladenden Geste an den Tresen, was ihr das Gefühl gab, den Job so gut wie in der Tasche zu haben. Jana setzte sich auf den Stuhl, den Iain ihr zurechtschob, reckte den Hals und sah ihn offen an.
»Ich hoffe, du kennst dich mit Whisky aus?«
»Hmm, ich denke schon.«
»Malt, Single Malt, Blend, Bourbon?«
Bei jedem der Begriffe nickte Jana zustimmend.
»Kennst du den Unterschied zwischen Whisky und Whiskey mit ›e‹?«
»Klar, der mit ›e‹ ist aus Irland«, antwortete sie.
»Und, kannst du darüber ein bisschen ausführlicher erzählen?«
Sie sah Iain fragend an.
»Irischer Whiskey, schön, aber das reicht mir nicht. Was ist das Besondere daran? Pot Still? Grüne Gerste?« Seine Stimme bekam einen ungeduldigen Unterton, der Jana unwillkürlich an die des Fremdprüfers in ihrer mündlichen Abiturprüfung erinnerte. Als sie nicht antwortete, sah er fast enttäuscht auf sie herab. Janas Gesicht glühte auf. Nach der halbstündigen Druckbetankung in Sachen Whisky-Wissen durch Tante Greta hatte sie sich als Expertin gefühlt. Jana versteifte sich. Kampflos wollte sie trotzdem nicht aufgeben.
»Okay, als Whisky-Expertin kann ich vielleicht nicht durchgehen.« Sie setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf. »Aber unter Umständen kann ich Sie, äh, dich auf eine andere Art beeindrucken …«
Iain zog die rechte Augenbraue empor.
»Ich habe gesehen, dass du drei reinsortige Kaffees auf der Karte hast.«
»Ja, sicher. Meine Gäste sind anspruchsvoll.«
»Warum führst du drei sehr kräftige, eher säurereiche Sorten und keine einzige milde?«
»Was würdest du denn vorschlagen?«
»Vielleicht einen Maragogype, zum Beispiel aus Mexiko?«
»Oha, keine Whisky-, aber dafür Kaffeeexpertin? Haben deine Eltern eine Rösterei?«
»Nein«, erwiderte Jana, »das ist ein Tick von mir, den ich mir eigentlich nicht leisten kann. Faule Kompromisse hasse ich.«
»Du hasst also faule Kompromisse«, wiederholte der Barbesitzer und griff hinter sich in einen Schrank. Wortlos stellte er sechs Gläser vor sie und goss aus verschiedenen Flaschen ein.
»Ardbeg aus meiner Heimat Islay, The Glenlivet, Slyr, Yamakazi, Jameson – einer mit ›e‹.« Dabei lächelte er sie auf eine Art an, von der sie nicht hätte sagen können, ob sie spöttisch oder verschwörerisch war. »Und der Vollständigkeit halber etwas von dem grauenvollen Zeugs, das die Amis brennen.«
»Ein Bourbon?«
»Ja, Kentucky, Sour Mash. Probier den zuerst. Dann hast du es hinter dir.«
»Soll das heißen, dass ich den Job habe?«
»Wir können es ja mal miteinander versuchen«, sagte er gedehnt. »Aber du musst wissen, wovon du redest, dich mit Whisky solide auskennen. Mit zusammengegoogeltem Halbwissen vergraulst du mir meine Gäste.«
Geraume Zeit später trat Jana ins Freie. Der Whisky in ihrem Bauch wärmte sie so sehr, dass sie die kühle Luft kaum spürte. Sie hatte den Job und in ihrer Handtasche zehn Fläschchen ausgefallener Whiskys, die sie bis zu ihrer ersten Schicht kennen musste.
Am nächsten Morgen wachte Jana gegen acht auf und tappte im Halbschlaf in Richtung Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Weil ihr aus dem Wohnzimmer ein seltsames Rauschen entgegendrang, bog sie ab und bemerkte, dass an ihrem Klapprechner ein gelbes Licht blinkte. Jana wunderte sich – normalerweise sah man an dem Rechner nur blaue und grüne Lichter – und trat näher heran. Sie hörte, dass der Lüfter wie verrückt arbeitete, hielt die Hand an die Lüftungsschlitze und zuckte zurück. Das Metallgitter war so heiß, dass sie sich fast verbrannt hatte, und das, obwohl der Computer im Bereitschaftsmodus nichts tun sollte.
»Was machst du denn für einen Unfug?«, grummelte sie und klappte den Laptop auf. Der Bildschirm war schwarz. Sie drückte den Startknopf, ihre Arbeitsfläche leuchtete auf und zeigte das, was sie auch am Vortag vor ihrem Aufbruch ins »Fàilte!« gesehen hatte. Probeweise verschob sie mit der Maus ein paar Fenster und öffnete eine Datei. Alles schien einwandfrei zu funktionieren. Sie zuckte mit den Schultern und klickte sich zu ihrem neuen Postfach. Heute Morgen gab es nicht nur zwei E-Mails auf »[email protected]«, sondern 48. Sie begann die Nachrichten zu lesen. Es waren durchgängig plumpe Anwerbeversuche von Islamisten oder Neonazis.
»Warum Islamisten und Neonazis und nicht zur Abwechslung Kommunisten oder Esoteriker?«, knurrte sie, ohne dass der Sarkasmus ihre Stimmung besserte. Die Sache wurde ihr unheimlich. Und überhaupt: Sie hatte sich in den Internetforen an Islamisten gewandt. Wieso belästigten sie auch Neonazis?
Verärgert legte sie die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. »Alles Deppen«, murmelte sie und löschte kurz entschlossen alle E-Mails auf einen Schlag. Danach saß sie einige Sekunden regungslos vor ihrem Rechner und lauschte dem Lüfter, der weiterhin auf vollen Touren lief. Weil ihr nichts Besseres einfiel, hob sie das Notebook an und prüfte, ob vielleicht Staub den Lüftungsschacht blockierte, doch sie fand nichts. Die Erkenntnis, praktisch nichts über ihren Computer zu wissen, ernüchterte sie. Sie spitzte die Lippen und stellte das Gerät zurück auf den Schreibtisch.
»Was soll’s. Ist ja noch Garantie drauf«, beruhigte sie sich und beschloss, das seltsame Verhalten fürs Erste zu übergehen. Wie meistens klickte sie sich zuerst auf ihre Facebook-Seite. Dort stand nichts Wichtiges, ebenso wenig bei Instagram oder in ihren E-Mails. Gerade wollte sie den Rechner ausschalten, als eine neue Nachricht in ihrem privaten elektronischen Postfach aufleuchtete. Sie öffnete die Nachricht und las:
von: Abu Mujahed
Betreff: Streiter für die gerechte Sache!
Jana, du möchtest für die Sache Gottes kämpfen? Schließ dich uns an! Willst du uns nicht sagen, wo du wohnst? Die Brüder in Berlin freuen sich darauf, dich kennenzulernen!
Allahu akbar
Jana stieß den Rechner von sich. Ihr Herz raste.
»Das darf nicht wahr sein! Wie um alles in der Welt sind die auf Berlin, an meinen Namen und an meine richtige E-Mail-Adresse gekommen?«
Kapitel 4
Montag, 12. Oktober 2020 – Wilhelmsruh, Berlin
Jana fühlte sich wie gerädert. Sie lag auf dem Rücken in ihrem Bett, Arme und Beine von sich gestreckt, und starrte an die Decke. Die ganze Nacht hatte sie kaum ein Auge zugetan. Inzwischen graute der Morgen, und erstes Licht fiel durch die Ritzen zwischen den Lamellen der Rollos. Ihre Lippen verzogen sich zu einem bitteren Lächeln bei dem Gedanken, wie lange sie mit sich gerungen hatte, die Teile anzuschaffen. Sie mochte weder Vorhänge noch Rollos, aber ihre Fenster hatten keine Rollläden, und im Hellen konnte sie nicht schlafen. Das waren damals Probleme! Inzwischen raubte ihr die Frage den dringend nötigen Schlaf, wie Abu Mujahed, wer auch immer sich hinter dem Namen verbarg, an ihre wahre Identität und E-Mail-Adresse gekommen war.
»So geht das nicht«, zischte sie, richtete ihren Oberkörper auf und ballte die Fäuste.
Ihr Blick fiel auf die Folge von Picasso-Stierbildern an der Wand, neben drei japanischen Kalligrafien im Wohnzimmer der einzige Wandschmuck in ihrer Wohnung. Es faszinierte sie, wie Picasso in wenigen Schritten das Wesentliche an einem Stier herausgearbeitet, in der letzten Zeichnung mit lediglich fünf Strichen auf den Punkt gebracht hatte.
Was war das Wesentliche in ihrer Lage? Irgendwelche Leute wollten etwas von ihr, wollten sie für Zwecke vereinnahmen, die sie verabscheute. Nicht mit mir!, ärgerte sie sich. Ich tanze nicht nach eurer Pfeife! Mit einem Satz war sie aus dem Bett und marschierte erbost in einer Art Stechschritt zu ihrem Rechner. Dort begann sie nach allen möglichen Kombinationen und Teilen der Begriffe »Abu Mujahed«, »Streiter Gottes« und »Kameradschaft Achatz Hilger« im Internet zu suchen. Sogar die Serveradresse aus Achatz’ E-Mail gab sie im Browser ein: »wsgh.net«, allem Anschein nach eine Poker-Seite in China. Sie fand nichts Brauchbares. Wenigstens stellte sich das beruhigende Gefühl ein, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Es hielt nicht lange an. Eine hartnäckige Stimme in ihrem Hinterkopf wurde nicht müde zu betonen, dass etwas nicht stimmte.
Jana blähte die Backen und sah auf die Uhr: gleich halb neun. Übernächtigt machte sie sich auf den Weg zur Uni. Ihre Hoffnung, dass die Routine sie wenigstens ein bisschen ablenken würde, erfüllte sich nicht. Die erste Vorlesung zog wie ein unscharfer Film an ihr vorbei. Gegen elf verließ sie den Hörsaal und zermarterte sich das Hirn darüber, ob das unerklärliche Heißlaufen ihres Rechners etwas damit zu tun haben könnte, dass sie widerliche und an sie persönlich gerichtete Spam-Nachrichten auf ihre normale E-Mail-Adresse bekam. Schließlich war ihr Computer die einzige Verbindung zwischen der anonymen »wbi8888«-Adresse und ihrer richtigen.
Auf dem Gang kam ihr Wibke entgegen. Ihre Bekannte hatte dunkle Ringe unter den Augen wie Jana selbst. Im Gegensatz zu ihr lächelte Wibke jedoch glücklich. Die Nacht war lang und schön gewesen, schloss Jana. Schnell verwarf sie die Hoffnung, mit Wibke über ihre Probleme reden zu können. Ein andermal vielleicht, aber heute Morgen würde Wibke kaum eine Hilfe sein. Jana beschloss, sich ihr gegenüber nichts von ihren Sorgen anmerken zu lassen.
»Gott sei Dank! Du lebst noch!«, begrüßte sie ihre Freundin.
»Wieso sollte ich nicht mehr leben?« Wibke gluckste.
»Na, immerhin warst du seit gestern Abend um sechs nicht mehr online auf Whatsapp, und ans Telefon bist du auch nicht gegangen. Was ist denn los?«
»Haucke – der Grund heißt Haucke.«
»Heißt so der Knabe aus dem Hoppegarten, dessentwegen ich vorgestern mit der S-Bahn zurückfahren musste?« Es klang nach Vorwurf und so gar nicht nach dem unbeschwerten Plauderton, den sie beabsichtigt hatte. Als ob sie Wibke ihre Eroberung missgönnte. Jana gab sich einen Ruck und lächelte herzlich. »Mir scheint, es hat sich gelohnt.«
Wibke zwinkerte ihr zu. »Warum sind denn so wenige da? Sag nicht, dass ich mich zu dieser nachtschlafenden Zeit herschleppe, und die Vorlesung fällt aus.«
»Nachtschlafend? Es ist immerhin gleich elf.«
»Du hast gut reden! Obwohl, warst du nicht gestern in dieser Bar? Die machen doch sicher nicht vor zwei zu. Oder hast du es dir anders überlegt mit dem Job?«
»Gestern war das Vorstellungsgespräch. Morgen ist meine erste Schicht. Die geht bis halb zwei.«
»Bis halb zwei schuften? Mir wäre das zu stressig.«
»Ich brauche eben das Geld«, murrte Jana.
»Was ist mit deinen Eltern? Geben die dir nichts?«
Einen Moment überlegte Jana, ob sie Wibke erklären sollte, warum sie zu stolz war, ihren Vater anzubetteln, dass sie lieber bis spät nachts arbeitete und sich einschränkte, als Abstriche an ihrer Unabhängigkeit zuzulassen, da bemerkte sie einen jungen Mann, der geradewegs auf sie zukam: Nils! Sein schmales Gesicht, das spitze Kinn und die wachen, grauen Augen hinter der Nickelbrille mit den runden Gläsern hätten ihm ein professorales Aussehen gegeben. Hätten, denn mit seinem fast bartlosen Gesicht und der aschblonden Stoppelfrisur wirkte er unreif wie früher als Schüler. Weder hatte er diesen schlaksigen Gang eines Halbwüchsigen abgelegt, noch achtete er auf sein Äußeres, alles genauso wie vor zwei Jahren, als sie zusammen ihr Abitur gemacht hatten. Das reinste Kontrastprogramm zu Wibke, die selbst heute, nach einer durchgemachten Nacht, mit Pumps, Minirock, karminrotem Blazer und selbstverständlich im gleichen Farbton lackierten Nägeln elegant und wie aus dem Ei gepellt auftrat.
»Hallo, Nils«, grüßte sie tonlos. »Bist du auch auf der HU?«
»Nein, ich studiere ITM an der TU. Hier höre ich nur Ludification als Gast.«
Jana hatte keinen blassen Schimmer, was Ludification oder ITM bedeutete. Ihre Gedanken rasten, ob sie Nils Wibke vorstellen sollte oder besser nicht. Was, wenn Wibke dabei erführe, dass sie jahrelang mit ihrer Mutter in einer Sozialwohnung in einem heruntergekommenen Stadtteil Kölns gewohnt hatte? Jana spürte, dass sie rot anlief, und nestelte an ihrem Schal, um Zeit zu schinden. Nils zog seine linke Augenbraue nach oben, räusperte sich in das unerquickliche Schweigen hinein und sagte: »Ich muss zur Vorlesung – man sieht sich.« Damit ließ er die beiden Frauen stehen und ging weiter.
»Wer war das denn?«, lästerte Wibke gerade laut genug, dass Nils sie nicht hören konnte. »Bitte sag, dass du mit dem nie etwas hattest.«
Gewissensbisse flackerten in Jana auf, denn Nils ließ nie jemanden im Stich und hätte sie sicher bei niemandem verleugnet. Wibke sah sie lauernd an. Werden wir richtige Freundinnen oder sind wir ein Zweckbündnis? Du bringst mich mit interessanten Leuten zusammen, und weil zwei schöne Frauen größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen als eine, nimmst du mich mit?
»Natürlich nicht«, wiegelte Jana ab. »Ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal eine Freundin hatte. Wir waren bloß auf derselben Schule in Köln.«
»Ist ja egal. Es gibt genug interessante Typen und auf so einen bist du glücklicherweise nicht angewiesen. Warst du schon mal bei einem Pferderennen? Nein? Das geht ja gar nicht! Freitag ist Renntag im Hoppegarten, und ich gehe mit Haucke hin. Wenn du willst, bringt er einen schicken Kollegen mit.« Wibke zwinkerte verschwörerisch.
»Mal sehen«, wich sie aus und entschloss sich, eine Lanze für Nils zu brechen. »Du unterschätzt Nils, wenn du ihn nur nach seinem Äußeren beurteilst. Der hat echt was drauf. Es gab noch kein Computerproblem, das der nicht im Handumdrehen gelöst hat, und wenn wenigstens die Hälfte der Geschichten stimmt, die über ihn in Köln die Runde machen, ist er ein Hacker, der selbst in Regierungsrechner reinkommt.«
Wibke zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst. Manchmal kann man so jemanden ja gebrauchen.«
In den folgenden Tagen fuhr Jana ihren Rechner nicht ein einziges Mal hoch. Ihre Seminararbeit bearbeitete sie an öffentlichen Computern der Uni. Um mit den Freunden in Kontakt zu bleiben, schnell etwas im Netz zu recherchieren, selbst um Videos zu schauen, benutzte sie das Smartphone. Einmal lugte sie via Smartphone in ihre E-Mails – 684 neue Nachrichten, die meisten von der Art, die sie überhaupt nicht sehen wollte. Am Donnerstag spät abends wollte Jana vor dem Schlafengehen nach neuen Nachrichten sehen und griff zu ihrem Smartphone. Der jüngste Eintrag auf Whatsapp stammte von jemandem, der sich Achatz nannte. Sie kannte niemanden dieses Namens, wenn man vom Absender der Neonazi-E-Mails an »wbi8888« absah. Ihre Hand zitterte, als sie die Meldung öffnete.
Jana, willst du mit uns für die gemeinsame Sache eintreten und die Ehre Deutschlands wiederherstellen?
Wo kann ich dich treffen?
HH, Achatz





























