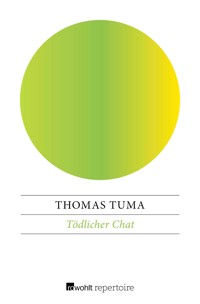
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei grausam ermordete Tote an zwei Wochenenden. Das Einzige, was die Opfer verbindet, ist ihre Leidenschaft für den Chat im Netz. Der junge Reporter Marc Pohl wittert die Story seines Lebens – Hauptsache, der Killer macht weiter. Denn in der Boulevardpresse gilt: Zwei Morde sind ein Alarmzeichen, drei ein Glücksfall. Das nächste Wochenende steht kurz bevor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Thomas Tuma
Tödlicher Chat
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Zwei grausam ermordete Tote an zwei Wochenenden. Das Einzige, was die Opfer verbindet, ist ihre Leidenschaft für den Chat im Netz. Der junge Reporter Marc Pohl wittert die Story seines Lebens – Hauptsache, der Killer macht weiter. Denn in der Boulevardpresse gilt: Zwei Morde sind ein Alarmzeichen, drei ein Glücksfall. Das nächste Wochenende steht kurz bevor …
Über Thomas Tuma
Thomas Tuma, geboren 1964, ist Autor und seit November 2013 stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts.
Inhaltsübersicht
Auf der CD «4:99» eröffneten die Fantastischen Vier ihren 99er Sommerhit «MfG» mit den Worten: «Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet …» Die folgende Geschichte ist frei erfunden, auch wenn ihr Grundgedanke morgen Wirklichkeit werden könnte. Prominente Namen tauchen nur als Kulisse auf. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen in der realen wie virtuellen Welt wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
«Es ist ein dreckiger und lächerlicher Job, Cher zu sein.
Aber irgendjemand muss ihn ja machen.»
Cher
«Vielleicht ist die Außenwelt nur ein Traum,
und nichts außer uns existiert.»
Bertrand Russell
Teil I: Die Innenwelt …
1/Ein Ende
Ends (Everlast)
Es ist nur eine Möglichkeit, obwohl sein Assi am Telefon gleich Parallelen zu einem ähnlichen Fall vor acht Jahren zog. Falsche Parallelen, wie sich schnell herausstellen würde. Es ist nur ein Mord. Ja. Ein Einzelfall? Nein. Egal. Polizeioberkommissar Klaus Sturm hat mit der folgenden Geschichte ohnehin nichts zu tun. Aber Sturm ist der Erste, der sich darüber Gedanken machen muss. Er wird nicht weit kommen. So viel ist sicher. Schon jetzt, als er seinen auberginefarbenen Dienst-VW-Passat vor dem Flughafen-Hotel im Erdinger Moos bei München parkt.
Es ist einer dieser typischen Schlafbunker mit einem Parkplatz so groß wie das Bauernnest daneben: cremefarbene Waschbetonfassade, multifimktionale Frühstücks- und Restauranthalle und Tagungsräume, die «Zugspitze» heißen und «Wetterstein», mit Overhead-Projektor und Flipchart. Über dem Marmortresen der Rezeption hängt an Messingkettchen ein furniertes Holzbrettchen: «Quick Check-In/ -Out». Sturm kennt das Hotel von einem Seminar des LKA, das er vor zwei Jahren besuchte. Zwei Tage lang ging es um Täterprofile oder so was. Vollpension, Kaffeepause, sonstige Getränke exklusive.
Es ist Mitte Juli. Es ist schwül. Es ist Urlaubszeit. Es ist kurz nach elf Uhr, als Sturm das Hotel betritt und mit der gläsernen Aufzugsgondel in den dritten Stock schwebt. Durch die Deckenlautsprecher tropft irgendein düsterer Radio-Song auf ihn herab. Eine weiche Frauenstimme beginnt gerade «Everything must change» zu singen. Doch dann wird sie von einem dieser US-Rapper überrumpelt. Sturm hat keine Ahnung, weshalb man in Aufzügen Musik hören muss. Keine Ahnung, wieso Fahrstühle so gern transparent gebaut werden. Vielleicht, damit man nicht immer nur an dem Menschen neben einem vorbeischauen musste, sondern auch eine Aussicht bekam auf ein anderes Nichts.
1. 2. 3. Pling. Ein Stöhnen schwillt durch den Flur heran. «Ja, tiefer», röchelt eine Frauenstimme. Vor Zimmer 317 stehen Kollegen von Sturm, daneben drei unbekannte Männer. Es stinkt. Es stinkt widerwärtig nach Parfüm. Irgendwas Billiges, irgendwas für die moderne Frau um die vierzig, die in letzter Verzweiflung, ihrem Mann nochmal etwas beweisen zu wollen, bei Douglas ihre Haushaltskasse ruiniert. «Besorg’s mir», stöhnt die Stimme.
Der Hotelmanager steht mit weit aufgerissenen Augen im Türrahmen, walkt seine Hände und sagt: «Wir wollten nicht, dass dieser …» Er bricht wieder ab. Er ist bleich unter seiner Piz-Buin-Bräune. Das mit Gel gebändigte Haar sieht lächerlich aus. Hotelmanagermode Deutschland 1999. «Dieser Geruch … Sie wissen schon … die anderen Gäste sollen so wenig wie möglich mitkriegen … Wir haben gerade fünfzig Leute von einem BMW-Fahrertraining hier … Das sind wirklich gute Kunden … Also … Wenn die mitkriegen, was hier los ist …»
Sturm weiß noch nicht genau, was hier los ist. Der Hotelmensch glotzt wieder ängstlich den Flur entlang.
«Und deshalb mussten Sie gleich das ganze Zimmer in einen orientalischen Puff verwandeln, oder was?», murmelt Sturm und taucht ab in den höhlengleich düsteren Raum.
Auf der violett-braun-grün gesprenkelten Überdecke liegt eine nackte Frau oder besser das, was von ihr noch übrig ist. Anfang dreißig, schätzt Sturm. Ihre Handrücken scheinen am Kopfende des Bettes zu kleben. Ihr Körper ist aufgeschnitten. Bilder, schießt es Sturm durch den Kopf, es sind nur Bilder. Bilder.
Er versucht, an den Kosovo zu denken, das ist weiter weg, an eines dieser Schulmassaker, die neuerdings häufiger zu sehen sind in «Explosiv» und «Brisant», oder an irgendeinen Horrorfilm, wo er solche Effekte immer bewundert. Aber das hier ist die Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die er bislang nicht für möglich gehalten hätte.
Sturm hat viele Tote gesehen. Oft waren es Unfälle, manchmal die pure Altersschwäche, oder den Mördern ging es um bloße Auslöschung. Aus Hass. Aus Eifersucht. Aus Habgier. Aus Angst. Flash. Die Blitze des Fotografen von der Spurensicherung zerhacken seine Gedanken.
«Mach doch mal einer diese Scheißvorhänge auf», mault er, hört das Surren der Vorhangringe, zuckt kurz unter der überraschenden Helligkeit zusammen und registriert die kleine Doppelzimmerwabe in ihrer plötzlichen Armseligkeit. In Stichworten. Das Übliche.
Rechts ein Kunstdruck an der Wand, dessen Rahmen wahrscheinlich teurer war als das Bild. Irgendwas Buntes, Abstraktes, das seit zehn Jahren die pastosen Zigeunerinnenporträts aus den Kaufhaus-Gemälde-Abteilungen verdrängt hat. Eine Kommode mit integriertem Schreibtisch. Helles Holz. Kristallener Aschenbecher. Kunstlederne Auflage mit bunten Prospekten. Fernseher. Pay-TV. Bilder. Ein vögelndes Paar in falschen, grellen Farben und Stimmen. Die Synchronsprecher grunzen am Original vorbei. Sturm schaltet ab.
«Gott sei Dank.» Von draußen lächelt der Hotelmanager herein. «Es ist nur … Wir wollten lieber nichts anfassen …»
Sturm dreht sich zum Flur. Er versucht ein nettes Gesicht, merkt aber, dass es misslingt. Er weiß, wie peinlich das ist, morgens beim Bezahlen eines Zimmers von einer appetitlichen Rezeptionsfee fröhlich gefragt zu werden: «Hatten Sie sonst noch was außer Telefon, Frühstück und …», dann werden sie immer noch lauter, «… Video?» Sie könnten auch lauthals ins Foyer schreien: «Wie gefiel Ihnen der Fickfilm?»
Sturm registriert weiter. Ein Bistro-Tischchen. Ein pinkfarbener Sessel. Links das Bett. Zwei Nachttischchen. Schallschutzfenster, die sich nicht öffnen lassen. Klimaanlage. Draußen wummert ein Airbus in den Himmel, randvoll mit Polyesteranzügen und Kunstlederköfferchen und Handys und Geschichten von Beförderungen und Rausschmissen und Seitensprungträumen und Kindergeburtstagserinnerungen.
Sturm und seine Frau haben keine Kinder. Seit vier Jahren versuchen sie es vergeblich, und Sturm kommt sich dabei immer häufiger wie ein Zuchtbulle vor.
«Scheiße», sagt er.
In der Ecke lehnt der Arzt. Er hat den Mund geöffnet, Schweißperlen auf der Stirn, den Blick an der Decke festgesaugt. Eine Viertelstunde vorher schaffte er es gerade noch, das Waschbecken zu erreichen, bevor er kotzen musste. Die Spurensicherung war auf hundertachtzig. Jetzt geht’s wieder, auch wenn die Fotoblitze augen- und ohrenbetäubend bleiben.
«Er hat sie ans Bett genagelt», sagt der Arzt. Er will es hinter sich bringen.
Sturm kapiert erst nicht.
«Die Hände», sagt der Arzt.
Christus am Kreuz, denkt Sturm und verbietet sich den Gedanken gleich wieder, weil er so albern nahe liegt. Er folgt dem Blick des Arztes und sieht es erst jetzt. «Öffne dich!» ist auf die Raufasertapete gegenüber dem Bett geschmiert. Flash.
«Blut?», fragt Sturm und dreht sich zu dem Arzt um.
«Kann sein», sagt der Arzt, ohne ihn anzublicken. Flash.
«Glauben Sie, sie hat das alles noch …»
«Keine Ahnung», fällt ihm der Arzt ins Wort, weil er auf die Frage gewartet hat. Weil er sie nicht hören will. Weil er sie sich selbst schon gestellt hat. Weil er sie hasst. «Kann sein. Kann sein, dass sie es noch gesehen hat. Dass sie das hier alles erlebt hat. Die Augen hat er ihr ja gelassen.» Der Arzt hat sichtlich Mühe fortzufahren: «Ihre Zunge ist herausgeschnitten. Keine Ahnung, was er mit der gemacht hat … Ich muss … die Obduktion … Ich hab so was noch nie … Wahnsinn.» Flash.
Der Arzt stößt sich von der Wand ab und geht, ohne die Frau noch einmal anzusehen.
Sturm steht vor dem Doppelbett und schaut in die weit aufgerissenen Augen der Toten. Der halb geöffnete Mund ist blutverschmiert, als sei der Frau ein roter Lippenstift abgerutscht. Ein dunkles Loch. Flash. Nach jedem Blitz fiept es, als sauge sich der Apparat wieder mit Energie aus seiner Umgebung voll.
Die verschwitzten brünetten Locken der Toten sind auf der Stirn angetrocknet. Diese Augen. Schöne braune Augen waren das. Aber sie haben allen Glanz verloren. Sie sind matt und leer, auch wenn sich darin Bilder eingebrannt haben. Ganz bestimmt. Auf dem Grund dieser Augen, denkt Sturm. Bilder. Geräusche. Sein Großhirn tobt.
Das Zimmer ist für drei Tage reserviert und vorher bar bezahlt worden von einem «Harald Schmidt». Der Name konnte nur ein Witz sein, denn als Wohnort wurde tatsächlich das Studio der Sat-l-Late-Night-Show in Köln angegeben. Sturm erkennt die Adresse sofort, weil er abends oft fernsieht, wenn seine Frau schon zu Bett gegangen ist, dann meist bei Schmidt hängen bleibt und dort immer diese Anschrift eingeblendet wird für Leute, die Schmidt Post schicken wollen. Manchmal liest Schmidt auch Briefe vor und macht sich darüber lustig. Das ärgert Sturm.
Niemand erinnert sich an den Gast, der am Freitag eincheckte. Kein Wunder, bei dem Rummel hier. Die kleine armenische Putzfrau hat Angst um ihren Job und radebrecht von Nie-offen-gehaben und Immer-Nicht-stören-Schild-an-die-Tür. Also wurde nicht gestört, nicht geputzt, nicht gegrübelt. Das handschriftliche Register des Frühstücksbüffets hat den Bewohner von Zimmer 317 jeden Tag aufgelistet. Einen Bewohner. Auch am Montag früh.
Drei Tage im Sommer 1999. Freitag bis Montag. Wie lange war die Frau hier? Wann begann die Folter? Wann endete sie? Er hat gefrühstückt. Jeden Morgen. Drei Tage. Drei Nächte. 72 Stunden. 4320 Minuten. Menschen sterben selten schnell. In einer einzigen Minute ist Platz für allerlei Ewigkeit.
Von der Toten existiert zunächst nichts als ihr Körper. Kein Personalausweis und kein Pass, keine Kleider und kein Ring mit Gravur, keine Scheckkarte, kein Portemonnaie, kein U-Bahn-Monatsticket und keine Familienfotos. Ihre Geschichte wurde akribisch weggewischt, entsorgt und ausradiert. Sturm könnte zur Tagesordnung übergehen, wenn nicht die Realität dieser Leiche wäre. Sie werden das Gesicht der Frau so zurechtschminken, dass das Foto für die Boulevardzeitungen taugt und übermorgen hunderttausendfach an den Kiosken von München hängt.
«Wer kennt diese Frau?» Es ist ein Mord. Nichts weiter. Bloß keine Details durchsickern lassen. Jetzt. Im Sommerloch. Wo sie aus jedem beschissenen Baggersee-Badeunfall einen Skandal schnitzen.
Sturm muss gelangweilt in die Runde schauen bei der Pressekonferenz vor der immer gleichen Polizeireporterclique, die genau wittert, wenn was faul ist. Gefährlich sind nicht die Alten mit den Säufernasen und den Schmerbäuchen unter den abgeschabten Sakkos, gefährlich sind die jungen Neueinsteiger. Die sind hungrig. So viel weiß Sturm mittlerweile. Er wird nur daneben sitzen, ernst schauen und dem Pressesprecher zunicken. Er hat für solche Auftritte immer die gleiche schwarze Lederkrawatte und dieselbe stoische Hackfresse parat.
Am besten sagt man sofort, dass noch geprüft werde, ob ein Sexualdelikt vorliege. Es wurde zwar nicht der Hauch einer Spermaspur entdeckt. Es wurde überhaupt nichts entdeckt: keine Fingerabdrücke, keine Zigarettenstummel, nichts. Auch keine Tatwaffen, ein Messer vielleicht, ein Hammer oder die Dose des Tränengases, das der Mörder benutzt haben muss. Null. Nur ein paar Fasern und etliche alte Fuß- und Fingernägel, die von Hunderten von Hotelgästen stammen könnten. Aber Sturm weiß, wie sie das in der Pressestelle hindengeln werden.
Sexualdelikt ist immer gut. Sexualdelikt klingt kurzfristig geil und mittelfristig derart langweilig, dass es keinen mehr interessieren wird. Es taugt in den Redaktionen als Verkaufsargument, wird entsprechend aufgeblasen und erreicht dann auch mehr neugierige Leser, denen die Tote vielleicht bekannt vorkommt. Ende der Woche werden Gesicht und Geschichte vergessen sein, weil dann die nächste Schülerin in irgendeinem einsamen S-Bahn-Loch vergewaltigt werden wird. Zimmer 317 ist nichts Besonderes. Es. War. Nur. Ein. Gewaltverbrechen. Von. Vielen. Punkt. Auch wenn die Regionalausgabe München eines großen Boulevardblatts das mit dem «Öffne dich!» an der Wand schreibt. Wer liest das schon? Wer vergisst das nicht gleich wieder?
Auf die Schlagzeilen vom Mittwoch melden sich insgesamt neun Anrufer. Eine Kollegin. Ein Exfreund. Ein Bruder. Zwei Immobilienmakler. Drei Bestattungsunternehmen. Ein Trödelhändler, der sich auf Haushaltsauflösungen spezialisiert hat. Die ersten drei sind sich einig, dass die Tote Gabriele Kohler heißt, dreiunddreißig Jahre alt und Sachbearbeiterin in einer großen Münchner Versicherung ist.
Hieß.
War.
Sie arbeitete mit einunddreißig Kollegen in einem Großraumbüro, dessen graue Schreibtische von spannstoffdrapierten, schlammfarbenen Sperrholzwänden voneinander getrennt sind. Das Großraumbüro ist eines von drei ihrer Abteilung. Die Abteilung ist eine von vier im Referat C. Referat C ist ein Bereich von acht innerhalb der Versicherung. Die Versicherung gehört zu 75 Prozent einem deutschen Mischkonzern, der an Banken, Industrieunternehmen und anderen Versicherungen beteiligt ist. Ihre Kollegen orakelten von einer drohenden Kündigungswelle. Gabi Kohler starb, ohne Genaueres zu wissen. Eine Entlassung war das Letzte, wovor sie sich am Ende fürchtete. Selbst vor dem Tod hatte sie zum Schluss keine Angst mehr.
Auf dem Bildschirmkasten ihres Computers kleben noch zwei Plastikfiguren aus Ferrero-Überraschungseiern: lachende Happy Hippos. An der rechten Seite hängt die Mallorca-Postkarte einer Kollegin: «Liebe Gabi, es ist Wahnsinn hier. Sonne, Sand und Meer. Wir haben heute früh bis 4 Uhr getanzt und sind dann … na, du weißt schon *grins* Viele liebe Grüße deine Iris».
Iris lebt. Gabi ist tot. Iris tupft sich mit einem umhäkelten Taschentuch über die trockenen Augen, sie kann sich das alles nicht erklären, weiß von keinem Freund, nur lockeren Bekanntschaften in dem Fitnessclub an der Leopoldstraße, mal einer aus dem Rechnungswesen, aber nur ein paar Wochen, und das ist schon ein Jahr her, der Letzte, soweit Iris weiß, und manchmal sei sie mit Gabi abends tanzen gegangen, mal hier, mal dort, früher, mit anderen Kolleginnen, mei, sie sei auf der Suche nach dem Märchenprinzen gewesen, aber ob’s den gibt, weiß auch Iris nicht, irgendwann laufe einem natürlich die Zeit davon, trotz aller Enttäuschungen, einer hat sie mal sitzen lassen wegen einer anderen, die Gabi, die Hochzeitsreise nach Las Vegas war schon gebucht, drei Jahre ist das bestimmt schon her, und danach hat sie sich die Haare kürzer geschnitten, moderner, die Gabi, nicht mehr diese endlos langen Locken bis zum Po.
Welche Rolle spielt es, dass auf dem Schreibtisch von Gabi Kohler nebeneinander drei schwarze Plastikschalen mit Aktendeckeln, Briefen und Telefonregistern liegen? Dass in den Schubladen sauber sortierte Kladden von Brandschadensfällen stecken, ein paar Stifte, Heftklammern, Stempel, eine Großpackung Aspirin+C, ganz hinten ein eingeschweißtes Kondom, laut Aufdruck mit Himbeergeschmack? Das könnte aber auch von Kohlers Vorgängerin stammen.
Büromöbel fressen im Laufe der Jahrzehnte die absurdesten Sachen in sich hinein. Neulich fand der Hausmeister bei einem Umzug einen klapprigen Vibrator, dessen Batteriesäure das Plastikgehäuse angefressen hatte. In einer Woche wird er alles in einen Pappkarton geräumt und an Kohlers Mutter geschickt haben. Nicht den Vibrator. Natürlich. Der war in einer anderen Abteilung, aber das Kondom. Kommentarlos. Er kannte Gabi Kohler nicht. An ihr Gesicht kann er sich nicht erinnern. Wenn er sie noch einmal sehen würde. Ja. Vielleicht. Die Frauen kommen und gehen.
Gabi Kohlers Mutter wird das Päckchen in einen der vierzehn Umzugskartons legen, in denen sie alles verpackt, was von ihrer Tochter nach der Auflösung der Zweizimmerwohnung in dem Giesinger Apartmentblock-Neubau übrig geblieben sein wird. Um die Möbel, das Futonbett und das verchromte CD-Türmchen will sich der Hausverwalter kümmern. Er habe da einen Abnehmer an der Hand, einen Trödelhändler, der sich auf Haushaltsauflösungen spezialisiert hat. Die Kaffeemaschine, die Stereoanlage, den tragbaren Fernseher und den Computer wird sie ihren drei Söhnen schenken, wie die Mikrowelle und die drei Lampen.
Die Beerdigung war sehr schön. Sogar der Kommissar war da, der ihr vorher nur gesagt hatte, dass Gabi ermordet worden sei, schnell, ohne Schmerzen, dass man alles tun werde, um den Mörder zu finden, und dass es besser sei, Gabi nicht noch einmal sehen zu wollen. Wirklich. Ein Fotograf wollte am offenen Grab Bilder machen. Der Kommissar bat ihn zu gehen. Ganz ruhig. Er klang traurig. Die Mutter nickte.
Sie wird nur das Beileidseinschreiben des Versicherungsvorstands behalten, das «ohne Unterschrift gültig» ist. Der Brief mit einem Verrechnungsscheck in Höhe von Gabi Kohlers letztem Nettogehalt (1954,47 Mark) «als kleine Geste unserer Anteilnahme» erreicht sie eine Woche nach dem Tod. Der Obduktionsbericht nennt den Montagmorgen als Todeszeitpunkt, aber das wird die Mutter nie erfahren. Für Rückfragen gibt die Versicherung eine Telefonnummer mit -0 am Ende an. Sie ruft nicht an. Warum auch? Es ist alles verpackt. Es ist alles geregelt. Es ist zu Ende.
Am 1. August wird eine andere junge Frau Gabi Kohlers höhenverstellbaren Drehsessel neu justieren. Und sie wird ihren eigenen kleinen Plüschmarienkäfer über den hässlich-klebrigen Fleck auf dem nackten PC pappen.
So was bringt Glück.
2/Ein Anfang
Heroes (David Bowie)
Karin Hensler trifft ihren Mörder unvorbereitet. Er hat keinen Termin. Er meldet sich nicht an unten im Foyer bei den ostdeutschen Pförtnern, die zehn Jahre nach dem Mauerfall noch immer angestrengt so tun, als seien sie irgendwann bei der Stasi gewesen. Er benutzt keinen der stählernen Aufzugssärge. Er kommt einfach in ihr Büro hier oben in den Schluchten des Commerzbank-Turms in der Frankfurter City, legt ihr Blumen auf die Tastatur ihres Computers und lächelt. Duftende, blutrote Rosen, die keiner ihrer Kollegen sehen kann. Ihr Gast ist unsichtbar, aber sehr charmant, obwohl er sie gleich duzt.
Karin hasst die Duzerei sonst leidenschaftlich. Vor einem Jahr oder so musste sie eine Hamburger Plattenfirma unter die Lupe nehmen, die an die Börse wollte. Jedes Mal, wenn sie in eines der ebenso frisch bezogenen wie bereits zugemüllten Backsteinbüros in einem umgebauten Hafenspeicher kam, grinste ihr ein Typ mit fettigen Locken, schwarzem T-Shirt mit Cannabis-Silhouette oder Abba-Druck und gepierctem Nasenflügel entgegen: «Hi du.» Und jedes Mal musste sich Karin beherrschen, um nicht loszuschnappen: «Pass mal auf, du kleiner Kacker. Wenn du nicht höflicher zu mir bist, dann kannst du deinen Hiwi-Job hier bald knicken.»
Sie wusste, dass sie es nicht sagen musste. Dass sie in solchen Momenten wie ein eiskalter, unerreichbarer Engel lächelte. Und dass die Typen vor ihr sich dann augenblicklich wie ein Haufen Scheiße fühlten. Manchmal genoss sie es. Manchmal hasste sie sich für ihre Unnahbarkeit.
Neulich war Karin mit Oliver beim Abiturstreffen ihres Jahrgangs zu Hause in Wertheim, das ihr mit jedem Jahr weiter entfernt vorkommt, obwohl es keine Autostunde von Frankfurt entfernt liegt. Wertheim ist wie Pinneberg oder Braunschweig oder Zwickau oder Erding. Es ist innerlich zerfressen vom Pizzahut-Benetton-Fielmann-Obi-Schlecker-Ketten-Virus, bewegt sich dabei aber langsamer als die Großstadt. Karin stört sich nicht an den Marken. Sie bewundert sie für ihre – Geborgenheit ausstrahlende – Allgegenwärtigkeit. Aber Wertheim ist Leben in Zeitlupe. Wertheim ist Wachkoma, aufgeschreckt vom seltenen abendlichen Geheul hochgetunter Golf-GTIs, deren Fahrer dann als plastikverpackte Blumensträußchen an irgendeiner Rechtskurve enden. Wertheim war jedes Mal, wenn sie hinkam, ein wenig moderner geworden – und dabei wieder ein Stück weiter in sich zusammengeschrumpelt wie die Freundinnen von Karins Mutter.
Am schlimmsten empfand sie bei dem Klassentreffen natürlich jene, die den Absprung nicht gesucht oder geschafft hatten und einfach hängen geblieben waren in der Überschaubarkeit ihres kleinstädtischen Beziehungsnestes. Aus Mädchen waren Mütter geworden mit sehr dicken Schenkeln, die noch immer am liebsten gemeinsam auf die Toilette gingen und durch die Trennwände kicherten. Träume hatten sich in Bausparverträge verwandelt und Jungs in Väter mit Pfeifentäschchen, knallfarbenen Freizeithemden (Lacoste!) und Goldrandbrillen wie die von Michael. Er war Karins erster Mann und der bislang vorletzte. Gott, wie das klingt. Sie waren beide siebzehn, es ging ein Jahr, und nun redeten sie kein Wort miteinander.
Noch schlimmer waren nur Karins alte Lehrer, die wieder einmal zusehen durften, wie das Leben an ihnen vorbeirauschte, sich einfach weiterentwickelte, während sie morgen früh in die arrogante Ahnungslosigkeit neuer Pickelgesichter glotzen durften. Manche dieser Lehrer hatten sich in eine Art innere Emigration gerettet, kleine Nischen aus Suhrkamp-Bücherwänden, alten Straßenkämpfergeschichten von Uni-Streiks, Wackersdorf oder Anti-Springer-Demonstrationen, griechischem Bergtee und Schulprojekten der Sorte «Wertheim im Dritten Reich». Karin konterte mit einer cremefarbenen Strickkleidhülle von Ipuri. Das reichte. Auch hier. Vor allem hier.
Eigentlich war es eine nette Jugend gewesen, dachte sie, eine Jugend mit «Hanni und Nanni», ein bisschen Bravo und ein bisschen Sex. Eine Jugend mit Genesis und Barclay James Harvest, Lagerfeuer an der Waldhütte, Blues-Brothers-Soundtrack, «We are the Champions»-Gegröle und Apfelschnaps-Orgien, Open-Air-Konzerten mit Ludwig Hirsch und Georges Moustaki, irgendwann einem «Why?»-Antikriegsposter im Mädchenzimmer (Pferdebilder fand Karin immer schrecklich kitschig) und Filmen wie «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» mit der Musik von David Bowie.
Mittlerweile trägt Bowie Armani-Anzüge und ist mit der Backlist seiner Hits an die Börse gegangen. Er hat Millionen verdient und seine «Heroes» als Werbejingle für eine Microsoft-Kampagne verhökert. Why not? Nachdem Karin den Song in einer Werbepause der «Harald Schmidt Show» hörte, ging sie zu WOM und kaufte sich die CD, nur der treibenden, euphorisch bis verzweifelten Melodie wegen. Der Text war ihr völlig egal. Musik bedeutet für sie Melodie. Melodie schafft Stimmung. Sprache schafft Verwirrung. Dachte sie damals.
Auf der Heimfahrt schob sie die CD in den Player und blies es sich in die Ohren, bevor sie den Zündschlüssel drehte. Sie fährt einen diamantschwarzen Z 3 von BMW. Karin und Oliver verließen das Klassentreffen als Erste, weil ihr ziemlich früh gedämmert hatte, dass sie selbst einen Teil dessen repräsentierte, worüber sie sich gerade lustig gemacht hatte. Oliver verstand das nicht. Komischerweise hatte sie mit ihm nie übers Heiraten geredet, selten übers Kinderkriegen, aber oft übers Kinderhaben. Sie sah in letzter Zeit häufig Kinder. Kinder mit Müttern. Kinder mit Vätern. Kinder mit Omis. Die jungen Eltern wirkten weniger verstört, vereinsamt, verschwitzt und verbittert, als Karin noch ein halbes Jahr vorher zu sehen glaubte.
Sie konnte das erklären. Irgendeine Hormonexplosion. Chemische Prozesse. Biologische Uhr. Sie kannte alle küchenpsychologischen Analysen aus ihren Frauenmagazinen. Aber das nützte nichts. Einmal war sie drauf und dran, morgens die Marvelon-Schachtel einfach liegen zu lassen, um die nächsten Monate zu sehen, was passierte. Die Chancen standen schlecht, dass viel passiert wäre außer einer unregelmäßigen Blutung und einem rötlichen Ausschlag am Hals.
Sex war für Karin meist Pflicht. Und selbst dann verglich sie ihn mit TV-Bildern irgendwelcher nächtlicher Erotik-Movies auf Pro Sieben oder Vox, denen die Realität selten standhielt. Wenn Oliver vorher geraucht hatte. Wenn er zu früh kam oder sie gar nicht. Wenn er dachte, dass sie dachte, dass er dachte, sie hätte Lust. Sie konnte keinen Weichzeichner vor die Augen klappen. Sie hatten auch wirklich selten Zeit. Sie wollten ihr Leben einrichten, bevor sie es lebten.
Oliver & Karin. Liebe ohne gemeinsames Klingelschild. Ein erster wilder Zungenkuss auf der Abiturfete, zitternde Leiber und verschwitzte Umarmungen, seine Bundeswehrzeit, ihr BWL-Studium, sein BWL-Studium, ihr halbes Jahr in Paris und das Trainee-Programm bei Bertelsmann, seine Praktika bei der Hypo-Bank in München und bei SAP in New York. Ihr Bewerbungsparcours bei der Commerzbank. Seiner bei Goldman Sachs. Ihr erstes Kostüm von Cerruti. Sein erster Joop-Anzug. Die vier ereignislosen Kurzurlaube auf Fuerteventura, Kreta, Mallorca und Lanzarote. Wieso hatten sie sich immer für Inseln entschieden? Die beiden kleinen Apartments im Westend. Die Abende vor dem neuen Sony-Fernseher. Ohne große Höhepunkte.
Karin lachte plötzlich. Oliver brüllte gegen Musik und Fahrtwind an, worüber sie sich amüsiere. «Ach, nichts», schrie Karin zurück. Ihr war gerade der Panasonic eingefallen, der mitten in der Nacht implodiert war und das ganze Wohnzimmer verrußt hatte. Karin musste eine halbe Stunde an diese blöde Versicherungstussi in München hinreden, bis die den Schaden akzeptierte. Sonst nichts. Gar nichts.
Wer war sie? Wofür lebte sie? Warum lebte sie? Was würde von ihr bleiben? Wie lange? Als Personalakte? Als Archivausschnitt? Als Erinnerung in irgendeinem Kopf?
Einmal tauchte Karins Name im Manager Magazin auf Es war eine Geschichte über den «Zukunftsjob Analyst». Der Fotograf hatte sie zwei Stunden lang auf ihrem Schreibtisch positioniert. Karin trug wenig Make-up, einen marineblauen Hosenanzug von Thierry Mugler, eine Seidenbluse von Prada, schwarze Stiefeletten von Dolce & Gabbana und den Tronchetto-Ring in Lapislazuli von Bulgari, den Oliver ihr geschenkt hatte. Der Fotograf sah aus wie ein Müllsack. Der Redakteur auch, allerdings wie ein Müllsack in einem zerknitterten Sakko. Sie war nett zu ihm. Sie spielte ihm freundlich-charmante Nervosität vor. Sie war nervös. Er beschrieb Karin dann als «Nachwuchs-Star unter den Commerz-Bankern». Sie kaufte sich an drei Kiosken, die nicht in ihrem Viertel lagen, insgesamt zwanzig Hefte, die nun in der Kellerzelle ihres Apartments liegen. Sie hatte sie in eine Plastiktüte gepackt, damit sie nicht so schnell verstaubten oder vergilbten.
Ein Exemplar brachte sie an einem der immer seltener werdenden Besuche am vorletzten Wochenende ihren Eltern mit. Karins Mutter setzte die Lesebrille ihres Vaters auf, schaute sich das briefmarkengroße Foto an, las den Text, und als sie fertig war, wusste Karin, dass sie nun wieder sagen würde: «Ich versteh immer noch nicht …» Im gleichen Moment sagte ihre Mutter: «… womit du nur dein Geld verdienst …»
Ihr Vater lachte verlegen über das «Wild Rose»-Kaffeeservice von Villeroy & Boch hinweg, das Karin ihnen zur Silberhochzeit geschenkt hatte und das ihre Mutter immer rausholte, wenn sie zu Besuch kam. Die Lieblingstochter. Die andere hatte es in Hamburg nur zur Sekretärin gebracht. Vater sagte: «Nun lass sie doch», hätte aber auch keine Antwort gewusst. Sie saßen auf der Terrasse und schauten auf die blendend weißen Ausflugsdampfer, die sich den Main entlang treiben ließen. Ihre Mutter hatte gedeckten Apfelkuchen gebacken. Die Sonne leuchtete. Die Wachstuchdecke brannte geblümt.
«Analysten schätzen Firmen ein», sagte Karin. «Sie errechnen Zukunft.» Himmel, wie erklärt man, was eine Analystin macht? Wie erklärt ein Consulter seinen Job den eigenen Nachkriegseltern? Oder ein Homepage-Designer? Oder ein Account-Manager? Oder ein Junior-Texter?
Am nächsten Abend saß Karin mit ihren Freunden in einem jener Frankfurter Neonschuppen, wo man die Wahl hat zwischen Rucola-Salat an Putenbruststreifen, Sushi-Rolls oder Falafel, und spielte eines der üblichen «Gimme Five»-Spiele ihrer Clique: «Gibt’s hier fünf Leute, die noch jemanden kennen, der wirklich etwas produziert oder schafft?» Es war ihr Abend.
Alle schauten erst sie an, dann ihre Prosecco-Kelche. Der Controller, der bei Procter & Gamble im Bereich Damenbinden und Toilettenpapier arbeitet, lachte unsicher. Er kannte einen Künstler, der irgendwo im Odenwald aus Kuhscheiße und alten Fahrrädern Installationen bastelte, die seinem Konzern neuerdings 50000 Mark wert waren, weil ein Art Consultant ihn als Kultur-Sponsoring-Objekt und Geldanlage empfohlen hatte. Der Texter von Lowe & Partners blieb bei seinem Vater hängen, der angeblich noch richtig bei Opel in Rüsselsheim Autos zusammenschraubte.
«Wo können wir mal wieder Proll tanken?», fragte Lowe & Partners zum Sorbet. Sie nannten ihre gemeinsamen Wochenendausflüge «Katastrophentourismus». Einmal fuhren sie nach Berlin-Neukölln shoppen, wo man zwischen Sonnenstudios und Spielhallen und Billig-Boutiquen den letzten Schrei der Zuhälter- und Asozialenmode studieren konnte. Die Blondine von Hunzinger PR kaufte sich unter lautem Gekreische einen illuminierten Plastikspringbrunnen. Ein anderes Mal hatten sie das Stützstrumpf-Geschwader einer Kaffeefahrt ins Erzgebirge begleitet und den Einpeitscher damit terrorisiert, dass sie ihn ständig nach den neurologischen Begleiterscheinungen seiner Magnet-Matratzen fragten.
Am aufregendsten war der regelmäßige Besuch des Hamburger-Dom-Jahrmarktes, weil man nirgends besser den Schick dieser kleinen, prallen Vorstadttürkinnen studieren konnte mit ihren Hennes & Mauritz-Tops, Mobilcom-Handys und Deichmann-Brikett-Absätzen. McKinsey war derart betrunken, dass er eines der Mädchen fragte, wie sie das eigentlich alle immer schafften, zwanzig Jahre später wie eine voll bepackte Aldi-Tüte mit Kopftuch durch die Welt zu schlurren. Die Türkin zischte «Arschloch» und schlug ihm ins Gesicht. McKinsey schlug zurück und traf ihr rechtes Auge. Der Freund der Türkin sagte gar nichts, er prügelte gleich drauflos. Der Armani-Anzug war ruiniert, weil die Blutflecke nicht mehr aus dem Revers gingen. Auf der Heimfahrt heulte und schluchzte McKinsey bis Göttingen, dann schlief er ein.
Karin hat ihn nie gefragt, ob er damals wegen seiner eigenen plötzlichen Brutalität oder wegen der Demütigung durch dieses Döner-Gesicht geweint hatte. Naja, daran erinnerten sie sich jedenfalls gern, während Karins dreißigster Geburtstag langsam in die Nacht versickerte. Ihre Freunde hatten ihr eine Faema-Espresso-Maschine aus ihrem Geburtsjahr 1969 geschenkt. Von ihren Eltern bekam sie einen Montblanc-Füller, den sie schon zweimal als Werbegeschenk zu Hause hatte. Oliver legte ihr einen Umschlag mit LH-Tickets für einen Last-Minute-Wochenend-Kurztrip nach New York auf die Stoffserviette. Das dreigängige Menü für ihre acht Freunde kostete 812 Mark – plus 88 Mark Trinkgeld. Sie demütigte die schmierigen Kellner gern mit hohen Trinkgeldern und fühlte sich doch von ihnen verhöhnt.
Am Samstag darauf standen sie auf dem Empire State Building. Oliver kramte aus seinem Chiemsee-Rucksack einen kleinen Strauß Moosröschen hervor und kniete sich plötzlich vor Karin. Seine Flanellhose wurde feucht, weil es wenige Stunden vorher geregnet hatte. Er hielt ihr die Blumen vor die Brust und sagte: «Ich möchte dich heiraten.» Der Wind riss den Satz in flatternde Fetzen. Karin verstand nur: «Ichöchtichratn.» Und während ihr Kopf die Sprachsplitter noch zusammenklebte, fragte sie sich zugleich, weshalb Oliver nicht wenigstens gefragt hatte: «Willst du meine Frau werden?»
Drei kleine italienische Touristinnen in Kaschmir-Rollis (Burberrys?) verstanden kein Wort, applaudierten aber dennoch. Sicher hatten sie «Schlaflos in Seattle» gesehen mit Meg Ryan und Tom Hanks. Sicher kannten sie auch die Original-Empire-State-Building-Szene aus «Die große Liebe meines Lebens» mit Deborah Kerr und Cary Grant. Das sind eben so Filme, über die man sich überall auf der Welt unterhalten kann, dachte Karin.
Es war entwürdigend, obwohl Oliver alles perfekt vorbereitet hatte: den Wolkenkratzerbesuch, die Rosen, alles. Er hatte sogar eine Flasche Taittinger und zwei langstielige Kelche von Riedel im Rucksack, die er aber nicht mehr herausholen konnte, weil Karins Blick erst leer war und dann von Tränen verschleiert. Sie ging an ihm vorbei zu den Aufzügen. Oliver stand auf, packte die Rosen wieder in den Rucksack, knipste die Klettverschlüsse zusammen und rannte ihr hinterher. Die drei italienischen Touristinnen starrten den beiden ergriffen nach und riefen «Tschüs». Auf Deutsch. Italiener erkennen Deutsche, auch wenn sie keine Mephisto-Wanderschuhe, Adiletten oder Pickelhauben tragen. Keine Ahnung, weshalb, dachte Karin und schob sich in die Schlange vor den Lifttüren. Aber so ist es nun mal.
Wahrscheinlich steht im Marco-Polo-Pocket-Reiseführer, dass hier oben jeden Tag hundertzwanzig Heiratsanträge gemacht werden und dass es nach der Premiere von «Schlaflos in Seattle» sogar dreihundertzehn waren. Karin liebt solche Statistiken, weil sie das Leben überschaubarer machen und ihr die Illusion erlauben, dass alles berechenbar ist. Und sie hasst diese Statistiken, weil sie sich zugleich von ihnen betrogen fühlt. Karin fragt sich manchmal, wer Heiratsanträge auf Wolkenkratzern eigentlich zählt. Und wie? Sie weiß nicht, wie man die misst. Oder die bunt gescheckte Masse der Oktoberfest-Besucher. Oder die Zahl der Sonnenstunden an der Nordküste Kretas. Oder die Milliarden von E-Mails, die jeden Tag weltweit verschickt werden.
Schweigend fuhren sie im Aufzugspulk des Touristentrosses nach unten. Oliver glaubte, er müsse Karin jetzt ein wenig Zeit lassen. Er war stolz auf die Rosen-Idee. Er hatte den ganzen New York-Trip nur um diesen Kniefall herum geplant. Er war ein Verlierer, der sich noch immer für einen Gewinner hielt. Es fing wieder an zu nieseln. Karin winkte ein Yellow Cab heran, stieg ein und sah aus den Augenwinkeln, wie Oliver auf der anderen Seite die Tür öffnete. Sein Rucksack knallte gegen die Tür. Sie hörte splitterndes Glas und nannte dem schwarzen Taxifahrer das Hotel. Er verstand sie nicht gleich, weil ihr Englisch besser war als seines.
Der erste Satz, den Oliver im Hotelzimmer von Karin hörte, war: «Hi, I’d like to change my reservation to Frankfurt. Is there any flight back to Germany this evening?»
Nachdem sie aufgelegt hatte, riss sie den Zettel mit dem Reservierungscode und dem Girlandengekrakel drum herum von dem dünnen Blöckchen und wartete darauf, dass Oliver fragte: «Was soll das denn jetzt? Hab ich irgendwas falsch gemacht?» Sie kannte ihn seit zwanzig Jahren. Seit elf Jahren verausgabten sie sich als Laiendarsteller eines gut aussehenden Paares am Standort Deutschland. Karin wusste, dass er genau diese Frage stellen würde. Da hörte sie ihn sagen: «Hab ich irgendwas falsch gemacht?»
Während der ganzen dreiundzwanzig Minuten dauernden Taxifahrt hatte sie sich ihre Antwort zurechtgelegt. Sie wollte antworten, wie schöne Frauen in Hollywood-Filmen antworten: kurz, klug, messerscharf Das war das Mindeste, was sie ihm antun konnte. Und so sagte sie am Ende, betont tonlos: «Nicht du hast etwas falsch gemacht, Oliver, sondern ich.» Und zum ersten Mal, seit sie sich erinnern konnte, nannte sie ihn Oliver, nicht Oli. «Mein Fehler warst du.» Das hätte Cher in «Mondsüchtig» auch nicht charmanter rüberbringen können.
Sie versuchte ein melancholisches Lächeln. Oliver ging ins Bad, und als er nach zehn Minuten wieder herauskam, roch er leicht nach «Cool Water» von Davidoff
In der LH-Boeing 747 ließ sie sich von der Stewardess einen Cointreau bringen, trank ihn warm und ohne Eis und fühlte sich so großartig wie nie zuvor. Dann trank sie noch einen und fand sich so beschissen wie nie zuvor. Dabei fallen noch niemandem die beiden grauen Haare auf, die sie neulich entdeckt hatte und die sie nicht auszureißen wagt, weil dann angeblich sieben neue nachwachsen.
Vor dem kleinen Fenster war gerade die Sonne untergegangen. Sie schob sich ihre Armani-Sonnenbrille aus dem im Nacken von einem Samtgummi gebändigten blonden Haar auf die Nase. Nicht Emporio Armani, sondern Giorgio Armani, obwohl das auch nicht teurer war. Emporio Armani war die Marke für den schwulen Friseur. Giorgio Armani war archaische Klassik, ewiges Leben. Sie liebte diese goldbraun gesprenkelte Hornbrille und den blassgoldenen Schriftzug auf dem ledernen Etui, das zuschnappte wie eine teure Autotür. Es gab mal diesen Mercedes-Werbespot, in dem ein Mann über irgendeinen staubigen Basar auf seinen Wagen zuging, einstieg und die Tür mit diesem sanft klackenden, fast saugenden Ploppen schloss. Im selben Moment war er zu Hause, weil dieser Wagen Heimat bedeutete. Genauso fühlte sich Karin nun. Die Sonnenbrille filterte den Dreck der Welt heraus. Sie schützte. Und sie schenkte ihr eine Heimat, die sie nicht hatte.
Karin Hensler wollte sich schön fühlen. Nach dem dritten Cointreau fühlte sie sich schöner als eines dieser Models in der Werbung, das am Flughafen in einer Minute ihren Nagellack wechselt. Sie gehörte schon jetzt, mit dreißig Jahren, zu den oberen zehn Prozent der bundesdeutschen Nachwende-Gesellschaft – einkommensmäßig –, auch wenn gerade eine Sechsundzwanzigjährige eingestellt worden war, die nach Studium in Mannheim, Genf und Harvard … na ja.
Sie war auf dem Gipfel, und wenn alles gut ginge, würde sie dort nun dreißig Jahre hocken. Was sollte sie also tun? Dreißig Jahre lang die Aussicht bewundern? Darauf warten, dass jemand vorbeikäme? Cointreau saufen? Eigentlich mochte sie dieses klebrige Zeug überhaupt nicht. Sie hätte dazu gern Musik gehört aus der Abteilung «Die fünf unterschätztesten Pop-Acts» der Geschichte: Roxette, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Abba, Pet Shop Boys oder Eurythmics.
Das war gestern. Heute ist Montag. Bald wird Karin sterben. Aber vielleicht ist ihr unbekannter Besucher heute hier das Leben. Ein Leben. Sie reden und reden, stundenlang. Ohne Stimmen. Am Ende will Karin wissen, ob sie ihn wenigstens wieder sehen werde, ihren «bezaubernden Niemand».
Er lächelt und antwortet: «Am schönsten ist es, wenn man etwas findet, was man gar nicht gesucht hat. So wie wir uns.» Dann verschwindet er so lautlos, wie er kam.
Morgen wird er wiederkommen. Sie weiß es. Sie hofft es. Wird er wiederkommen? Karin sieht aus dem Fenster. Ihre Augen schmerzen. Ihre Ohren glühen.
Sie sieht den nahenden Herbst nicht. Sie sieht die große funkelnde Stadt. Die Perlenschnüre der Einfallstraßen. Ihr funkelndes Spinnennetz. Da unten. Nur ihr Spiegelbild in den Scheiben lächelt. Alles ist möglich.
Plötzlich.
3/Ein Killer
1992 (Blur)
Er sollte sich beschweren. Wirklich wahr. In dem Sonst-wie-viel-Sterne-Luxushotel an der Hamburger Außenalster kostet die Übernachtung 280 Mark aufwärts. Als Gast verfügt man zwar über ein ausladendes Frühstücksbüffet. Der Wildlachs ist ganz hervorragend. Der Kühlerwald wird regelmäßig mit neuen Champagnerflaschen aufgeforstet, und die Orangenmarmelade ist angenehm bitter. Aber die beiden Körbe mit den Drei- und Fünf-Minuten-Eiern sind ein Witz. Ein schlechter. Die angeblichen Drei-Minuten-Eier sind keine Drei-Minuten-Eier. Die angeblichen Fünf-Minuten-Eier sind keine Fünf-Minuten-Eier. Beide Sorten sind einfach nur kalt und hart. Und schlecht. Ekel erregend.
Es ist Montag, 7 Uhr 05. Der Mord an Gabi Kohler ist seit einer Woche Geschichte. Außer drei Geschäftsleuten und einem alternden Beau mit einer sehr schlechten Verona-Feldbusch-Kopie sitzt nur er in dem großen Saal, ganz hinten an der Wand, mit Blick auf den Eingang, die kackbraune Alster und den langsam aus den Vorstadtvierteln heranschwellenden Berufsverkehr, der sich draußen vorbeiquält zu den Boutiquen und Großraumbüros, Kontoren und Kaufhäusern des hanseatischen Fußgängerzonen-und-Einkaufspassagen-Herzens.
«Kaffee oder Tee?»
Er schrickt hoch, sieht in die braunen Augen einer adretten türkischen Servicemaus und sagt nur: «Kaffee, bitte!» Er lächelt kurz.
Die Maus nickt. Ihr rechtes Auge ist blau angeschwollen. Auch das noch. Das gibt’s doch gar nicht, denkt er und weiß für die Dauer eines Augenaufschlags nicht, worüber er sich mehr aufregen soll: dass die Kleine in dem Zustand auf die Gäste hier losgelassen wird oder darüber, dass sie so zugerichtet wurde. Die Maus verschwindet.
Bloß keine Anteilnahme über ihr blaues Auge heucheln. Und keine Beschwerde wegen der Eier. Das wäre wirklich zu übermütig, auch wenn er weiß, dass sie ihn nicht im Visier haben können. Noch nicht jetzt. Dennoch: Diese kleine Türkin könnte sich später an das unauffällige Gesicht erinnern, wenn sie die Leiche in Zimmer 254 finden, an dessen Tür das rote «Bitte nicht stören»-Schild hängt. Man würde nach ihren Angaben eine Phantomzeichnung machen lassen, dank deren drei Dutzend unbescholtene Menschen verhaftet, angeschossen oder für den Rest ihres Lebens diskreditiert werden würden. Er lächelt.
Er darf jetzt nicht auffallen. Er darf später niemandem einfallen. Er muss unsichtbar bleiben. Er. Er. Er. Die Unsichtbarkeit ist seine Stärke. Sie ist die kleine Schwester der Anonymität, die ihn schützt.
Er schließt die Augen und sieht einen Film. Nicht so eine deutsche Beziehungskisten-Komödie mit Katja Riemann, Meret Becker oder wie diese verzickten Amateuraktricen alle heißen. Er sieht einen guten, einen großen Film. Er sieht seinen Film. Einen, in dem er alle Rollen selbst spielt und jede Nacht das Drehbuch umschreibt, mit professioneller Sicherheit Regie führt, das Licht dirigiert und die Perspektive des Kameraauges. Er ist mal Mann, mal Frau. Er ist mal charmanter Enddreißiger mit eigener Großmetzgerei im Niederbayerischen, mal frühreifes Luder aus dem Norden. Er ist König Lear und Lolita. Er ist, was immer er will. Er. Ist. «Er? Sie? Es? Ich bin die Antwort. Ich bin das Ende. Ich bin der Killer.» Die Rolle sitzt.
Seine Sprache ist sein Köder und seine Waffe. Nichts sonst. Wenn er jagt, mutiert er zu purer Phantasie, blank gescheuerten Gedanken, Wahrheit des Augenblicks. Er schleicht sich in den Kopf seiner Beute. Und bevor die noch selbst weiß, was mit ihr geschieht …
Es klirrt. Die Maus setzt das Porzellankännchen auf, Kaffee schwappt über und sickert zu einer kleinen, braunen Pfütze auf dem Silbertablett zusammen. Die Maus verzieht die Mundwinkel peinlich berührt.
«Lassen Sie nur. Danke.» Diesmal verbietet er sich ein Lächeln, obwohl es ihm schwer fällt.
Er ist ein netter Mensch. Er funktioniert. Er lässt sich beim Einkaufen immer gerne Handzettel für neue Fitness-Studios, Single-Partys oder Räumungsverkäufe aufdrängen, die er erst zu Hause wegwirft. Er bringt freitags den Müll raus, kauft jedes Jahr hoffnungslos überteuerte Weihnachtskarten zugunsten der Unicef und wäscht regelmäßig sein Auto. Er hat für jeden pockennarbigen Penner auf der Straße eine Mark übrig. Er fährt nie schwarz mit dem Bus zur Arbeit. Er bremst auch für Tiere. Er bezahlt seine GEZ-Fernsehgebühren im Lastschriftverfahren, obwohl er nur noch Harald Schmidt regelmäßig sieht und der sich durch Werbung finanziert. Er selbst finanziert mit seinen Steuern das Bafög von Psychologiestudenten im 23. Semester und den Drittfernseher Bottroper Großfamilien, den Euro-Fighter, die Gleichstellungsbeauftragten kleiner Großstädte und den Currywurst-Kanzler, den er gewählt hat, obwohl er sich keinerlei Gegenleistung von ihm verspricht. Kein Dankeschön. Kein gar nichts. Es ist seine Pflicht als Staatsbürger. Punkt. Das ist okay. Wirklich. Das ist Demokratie.
Um ihn herum scheinen alle ihre Geschichte gefunden zu haben, ihren Stil, ihr Dasein: Die Zehnjährigen wärmen sich sorglos in Hiphop-Hosen, die ihnen in den Kniekehlen schlabbern, und bereiten sich auf die Pubertät vor. Die Zwanzigjährigen sind vollauf damit beschäftigt, nicht mehr an die Schulzeit denken zu müssen, und bereiten sich auf das Leben vor. Die Vierzigjährigen sind gerade in ihr Eigenheim eingezogen und bereiten sich auf die erste Kur vor. Die Fünfzigjährigen träumen von den guten alten Sechzigern. Die Sechzigjährigen träumen davon, nochmal zwanzig zu sein. Die Siebzigjährigen träumen von gar nichts mehr. Nur die Mittdreißiger sind nicht mehr als eine gigantische, stumme Wucherung an der Alterspyramide, die längst wie eine Latschenkiefer aussieht. Eine schweigende Masse.
Es hat aber auch sein Gutes, 1999 in Deutschland Mitte dreißig zu sein. Er hat keinen Krieg erlebt, sondern musste sich nur die Geschichten darüber anhören. Von seinem Großvater. Von seinem Vater. Von seinen hauptberuflich betroffenen Lehrern. Und von Arte, das auf seiner Fernbedienung den Programmplatz 28 besetzt, hinter Eurosport und TV5. Okay, das mit den Geschichten war auch eine Strafe, aber das würde er nie laut sagen. Er würde überhaupt nichts laut sagen. Er musste in seiner Jugend keine Hakenkreuzfahnen basteln und keine Kohlen klauen. Er musste keine Brotsuppe essen und keine Crevetten-Cocktails. Er musste nicht mehr in Wohngemeinschaften hausen und keine Straßenschlachten besuchen. Er hätte auch wirklich keine Lust darauf gehabt, sich von Wasserwerfern durchnässt vom Bordstein fegen zu lassen. Wirklich nicht.
Für was auch? Dutschke? Abrüstung? Mehr Kindergeld? Weniger Steuern? Scientology? Regenwald? Abtreibungspille? Links?
Oder gegen was? Strauß? Volkszählung? Tierversuche? Atomkraft? Scientology? FCKW? Klonschafe? Rechts?
Er legt sich nicht mal mit den verschnarchten Sie-ham-hiernoch-gefehlt-Schalterbeamten in seiner Postfiliale an. Er stellt sich mit schlafwandlerischer Sicherheit immer ans Ende jener Schlange, in der er am längsten warten muss für ein paar Briefmarken. Er streitet auch nicht mit frigiden Politessen, sondern nimmt kommentarlos deren Strafzettel entgegen und überweist sie gleich am nächsten Tag. Er stellt keine Männer zur Rede, die das Bahnhofsklo verlassen, ohne sich die Hände zu waschen. Er schlägt keine Kinder, die quengelnd auf die Regale der Teletubbies hereinfallen und kreischen: «Ah, oh, Tinky Winky.»
Aber er hasst gern. Er genießt diesen Hass in der gebotenen Ruhe. Er definiert sich über diesen Hass wie andere Leute vielleicht über ihren Beruf oder ihre Familie oder die Höhe ihrer kleinen Nische im vogelverschissenen Felsen, den man gemeinhin Gesellschaft nennt. Gesellschaft! Er suchte sich seine eigene Gesellschaft. Er wählte sich seine Nachbarschaft allein aus. Und sein Hass ist noch wunderbarer geworden, seit er endlich einen Kanal und Kulminationspunkt gefunden hat. Sein Hass passt ihm wie eine zweite Haut. Er hat Angst vor diesem Hass.
Am Abend davor kam er unbemerkt an und stieg zielstrebig in den Aufzug gegenüber der Rezeption. Wer die nötige Sicherheit ausstrahlt, schleicht sich an jedem Pförtner und jedem Empfangschef vorbei – auch mit einem alten Seesack in den Händen. Er hatte sein Opfer vorher dazu gebracht, sich unter falschem Namen anzumelden und eine bestimmte Zimmernummer zu verlangen. Sein Opfer, das so wenig erkannt werden wollte wie er selbst, hatte «Andreas Türck» vorgeschlagen. Nach dem schmierlappigen Nachmittagstalker aufPro Sieben, den er auch gerne hasst. Nicht, weil Türck jeden Mittag in seiner Show den Urschlamm des Lebens präsentiert. Sondern weil er es mit einem Grinsen tut, als verachte er dafür nicht sich, sondern seine Gäste wie Zuschauer und damit all jene, denen er sich selbst verdankt.
Gegen 21 Uhr klopfte er energisch an die Doppeltür. Er hörte, wie sich die innere Tür leise öffnete, und riss im selben Moment mit der Linken die äußere auf. Mit der Rechten hielt er das Tränengas, das er dem Mann sofort ins Gesicht sprühte. Dann stieß er ihn mit der Linken in das Zimmer zurück. Dann zog er den Seesack nach drinnen. Dann schloss er erst die äußere Tür schnell. Dann schloss er die innere langsam. Dann war Stille.
Er durfte nicht lange fackeln. Es musste schnell gehen. Der Mann würde schon an der Tür überrascht zurückweichen, weil er eine junge Frau erwartet hatte, ein gefahrloses Abenteuer, ein Bild, einen Traum. Hier aber war Endstation für jede Art von Traum.
«Willkommen in der Realität», sagte der Killer, zog ächzend den gekrümmten Körper hoch, schleppte ihn schnaufend durch das Zimmer, wuchtete ihn aufs Bett, riss ihm die Arme auf den Rücken und band sie mit einem breiten, braunen Klebeband zusammen. Nochmal Tränengas ins Gesicht, damit der Typ gar nicht erst auf die Idee kam, hier herumzuschreien. Dann schloss er die Vorhänge und stopfte dem Mann die weichen Kissen unter den Hinterkopf, damit der sehen konnte, wie er die dünnen Gummihandschuhe anzog und aus dem Seesack das Werkzeug der kommenden Nacht auspackte.
Ein Stück nach dem anderen. Langsam kam der Mann zu sich, sah, registrierte, verstand nichts. Die Geflügelschere. Das Skalpell. Der Killer griff nur mit einer Hand in den Sack, seine andere hielt eine Leine, die an einem Stacheldrahtkranz endete, den er dem Mann um den Hals gelegt hatte. Das Obstmesser. Die Stricknadeln. Er liebte die Stricknadeln. In jedem anderen Zusammenhang hätten sie wunderbar harmlos ausgesehen. In jedem. Hier schufen sie Bilder von grenzenloser Tiefenschärfe, monströse Schlachtengemälde, unglaubliche Illusionen des Grauens. Und nur darum ging es.
«Ein Schrei, und ich ziehe so fest, dass es Ihr letzter war.» Der Killer siezte sein Opfer. Er hatte dieses Arschloch lange genug geduzt. Er wusste alles über ihn.
Der Mann hieß Claus Kollwitz, war dreiunddreißig Jahre alt, seit fünf Jahren verheiratet mit einem Ex-Model und hatte ein Kind – die einjährige Luna. Der Killer musste sich nicht sonderlich anstrengen, auch Leute zu hassen, die ihre Kinder Luna nennen. Solche Eltern kaufen Kindertapeten bei Laura Ashley, sehr teures Holzspielzeug und mit jedem Liter Milch vom Bauern draußen in der Lüneburger Heide die Gewissheit, ihren Nachwuchs biologisch zu ernähren. Aber sie zwinkern dazu, als wüssten sie um ihr eigenes Klischee. Kollwitz war Creative Director einer dieser jungen, wilden Werbeagenturen, die rote Lampen in ihre Bürofenster stellen wie ein Puff und sich neue schrille Identitäten ausdenken für Consors oder Mobilcom oder Sat 1. Vielleicht war er eine Spur zu prominent. Der Killer hatte bereits vorher so seine Zweifel. Aber es galt, ein Zeichen zu setzen. Endlich ein Zeichen.
Kollwitz kam nur langsam wieder zu sich, blickte noch ein paar Minuten durch gerötete Augenschlitze, bevor er vorsichtig begann: «Wer sind Sie? Was soll das hier alles?»
Der Killer lächelte. «Sie wissen doch alles, was Sie über mich wissen mussten, um sich mit mir zu verabreden: Ich heiße Julia, bin siebzehn, Gymnasiastin aus Harburg, blond, habe grüne Augen, bin 1,73 groß, trage Kleidergröße 36 und stehe auf Analsex.»
«Das waren Sie?», schrie Kollwitz. Er war außer sich, kapierte aber noch immer nichts. Was war das hier? «Versteckte Kamera»?
Sein Gegenüber ließ ihn reden: «O Gott, das ist doch, ich meine, wir sind doch erwachsene Menschen, das lässt sich doch regeln, ich habe Ihnen doch gar nichts tun wollen, meine Frau, mein Kind, es war doch nur ein Spaß, lassen Sie uns darüber reden, ich kann Ihnen Geld geben, lassen Sie mir ein paar Tage Zeit, wie oft hatten wir es – dreimal? Ja, dreimal – und ich habe es nicht gemerkt, das glaub ich alles nicht, was wollen Sie jetzt von mir, o Mann, ist das peinlich, oder ist Julia Ihre Tochter, Scheiße, und ich dachte wirklich …»





























