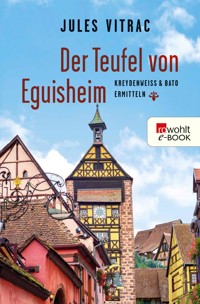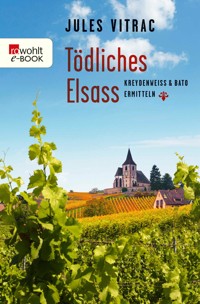
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Elsass-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 3. Band in der beliebten Elsass-Krimiserie: Perfekter Stoff für Liebhaber des Elsass, für Regiokrimi-Fans, für Leser von Jean-Luc Bannalec und Martin Walker. Ein klug gestrickter Krimi, charmant, kenntnisreich und unterhaltsam. In heller Panik läuft eine junge Frau mitten in der Nacht aus dem alten Maison des Chevaliers. Ein Gespenst habe sie zu Tode erschreckt! Immerhin ist der Herrenhausbesitzer Hugo Filipier froh, seine aktuelle Geliebte auf diese Weise elegant los zu sein. Kurz darauf ist die Frau tot. Wasser auf den Mühlen der abergläubischen Dorfbewohner: La Dame Blanche, die Weiße Dame, Künderin nahenden Unheils, treibe in Eguisheim ihr Unwesen. Alle sarkastischen Bemerkungen von Chef de Police Céleste Kreydenweiss helfen da rein gar nichts. Als Céleste noch eine weitere Leiche im sonst so beschaulichen Eguisheim findet, haben sie und ihr akkurater Brigadier Luc Bato einen handfesten Fall zu lösen, der unheimlicher ist als jede Spukgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jules Vitrac
Tödliches Elsass
Kreydenweiss & Bato ermitteln
Über dieses Buch
Das Elsass: idyllisch, urig und lebensgefährlich.
In heller Panik läuft eine junge Frau mitten in der Nacht aus dem alten Maison des Chevaliers. Ein Gespenst habe sie zu Tode erschreckt! Immerhin ist der Herrenhausbesitzer Hugo Filipier froh, seine aktuelle Geliebte auf diese Weise elegant los zu sein.
Kurz darauf ist die Frau tot. Wasser auf den Mühlen der abergläubischen Dorfbewohner: La Dame Blanche, die Weiße Dame, Künderin nahenden Unheils, treibe in Eguisheim ihr Unwesen. Alle sarkastischen Bemerkungen von Chef de Police Céleste Kreydenweiss helfen da rein gar nichts. Als Céleste noch eine weitere Leiche im sonst so beschaulichen Eguisheim findet, haben sie und ihr akkurater Brigadier Luc Bato einen handfesten Fall zu lösen, der unheimlicher ist als jede Spukgeschichte.
«Jules Vitrac hat für die Atmosphäre der Region des Elsass eine besonders gute Hand.» (Hellweger Anzeiger)
Vita
Jules Vitrac ist eine erfolgreiche deutsche Schriftstellerin und Juristin. In ihren Krimis verbindet sie ihre berufliche Erfahrung mit kriminellen Abgründen und ihr Faible für vertrackte Rätsel mit ihrer großen Liebe zu Frankreich. «Mord im Elsass» war ihr erster Kriminalroman um Chef de Police Céleste Kreydenweiss und ihren jungen Brigadier Luc Bato. Für den zweiten Band «Der Teufel von Eguisheim» wurde sie für den HomBuch-Preis der Homburger Buchmesse nominiert.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Elisabeth Mahler
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke und Cordula Schmidt
Coverabbildung bluesky6867/fotolia; Cultura/Francesco Meroni/mauritius images; Serg64/Shutterstock
ISBN 978-3-644-40620-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Und was ist Zufall anders, als der rohe Stein,
Der Leben annimmt unter Bildners Hand?
Den Zufall gibt die Vorsehung – zum Zwecke
Muß ihn der Mensch gestalten.»
Friedrich Schiller
1
Der Wagen kroch mit ungefähr zehn Stundenkilometern die Straße entlang. Er fuhr in der Mitte, so als ob er sich in der nächtlichen Dunkelheit am Mittelstreifen entlangtastete, und selbst dort machte er hin und wieder einen unsicheren Schlenker.
Céleste Kreydenweiss, Chef de Police von Eguisheim, stieß ihren jungen Brigadier Luc Bato mit dem Ellenbogen an. «Der Fahrer ist voll wie ein Fass, den müssen wir rausholen.»
Luc nickte und hob die Kelle.
Als der Fahrer die beiden Beamten der Police Municipale bemerkte, schien er für einen kurzen Moment Gas geben zu wollen. Dann überlegte er es sich offensichtlich anders, bremste ab und kam am Straßenrand zum Stehen.
Céleste kniff die Augen zusammen. «Das Auto kenne ich doch …», murmelte sie überrascht.
Sie gingen zur Fahrerseite und klopften an die Scheibe. Ein großer Mann saß zusammengesunken auf dem Fahrersitz: Henri Breton, der Wirt des Dorfbistros, dem Café du Marché. Bislang war er weder durch übermäßiges Trinken aufgefallen noch durch sonstige unvernünftige Verhaltensweisen. Im Gegenteil. Henri Breton war der Inbegriff verlässlicher, leicht langweiliger Biederkeit. Als Céleste noch einmal klopfte, senkte sich die Scheibe mit einem schwachen, resigniert klingenden Surren. Ein Schwall alkoholgeschwängerter Luft drang aus dem Inneren des Autos. Im Fußraum des Beifahrersitzes kullerten leere Flaschen herum.
«Henri!» Céleste öffnete die Tür. «Steig bitte mal aus.» Als er nicht reagierte, beugte sie sich ins Auto und zog den Schlüssel ab.
Henri stieg schwerfällig aus und fiel prompt Luc in die Arme, der Mühe hatte, den großen Mann aufzufangen.
«Das Leben ist ein einziger großer Misthaufen …», brummelte Henri und blieb schließlich schwankend stehen. Luc Bato hielt ihn an den Schultern fest.
«Wir fahren dich jetzt nach Hause», sagte Céleste.
«Nich nach Hause …», lallte Henri. «Nich nach Hause …» Er begann, sich unbeholfen gegen Lucs Griff zu wehren.
«Sei doch vernünftig, Henri», sagte Céleste. «Du bist stockblau. Was ist denn in dich gefahren, in dem Zustand Auto zu fahren?»
«Nich nach Hause …» Mit einem Ruck riss er sich von Luc los und taumelte nach hinten. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel in den zugewucherten Straßengraben, der an dieser Stelle die Weinberge von der Straße trennte. Undeutliches Fluchen drang herauf.
Die beiden Polizisten sahen sich an und seufzten. Als klarwurde, dass Henri weder in der Lage noch willens war, aus eigener Kraft aus dem Graben herauszuklettern, stieg Luc hinunter, um Henri zu helfen. Augenblicklich ertönte lautstarker Protest, dann hörte man einen dumpfen Schlag, und etwas Schweres fiel zu Boden.
«Luc?» Céleste leuchtete mit der Taschenlampe in den Graben.
Luc Bato saß etwas belämmert im Gestrüpp und befühlte stöhnend seine Nase. «Er hat mir eine reingehauen!», beschwerte er sich, mehr überrascht als wütend.
Inzwischen hatte sich Henri aufgerappelt, und er versuchte schwankend, den Graben entlang zu flüchten, doch auch Luc hatte sich wieder gefangen. Er sprang auf und umklammerte den sich heftig Wehrenden von hinten – mit dem Ergebnis, dass beide wieder stürzten und auf dem Boden weiterrangelten. Irgendwann gelang es Luc mit der Hilfe von Céleste, den Betrunkenen wieder nach oben auf die Straße zu manövrieren.
«Verdammt, Henri, was ist denn los mit dir?», schimpfte Céleste, während sie den Mann zu ihrem Wagen beförderte. «Hast du noch alle Tassen im Schrank?»
«Mein Auto …», nuschelte Henri, als Luc ihn auf den Rücksitz ihres Dienstwagens bugsierte. «Ich brauche mein Auto …»
«Heute Abend brauchst du gar nichts mehr.»
«Aber …» Henri plumpste auf den Sitz, nur um sofort wieder aufzustehen – versuchsweise zumindest.
Céleste drückte ihn mit einer Hand zurück auf die Rückbank. «Jetzt bleib mal hier, verdammt! Wir bringen dein Auto nach Hause.» Céleste warf ihrem Brigadier einen Blick zu. «Könnten Sie …?» Sie stutzte und richtete ihre Taschenlampe auf Lucs Gesicht. «Auweia!», rief sie. «Henri hat Sie ja voll erwischt.» Das linke Auge des jungen Brigadiers war blaurot verfärbt und schwoll bereits an, und er blutete heftig aus der Nase. Sie reichte ihm ein Taschentuch. «Schaffen Sie das?»
Luc nickte und hielt sich das Papiertuch an die Nase. «So ein Idiot», brummte er unter dem Tuch hervor, das sich jetzt schnell rot färbte. «Was hat er sich nur dabei gedacht?»
Céleste seufzte. «Falls es Ihnen ein Trost ist, ich glaube nicht, dass Henri überhaupt viel gedacht hat.»
Henri Bretons Haus lag etwas außerhalb von Eguisheim, inmitten von Weinbergen und Feldern. Céleste fuhr mit dem Dienstwagen voraus, Luc mit Henris Auto hinterher. Kurz bevor sie ihr Ziel erreichten – Céleste hatte bereits abgebremst und den Blinker gesetzt, um in die Einfahrt einzubiegen –, öffnete Henri die Wagentür und sprang mit überraschendem Elan aus dem Auto. Bis Céleste den Wagen angehalten hatte, war Henri bereits über die Straße gelaufen und in den Weinbergen verschwunden. Unwirsch trabte sie, gefolgt von Luc, durch die ordentlich aufgereihten Weinstöcke, leuchtete mit der Taschenlampe umher und rief nach Henri. Als sie einen Ast brechen hörte, lenkte sie den Lichtstrahl in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, und entdeckte Henri, der etwa hundert Meter weiter offenbar gegen einen Weinstock gelaufen war und sich gerade wieder aufrappelte.
«Henri, du Hornochse, bleib endlich stehen!», schrie sie, der Wirt torkelte jedoch unbeirrt weiter.
Widerwillig nahm Céleste erneut die Verfolgung auf. Aber schon nach wenigen Metern stolperte sie und schlug der Länge nach hin. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihren Knöchel. Als Luc näher kam, angeleitet vom lautstarken Fluchen seiner Chefin, bedeutete sie ihm mit der Hand, Henri zu folgen, und sah sich um. Sie war in ein Loch getreten, das sie übersehen hatte. Es dauerte keine fünf Minuten, da kam Luc mit Henri im Schlepptau zurück. Den Wirt hatten nach dieser letzten Anstrengung seine Kräfte offenbar endgültig verlassen. Luc hatte ihn untergehakt und trug ihn mehr, als dass Henri selbst lief. Céleste lächelte gequält. Es hatte durchaus seine Vorteile, einen großen, durchtrainierten Brigadier an der Seite zu haben.
Ächzend stand sie auf und humpelte den beiden hinterher. Ihr Fuß sandte schmerzende Signale an ihr Gehirn, und am liebsten hätte sie Henri Breton einfach hier irgendwo sitzen lassen, als Strafe dafür, dass er sie in seinem Suff so sinnlos durch die Pampa gejagt hatte. Es passte gar nicht zu dem sonst so braven Wirt, sich dermaßen zu betrinken. Aber was wusste sie schon. Gründe zu saufen gab es schließlich genug auf der Welt.
Am nächsten Morgen, nach einer kurzen, unruhigen Nacht, war Célestes rechter Knöchel auf die Größe einer kleinen Honigmelone angeschwollen, und der Fuß ließ sich nicht mehr bewegen. Sie musste sich eingestehen, dass sie um einen Arztbesuch wohl nicht herumkam. Gottlob war ihr Hausarzt, der junge Dr. Schupfer, nicht weit von ihrer Wohnung entfernt in der Rue du Rempart.
Dr. Laurent Schupfer war eigentlich gar nicht mehr so jung, er war längst in den Vierzigern, im Dorf hieß er allerdings noch immer «der junge Dr. Schupfer», weil es eben noch einen alten gab. Der alte Dr. Schupfer, Maurice, war zwar schon seit fast fünfzehn Jahren im Ruhestand, doch sehr zum Leidwesen seines Sohnes ließ er es sich dennoch nicht nehmen, einige seiner «Stammkunden» weiterhin selbst zu behandeln. Bei der Regelung der Übergabe hatte er sich dafür extra noch einen Raum ausbedungen, wo er seine Patienten empfangen konnte. Lieber als dort praktizierte er jedoch in seinem Stammlokal, dem Café du Marché, wo er seinen Frühschoppenfreunden bei Bedarf zwischen zwei Gläsern Riesling ganz zwanglos Spritzen gegen Rückenschmerzen in den Allerwertesten verpasste. Sein Sohn Laurent war da erheblich spießiger: Die Behandlungen fanden ausschließlich in der modern ausgestatteten Praxis statt.
Céleste kannte den alten Dr. Schupfer seit ihrer Kindheit, zog es aber dennoch vor, sich in ärztlichen Angelegenheiten an seinen Sohn zu wenden. Ihr Opa Théo und der alte Maurice Schupfer waren seit über einem halben Jahrhundert allerbeste Freunde, und sie war sich nicht sicher, wie gut es um die Diskretion der alten Herren bestellt war. Das bisschen Privatsphäre, das man sich in einem so kleinen Dorf wie Eguisheim überhaupt bewahren konnte, durfte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
Es war noch recht früh, und die Sonne kroch gerade erst über die spitzen Dächer der stattlichen Fachwerkhäuser, die den Marktplatz säumten, als sich Céleste zu Fuß auf den Weg machte. Als Krücke nahm sie einen Regenschirm zu Hilfe. Allerdings hatte sie sowohl die Stabilität des Regenschirms als auch die Schmerzen falsch eingeschätzt, die jegliche Belastung des Fußes mit sich brachte, und so kam sie nur sehr schleppend voran.
«Salut Céleste!» Paul, der Metzger, der dabei war, seinen Laden zu öffnen, winkte ihr zu, während er eine Tafel in Form eines Schweines vor die Tür stellte, auf der das Mittagsgericht des Tages angekündigt wurde.
«Guten Morgen, Paul!», grüßte Céleste lächelnd zurück.
«Ist das nicht was für dich?» Paul deutete auf die Tafel. Er kannte Célestes Vorliebe für deftiges Essen. Céleste warf einen Blick auf das lachende Schwein: Es gab Rôti de porc aux pruneaux, Carottes Vichy, Pommes sautées – Schweinebraten mit Backpflaumen, dazu Karotten und Bratkartoffeln, für €6,50.
«Auf alle Fälle.» Céleste nickte. Dieser Schweinebraten war immer einen Besuch bei Paul wert.
Sie humpelte weiter, bevor Paul auf die Idee kam, sie zu fragen, was mit ihrem Fuß passiert war. Sie hatte keine Lust, aller Welt von ihrer nächtlichen Verfolgungsjagd zu erzählen. Schon gar nicht vor dem Frühstück. Im Vorbeigehen fiel ihr Blick auf das Café du Marché, das sich gegenüber der Metzgerei befand und noch geschlossen war. Angesichts des gestrigen Vollrausches des Besitzers verwunderte Céleste das nicht. Henri brauchte offenbar noch ein wenig Anlauf, um wieder auf die Beine zu kommen. Wie sie auch, dachte sie und widmete ihrem geschwollenen Fuß einen finsteren Blick.
«Oh, schon wieder die Polizei!» Dr. Schupfer junior, ein schlanker, eher ernster Mann, begrüßte sie mit einem amüsierten Gesichtsausdruck, wie Céleste fand, doch er untersuchte Célestes Knöchel schweigend und diagnostizierte dann einigermaßen lapidar eine Bänderzerrung. Anstatt des Regenschirms gab er ihr zwei Krücken mit. «Sie sind heute schon die zweite Amtsvertreterin bei mir in der Praxis», sagte er dann beiläufig.
«Ach! Brigadier Bato war auch schon da?», gab Céleste mürrisch zurück. So viel zur Diskretion in einem kleinen Dorf.
«Darf man fragen, wo Sie sich die Verletzungen zugezogen haben?»
«Bei einer Verfolgungsjagd», sagte Céleste knapp und begann, mit den unhandlichen Krücken herumzuhantieren.
Dr. Schupfer hob überrascht die Brauen. «Hier bei uns in Eguisheim?» Er lachte. «Kaum vorstellbar, dass hier jemand davonläuft. Noch dazu vor Ihnen.»
Als Céleste ihm daraufhin einen tödlichen Blick zuwarf, präzisierte er hastig: «Ich habe das als Kompliment gemeint.»
Er erbot sich, Céleste krankzuschreiben, die schüttelte jedoch den Kopf.
«Aber in den kommenden Tagen bitte keine Verfolgungsjagden!» Dr. Schupfer lachte erneut. Offenbar fand er diesen «kleinen Arbeitsunfall», wie er es nannte, ganz besonders witzig.
Céleste lächelte säuerlich. «Keine Sorge, das nächste Mal lasse ich gleich meinen Brigadier laufen.»
Was Dr. Schupfer so lustig fand, amüsierte Céleste kein bisschen. Sie war in denkbar miserabler Stimmung, während sie sich auf Krücken zum Rathaus vorkämpfte. Da die Gemeindepolizei dem Bürgermeister unterstellt war, befand sich ihre Dienststelle in der Mairie. Es würde noch einige Zeit dauern, bis Céleste wieder richtig laufen konnte, hatte der Arzt gemeint. Unterwegs begegnete ihr Louis Balzac, der örtliche Obermüllmann, Poet, ehemaliger Trinker und alles in allem ein Eguisheimer Original. Trübsinnig schlurfte er über den Marktplatz und trug dabei eine blaue Bank auf der breiten Schulter.
«Salut, Louis.» Céleste blieb stehen. «Wo willst du denn mit der Bank hin?»
Louis wuchtete die Bank von seiner Schulter und stellte sie neben sich ab. «Keine Ahnung», brummte er.
«Ist das nicht Madeleines Bank?»
Madeleine Béranger, die ehemalige Buchhändlerin des Dorfes, war Louis’ Vertraute gewesen. Er hatte sogar ein Gedicht über sie geschrieben, und auch nach ihrem Tod hatte man Louis meist vor dem leerstehenden Buchladen auf ebenjener blauen Bank sitzen, dichten und um sie trauern sehen.
Louis nickte und kratzte sich an seinem struppigen Bart. «Hab ich geschenkt bekommen», brummte er. «Ninette kann sie nicht gebrauchen, weil sie jetzt, wo’s wärmer wird, Tische und Stühle rausstellt. Um ein Haar wär die Bank auf dem Sperrmüll gelandet. Das muss man sich mal vorstellen. Madeleines Bank! Auf dem Müll …» Verstohlen wischte er sich eine Träne aus dem faltigen Augenwinkel.
«Ist doch schön, wenn in Madeleines Buchladen wieder neues Leben einzieht», versuchte Céleste, Louis zu trösten. «Madeleine hätte es gefreut.»
Louis brummte etwas Unverständliches und ließ sich dann auf die Bank plumpsen. «Aber auf den Müll …», wiederholte er kopfschüttelnd. «Die Bank ist wie neu.»
Nicht ganz unglücklich über die Gelegenheit, ihrem Fuß eine kleine Pause zu gönnen, setzte sich Céleste neben ihn. Madeleines Laden unweit des Marktplatzes war nach dem Tod der Buchhändlerin eine ganze Weile leer gestanden, denn es fand sich niemand im Dorf, der ihre Nachfolge hatte antreten wollen. Letzten Herbst war dann Ninette Schweitzer gekommen. Die temperamentvolle rothaarige Mittfünfzigerin aus Straßburg hatte den Laden gepachtet, um dort ein kleines Café zu eröffnen, was insbesondere bei Henri Breton anfänglich nicht gerade auf Begeisterung gestoßen war – befand sich die ehemalige Buchhandlung doch nur einen Steinwurf von seinem Café du Marché entfernt. Inzwischen musste jedoch sogar ihm klargeworden sein, dass das neue Café keine Konkurrenz für ihn darstellte. Es hieß Tantine Ninette, Tantchen Ninette, und war so etwas wie ein Kunst-und-Krempel-Café. An jedem freien Fleck an den Wänden hingen Gemälde und Zeichnungen, die teils von Ninette selbst, teils von Künstlern aus dem Ort stammten, und überall verteilt standen kleine Figürchen, verspielte Basteleien, Trödel und ausgefallene Accessoires herum. Es gab Flammkuchen, selbstgebackene Tartes sowie kunstvolle Törtchen, und an einigen Abenden im Monat wurde Livemusik geboten, ebenfalls von örtlichen Musikern. Diese Mischung zog vor allem jüngeres Publikum und Kunstinteressierte an. Das war nicht unbedingt das, was Henris Stammkundschaft suchte, die vorwiegend aus den älteren männlichen Eguisheimern bestand, die sich in der Regel zweimal am Tag zu festen Zeiten, vormittags gegen elf und am Nachmittag ab vier, zu einem Umtrunk bei Henri einfanden, um die Neuigkeiten des Tages auszutauschen. Das Tantine Ninette mit seinen fünf kleinen runden Tischen und der lauschigen Hintergrundmusik war dafür nicht der geeignete Ort – zumal Ninette noch ein besonderes Hobby pflegte, das Kartenlegen, und bei Café au lait und Zitronenbaisertörtchen bereitwillig Rat in Liebesdingen erteilte. Beim Gedanken an Ninettes süße Köstlichkeiten lief Céleste das Wasser im Mund zusammen, und sie beschloss, Ninette einen kurzen Besuch abzustatten. Am liebsten kaufte sie ihr Frühstück – ein ofenwarmes Brioche – bei Henri, doch der war ja heute unpässlich. Selbst schuld.
«Was willst du denn jetzt mit der Bank machen?», fragte Céleste und stand vorsichtig auf, ohne ihr Bein zu belasten.
Louis zuckte mit den Schultern. «Ich nehm sie mit nach Hause, schätz ich.»
Céleste überlegte. Louis Balzac hauste in einem winzigen Häuschen, das an der Rückwand der Kellerei Dopfer mehr lehnte, als dass es selbständig stand, und es war so eng und vollgestopft, dass sich Céleste nicht vorstellen konnte, wo dort noch eine Bank Platz finden sollte. «Vielleicht fällt mir noch eine bessere Lösung dafür ein», sagte sie. «Du hast schon recht: Madeleines Bank hat einen guten Platz verdient.»
Louis tätschelte mit seinen schwieligen Händen ihren Arm. «Bist ’n gutes Mädchen, Céleste, auch wenn du den falschen Beruf hast.»
Das war einer von Louis’ Standardsprüchen aus alten Säuferzeiten, wo er zur rechten Zeit über alle Obrigkeiten, vom Papst und der Kirche über den Präsidenten bis zum Bürgermeister, hergezogen war und dabei auch vor der Police Municipale und dem örtlichen Fußballvereinsvorsitzenden nicht haltgemacht hatte. Allerdings hatte ihm schon damals niemand dafür böse sein können. Seit er nur noch Kamillentee trank, saß Céleste hin und wieder mit Louis auf der von ihm so verehrten blauen Bank und lauschte seinen philosophischen und lyrischen Betrachtungen über Gott und die Welt im Allgemeinen und über Eguisheim im Besonderen. Sie fand, dass man dabei mehr über das Dorf und die Leute erfuhr als beim üblichen Klatsch und Tratsch im Bistro oder in Julien’s Winstub. Insofern lag es auch in ihrem Interesse, dass diese blaue Bank ein neues, ebenso inspirierendes Zuhause wie bisher fand.
Louis sah ihr dabei zu, wie sie ihre Krücken nahm, und offenbar fiel ihm erst jetzt auf, dass etwas anders war als sonst. «Was ist denn mit deinem Bein passiert?»
Céleste warf erneut einen finsteren Blick in Richtung Café du Marché. «Bin gestolpert», sagte sie.
«Warst du betrunken?»
«Nein. Ich nicht.»
«Dann vielleicht dein junger Brigadier? Der Bato? Ich hab ihn heute Morgen auch schon gesehen. Sieht aus wie Rocky nach seinem letzten Kampf.»
«Nein. Auch Luc war nicht betrunken.» Céleste unterdrückte ein Seufzen. Es war gerade einmal neun Uhr, und jeder wusste anscheinend schon von ihrem Malheur. Manchmal ging ihr dieses Dorf, das sie eigentlich von ganzem Herzen liebte, ziemlich auf die Nerven. Sie verabschiedete sich hastig von dem alten Müllmann, ehe er weitere Spekulationen anstellen konnte, und versprach, sich um einen würdigen Platz für Madeleines blaue Bank zu kümmern. Dann humpelte sie, so schnell es mit den verdammten Krücken möglich war, zu Tantine Ninette, um für sich und Bato einen süßen Trost zu besorgen.
Tantine Ninette war schon frühmorgens voll besetzt, was bei fünf Tischen nicht weiter verwunderlich war. Vor allem Touristen frühstückten hier. Doch an der Kuchentheke standen auch Claire Kempf, die Besitzerin der Bäckerei nebenan, und Claudine, die Frau des Metzgers, und tranken mit Ninette ein Gläschen. Champagner, wie sich herausstellte, als Céleste mühsam an den Tischen vorbei näher gehumpelt kam und umständlich ihre Krücken an die Theke lehnte. Bevor sie überhaupt eine Bestellung aufgeben konnte, drückte ihr Ninette über den Tresen bereits ein Glas in die Hand.
«Aber es ist gerade mal neun …», protestierte Céleste, woraufhin die Frauen lachten.
«Eben. Die perfekte Zeit für Champagner», sagte Ninette und fügte mit einem Blick auf Célestes dick verbundenen Fuß hinzu: «Sieht so aus, als könnten Sie eine Aufmunterung gebrauchen, meine Liebe.»
Da konnte ihr Céleste nicht widersprechen. Während sie an ihrem Glas nippte, bestellte sie Zitronentörtchen, Schokoladenkuchen und noch ein paar fluffige Madeleines obendrauf und ließ sich alles in eine Tüte packen. Als sie ihren Champagner ausgetrunken hatte und sich von der fröhlichen Damenrunde verabschiedete, stellte sie fest, dass Ninette recht hatte: Neun Uhr war eine hervorragende Zeit für ein Glas Champagner.
Entsprechend beschwingt traf Céleste kurz darauf trotz der Krücken und des schmerzenden Fußes in der Mairie ein. Ein Blick auf ihren Kollegen verriet ihr, dass auch ihm ein Glas Champagner gutgetan hätte: Luc Batos linkes Auge war fast völlig zugeschwollen und schillerte dunkelblau. Auch seine Nase war dicker als gewöhnlich. Er sah tatsächlich aus, als hätte er sich gestern einen Boxkampf geliefert – und verloren. Übellaunig hockte der junge Brigadier vor seinem Rechner.
«Morgen, Chef», nuschelte er, ohne aufzuschauen.
«Morgen.» Céleste lehnte ihre Krücken an den Schreibtisch und stellte die Kuchentüte ab. «Sie sehen scheiße aus.»
Luc nickte. «Weiß ich selber. War schon beim Arzt heute Morgen. Die Nase ist angebrochen.»
Céleste entfuhr ein deftiger Fluch. Henri Breton war ihnen beiden gehörig etwas schuldig, so viel stand fest. «Und was tun Sie dann noch hier?»
«Ich verstehe nicht?»
«Gehen Sie nach Hause, Bato. Sie sind nicht einsatzfähig.»
«Aber ich kann ein bisschen Büroarbeit machen …»
«Sie können doch gar nichts sehen.» Céleste deutete auf Batos zugeschwollenes Auge.
«Ein bisschen schon. Und ich hab ja noch mein anderes Auge.»
Céleste lachte und begann, die Tüte auszupacken. «Da haben Sie recht. Sogar einäugig sind Sie mir lieber als jeder andere mit zwei Augen, Bato.»
Der junge Brigadier zwinkerte verlegen, was in seinem verschwiemelten Gesicht sehr merkwürdig aussah. «Danke, Chef», murmelte er. «Ich finde Sie mit nur einem gesunden Bein auch ganz gut.»
«Na, dann hätten wir zumindest das geklärt.» Céleste schaltete die Kaffeemaschine ein und reichte Luc wenig später eine dampfende Tasse. «Jetzt frühstücken wir erst einmal, und dann gehen Sie nach Hause.»
«Und Sie?»
Céleste setzte sich und legte ihr verletztes Bein vorsichtig auf dem Schreibtisch ab. «Ich halte hier die Stellung. Jedenfalls bis Mittag. Ich glaube, Eguisheim kann es verkraften, wenn das Auge des Gesetzes in Form von einer Lahmen und einem Blinden einmal einen halben Tag lang ruht.»
Luc Bato biss in ein Zitronentörtchen, kaute bedächtig und nickte dann. «Da haben Sie recht, Chef. Hier passiert ja sowieso nichts.»
Beide ahnten nicht, wie schnell sie eines Besseren belehrt werden würden.
2
Der Mond stand wie eine vollkommene Scheibe am wolkenlosen Himmel und tauchte die krummen Dächer und engen Gassen von Eguisheim in silbriges, unwirkliches Licht. Die Kirchturmuhr schlug drei Mal, als Henri Breton durch das westliche Stadttor hinaus auf die Place Charles de Gaulle trat, wo er sein Auto geparkt hatte. Viertel vor zwölf. Um diese Zeit schlief in der Regel das gesamte Dorf. Dennoch sah er sich verstohlen um. Erst als er sich vergewissert hatte, dass der Platz tatsächlich menschenleer war, nestelte er mit zittrigen Fingern die Autoschlüssel aus der Innentasche seines Jacketts. Der Piepton, mit dem sein Auto sich meldete, klang vorwurfsvoll in seinen Ohren, und das kurze Aufblinken der orangefarbenen Lichter erschien ihm wie ein höhnisches Zwinkern. Mein eigenes Auto verspottet mich, dachte Henri und spürte, wie sich auf seiner Stirn Schweißtropfen sammelten. Er versuchte, sich zu beruhigen, nahm einen tiefen Atemzug und stieg rasch ein.
Im Auto warf er einen Blick in den Rückspiegel und glättete mit einer nervösen Handbewegung sein spärliches Haar. Dann ließ er die Hände sinken. Er musste verrückt geworden sein. Komplett wahnsinnig. Ja. Das war die einzige Erklärung: Er hatte den Verstand verloren. Eine andere Rechtfertigung gab es nicht. Sein Leben ging gerade mit Karacho den Bach hinunter – und er? Was tat er? Warum hielt ihn nur niemand auf? Er öffnete ein Fenster und nach kurzem Zögern auch das auf der Beifahrerseite. Der dadurch entstehende Zug trocknete ihm Stirn und Nacken. Dann startete er den Wagen und fuhr langsam los.
Als er den Dorfrand erreichte, wurde die Luft kühler. Er passierte den ersten Weinberg, der sich unmittelbar an das Dorf anschloss, und sog den herben Duft nach umgegrabener, fetter Erde und das feine Aroma des zarten, überall sprießenden Grüns tief in seine Lungen. Keine fünf Minuten mehr, dann bin ich zu Hause, dachte er erleichtert. Es war alles gutgegangen. Niemand hatte ihn gesehen, gottlob hatte ihn auch die Polizei nicht erwischt. Zwar war er nüchtern, im Gegensatz zu gestern Nacht, dennoch hätte er nicht mit dem Auto fahren dürfen. Er hätte das Rad nehmen müssen, war aber ganz selbstverständlich in sein Auto gestiegen. Und im Grunde spielte es auch keine Rolle. Nichts spielte mehr eine Rolle. Er war verrückt geworden.
Durch die geöffneten Fenster hörte er jetzt die Kirchturmuhr von St. Peter und Paul erneut schlagen. Zwölf Mal, Mitternacht. Er zählte in Gedanken die Schläge mit, als das düstere Maison des Chevaliers hinter der nächsten Biegung auftauchte. Die mit Efeu überwucherte Steinmauer, die das Grundstück umgab, sah aus wie eine Friedhofsmauer, und Henri fröstelte unwillkürlich. Er hatte Hugo Filipiers Haus noch nie gemocht. Ebenso wenig wie er Hugo Filipier mochte, diesen windigen Möchtegern-Adeligen mit seinen undurchsichtigen Geldgeschäften und den unzähligen Frauengeschichten. Er hatte etwas ähnlich Verkommenes an sich wie sein verwildertes, verlottertes Anwesen, fand Henri. Sein Blick wanderte die schier endlose Mauer des Maison des Chevaliers entlang, die an manchen Stellen schon brüchig wurde, und er schnalzte missbilligend mit der Zunge. Es war eine Schande, das Anwesen derart verwahrlosen zu lassen. Im Schatten hinter der Mauer konnte er jetzt das bemooste Dach des alten Pförtnerhäuschens erkennen, das seit einiger Zeit unbewohnt war, und als Henri an den Grund für den Leerstand dachte, wurde ihm noch unbehaglicher zumute. Jeder in Eguisheim wusste Bescheid, und dennoch sprach keiner darüber, fast so, als könnte man damit ungeschehen machen, was passiert war. Niemand wollte mehr dort einziehen, sobald er von jener Geschichte erfuhr, und Henri konnte das gut verstehen. Ihn brächten keine zehn Pferde dazu, dieses verfluchte Haus auch nur zu betreten, obwohl er sich selbst für einen recht vernünftigen, rational denkenden Menschen hielt – doch es gab Grenzen. Es gab Dinge, die waren mit dem Verstand nicht zu erklären. Und die dunkle, ja fast böse Ausstrahlung des Maison des Chevaliers gehörte definitiv dazu, und zwar nicht erst seit diesem Vorfall. Das Maison des Chevaliers war seit jeher unheimlich gewesen. Schon als er noch ein Kind gewesen war, hatte es als Mutprobe gegolten, sich um Mitternacht in den Park zu schleichen und als Beweis einen Kieselstein oder – für die ganz Mutigen – einen giftigen Eibenzweig mitzubringen.
Fast erleichtert näherte er sich dem großen Tor, das das Ende des Grundstücks markierte. Es stand wie üblich offen und gab den Blick frei auf das Herrenhaus mit seinen hohen, schmalen Fenstern und dem säulengestützten Balkon über dem Eingang. Aus einem der Fenster im Erdgeschoss drang ein matter Lichtschimmer. Als Henri näher kam, meinte er zu spüren, wie der Luftzug durch die Wagenfenster kühler wurde. Dann plötzlich drang vom Herrenhaus her ein seltsames Geräusch an sein Ohr, ein grausiges Heulen, hoch und durchdringend. Unmittelbar darauf folgte ein menschlicher Schrei, der ihm die wenigen verbliebenen Haare auf seinem Schädel zu Berge stehen ließ.
Unwillkürlich trat er auf die Bremse. Er wartete und lauschte, doch alles blieb still. Im nächsten Moment stürzte eine Frau aus der Einfahrt, und als sie Henri sah, fing sie erneut an zu schreien und mit den Armen zu fuchteln. Sie trug nur ein hauchdünnes weißes Etwas am Leib und war barfuß. Ihre langen Haare hingen in wirren Strähnen herab, und in ihren weit aufgerissenen Augen stand die nackte Panik. Noch immer schreiend und die bloßen Arme hilfesuchend ausgestreckt, kam sie über die Straße direkt auf Henri Bretons Wagen zugerannt.
Nach ein paar erwartungsgemäß ereignislosen Stunden hatte sich Céleste gegen Mittag bei Marie, der Sekretärin des Bürgermeisters, abgemeldet und war nach Hause gehumpelt. Der Bürgermeister André Ginglinger, der von allen nur Dédé gerufen wurde, war für zwei Wochen im Urlaub an der Côte d’Azur, was Céleste ihm aufrichtig gönnte. Den Nachmittag und den Abend verbrachte sie gemütlich zu Hause, das Bein hochgelegt, und schaute sich eine Fantasyserie an, von der gerade die x-te Staffel angelaufen war und die groß gehypt wurde. Sie hatte die vorherigen Staffeln nicht gesehen und deshalb keinen blassen Schimmer, worum es eigentlich ging. Aber das war ihr nur recht. Berieselung funktionierte am besten, wenn man nicht nachdenken und schon gar nicht mitfiebern musste. Céleste wollte gerade von der Couch ins Bett wechseln, als sich ihr Bereitschaftshandy meldete. Es trällerte unangenehm laut und blechern, und Céleste schaltete es schnell auf stumm, während sie die Nummer auf dem Display ansah: eine ihr unbekannte Handynummer. Nächtliche Notrufe gab es in Eguisheim so gut wie nie, und die Rufbereitschaft, die sie sich mit Luc und den Kollegen aus Wettolsheim teilte, wurde kaum einmal in Anspruch genommen. Deshalb hatte sie es heute trotz ihres leicht angeschlagenen Zustands auch nicht für nötig befunden, die turnusgemäß ihr obliegende Pflicht jemand anderem aufs Auge zu drücken. Sie meldete sich mit vollem Namen und Titel und war einigermaßen verblüfft, als sie die Stimme am anderen Ende der Leitung erkannte.
«Henri? Du schon wieder?»
Henri Breton hob zu einer Erklärung an, verhaspelte sich und verstummte für einen Moment. Im Hintergrund hörte man eine Frau weinen.
«Was ist los?»
Er fluchte ausgiebig – etwas, das Céleste von Henri ebenfalls nicht kannte – und versuchte es dann erneut. Dieses Mal mit etwas mehr Erfolg. Céleste lauschte schweigend, und mit jedem hastigen Satz, der aus dem Handy drang, hoben sich ihre Augenbrauen weiter. Henri endete mit der Ankündigung, bereits auf dem Weg zur Polizeiwache zu sein, und Céleste versprach, ihn dort zu treffen, ehe sie auflegte.
«Ein Geist?», fragte Céleste zur Sicherheit noch einmal nach.
Sie saß mit Henri und seiner halbnackten Begleitung in ihrem Dienstzimmer in der Mairie. Die junge blonde Frau, die sich als Segolène Lambert vorgestellt hatte, trug nur ein Negligé, ein weißes, seidiges Nichts mit hauchdünnen Trägern, das ihr kaum über den Po reichte. Sie war barfuß, kreidebleich und offensichtlich mit den Nerven völlig am Ende. Céleste hatte ihr eine Decke um die Schultern gelegt. Henri Breton war zu Célestes Erleichterung nüchtern und vollständig bekleidet, jedoch nervlich in ähnlicher Verfassung wie Madame Lambert. Er schwitzte, und seine Hände zitterten.
«Ihr habt also einen Geist gesehen?», wiederholte Céleste ihre Frage etwas bestimmter, nachdem beim ersten Mal keine Reaktion erfolgt war. Sie überlegte, wie der grundbiedere, seit Jahrzehnten verheiratete Henri und diese junge Frau im Negligé zusammenpassten. Und der Geist, nicht zu vergessen.
Henri Breton schüttelte den Kopf. «Ich nicht …»
«Ich. Ich habe ihn gesehen», flüsterte die Frau und riss die Augen so weit auf, dass man meinen konnte, sie würden ihr gleich aus den Höhlen fallen. «Es war ein Mädchen.»
Céleste räusperte sich. «Ein Mädchen? Ein Gespenst mit Zöpfen, oder wie soll ich mir das vorstellen?»
«Eine junge Frau in einem weißen Kleid. Sehr dünn, mit langen Haaren und leeren Augen. Löchern statt Augen. Und da war so ein Heulen. Es war schrecklich …» Sie hielt sich in Erinnerung daran die Ohren zu.
«Ein Heulen …» Henri nickte und wurde noch ein wenig blasser, als er ohnehin schon war. «Das habe ich auch gehört …» Er schauderte und fuhr sich mit beiden Händen über sein langes Gesicht.
«Was genau hast du gehört? Und wo?», wandte sich Céleste an Henri.
«Ich war direkt am Tor des Maison des Chevaliers. Da hab ich so einen hohen Ton gehört.» Er überlegte. «Wie … wenn der Wind durch einen alten Kamin heult, nur lauter, durchdringender … irgendwie nicht …» Er räusperte sich etwas verlegen. «… nicht … normal. Und dann hab ich einen Schrei gehört, und jemand ist aus dem Tor gekommen, direkt auf mein Auto zugelaufen …»
«Dein Auto? Du warst mit dem Auto unterwegs?», fragte Céleste verblüfft.
Henri zögerte. «Ja.»
«Sag mal, Henri, seit wann bist du eigentlich so ein Idiot?», fragte Céleste kopfschüttelnd und musterte den Wirt ratlos. Er ließ seine ohnehin schon schmalen Schultern noch tiefer herabhängen und sah mehr denn je wie ein trauriger großer Vogel aus. «Was hattest du da überhaupt zu suchen, mitten in der Nacht? Dein Bistro ist doch längst zu?»
Er gab keine Antwort.
Céleste zuckte ratlos mit den Schultern und wandte sich an die Frau. «Sie sind also bei Hugo Filipier zu Gast?»
Segolène Lambert nickte und schluchzte auf. «Er ist mein … wir … sind zusammen.»
Céleste nickte. «Verstehe. Und wo ist Monsieur Filipier jetzt? Warum hat er Ihnen nicht geholfen bei dieser … ähm, Begegnung?»
«Er war nicht da.» Die Frau starrte Céleste einen Augenblick lang an, dann fügte sie mit zitternder Stimme hinzu: «Sie glauben mir nicht.»
Céleste hob entschuldigend die Schultern. «Es klingt ein wenig seltsam, Madame …»
«Es war ein Geist! Der Geist einer jungen Frau», insistierte Madame Lambert. «Sie stand auf der Veranda und hat mich direkt angesehen …»
«Und das ohne Augen?» Céleste hob eine Braue.
«Bitte! Glauben Sie mir! Ich bin doch nicht verrückt!» Die Frau wandte sich an Henri: «Sagen Sie doch was! Sie haben es doch auch gehört.»
«Hab ich ja schon gesagt.» Henri schaute unentschlossen von der jungen Frau zu Céleste. Die stand auf und griff nach ihren Krücken. Henri senkte beschämt den Blick. «Tut mir leid wegen gestern, Céleste. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.»
Céleste ging nicht darauf ein. Sie humpelte zur Tür und sah die beiden auffordernd an. «Dann mal los. Schauen wir uns diesen Geist mal an.»
Segolène Lambert fuhr erschrocken herum. «O nein. Ich gehe da nicht mehr hin. Auf keinen Fall.»
Céleste seufzte. «Wo wollen Sie sonst hin?»
«Ich … ich weiß nicht …»
«Wo wohnen Sie denn?»
Die Frau zögerte. «In … ähm … Nancy.»
«Ich glaube nicht, dass Sie jetzt, mitten in der Nacht, nach Nancy fahren sollten, noch dazu in dieser Verfassung. Und wenn doch, wäre es vielleicht gut, sich vorher etwas anzuziehen», gab Céleste trocken zurück. «Also kommen Sie schon. Ich begleite Sie ja.»
«Und ich?», ließ Henri ungewöhnlich schüchtern vernehmen. «Kann ich nach Hause fahren?»
«Fahren ganz sicher nicht.» Céleste streckte die Hand aus. «Die Autoschlüssel.»
Henri starrte sie an. «Aber bis zu mir nach Hause sind es über vier Kilometer.»
Céleste hob die Schultern. «Das hättest du dir früher überlegen müssen. Du kannst ja deine Frau anrufen und sie bitten, dich abzuholen.»
Henri zuckte zusammen. «Irène?» Sein Gesicht war jetzt aschfahl. «Das geht nicht. Irène … ist nicht da.»
«Ach. Wo ist sie denn?»
«B-b-b-bei ihrer Schwester», stotterte Henri.
Céleste verdrehte die Augen. «Also gut, ich nehme dich bis zum Maison des Chevaliers mit. Das ist der halbe Weg. Den Rest kannst du laufen.» Sie hoffte, dass sie mit ihrem geschwollenen Fuß überhaupt fahren konnte, doch das erwähnte sie nicht.
Henri Breton nickte.
Céleste fuhr vorsichtig an, ohne ihren Knöchel allzu sehr zu belasten. Zu ihrer Erleichterung war die Fahrt recht kurz. Als sie Henry am Maison des Chevaliers aussteigen ließ und er mit gekrümmtem Rücken und hängenden Schultern zu Fuß weiterging, überkam sie Mitleid mit dem offensichtlich von irgendetwas schwer gebeutelten Mann, und sie rief ihm nach: «Danke, Henri.»
Überrascht drehte er sich um. «Wofür?»
«Dafür, dass du der Frau geholfen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Zumal du damit riskiert hast, noch mehr Ärger zu bekommen.»
Henri lächelte ein müdes Lächeln. «Ärger … ja …» Er nickte vage und machte ein zweifelndes Gesicht, als ob er sich noch mehr Ärger gar nicht vorstellen konnte. Dann wandte er sich um und schlurfte entlang der Landstraße weiter, bis ihn die Dunkelheit verschluckte.
Die große, schwere Haustür des Maison des Chevaliers stand sperrangelweit offen, und als sie darauf zugingen, wurde Segolène Lambert immer langsamer. Fast schien sie sich hinter Céleste verstecken zu wollen. Céleste hatte durchaus Verständnis für die Furcht der jungen Frau. Schon ohne heulende Gespenster wirkte der alte, renovierungsbedürftige Kasten düster und unheilvoll. Hugo Filipier hatte ihn von einem Onkel zweiten oder dritten Grades geerbt, als er gerade mal Anfang zwanzig gewesen war. Damals hatte Filipier noch in Paris gewohnt und studiert und war nur sporadisch hergekommen, um mit seinen Freunden wilde Feste zu feiern und im Park des Anwesens mit Jagdgewehren herumzuballern. Céleste war damals noch zu jung gewesen, um sich wirklich an ihn zu erinnern, doch sie kannte die Geschichten. Inzwischen war Hugo Filipier Ende fünfzig und hatte vor rund fünfzehn Jahren das Maison des Chevaliers zu seinem Hauptwohnsitz erkoren – was jedoch am Zustand des Hauses und der Parkanlagen nichts geändert hatte. Noch immer machte beides einen vernachlässigten, ja geradezu verwahrlosten Eindruck, was vor allem daran lag, dass Filipier zwar für sich in Anspruch nahm, Nachfahre alten elsässischen Landadels seit dem 13. Jahrhundert zu sein, jedoch keinerlei Interesse an dem Anwesen hatte. Seine einzige wirkliche Leidenschaft war die Jagd. Danach, mit großem Abstand, folgten Frauen – eine endlos scheinende Reihe überwiegend junger, hübscher Frauen, die kamen und gingen, und es war Céleste ein Rätsel, was sie alle an einem dicklichen, arroganten und in die Jahre gekommenen Langweiler wie Hugo Filipier fanden.
Sie trat mit der aktuellen Geliebten aus Hugos langer Liste über die Schwelle und sah Madame Lambert fragend an. «Wo genau waren Sie, als Ihnen der Geist erschienen ist?»
«In der Bibliothek.» Mit zitternder Hand deutete die junge Frau auf eine offene Tür am anderen Ende des mit Geweihen und Jagdtrophäen zugepflasterten Flurs.
Unter den toten Augen zahlreicher Rehböcke, Wildschweine und Auerhähne liefen die beiden den Gang entlang und traten in den Raum, den Segolène Lambert als Bibliothek bezeichnet hatte. Zwei deckenhohe, gut bestückte Bücherregale aus dunklem Mahagoniholz rechtfertigten den Begriff ‹Bibliothek› durchaus, wobei Céleste sich sicher war, dass keines der Bücher tatsächlich von Filipier gelesen worden war. Die breite Stirnseite des Raumes gehörte dagegen der modernen Technik. Dort thronte ein riesiger Flachbildfernseher, der, flankiert von zwei großen Lautsprechern, fast die gesamte Breitseite des Raumes einnahm. Mitten im Zimmer, zum Fernseher ausgerichtet, standen ein breites Sofa und ein Glastischchen. Ein kaputtes Weinglas nebst dazugehöriger Rotweinflasche und eine zerknüllte weiße Wolldecke lagen vor dem Sofa auf dem Boden. Die Decke war getränkt vom verschütteten Rotwein, der im schwachen Licht einer kleinen Lampe, die die einzige Lichtquelle darstellte, wie Blut hätte wirken können, wäre da nicht der durchdringende Weingeruch gewesen. Der Fernseher zeigte ein leeres blaues Bild.
Céleste suchte die Fernbedienung und schaltete ihn aus. «Was haben Sie sich denn für einen Film angesehen?», fragte sie die junge Frau. «War es vielleicht ein Gruselfilm?»
«Nein.» Aus irgendeinem Grund wurde Segolène Lambert rot.
«Da kann man es ganz schön mit der Angst bekommen, wissen Sie. Ich habe mal einen Film gesehen, in dem ein Haus …» Céleste unterbrach sich überrascht. Ihr Blick war auf eine DVD-Hülle gefallen, die auf dem Boden lag. «Cinderella? Walt Disney? Im Ernst?»
«Das ist einer meiner Lieblingsfilme», gab Segolène Lambert verlegen zu. «Es macht mich immer so glücklich, wenn Cinderella trotz der Gemeinheiten, die ihre Schwestern und die Stiefmutter ihr zufügen, mit den Tieren singt und tanzt. Sie nicht?»
Nein, dachte Céleste. Davon bekomme ich Magenkrämpfe. Und einen Zuckerschock. Doch das sagte sie nicht. Stattdessen schaute sie sich in dem hohen Raum um und blieb schließlich vor dem Sofa stehen. «Wo genau ist das Gespenst aufgetaucht?»
«Da.» Madame Lambert deutete auf die offene Verandatür. «Zuerst habe ich nur dieses grausige Heulen gehört, ganz leise. Aber dann wurde es lauter, und ich habe sie … also es … Es stand genau vor der Tür.» Sie erschauerte erneut.
Céleste humpelte hinaus auf die Veranda, die entlang der gesamten Rückseite der Villa verlief, und versuchte, dabei ihre Taschenlampe anzuknipsen, ohne ihre Krücken fallen zu lassen – was nicht ganz einfach war. Die morschen Holzplanken knarrten unter ihren Schritten, und sie klemmte sich ungeduldig eine Krücke unter den Arm. Mit der Taschenlampe in der nun freien Hand leuchtete sie in die Dunkelheit, während sie langsam und unbeholfen die Veranda entlangtappte. Nirgends war etwas Ungewöhnliches zu erkennen. Eine staubige, im Lauf der Zeit schwarz gewordene Holzbrüstung mit aufwendig verschnörkelten Schnitzereien an den Verstrebungen zeugte von vergangenen, sogenannten ‹besseren› Zeiten, als man auf solchen Veranden Tee aus zierlichen Porzellantassen trank, importierte Zigarren rauchte und gepflegte Nachmittagsunterhaltungen führte. Jetzt stand hier nur ein verblichener Liegestuhl, und in der Ecke lehnte ein zerrupfter Strohbesen. Eine Treppe führte hinunter in den weitläufigen Park. Verwilderte Rasenflächen und struppiges, von Kletterranken und Brombeerstauden durchzogenes Unterholz, nur spärlich vom Licht der Fenster erhellt, lagen zwischen noch kahlen Bäumen, die sich kaum gegen den schwarzen Himmel abzeichneten. Céleste stieg mühsam die Stufen hinunter und leuchtete mit der Taschenlampe ein wenig in dem unübersichtlichen Gelände umher. Nichts regte sich. Wenn jemand hier gewesen war, um Segolène Lambert einen Streich zu spielen, so war er längst über alle Berge.
«Was macht Sie so sicher, dass es ein Gespenst war?», fragte Céleste, als sie zurück in die Bibliothek kam. Ihr Fuß pochte wie wild. «Hätte es nicht auch ein echter Mensch sein können? Vielleicht verkleidet, mit einer Maske?»
«Nein, ganz sicher nicht», antwortete die junge Frau bestimmt. «Das war nichts Menschliches. Es war durchscheinend, bläulich-weiß. Ich konnte dahinter die Brüstung der Veranda erkennen. Es war ein Geist …» Die Frau schluchzte erneut auf. «Bitte! Ich möchte endlich von hier weg.»
Céleste nickte und holte ihr Handy aus der Tasche. «Wir sollten erst einmal versuchen, Monsieur Filipier zu erreichen.» Die Frau nannte ihr Hugo Filipiers Nummer, doch es meldete sich nur die Mailbox.
«Wo ist Hugo eigentlich?», fragte Céleste.
Madame Lambert zögerte. «Er hatte eine Verabredung. Eine Versammlung des Jagdvereins. Es war … ich bin überraschend gekommen.» Sie biss sich auf die Lippen, und ihr verschrecktes Kleinmädchengesicht bekam einen trotzigen, wütenden Ausdruck.
«Haben Sie sich deswegen gestritten?», mutmaßte Céleste.
Die andere nickte. «Ja, irgendwie schon. Ich fand, er könnte diese dämlichen Arschgesichter ruhig mal alleine saufen lassen.» Sie schob die Unterlippe vor, und ihre Augen funkelten zornig.
Ein wenig überrascht von der so plötzlich veränderten Ausdrucksweise der Frau nickte Céleste. «Verstehe.» Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. «Ich bringe Sie jetzt in eine Pension. Morgen können Sie dann in Ruhe entscheiden, was Sie tun wollen.»
Céleste begleitete die junge Frau nach oben und wartete vor der Schlafzimmertür, bis die sich umgezogen hatte. Kurze Zeit später kam Segolène Lambert mit einem Koffer aus dem Zimmer, der so groß war, dass sie ihn kaum alleine tragen konnte. Offenbar hatte sie nicht vor, morgen hierher zurückzukehren. In den engen Jeans, Sneakers und einem verwaschenen Sweatshirt, das blonde Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, wirkte sie noch jünger als in ihrem dünnen Nachthemd, fast wie ein Teenager. Mit verbissenem Gesichtsausdruck schleppte sie den Koffer nach unten, ohne sich von Céleste helfen zu lassen.
«Vergessen Sie Cinderella nicht», erinnerte sie Céleste. Sie ging in die Bibliothek, nahm die DVD aus dem Recorder, steckte sie in die Hülle und brachte sie der jungen Frau. Die ließ sie mit einem gespielt gleichgültigen Schulterzucken in ihre mit Glitzersteinen besetzte Umhängetasche gleiten. Im Hof half ihr Céleste, den riesigen Koffer in einen kleinen, verbeulten Peugeot zu wuchten, der ein wenig abseits hinter den Bäumen geparkt war.
«Sollte wohl ein längerer Besuch werden», sagte sie und drückte mit Mühe den Kofferraumdeckel zu.
Segolène Lambert schwieg und stieg in ihr Auto. Céleste fiel auf, dass das Autokennzeichen die Nummernkombination 67 aufwies. Das bedeutete, es war im Departement Strasbourg zugelassen und nicht in Nancy, wo Segolène Lambert angeblich wohnte. Unauffällig notierte Céleste sich das Kennzeichen in ihrer Handfläche und humpelte zu ihrem eigenen Auto. Sie lotste die junge Frau durch die schlafenden Straßen von Eguisheim zur Auberge Le Pigeonneau, die Madame Lagrande gehörte. Die würde kein Problem mit mitternächtlichen Überraschungsgästen haben, so gut kannte sie Madame Lagrande. Sie hatte überhaupt wenig Probleme mit irgendetwas. Groß, dick und stoisch glitt sie wie ein Ozeandampfer durchs Leben, gehüllt in wallende Kleider und fliegende Seidenschals, die tintenschwarz gefärbten Haare zu einem hohen Nest aufgetürmt, scheinbar unberührt von den Widrigkeiten des Lebens.
Die Ausstattung ihrer Herberge zum Täubchen war irgendwann in den Siebzigern steckengeblieben, jeder freie Fleck war belegt von leicht angestaubten Stoffblumen, kleinen Glastieren, Porzellantassen und zierlichen Figurinen, die in einem fast grotesken Gegensatz zur ausladenden Gestalt von Madame Lagrande standen. Ihre verwinkelte Pension befand sich am Ortsrand in einem dunkelrot gestrichenen Hexenhäuschen, umgeben von einem Garten voller Nippes aus Kunststein, kleinen Brunnen, träumenden Elfen, grimmig dreinblickenden Trollen und freundlichen Zwergen, die solarbetriebene Laternen hochhielten, mit denen der verschlungene Gartenweg zum Haus beleuchtet wurde.
Madame Lagrande empfing die beiden in einem rüschenbewehrten lilafarbenen Morgenmantel und passenden Pantoffeln, die üppige Haarpracht zu einem dicken schwarzen Zopf gebunden, der ihr weit über den Rücken reichte. Sie stellte keine Fragen, sondern nahm Segolène Lambert samt ihrem riesigen Koffer wie selbstverständlich in ihre Obhut.
Als Céleste endlich die Tür zu ihrer Wohnung in der Rue du Rempart aufsperrte, war die Nacht fast vorüber. Ohne Licht zu machen, trank sie ein Glas Wasser aus dem Hahn, zog sich im Bad aus und schlurfte humpelnd in ihr Schlafzimmer. Sie öffnete das Fenster, ließ den Duft nach Flieder und Frühling ins Zimmer und kroch aufatmend unter die Bettdecke. Praktisch sofort fiel sie in einen tiefen, glücklicherweise von keinen Geistern bevölkerten, wohligen Schlaf, während sich vor dem Fenster allmählich schon die Vögel bereit machten, den neuen Tag zu begrüßen.
3
Am nächsten Morgen, nach nur wenigen Stunden Schlaf, überhörte Céleste prompt den Wecker und musste sich höllisch beeilen, um wenigstens einigermaßen pünktlich in die Mairie zu kommen. Dort empfing sie Luc Bato in einem frischgebügelten himmelblauen Uniformhemd, ausgeschlafen und erheblich besser gelaunt als gestern. Offenbar hatte ihm der freie Tag gutgetan. Auch wenn sein Gesicht noch geschwollen war und das Veilchen, das ihm Henri verpasst hatte, inzwischen in allen Farben leuchtete, sah er fast schon wieder wie der alte Luc aus, der Naturbursche, den so leicht nichts umhaute. Seine kräftige, durchtrainierte Gestalt und seine gesunde Gesichtsfarbe hatte Luc keinem Fitnessstudio oder Solarium zu verdanken, sondern dem Bauernhof seiner Eltern, der eine halbe Stunde entfernt von Eguisheim in den Vogesen lag. Dort pflegte er die Wochenenden mit viel gesunder Arbeit an der frischen Luft zu verbringen. Sein blaugrün schillerndes Auge und die noch immer zerknautscht wirkende Nase verliehen ihm an diesem Morgen geradezu etwas Verwegenes. Allerdings nur, wenn man ihn nicht näher kannte. Verwegenheit war nämlich eine Eigenschaft, die Luc Bato völlig fremd war.
Bei seinem tadellosen Anblick fiel Céleste ein, dass sie heute Morgen in der Eile vergessen hatte, sich zu frisieren. Schlechtgelaunt fuhr sie sich mit den Fingern durch die dichten dunklen Locken, kramte aus ihrer Uniformjacke ein Haargummi hervor und flocht sich ihren obligatorischen Arbeitszopf, während sie sich an ihren Schreibtisch setzte und Luc einsilbig begrüßte.
«Gut geschlafen, Chef?», fragte Luc leutselig.
Céleste hob eine Augenbraue. «Sehe ich etwa so aus?», fauchte sie.
Luc klappte erschrocken den Mund zu. Nach einer Weile fragte er vorsichtig: «Kaffee, Chef?»
Céleste nickte stumm, und ihr wohlerzogener Brigadier stand auf und brachte ihr schweigend einen großen Becher.
Eine Viertelstunde später hatte sich Célestes Stimmung so weit gebessert, dass sie in der Lage war, Luc über ihren neuerlichen nächtlichen Einsatz zu berichten.
Der runzelte die Stirn. «Was denken Sie, was das war, Chef?», fragte er, als sie geendet hatte.
«Was war was?», mischte sich eine Stimme ein, bevor Céleste antworten konnte. Die beiden drehten sich überrascht um. Dédé stand in der Tür und sah sie beide neugierig an.
«Was machen Sie denn hier, Monsieur le Maire?», fragte Céleste. «Sie sind doch im Urlaub!»
«Das war ich.» Dédé trat wichtigtuerisch ein. Er war klein, rund und kurzbeinig, und er hatte eine Glatze, über die er sich ständig mit einem Taschentuch wischte – eine für ihn so typische Bewegung, dass sie im Dorf bereits Symbolcharakter hatte.
«Aber nur drei Tage …»
«Wenn man es richtig macht, dann reicht das.»
«Wollten Sie nicht an die Côte d’Azur fahren?», erkundigte sich Luc.
«Meine Frau wollte das», stellte Dédé richtig. Im selben Moment erschrak er. «Wie sehen Sie denn aus, Brigadier? Haben Sie sich geprügelt? Und was sind das für Krücken?» Er blickte beunruhigt von einem zum anderen.
«Nicht so wichtig», meinte Céleste. «Nur ein kleiner Betriebsunfall.»
«Betriebsunfall?» Dédé wischte sich mit seinem obligatorischen Taschentuch über die Stirn. «Das klingt aber gar nicht gut.»
«Erzählen Sie doch erst einmal von Ihrem Urlaub. Von der Côte d’Azur, und warum Sie schon wieder da sind.»
«Ach, wissen Sie, das da unten ist nichts für mich. Dieser Süden. Zu viel Meer, ständig gibt es Fisch und Muscheln und so Zeug …» Er verzog das Gesicht. «Außerdem ist es viel zu heiß.»
«Es ist doch erst Ende April», wandte Céleste lachend ein.
«Ja, eben! Stellen Sie sich mal vor, Kreydenweiss, wie das erst im Juli ist! Ich habe jetzt schon ständig geschwitzt.» Er schüttelte den Kopf. «Nein, das ist keine Gegend für mich.»
«Und Ihre Frau?», fragte Luc. «Ist sie nicht enttäuscht, dass der Urlaub so kurz war?»