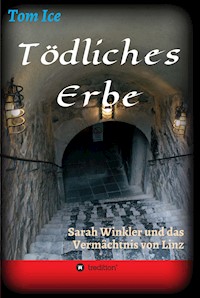
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sarah Winkler
- Sprache: Deutsch
"Tödliches Erbe - Sarah Winkler und das Vermächtnis von Linz" ist ein Kriminalroman, der vor der malerischen Kulisse der kleinen Rheinstadt spielt. Zum Inhalt: In Linz spielen sich seltsame Dinge ab. Die sonst so ruhige Stadt am Rhein wird erschüttert von einem mysteriösen Mordfall. Graf Gero von Wolkenfels wird, grausam zugerichtet, in der Folterkammer seiner Burg gefunden. Die Kriminalkommissarin Sarah Winkler aus Koblenz ermittelt mit ungewöhnlichen Methoden und gemeinsam mit ihrem Kollegen Fabian Lauer aus Linz - und noch während sie von Visionen heimgesucht wird, die ihre eigene Vergangenheit betreffen, geschieht ein weiterer Mordfall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Für Christine, meine wunderbareGefährtin und Seelenverwandte.
Tom Ice
Tödliches Erbe
Sarah Winkler und das Vermächtnis von Linz
Tom Ice, „Tödliches Erbe – Sarah Winkler und das Vermächtnis von Linz“
© 2018: Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
© 2018: Thomas Hoffmann
Umschlag/Foto: Thomas Hoffmann
Porträtfoto: Dieter Kämerow, Foto Bauer, Wissen
Lektorat, Korrektorat: Rainer Daus, Bad Berleburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-7306-7
Hardcover:
978-3-7469-7307-4
e-Book:
978-3-7469-7308-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
„Es hat in unsrer Mitte Zaubererund Zauberinnen, aber niemand weiß sie.“
Hugo von Hofmannsthal, österreichischer Schriftsteller und Dramatiker (1874-1929)
Prolog
Einen Monat vor der Gegenwart
Peter Sinner zitterte am ganzen Körper. Er las den Brief, den er in der linken Hand hielt, bereits zum vierten Male. Aber obwohl seine Augen immer wieder die Worte registrierten und obwohl sein Verstand versuchte, das zu begreifen, was er da schwarz auf weiß, oder besser blau auf weiß, vor sich sah, schien eine Sperre in seinem Kopf zu verhindern, dass er den gesamten Sinn von dem erfasste, was seine Mutter ihm als letzten Gruß hinterlassen hatte.
Er ließ die Hand sinken und dachte an seine Mutter, die vor einer Woche gestorben war. Er sah sie, die Heldin seiner Kindheit und auch Jugend, er sah sie, wie sie ihm Lesen und Schreiben beibrachte (da war er gerade mal fünf gewesen), er sah sie, wie sie mit ihm gemeinsam am Rhein saß und ihm Geschichten von der Loreley und den Nibelungen und deren Rheingold erzählte und er sah sie, wie sie ihn als Dreijährigen im Garten ihres kleinen Hauses in Remagen herumschwenkte; er sah ihre herrlichen blonden Haare fliegen und ihr schönes Gesicht lachte ihm zu. „Peter, mein Peter, was für ein Glück, dass ich dich habe!“, rief sie und sie lachte erneut. Sie hatte ihn geliebt und auch er hatte sie geliebt und er hatte gemeinsam mit ihr gegen die heimtückische Krankheit gekämpft, ein Kampf, den sie und damit auch er, am Mittwoch letzter Woche verloren hatte.
Als sie spürte, dass kein Arzt und keine Medizin mehr helfen würde, hatte sie darauf bestanden, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden und war nach Hause gekommen; nach dem Zuhause, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hatte und in dem sie die meiste Zeit glücklich gewesen war, glücklich mit dem einzigen Menschen, der ihr etwas bedeutete, mit ihrem Sohn. Sie hatte ihn ein letztes Mal mit ihrem berühmten Mutterlächeln angesehen (ich bin für dich da, mein Junge, dir kann nichts passieren), das nur ihm allein gehörte und das er so an ihr liebte, und sie hatte gesagt: „Peter, in meinem Bankschließfach ist ein Brief für dich, er wird dir alle Fragen beantworten, die du schon lange hattest, und wenn du es richtig machst, wird er für dich die Eintrittskarte in eine wunderbare Zukunft sein.“
Erneut blickte er nun auf den Brief. Vielleicht war es das Zittern seiner Hand, vielleicht auch nur ein Lufthauch, jedenfalls veränderte sich die geruchliche Atmosphäre des Raumes schlagartig. Er nahm einen Duft von Blumen und Wildheit und Freiheit wahr, der sich aus dem Papier zu erheben schien. Und mit diesem Duft war auch seine Mutter plötzlich hier, sie stand neben ihm und lächelte ihn an, so jung und schön und voller Leben, wie sie noch vor einem Jahr gewesen war. Wenn du es richtig machst, wird er für dich die Eintrittskarte in eine wunderbare Zukunft sein.
Seine Miene veränderte sich. Der nachdenkliche, traurige Blick, der Peters Gesicht bis vor wenigen Sekunden beherrscht hatte, verschwand vollständig und an seine Stelle trat ein Ausdruck des Erstaunens. Dann lachte er plötzlich und es war ein Lachen, wie es vielleicht auch der griechische Gelehrte Archimedes ausgestoßen hatte, als er etwa 240 vor Christus eine bahnbrechende Entdeckung machte und mit den Worten „Heureka, ich hab´s“ aus seinem Badezuber sprang und nackt auf die Straße rannte.
Sollte es nämlich tatsächlich so sein, wie die weiche, kunstvolle Schrift es darstellte, müsste seine Geschichte zumindest in Teilen neu geschrieben werden. Mehr noch, würde das Ganze sich als wahr herausstellen - und daran gab es spätestens seit seiner Erleuchtung vor wenigen Sekunden für ihn nicht den geringsten Zweifel - wäre er nicht mehr Peter Sinner und ganz sicher nicht nur ein einfacher, wenn auch bis zu diesem Zeitpunkt zufriedener, Metallfacharbeiter, sondern ein „von Wolkenfels“, Mitglied einer im hiesigen Raum noch immer einflussreichen und vor allem vermögenden Adelsfamilie, deren Verbindungen einst bis an den französischen und heute noch bis an den niederländischen, schwedischen, norwegischen und englischen Hof gereicht hatten und reichten.
Wie aber sollte er sein Wissen verwerten, wie ließ sich aus den vorhandenen Informationen Kapital schlagen? Er konnte ja nicht einfach so mit der Fähre über den Rhein übersetzen, in die Burg spazieren und nach dem Grafen verlangen.
Peters Gesicht verwandelte sich erneut, auf der eben noch glatten Stirn bildeten sich Falten, die nach oben gezogenen Mundwinkel wurden zu einem bleichen Strich und die Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen.
Graf, wenn er das Wort nur dachte, drehte sich beinahe sein Magen um und er spürte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte. „Graf“, das Wort kam laut und wütend aus seinem Mund und zugleich lachte er ironisch. „Graf“, spuckte es noch einmal aus ihm hervor, „ich werde dir zeigen, was für ein Graf du bist.“
Er ging auf den Balkon. Von hier aus hatte er einen prächtigen Blick auf den Rhein und hinüber nach Linz, wo Teile der mittelalterlichen Fassade zu sehen waren. Sein markantes Gesicht mit der für seine Vorfahren - wie er jetzt vermutete - typischen Adlernase hatte unter den schwarzen, glatten Haaren einen entschlossenen Zug angenommen und er blickte auf die malerische Stadt an der anderen Rheinseite. „Man hat dich mir vorenthalten, aber ich werde dich holen, zumindest den Teil von dir, der mir zusteht“, flüsterte er leise vor sich hin. Seine Züge entspannten sich sichtlich, als er auf den großen Wandspiegel im Flur zuging, sich vor ihn stellte und sein ein Meter einundachtzig großes athletisches Ebenbild betrachtete, das jetzt beide Arme erhoben und die Finger beider Hände zum Victory-Zeichen geformt hatte. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, aber es war kein Lächeln, das seiner Mutter gefallen hätte. Mutter, du hast recht, dachte er bei sich, er wird für mich die Eintrittskarte in eine wunderbare Zukunftsein. Er ging in sein Arbeitszimmer und legte den Brief links auf seinen Schreibtisch. Während der Computer hochfuhr, las er ihn ein sechstes Mal. Er rief die Google-Oberfläche auf und gab einige Worte ein. Wenig später hatte er das gefunden, wonach er suchte. Er nahm sein Smartphone und rief zuerst seinen Chef an, um sich seinen Resturlaub für dieses Jahr zu nehmen; anschließend wählte er die Nummer, die er vor sich auf dem Bildschirm sah.
1. Kapitel
Gegenwart
Das Feuer im Kamin knackte und gab dem Raum, trotz seiner Größe, mit seinem gelb-rötlichen Widerschein eine anheimelnde, wohlige Atmosphäre. Langsam und liebevoll legte der Graf seine kraftvollen Hände, die sich warm und stark anfühlten, um ihre Hüfte. Er zog sie an seinen halbnackten Körper heran und liebkoste ihren Hals und ihre Brüste mit sanften Küssen. Sie roch seinen alkoholgeschwängerten Atem und sah seine rotgeäderten Augen. Er wurde jetzt fordernder und seine rechte Hand fasste hart an ihr Geschlecht. Sie wehrte sich, aber er machte immer weiter und weiter. Sie riss sich los und rannte. Jetzt befand sie sich vor einem großen Spiegel. Sie sah hinein und sie sah, dass sie einen schwarzen Kapuzenumhang trug. Sie sah die silberne Kette mit dem kleinen, kunstvollen Kreuz an ihrem Hals im Spiegel glitzern. Ihr Gesicht erkannte sie nicht, es wirkte seltsam verschwommen, wie unter Tränen. „Du gehörst mir, mir ganz allein“, hörte sie plötzlich die raue, tiefe Stimme des Grafen hinter sich und sie spürte, wie er an ihren Haaren riss. Sie sah, dass er jetzt vollkommen nackt und sehr erregt war. Sie stemmte sich mit aller Kraft gegen ihn und erneut gelang es ihr, zu entkommen. Wenig später befand sie sich im Burgverlies, in dem sie jetzt vor diesem seltsamen dreieckigen Ding stand, das sie schon so oft gesehen hatte. Aber etwas war diesmal anders, ganz anders. Mit einem gellenden Schrei erwachte Manuela.
2. Kapitel
AAAAAAIIIIIIIHHHHHUUUUUAAAAIIIIIIHHHHUUUUAAAA. Der grauenhafte, langgezogene Laut, der aus dem Keller über den nächtlichen Burghof hallte, ließ Jens Thielmann das Blut in den Adern gefrieren. Der Reporter spähte vorsichtig durch die verschlossene Gitterdrehtüre in die Folterkammer hinein, aus der er jetzt schreckliches Gewimmer hörte; Gewimmer von einem Menschen, der Höllenqualen auszustehen schien. Noch einmal das markerschütternde Geheule. Dann war Stille, absolute Stille, aber kurz darauf - vielleicht nach zehn Sekunden - vernahm er klappernde Geräusche und Schritte. Schnell hastete er die Stufen hinauf. Gerade noch rechtzeitig, denn irgendjemand oder irgendetwas kam aus der Folterkammer nach oben, genau auf ihn zu. Die Schritte waren kaum zu hören, aber die hektischen, panischen Atemzüge wurden schnell lauter. Der Reporter zuckte zurück. Sein Körper verschmolz mit den Schatten, die die innere Mauer im fahlen Mondlicht warf. Ganz langsam schob er seinen Kopf um die Mauerecke und jetzt konnte er eine schwarze Gestalt erkennen. In ihrer Kutte erinnerte sie an einen Mönch. Aber die Verkleidung konnte den Reporter nicht täuschen. Er wusste, wer sich unter dem schwarzen Habit verbarg und bald schon, wahrscheinlich sehr bald, vielleicht schon heute, würde er sich dieser Person annehmen müssen.
3. Kapitel
Ansgar von Wolkenfels saß am Pool seiner Villa im spanischen Menorca. Es war jetzt zwei Uhr vierzig am frühen Morgen und ein kalter Wind wehte vom Meer hinauf. Ansgar bemerkte ihn nicht. Er war in seinen weißen Bademantel gehüllt und blickte fasziniert auf die Bilder, die ihn gerade aus Deutschland erreichten. „Genial“ flüsterte er vor sich hin. Vor wenigen Augenblicken war die Falle zugeschnappt, die er aufgestellt hatte; eine Falle, aus der es kein Entrinnen gab. Alles lief nach Plan und es wurde von Sekunde zu Sekunde besser. Ansgar stutzte. Er hielt das Gesicht ganz nahe vor den Bildschirm und verharrte mehrere Minuten in dieser Stellung. „Das gibt´s doch nicht“, sagte er leise zu sich selbst, „das hätte ich nicht gedacht, das ist ja Wahnsinn, besser als alles, was ich bisher gesehen habe, das nenne ich mal einen absoluten, uneingeschränkten, vollen Erfolg.“ Er legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Eine einzelne schwarze Haarsträhne, die von seinem einstmals vollen Haar übriggeblieben war und die wie eine elegante Trauerflagge das rechte Auge seines aufgedunsenen Gesichtes bedeckte, bewegte sich verspielt im Wind. „Aber jetzt muss ich meinen Plan modifizieren“, sagte er laut und entschlossen, als er die Augen wieder öffnete. „Kein Problem, ich bin der Einzige, der Geniale, der Unerreichbare!“, rief er in die sternenklare Nacht. „Ich bin Ansgar von Wolkenfels und bald wird Alles, Alles, Alles mir gehören!“
Er speicherte die Eingänge der letzten Stunden ab. Die ersten Fotos verwarf er, die hatten in dem neuen Plan nichts mehr verloren, aber von den letzten zwanzig, die er erhalten hatte, lagerte er vier in eine gesonderte Datei aus. Diese sendete er über einen gesicherten Server, der irgendwo in Südamerika saß und nicht zu identifizieren war, wieder nach Deutschland, genau an die Adresse, von der er die Bilder erhalten hatte. Der Empfänger würde wissen, was zu tun ist.
4. Kapitel
Der heutige Oktobersamstag versprach ein herrlicher Tag zu werden, am Himmel waren keinerlei Wolken zu sehen und die sanfte Sonne der Morgendämmerung tauchte das untere Stadttor und den der Burg Linz vorgelagerten Platz mit den mittelalterlichen Häusern und ihrem kunstvollen Fachwerk in ein verträumtes, beinahe magisch wirkendes Licht. Die über vielen Türen an gedrechselten Edelmetallstangen befestigten messingglänzenden Schilder mit ihren kunstvoll geschwungenen Brezeln, Weinfässern und Scheren verrieten - zumindest in den meisten Fällen - auch heute noch den Beruf der in ihnen wohnenden Menschen, von denen viele gerade ihre Nacht beendeten, um sich einem neuen, unbeschwerten Tag zuzuwenden. Unten am Rhein hatte die Fähre bereits seit zwei Stunden ihren Betrieb aufgenommen und sie brachte die ersten Passagiere an diesem Morgen nach Linz, damit diese ihre alltäglichen Arbeiten in den zahlreichen Bekleidungsgeschäften, Bäckereien, Restaurants und anderen für den Tourismus wichtigen und unverzichtbaren Einrichtungen aufnehmen konnten.
Manuela Caspari war an diesem Morgen etwas früher aufgestanden, genauer gesagt, etwa zwei Stunden früher, weil sie noch einige neue Erzeugnisse in die zahlreichen Vitrinen und Regale in den Ausstellungsräumen der römischen Glashütte, die sich in einem Teil der Burg befand, sortieren wollte, ehe der große Besucherandrang um zehn Uhr einsetzte. Jetzt, um kurz vor sieben Uhr, betrat sie den Hof. Die Privaträume des Grafen sowie die Gastronomie-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude lagen noch im friedlichen Halbdunkel. Manu (wie ihre Freunde sie nannten) liebte diese Burg und sie hatte sogar mit dem Grafen eine kurze, leidenschaftliche Affäre gehabt. Dann aber hatte sie entdeckt, dass er Geheimnisse hatte, dunkle Geheimnisse, und sie hatte sich von ihm getrennt. „Ich spiele da nicht mit, das ist nicht mein Ding“, hatte sie gesagt, als sie das letzte Mal bei ihm gewesen war, „du wirst sicher jemanden finden, der toleranter ist als ich.“ Gero war wütend geworden. „Du verdammte kleine Hure, glaubst du denn, du wärest etwas Besonderes, so eine wie dich finde ich an jeder Straßenecke“, hatte er ihr noch hinterhergerufen, aber sie war froh, seinen Machenschaften entkommen zu sein. Sie widmete sich wieder mit ihrer ganzen Kraft ihrer Arbeit in den Ausstellungsräumen der römischen Glashütte. Manu war mit ihren 35 Jahren zwar keine Schönheit im klassischen Sinne, aber in ihren wachen, blauen Augen spiegelte sich eine faszinierende Mischung aus Entdeckergeist, Optimismus und Lebensfreude. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare und wenn sie sich bewegte, schien eine Aura der Leichtigkeit sie zu umgeben.
Die Besucher der Glashütte mochten ihre herzliche Art und ihren Humor und sie wiederum war gerne zwischen all den schönen, glitzernden Dingen, angefangen von Eulen aus Glas über Glasschwerter und Weihnachtsschmuck bis hin zu Glasperlenspielen. Außerdem liebte sie es, die Menschen zu beobachten, die oftmals glänzende Augen bekamen und ab und an auch ihrer Freude Ausdruck verliehen: „Schau, wie schön, dieser Spiegel hier in unserem Flur, die Meiers werden vor Neid erblassen“ oder „Was für ein wunderbarer Engel, alleine das Gesicht und die Flügel, einfach Wahnsinn, der wird Mutter gefallen, ja, sie wird sich freuen, und wie“, solche Sätze hörte sie täglich und diese Worte zauberten auch ihr jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Manu war wieder glücklich und mit sich und der Welt im Reinen.
Und Manu war ein Gewohnheitsmensch. Ihr Credo hieß Routine, denn Routine bedeutete Sicherheit; Sicherheit und Ruhe. Hatte man erst einmal ein festes Konzept, konnte nichts passieren. Gemäß dieser Prämisse lebte Manu bereits seit vielen Jahren und gemäß dieser Prämisse konnte sie auch niemanden in ihrem Leben gebrauchen, schon gar keinen Mann, denn das hätte unweigerlich das Ende jeglicher Ordnung bedeutet. Die kurze, heftige „Affäre“ mit dem Grafen hatte diese selbstgesetzte Regel nur bestätigt; und wie sie sie bestätigt hatte: deutlich und unmissverständlich und ein für alle Male! Und doch, ab und zu sehnte sich Manu nach einem Partner oder noch besser, einer Partnerin, jedenfalls nach jemandem, der sie wärmen und beschützen konnte; erst letzte Nacht war sie in ihrem Bett schweißgebadet aus einem nervenzerreißenden Traum erwacht.
Sie hatte Schreie gehört in diesem Traum, fürchterliche Schreie, und sie hatte etwas gesehen, eine Gestalt, die sie anblickte mit toten, leeren Augen und die mit einer Stimme, als würden Kieselsteine aneinander gerieben, zu ihr sprach. „Ich bin hier unten, und ich warte auf dich, warte auf dich, warte, warte, warte auf dich, dich, dich.“
Als sie jetzt den Burgplatz betrat, beschloss sie - einer plötzlichen Eingebung folgend und gegen ihre innere Überzeugung -, nicht wie üblich zunächst die Ausstellungsräume aufzusperren, sondern sich dem Folterkeller mit den schrecklichen Geräten zu widmen. Der Burgplatz erschien friedlich und ruhig, die beiden Brunnen an der linken Hofseite sprudelten leise und fröhlich und auch ansonsten schien alles in bester Ordnung zu sein. „Träume sind Schäume“, sagte Manu mit ihrer kräftigen, für eine Frau etwas tiefen Stimme und überquerte den Platz mit vier, fünf Schritten, ehe sie die Treppe zum „Verlies“ erreichte. Sie schaute nach unten und bemerkte einen schwachen, rötlichen Schein aus der Kammer. Merkwürdig, dachte sie sich, was ist das?, als sie vorsichtig die Treppe hinunterschritt.
Die vergitterte Drehtüre war verschlossen, aber jetzt nahm sie einen leichten Geruch wahr, einen Geruch nach verbranntem Schwefel. „Was zum Teufel ist hier los?“, fragte sie leise und mit einem Male war der Traum von letzter Nacht wieder da, so klar und deutlich, als würde er mit Gewalt in ihr Gehirn gepresst. Ein eiskalter Schauer lief über ihren Kopf und Nacken und den Rücken hinab und ihr wurde beinahe schwarz vor Augen. Jede einzelne Faser ihres Körpers fühlte sich an wie eine zum Zerreisen gespannte Gitarrensaite und ihr Herz trommelte einen stakkatoartigen Rhythmus in ihrer Brust. Sie lauschte jetzt angestrengt, aber außer einem gelegentlichen Rascheln und einem leisen, unregelmäßigen Knackgeräusch, das sich anhörte, als würden kleine Knochen zerbrochen, konnte sie nichts hören.
Was ist das hier, was hat das Licht zu bedeuten, was ist das für ein schreckliches Knacken?, dachte sie sich, und dann Du musst was tun, Manu, schnell, tu was, tu was, tu was…“
Sie unterdrückte ihre Angst und rannte, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf. Als sie auf dem Hof kurz zu Atem kam, blickte sie sich um. Hier war nach wie vor alles still. „Ganz ruhig, Manu“, ermahnte sie sich selbst, „ganz ruhig, du wirst das hier schon meistern.“ Erst nach dem dritten Versuch gelang es ihr, den Schlüssel zum Hauptgebäude in ihrer Handtasche zu finden. Zitternd schloss sie die große Türe auf, betätigte den Lichtschalter und stürmte nach oben in den Ausstellungsraum der Glasgalerie, wo sie in der Schublade unter dem Verkaufstisch Münzen für die Drehtür zur Folterkammer aufbewahrte, die an die Besucher verkauft wurden. Hastig nahm sie einige in die Hand und griff gleichzeitig mit der anderen nach der sich ebenfalls in der Schublade befindenden Taschenlampe. Sie rannte wieder nach unten, über den Hof und die Treppe zur Folterkammer hinunter. Als sie die Kammer betrat, befand sie sich unmittelbar vor einem Gerät, mit dem in früherer Zeit „Hexen“ aufgezogen worden waren, um ihnen Geständnisse über ihre Buhlschaft mit dem Teufel zu entlocken. Unter dem Schein ihrer starken Lampe warfen die Folterinstrumente noch mehr Schatten als üblich und mit ihren Bewegungen aktivierte sie die Tonanlage, die auch akustisch das Grauen vergangener Jahrhunderte illustrierte. Neben dem Stöhnen, Schreien und irren Kichern aus der Anlage nahm sie aber als Hintergrundgeräusch auch immer wieder dieses seltsame Knacken wahr und jetzt endlich erkannte sie die Quelle. In regelmäßigen Abständen standen schmiedeeiserne Ständer, in denen sich Fackeln befanden. Mehrere dieser Fackeln waren bereits verlöscht oder glimmten nur noch, aber weiter links brannten noch einige und Manuela erkannte, dass das Knacken von den kleinen Flammen herrührte, die sich am Schwefelkörper immer weiter nach unten fraßen.
Ihre Nerven vibrierten, als sie weit hinten in der Kammer einen Schatten erblickte, einen Schatten, der bis an die Decke reichte und der im Licht der flackernden Fackeln makaber zuckte. Obwohl sie am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht hätte, zwang sie ihre Muskeln zum Handeln. Vorsichtig ging sie weiter. Die Taschenlampe hielt sie wie ein Schwert mit beiden Händen vor sich. Sie spürte den Adrenalinschub kaum, der ihren Körper jetzt flutete, ihre Fluchtreflexe aktivierte und ihre Sinne schärfte. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen. „Träume sind Schäume, Träume sind Schäume, Träume sind Schäume“, sagte sie leise vor sich hin, als sie sich langsam dem zuckenden Schatten näherte. Träume sind Schäume, dachte sie noch, als sie am Fuße des Objektes angekommen war und ihre Taschenlampe nach oben richtete. Dann setzten ihr Verstand und ihr Herz mit einem Schlag aus.
Die etwa 30 Passagiere, die an diesem sonnigen Morgen die Fähre vor wenigen Minuten verlassen und gerade erst das untere Stadttor passiert hatten, waren noch in ihre Unterhaltungen, stillen Monologe oder Gedanken vertieft, als eine Serie von abgehackten, spitzen und kaum menschenähnlichen Schreien sie mitten in ihren Tätigkeiten und Bewegungen erstarren und ihre Köpfe, in scheinbar namenlosem Entsetzten, wie auf ein geheimes Kommando in Richtung Burg drehen ließ.
5. Kapitel
Anno 1395 - Mai.
„Ut malediceret tibi: et ob vestra libido Henricus!“. Gisela fluchte, aber die Sprache, in der sie ihre wilden Verwünschungen ausstieß, hätten die wenigsten Menschen verstanden. Es war das Latein der Kirchenleute und Gelehrten, eine alte Sprache, mit der auch ihre Mutter gesprochen hatte, eine Sprache, die - wenn man ihre Geheimnisse kannte - weit mehr bewirken konnte als Besitzansprüche auf Urkunden zu regeln und Heiratsverträge unter Adeligen zu besiegeln. Die vom Schweiß durchnässten goldblonden Haare der Burgmagd klebten am Stroh der kleinen Kate, in der sie ihr erstes Kind erwartete. Schon vor Stunden hatten die Wehen eingesetzt und mit ihnen die Panik. Was sollte sie tun, wie sollte sie sich verhalten? Und sie hatte niemanden, der ihr beistehen konnte, niemanden, der helfen konnte, dieses Ding, was sie in einem unachtsamen Moment mit dem Grafen gezeugt hatte und das sie gar nicht wollte, auf die Welt zu bringen.
„Ich verfluche dich, Heinrich, wegen deiner Fleischeslust!“, rief sie erneut auf Latein, aber gleichzeitig dachte sie an die Nacht der Zeugung. Hell war der Mond gewesen und nach zwei, drei Bechern Wein, die Heinrich ihr eingeschenkt hatte, hatten die Sterne noch heller geleuchtet auf der Veranda des Jagdhauses, zu dem er sie mitgenommen hatte, um, wie er sagte, bei seinem Ausritt nicht vollständig auf sein Personal verzichten zu müssen. Natürlich war ihr klar gewesen, dass Heinrich sie nicht mitnahm, damit sie ihm Getränke anreichte, die Speisen zubereitete oder das Bett machte (obwohl letzteres sicherlich zu ihren Aufgaben gehören würde; so oder so), aber ihr gefiel, wie der Graf sie ansah, wenn sie in der Burg an ihm vorbeiging oder ihm etwas bringen musste. Manchmal, aber wirklich nur manchmal hatte sie sich absichtlich vor ihm gebückt, so als habe sie etwas fallen lassen, und sie hatte gespürt, wie die Blicke des Grafen zuerst auf ihren Kopf, dann auf ihr pralles Mieder und schließlich auf die wohlgeformten Rundungen ihrer Hinterpartie fielen. Und ihr hatte es gefallen, dass der hochherrschaftliche Mann, der überdies stark war und gut aussah (er hatte blaue Augen, schwarze Haare, eine gerade Nase und beinahe noch alle Zähne) ihr seine Aufmerksamkeit schenkte. Auch ansonsten schien er mit seinem lachenden, offenen Gesicht und seiner ungezwungenen Art eine fröhliche Aura zu verbreiten, eine Aura, die Gisela immer heller erschien, je öfter sie in die Nähe des Grafen kam. Für die meisten seiner Untergebenen (hauptsächlich allerdings für die weiblichen) fand er oft gute und lobende Worte. Und für sie, Gisela, hatte er zumindest in den letzten Wochen und Monaten mehr lobende und anerkennende, beinahe schon bewundernde Worte gefunden als für alle anderen. Sein Lächeln war noch strahlender geworden, seine Aura noch heller und es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte in der Burg einen Jubelschrei von sich gegeben, als er sie fragte, ob sie ihn begleiten wolle. Wie dumm war ich doch damals, dachte sich Gisela, als sie jetzt mit schweißnassem Gesicht auf dem fauligen Stroh lag, aber zugleich glänzten ihre Augen, wenn sie an die „verbotene“ Liebesnacht dachte. Verboten deswegen, weil die Frau des Grafen, Mechthild, eifersüchtig über ihren Gemahl wachte. Gisela wäre nicht die erste gewesen, die - hätte Mechthild von der Sache erfahren - ihres Lebens nicht mehr sicher gewesen wäre. Faruka, die man mitten im Winter vom Hofe gejagt hatte, war ebenfalls eine Bedienstete in der gräflichen Burg gewesen, und Carmen war eines Morgens in ihrem Bett gefunden worden, die tote Hand noch an einem Kelch, an dessen Rand sich Spuren von Schierling befanden. Da man die eine verjagt und die andere schnell und ohne kirchlichen Beistand verscharrt hatte, weil es sich - wie der Hofarzt versichert hatte, um einen Selbstmord gehandelt hatte -, konnte natürlich niemand sagen, ob eine der beiden oder gar beide „in Hoffnung“ gewesen waren. In Hoffnung, dachte sich Gisela, eher wohl in Verzweiflung, als ein neuer heftiger Krampf ihr Becken erzittern ließ. Sie spürte, wie sich der Muttermund weiter und weiter öffnete, sie fühlte, wie das Ding aus ihr rauswollte und auch sie wollte es jetzt heraushaben aus ihrem Körper, heraus mit aller Macht, also presste sie, sie presste und presste und presste. Die Schmerzen waren beinahe unerträglich. Ihr schien es, als wolle ihr Rücken zerbrechen, während ihre Beine von einem zunehmenden Taubheitsgefühl befallen wurden. Sie schrie, aber niemand schien sie zu hören. Sie sah helle Sterne vor ihren Augen und einen Augenblick, bevor alles um sie herum schwarz zu werden drohte, spürte sie, wie sich etwas von ihr löste. Ein Wort, das sie so oft in der Kirche gehört hatte, fiel ihr ein: ERLÖSUNG! Mit einer Kraft, die sie noch vor wenigen Sekunden nicht für möglich gehalten hätte, schrie sie das Wort heraus: ERLÖSUNG, ERLÖSUNG, ERLÖSUNG!!!, und es schallte über die nahen Wiesen und Felder bis hinein in den Wald, in dem sie sich vor Monaten (oder waren es Jahre?) mit dem Mann vereinigt hatte, von dem sie glaubte, dass er zu ihr halten würde, dass er zu ihr stehen würde und zu ihrer Liebe, die sie von ganzem Herzen empfunden hatte. Noch einmal schrie sie und diesmal, so glaubte sie, würde man es sogar in der drei Meilen entfernten Burg hören, das Wort, das ihr in diesem Augenblick alles bedeutete: EEERRRLÖÖÖSUNG! Im nächsten Augenblick ließ der stechende Schmerz nach und das blutige, schleimige Bündel, das sich so lange von ihrem Körper ernährt hatte, lag auf dem Stroh zwischen ihren Beinen. Gisela, die - trotz oder gerade wegen ihrer Schönheit - von jeher über einen gesunden und robusten Körper verfügt hatte, seufzte erleichtert auf und hob ihren Oberkörper leicht an, um sich das anzusehen, was da aus ihr herausgekommen war. Das Bündel regte sich nicht und Gisela betrachtete eine Weile das kleine zusammengekauerte Etwas, das einer verschrumpelten Wurst - allerdings einer mit Armen, Beinen und einem Kopf - nicht unähnlich sah. Sollte es gar tot sein?, fragte sich Gisela nicht ohne Hoffnung. Vorsichtig nahm sie die kleine Gestalt in ihre beiden Hände, als diese plötzlich heftig zuckte und gleich darauf den Mund öffnete, um mit einem markerschütternden Schrei ihre Ankunft in der Welt und ihr Recht auf Leben zu verkünden.
6. Kapitel
Gegenwart
Das Telefon klingelte. „Polzeiinspektion Linz, mein Name ist Lauer.“
„Schnell, Sie müssen sofort kommen, hier wird geschrien.“
Fabian Lauer war Polizist und er war es mit Leib und Seele. Seit nunmehr zwölf Jahren versah der 32-jährige eingefleischte Single, als der er sich selbst betrachtete, seinen Dienst, immerhin zehn davon in Linz. Fabian liebte „seine Stadt“, sie war ruhig und schön und vor allem war sie friedlich, für seinen Begriff manchmal allerdings zu friedlich, denn gelegentliche Laden- und Taschendiebstähle sowie experimentierfreudige Jugendliche, die sich mit neuesten Drogen versorgten, waren die einzigen kriminalistischen Herausforderungen, denen er sich in seiner bisherigen Amtszeit gegenübergesehen hatte.
Bis zu diesem Tage, denn auf das, was ihn nach einem aufgeregten Anruf von einem Passanten erwartete, hatte ihn keine Schulung und auch keine langjährige Praxis vorbereiten können.
„In der Burg wird geschrien, Sie müssen sofort kommen, es ist schrecklich!“ Die Stimme am anderen Ende überschlug sich beinahe und Fabian Lauer hielt den Hörer weit weg von seinem Ohr, um die Gefahr eines Tinnitus zu bannen. Gleichwohl spürte er die Panik des Anrufers, die sich aus dem Telefon direkt in sein Gehirn zu schrauben schien. „Bitte sagen Sie mir Ihren Namen und schildern Sie in Ruhe, was geschehen ist“, sagte er, um einen sachlichen Tonfall bemüht. „Mein Name ist Peter Sinner und es ist keine Zeit für Ruhe!“, schallte es lautstark zurück, ehe die Verbindung unterbrochen wurde. Fabian schaute Frank Merbold an, einen verheirateten, älteren Kollegen, mit dem er schon seit einigen Jahren gemeinsam Streife fuhr. „Alarm“, rief er fröhlich. Er ließ alles stehen und liegen und sprintete zu dem Dienstwagen. Frank Merbold folgte ihm eilig. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und unter Zuhilfenahme von Blaulicht und Sirene rasten sie hinunter zur Burg, wo sie in weniger als fünf Minuten nach dem Anruf eintrafen.
Auf dem Platz vor der Burg, der den unteren Teil der Altstadt gewissermaßen eröffnete, hatte sich schon eine beachtliche Menschenmenge versammelt und wenn auch aus dem alten Gemäuer selbst nichts zu hören war, sah Fabian doch die von Panik und Sorge gezeichneten Gesichter der Passanten.
Fabian stellte sich vor die Menge und rief lautstark: „Mein Name ist Fabian Lauer und ich wurde soeben informiert, dass aus der Burg Schreie geklungen seien. Wer von Ihnen ist Peter Sinner?“
Die Versammlung der Passanten geriet in Bewegung. Der etwa ein Meter achtzig große Mann, der jetzt aus der Menge trat und auf Fabian zulief, sah übernächtigt aus; seine schwarzen Haare waren ungekämmt und sie klebten in wirren Nestern schweißnass an seinem Kopf. Sein Gesicht war von Bartstoppeln bedeckt und seine Augen lagen eingefallen in ihren Höhlen. „Ich bin Peter Sinner und ich hoffe, es ist nicht zu spät, aber die Schreie waren einfach unerträglich und so habe ich Sie informiert.“
Fabian vertraute seinen Instinkten. Sie hatten ihm schon in so mancher brenzligen Situation, in denen er sich im Laufe der Jahre befunden hatte, geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als er den Mann sah, meldete sich dieser Instinkt, deutlich und unmissverständlich. Sieh ihn dir an, irgendetwas stimmt mit dem nicht, der sieht ja aus wie der Tod persönlich, behalte ihn im Auge.
„Bitte begleiten Sie mich, vielleicht können Sie mir unterwegs erklären, woher genau die Schreie kamen“, sagte er zu seinem Gegenüber. Pass du auf die Leute auf, damit sie nicht in den Hof kommen“, rief er seinem Kollegen zu, der sich daraufhin vor der Menge postierte und damit begann, die Passanten zu befragen.
7. Kapitel
Peter Sinner hielt sich dicht hinter dem Polizisten. Seine Nerven vibrierten, als sie sich in den Burginnenhof begaben, wo sie sich umsahen. Alles schien merkwürdig ruhig zu sein, außer dem leisen Plätschern der Brunnen war kein Laut zu hören. Die Tür zur römischen Glasgalerie stand weit offen und er folgte Lauer, der zunächst in diesem Teil des Gebäudes nachschaute. Vorsichtig erkundete der Polizist den unteren Raum, der mit Stühlen für Besucher bestückt war, die sich die Videovorführungen von der Herstellung der Glaswaren anschauen konnten. Hier schien alles ruhig. Kein Video lief, niemand war zu sehen.
„Hier ist die Polizei!“ rief Fabian Lauer laut, „ist hier jemand?“ Im Raum selbst und auch im oberen Stockwerk, zu dem eine Treppe hinaufführte, war es ruhig. Dennoch stiegen sie die Stufen hinauf. Einer der beiden Ausstellungsräume war geöffnet und die Beleuchtung war eingeschaltet. Einzelne Münzen lagen auf dem Verkaufstresen. „Die sind zum Öffnen der Folterkammer“, sagte Fabian und schaute Peter Sinner an. Dieser zögerte nicht lange, er griff sich zwei Münzen und rannte die Treppe hinunter und über den Hof. „Hier!“, rief er knapp 20 Sekunden später. Seine Stimme klang aufgeregt: „Schnell, hier ist etwas.“ Gemeinsam blickten sie die Treppe hinunter und sie sahen bereits von oben, dass die Dunkelheit der Folterkammer von einem Lichtstrahl, der offensichtlich nicht von einer Innenbeleuchtung herrührte, durchbrochen wurde. Nacheinander stiegen sie vorsichtig die Stufen hinab und begaben sich in das Verlies. Auf den ersten Blick konnten sie kaum etwas erkennen, lediglich der helle Lichtpunkt einige Meter weiter links gab ihnen eine Art Orientierung. Ein schwacher, aber beißender Geruch drang in ihre Nasen. „Was zum Teufel ist das, wieso riecht es hier so nach Rauch?“, fragte Fabian Lauer leise, als er in beiden Seiten des Gewölbeganges in unregelmäßigem Abstand glühende Punkte bemerkte, die nicht von dem Strahl der Lichtquelle erfasst wurden und die im Dunkeln zu schweben schienen. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass es sich um Fackeln handelte, die augenscheinlich noch kurz zuvor gebrannt hatten. „Verdammt, was soll das?“, fragte er noch einmal und seine Stimme hallte ihm dumpf von den kalten Steinwänden entgegen, „hat hier jemand eine schwarze Messe gefeiert?“ Peter Sinner gab keine Antwort; er hätte zwar eine geben können, aber er verspürte blanke Panik und er würde nichts sagen. Schweigen war im Augenblick besser, viel besser, denn alles was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden.
Als sie sich auf den leuchtenden Punkt zubewegten, schaltete sich die Tonanlage der Kammer ein. Gleichzeitig wurde alles in ein diffuses Licht gehüllt und ein permanentes Knarren und Stöhnen verstärkte die gespenstische Atmosphäre noch. Peters Brustkorb schien zu schrumpfen, sein Hals war wie zugeschnürt, und seine Beine begannen zu zittern. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Seine kurzen, rasselnden Atemstöße klangen in dem dunklen Gewölbe beängstigend laut. Er spürte seinen Herzschlag. BUMM, BUMM, BUMM, dröhne die Pauke in seiner Brust und das Echo schien von den Wänden der Kammer widerzuhallen. Er erinnerte sich an eine Geschichte, die er einmal gelesen hatte, sie war von Edgar Ellen Poe, wenn er sich nicht täuschte. Das verräterische Herz hatte sie geheißen und sie hatte von einem Verbrechen gehandelt, aber der Schuldige war nicht davongekommen; das tote Herz seines Opfers hatte ihn verraten. BUMM, BUMM, BUMM. Alles, was Sie sagen und jedes Geräusch, das Sie von sich geben, kann gegen Sie verwendet werden, BUMM, BUMM, BUMM…, BUMM, BUMM, BUMM. Peter schauderte. Die Lichtquelle, auf die sie zugegangen waren, entpuppte sich als Taschenlampe. Er nahm sie auf und leuchtete in das Gewölbe vor sich. Als er sich umdrehte und Fabian Lauer anblickte, standen seine nassen Haare zu Berge und sein Gesicht war grau. Seine Augen waren weit aus ihren Höhlen getreten und seine Pupillen waren vor Entsetzen geweitet. Wortlos stürmte er an dem Polizisten vorbei. Ihm war schlecht und er hatte jetzt Angst, schreckliche, unbeschreibliche Angst.
Wenige Sekunden später hörte der Polizist, wie sein Begleiter sich erbrach.
8. Kapitel





























