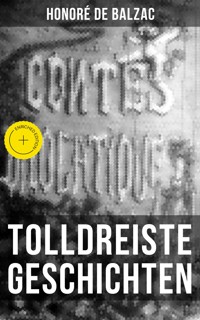
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Werk 'Tolldreiste Geschichten' nimmt der renommierte französische Schriftsteller Honoré de Balzac die Leser mit auf eine fesselnde Reise durch die Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil, der von Realismus und Ironie geprägt ist, beleuchtet Balzac auf humorvolle und zugleich kritische Weise die sozialen und moralischen Verhältnisse seiner Zeit. Die Geschichten sind geprägt von scharfsinniger Beobachtung, feinem Gespür für menschliche Schwächen und einer gekonnten Darstellung des Lebens in der französischen Hauptstadt. 'Tolldreiste Geschichten' ist ein Meisterwerk der Weltliteratur und ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Realismus als literarische Strömung. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tolldreiste Geschichten
Books
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Honoré de Balzacs Tolldreiste Geschichten sind ein eigener, geschlossen gedachter Teil seines Werks: ein Zyklus von Erzählungen, die in deutscher Überlieferung seit Langem unter diesem Titel geführt werden. Die vorliegende Werksammlung versammelt sie in einer zusammenhängenden Lesefassung und folgt dabei einer deutschen Titeltradition, wie sie die hier aufgeführten Stücke erkennen lassen. Sie führt von schalkhaften Hof- und Klostergeschichten über Chroniken aus der Touraine bis zu satirischen Miniaturen über Recht, Ehe und Geistlichkeit. Der Band versteht sich als Einladung, Balzacs komische, derbe und zugleich feinsinnige Kunst jenseits seiner großen Gesellschaftsromane in ihrem eigenen Profil kennenzulernen.
Zweck dieser Zusammenstellung ist es, Balzacs Prosastücke, die er auf Französisch unter Les Contes drolatiques veröffentlichte, als erzählerisch zusammenhängendes Projekt zu zeigen. Es handelt sich nicht um Romane oder Dramen, sondern um in sich geschlossene Erzählungen, die teils lose, teils motivisch eng miteinander verbunden sind. Die Auswahl und Ordnung ermöglicht ein fortlaufendes Lesen, ohne dass eine starre Reihenfolge nötig wäre. Zugleich soll der Band den historischen und poetischen Rahmen sichtbar machen, in dem Balzac diese Texte erdachte: als spielerisches, doch kunstvolles Gegenstück zu seinen realistischen Gesellschaftsdarstellungen.
Die hier versammelten Stücke gehören zur Gattung der Erzählung im weiten Sinn: Schwänke, Novellchen, moralische Exempel, listige Anekdoten und parodistische Predigten stehen neben fiktiven Chroniken, Reise- und Gerichtsberichten. Manche Texte nehmen die Form eines gelehrten Traktats auf, andere imitieren Protokolle oder mündliche Überlieferung. Durch diesen Wechsel der Formen hält Balzac das Erzähltempo hoch, variiert die Sprechhaltung und lässt unterschiedliche soziale Register anklingen. Der Band macht diese formale Vielfalt sichtbar, ohne die Einheit des Zyklus preiszugeben: die Freude am Erzählen und am sprachlichen Einfall ist sein stärkster Zusammenhalt.
Thematisch kreisen die Tolldreisten Geschichten um Liebe, Begierde und Ehe, um Sünde, Reue und Buße, um Macht und ihre Masken. Die Titelfolge zeigt es bereits: Könige, Richter, Mönche und Edelfrauen geraten in Konstellationen, in denen weltliche Ordnung und menschliche Leidenschaft aufeinandertreffen. Balzac interessiert weniger die moralische Verurteilung als die genaue Beobachtung der Kräfte, die Menschen leiten: Ehrgeiz, Neugier, Eitelkeit, Furcht und Lust. So entstehen Geschichten, in denen sich Frömmigkeit und Derbheit, Ernst und Übermut kreuzen – und in denen gesellschaftliche Rituale ebenso entlarvt werden wie private Selbsttäuschungen.
Stilistisch setzt Balzac auf eine bewusst altertümelnde, spielerisch überbordende Sprache. Er imitiert Klangfarben älterer französischer Chroniken, durchsetzt die Prosa mit Neuschöpfungen, derben Bildern und gelehrten Anspielungen und entfaltet so ein Register, das zwischen Komik und Groteske schillert. Dieses pastichierende Verfahren, das im französischen Original deutlich hörbar ist, wirkt in deutscher Übertragung als eigentümliche Mischung aus gehobener Erzählweise und volkstümlicher Rede. Die Freude an Wortspielen, Übertreibung und der dramatischen Pointe verbindet sich mit genauer Szenenführung – eine Kunst, die Balzac auch in seinen großen Romanen auszeichnet.
Die Erzählstimmen dieses Zyklus sind bewusst unterschiedlich gestellt. Ein fiktiver Chronist kann das Wort führen, an anderer Stelle klingt eine Kanzelrede, ein dörflicher Schwank oder ein höfischer Bericht an. Balzac spielt mit Rollenprosa, wechselt vom saloppen Plauderton zur gelehrten Sentenz, vom Protokoll zur Predigt. Dadurch entstehen Perspektivverschiebungen, die das Lachen vieldeutig machen: Spott und Sympathie, moralischer Ernst und ausgelassene Heiterkeit halten sich die Waage. Zugleich laden die Texte ein, die Rhetorik der Macht – juristisch, theologisch, höfisch – als ein Theater der Sprache zu begreifen.
Häufig sind die Schauplätze in eine historisch erkennbare Landschaft eingebettet, die Balzac lieb war: Städte und Schlösser der Touraine, Höfe und Klöster, Gassen und Wirtsstuben. Zugleich treten Figuren mit klingenden Namen der französischen Geschichte auf, deren Zeitkolorit den Rahmen der Handlung setzt. Diese historische Kulisse ist jedoch kein Museum: Sie dient als Resonanzraum, in dem gesellschaftliche Rollen sichtbar und spielerisch verkehrt werden. Gerade durch die Distanz einer früheren Epoche lassen sich Mechanismen von Herrschaft, Frömmigkeit und Begehren schärfer zeichnen – und umso lustvoller in Frage stellen.
Im Gesamtwerk Balzacs stehen die Tolldreisten Geschichten neben der Comédie humaine. Sie gehören nicht zu deren engerem Gefüge, erweitern aber das Bild des Autors um eine Facette, die seine Prosa insgesamt erhellt: die Fähigkeit, psychologischen und sozialen Scharfblick in eine Sprache zu kleiden, die sich der Tradition von Chronik, Schwank und Satire bedient. Der Zyklus wirkt wie ein Labor des Stils und der Perspektive, in dem Balzac Figuren- und Motivtypen erprobt, die auf andere Teile seines Werks zurückstrahlen, ohne sich ihnen zu unterordnen.
Die deutsche Titel- und Texttradition, an die diese Sammlung anknüpft, betont den lustvollen, schalkhaften Charakter der Erzählungen. Übersetzungen haben dabei den altertümelnden Tonfall des Originals auf unterschiedliche Weise nachgebildet. In jeder Variante bleibt entscheidend, dass die sprachliche Maskerade nicht bloßer Zierrat ist, sondern die Pointe trägt: Das Komische entsteht aus der Kollision von stattlicher Rede und sehr menschlicher Praxis. So ist die deutsche Lesefassung nicht nur Vermittlung, sondern auch interpretierender Nachvollzug der stilistischen Idee, die den Contes drolatiques zugrunde liegt.
Die innere Gliederung der Sammlung macht wiederkehrende Motive sichtbar. Mehrfach gegliederte Stücke – etwa über eine Ehezeit, eine Buße oder ein Verfahren – entfalten ihre Themen in nummerierten Abschnitten, die Perspektiven schichten und Konstellationen variieren. Zugleich stehen autonome Erzählungen, die Hof, Kloster oder Dorf in den Blick nehmen, frei neben längeren Folgen. Diese Anordnung erlaubt es, einzelne Texte für sich zu genießen, ohne die übergreifende Bewegtheit aus dem Auge zu verlieren: das Hin- und Herpendeln zwischen Regel und Ausnahme, Ordnung und deren lustvoller Überschreitung.
Wer die Tolldreisten Geschichten liest, kann sie episodisch oder in langen Zügen genießen. Empfehlenswert ist beides: Die pointenstarken Stücke entfalten sich schnell, doch die wiederkehrenden Themen gewinnen an Tiefe, wenn man den Zyklus als Ganzes durchmisst. Das Lachen ist oft der erste Zugang, nicht selten aber beherbergt es eine ernste Einsicht in die Zwiespältigkeit menschlicher Wünsche. Der Band lädt dazu ein, das Derbe nicht gegen das Feine auszuspielen und das Zeitkolorit als poetische Maske zu begreifen, die Gegenwärtiges zum Vorschein bringt.
Die anhaltende Bedeutung dieser Werksammlung liegt in der Verbindung von erzählerischer Lust, stilistischer Erfindung und genauer Menschenbeobachtung. Balzac zeigt, wie Sprache Rollen stiftet und entlarvt, wie Institutionen funktionieren und wie Privatheit sich behauptet oder scheitert. In den Spiegeln von Hof, Kanzlei und Kloster erscheinen zeitlose Konflikte von Begehren und Gesetz, Ansehen und Wahrheit. So öffnet dieser Band, über seinen historischen Schein hinaus, einen Weg zu Balzacs Kunst insgesamt: dem unermüdlichen, witzigen und hellsichtigen Erzählen. Er lädt ein, diese Welt zu betreten – mit Vergnügen, mit Neugier und mit offenem Blick.
Autorenbiografie
Honoré de Balzac (1799–1850) gilt als Schlüsselfigur des europäischen Realismus. Mit der monumentalen, zyklisch angelegten Comédie humaine zeichnete er ein Panorama der französischen Gesellschaft nach der Revolution und unter der Restauration. Neben seinen großen Romanen verfasste er zwischen 1832 und 1837 die Contes drolatiques, in denen er eine archaisierende, rabelaisische Sprache pflegte und komische, bisweilen derbe Episoden aus einer imaginären Renaissancewelt erzählte. Diese Doppelspur – streng beobachtender Gesellschaftsroman und spielerisch-derber Erzählzyklus – prägte seine Stellung als innovativer Erzähler, der soziale Mechanismen, Leidenschaften und Ambitionen mit erzählerischer Energie, stilistischer Kühnheit und historischer Sensibilität verband.
Balzac besuchte Schulen in Vendôme und Paris und studierte anschließend Rechtswissenschaften; kurze Anstellungen in Kanzleien schärften seinen Blick für Verträge, Verbindlichkeiten und die Psychologie von Macht und Geld. Früh schrieb er unter Pseudonymen Romane für den Markt und betrieb zeitweilig ein Druck- und Verlagsunternehmen, Erfahrungen, die sein Verständnis des literarischen Betriebs und seine Arbeitsdisziplin formten. Als prägende Einflüsse gelten Walter Scott, dessen historischer Zugriff auf Gesellschaft und Sitten Schule machte, und François Rabelais, dessen überbordende Sprachlust und satirische Phantasie Balzacs Contes drolatiques nachhaltig inspirierten. Sprachstudien, Archivlektüren und Regionalkunde flossen nachweislich in seine stilistische Ausbildung ein.
Beruflich fand Balzac seinen Rhythmus, als er parallel an Romanzyklen und kürzeren Prosastücken arbeitete. Die Contes drolatiques boten ihm ein Labor für Experimente mit Tonfall, Anspielungen und grotesker Komik. In deutschen Übersetzungen tragen einzelne Stücke Titel wie Der Pfarrer von Azay-le-Rideau, Wie das Schloß zu Azay entstand, Die klatschhaften Nonnen zu Poissy, Die schöne Imperia oder Die Späße König Ludwigs des Elften. Diese Texte variieren Stoffe von Geistlichkeit bis Hofleben, führen ländliche und städtische Schauplätze vor und zeigen, wie Balzac historisierende Masken nutzt, um über zeitlose Triebkräfte des Handelns zu erzählen, ohne die Gegenwart direkt zu benennen.
Zentrales Thema der Sammlung ist das Wechselspiel von Begehren, Frömmigkeit und gesellschaftlicher Fassade. Episoden wie Die läßliche Sünde, Was eine ‚läßliche Sünde‘ besagt. oder Die Gefahren übergroßer Tugend treiben moralische Begriffe in paradoxe Situationen. Die Predigt des fröhlichen Pfarrers von Meudon parodiert kirchliche Rhetorik; der Zyklus Der Buhlteufel – mit Abschnitten wie Was ein Buhlteufel besagen will. und Das Verfahren wider den weiblichen Dämon – spielt mit Prozessformen und Dämonologie. Figuren wie der Mönch in Wie der Mönch Amador ein glorreicher Abt ward oder die Titelfigur der reuigen Sünderin werden exemplarisch und zugleich menschlich gezeichnet.
Zeitgenössisch wurden die Contes drolatiques ambivalent aufgenommen: Ein Teil der Leserschaft rügte ihren derben Witz, andere bewunderten die kunstvolle Archaisierung und Gelehrsamkeit. Balzac nutzte den Rahmen, um soziale Rollen von Hof und Milieu durchzuspielen: Des Königs Liebste und Des Konnetabels Weib kontrastieren Macht und Intimität; Die Waffenbrüder und Die drei Zechpreller zeigen kameradschaftliche Rituale; Eine teure Liebesnacht oder Die Edelfrau als Dirne wenden erotische Ökonomie ins Komische. Selbst Außenseiterfiguren wie Buckelchen oder Unschuldsszenarien wie Die Jungfrau von Thilhouze werden ohne Sentimentalität, doch mit erzählerischer Sympathie gezeichnet, zwischen Liebesverzweiflung und standhafter Liebe.
In den 1830er und 1840er Jahren konzentrierte Balzac seine Kräfte auf die Comédie humaine und prägte mit Romanen wie Eugénie Grandet, Le Père Goriot, Illusions perdues sowie Splendeurs et misères des courtisanes den europäischen Roman. Die zwischen 1832 und 1837 entstandenen Contes drolatiques blieben ein abgeschlossenes Experimentierfeld, dessen sprachliche Kühnheit und historischer Maskenball auf die Romanwerkstatt zurückwirkten. Unablässige Arbeit, verlegerische Risiken und dauernde Schulden belasteten seine Gesundheit. In den späten 1840er Jahren verschärfte sich die Erschöpfung; 1850 starb er in Paris, hinterlassend ein Werk, das sowohl systematisch geplant als auch schillernd heterogen angelegt war.
Balzacs Vermächtnis gründet in der Verbindung von formaler Planung, sozialer Diagnostik und Charaktergestaltung. Die Contes drolatiques behaupten darin einen besonderen Platz: als lustvoll-gelehrtes Gegenstück zu den großen Gesellschaftsromanen, das Sprachregister, Komik und historische Imagination erprobt. In Übersetzungen wie den hier genannten deutschen Titeln bleiben sie zugänglich und zeigen, wie Balzac zwischen volkstümlichem Ton und kunstvoller Komposition wechselt. Seine Romankunst beeinflusste Flaubert, Zola, Henry James und zahlreiche Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts. Heute werden sowohl die Comédie humaine als auch die drolatischen Erzählungen als komplementäre Seiten eines ambitionierten Projekts gelesen.
Historischer Kontext
Honoré de Balzac verfasste die Tolldreisten Geschichten – im Original Les Contes drolatiques – zwischen 1832 und 1837, in drei Zehnergruppen, den sogenannten dizains. Entstanden unter der Julimonarchie, greifen sie in die Vergangenheit zurück und spielen überwiegend im späten Mittelalter und in der Renaissance. Balzac, 1799 in Tours geboren, verband seine intime Kenntnis der Touraine mit einem literarischen Projekt, das bewusst neben der Comédie humaine stand: nicht als realistisches Gesellschaftspanorama der Gegenwart, sondern als heiter-derbe Historienfolge. Die deutschen Ausgaben machten den Titel Tolldreiste Geschichten zur festen Bezeichnung und verbreiteten die Sammlung im deutschsprachigen Raum, wo sie als eigenständiger, sprachspielerischer Teil des Balzac’schen Œuvres wahrgenommen wurde.
Die 1830er Jahre in Frankreich waren von romantischer Geschichtsbegeisterung geprägt. Nach Victor Hugos Notre-Dame de Paris (1831) und in der Nachfolge Walter Scotts gewann die nationale Vergangenheit als literarischer Stoff an Gewicht. Balzac beteiligte sich an dieser Bewegung, jedoch auf seine eigene Art: Er rekonstruierte nicht bloß Sitten und Bräuche, sondern führte die sprachliche und komische Energie volkstümlicher Erzähltraditionen vor. Seine Anleihen bei Farce, Fabliau und Chronik sind Teil eines breiteren Interesses der Romantik an Vormoderne und Volkspoesie. So eröffnen die Tolldreisten Geschichten einen Zugang zur französischen Renaissance, der weniger heroisch, dafür umso irdischer und unmittelbarer wirkt.
Politisch standen die Jahre nach der Julirevolution von 1830 im Zeichen des Ausgleichs zwischen monarchischer Stabilität und bürgerlicher Ordnung. Eine wachsame Presseaufsicht und moralische Normen schränkten die literarische Freiheit nicht selten ein. Historische Verkleidung bot daher Spielraum: In der Distanz der Jahrhunderte ließen sich heikle Themen – Sexualmoral, kirchliche Macht, soziale Hierarchien – freier behandeln. Balzacs Sammlung nutzt diese zeitliche Verschiebung, um über Gegenwartsfragen nachzudenken, ohne sie frontal zu benennen. Das historische Dekor fungiert als Resonanzraum, in dem Debatten über Autorität und Freiheit, Lust und Gesetz, Frömmigkeit und Heuchelei für ein Publikum der 1830er Jahre mitklingen konnten.
Die erzählten Welten verorten sich in Städten, Klöstern, Burgen und Herbergen – Orten, an denen ständische Ordnung und Alltagsgeschäfte aufeinandertreffen. Seneschalle, Pfarrer, Handwerker, Wirte, Edelleute und Hofleute bevölkern die Handlung und spiegeln das vielschichtige Gefüge vormoderner Gesellschaft. Zunftregeln, Lehenspflichten und regionale Gewohnheitsrechte strukturieren die Beziehungen ebenso wie Patronage und Klientel. Geschichten, die Nonnen, Pfarrer oder Gerichtsdiener auftreten lassen, knüpfen an überlieferte Topoi an und rücken die Reibungsflächen zwischen Norm und Bedürfnis in den Fokus. So entsteht ein Panorama, das soziale Mikropraktiken sichtbar macht, ohne sie museal zu verklären.
Immer wieder erscheinen Könige und Höfe als Brennpunkte politischer Ordnung. Die wiederkehrenden Anspielungen auf Louis XI. (1461–1483) oder François I. (1515–1547) verorten die Handlung in Phasen monarchischer Verdichtung und höfischer Kultur. Unter Louis XI. festigten sich Verwaltung und Netzwerke königlicher Macht; unter François I. wurden Humanismus und Repräsentation am Hof weiter ausgebaut. Wenn Geschichten Hofnarren, Hofdamen oder königliche Launen erwähnen, so illustrieren sie die Nähe von Macht und Spiel. Balzac setzt die höfische Bühne als Kontrastfolie zur Lebensklugheit der Städte und Provinzen ein und erkundet, wie Autorität sich im Alltag behauptet – oder unterläuft.
Ein Schwerpunkt liegt auf religiösen Institutionen und Debatten. Die Erzählungen spielen vielfach im Vorfeld der Reformation und thematisieren Klosterdisziplin, Beichtpraxis und kirchliche Gerichtsbarkeit. Der Ausdruck lässliche Sünde verweist auf die Unterscheidung der katholischen Moraltheologie zwischen leichteren und schwereren Vergehen. In dieser Konstellation entfaltet Balzac eine Tradition des geistreichen Antiklerikalismus, die bereits in mittelalterlichen Fabliaux und bei Rabelais angelegt ist. Geistliche Figuren agieren menschlich, nicht idealisiert; die Spannung zwischen Norm und Natur bietet Anlass zu Satire und zur Prüfung kirchlicher Autorität – ohne eine systematische Kirchengeschichte zu liefern.
Recht und Obrigkeit erscheinen als wechselnde Rahmen, in denen Sitte und Gesetz oft auseinanderfallen. Die Erzählwelten kennen seigneuriale Gerichtsbarkeit, städtische Räte und kirchliche Foren; sie spiegeln damit eine Zeit, in der Rechtsräume konkurrierten. Die Rede vom Buhlteufel spielt mit frühen neuzeitlichen Vorstellungswelten, in denen Dämonologie und Moralgerichtsbarkeit nebeneinander existierten und gelegentlich Verfahren gegen vermeintliche übernatürliche Verführungen angestrengt wurden. Solche Motive beleuchten die Grauzonen zwischen Glauben, Aberglauben und sozialer Kontrolle. Balzac nutzt den juristischen Rahmen, um menschliche List, Angst und Ehre in ihrer historischen Konstellation erfahrbar zu machen.
Die europäische Bühne des 15. und 16. Jahrhunderts ist von Kriegen und diplomatischen Verschiebungen geprägt. Französische Feldzüge nach Italien und Rivalitäten mit Habsburg veränderten Mobilität, Söldnerwesen und Hofkontakte. Wenn Waffenbrüderschaft, Duelle oder Kriegszüge anklingen, dann steht dahinter die Transformation ritterlicher Werte in einer Epoche, die neue Techniken, Bündnisse und Söldnerheere kennt. Diese geschichtliche Kulisse liefert Motive für Loyalität und Verrat, Ruhm und Tadel, aber auch für Begegnungen über Standes- und Sprachgrenzen hinweg. Die Geschichten verdichten solche Hintergründe zu knappen, pointierten Episoden, die Konflikt- und Ehrenkulturen der Renaissance aufscheinen lassen.
Topographie und Baukunst sind mehr als Dekor. Die Loire-Landschaften, Burgen und Städte der Touraine – Balzacs Herkunftsregion – bieten eine anschauliche Bühne. Orte wie Azay-le-Rideau verweisen auf die frühe französische Renaissance an der Loire, die neue Wohnformen, Repräsentationsbedürfnisse und Kulturkontakte sichtbar macht. Im 19. Jahrhundert wuchs zugleich das Interesse an Denkmalpflege und historischer Architektur; staatliche Initiativen und Reiseschriftstellerei lenkten den Blick auf Schlösser, Kirchen und Städte. Der literarische Rückgriff auf solche Schauplätze verband sich so mit einem zeitgenössischen Sinn für materielle Überlieferung und die Aura historischer Räume.
Sprachlich arbeiten die Tolldreisten Geschichten mit einem bewusst archaisierenden Ton. Balzac ahmt die Register des Altfranzösischen und Frühneuzeitlichen nach, spielt mit Neologismen, Derbheiten und gelehrten Anspielungen. Er steht damit im Dialog mit Rabelais, François Villon und Autoren der Schwanktradition. Die künstliche Altertümlichkeit ist keine philologische Rekonstruktion, sondern ein literarisches Experiment, das Klang, Witz und Zweideutigkeit kultiviert. Übersetzer ins Deutsche standen früh vor der Aufgabe, Wortspiele, Derbheiten und regionale Färbungen adäquat zu übertragen. So prägten die stilistischen Eigenheiten entscheidend die Rezeption und den Ruf der Sammlung als „gaullischer“, lebensnaher Erzählkosmos.
Die historische Welt der Erzählungen fällt in eine Zeit mit wachsender Bedeutung des Buchdrucks, der Debatten, Predigten und Satiren verbreitete. Zugleich erlebte Balzacs Gegenwart ein eigenes Medienwachstum: billigere Drucktechniken, erweiterte Buchmärkte und Lesekabinette erweiterten die Öffentlichkeit. Die Tolldreisten Geschichten bewegen sich damit doppelt im Zeichen der Medialisierung – sie thematisieren indirekt die frühneuzeitliche Kommunikationslust und profitieren selbst vom modernen Buchhandel. Illustrierte Ausgaben und Sammlereditionen des 19. Jahrhunderts trugen zur Popularität bei. Die Interferenz von alter und neuer Medienwelt wird so zu einem unterschwelligen Kommentar auf Überlieferung, Zitat und Parodie.
Geschlechterordnungen bilden einen zentralen historischen Bezugsrahmen. Ehe, Mitgift, Standesehre und Erbfolge regulieren Beziehungen; zugleich behaupten Frauen als Witwen, Hofdamen, Kaufmannsfrauen oder Kurtisanen Handlungsmacht. Die Figurentypen – etwa die schöne Imperia – greifen Muster der Renaissance auf, in der die kultivierte, ökonomisch selbstbewusste Höflings- und Stadtkultur Frauen neue, wenn auch fragile Spielräume eröffnete. Balzac führt keine sozialhistorische Abhandlung, doch seine Episoden verweisen auf Konfliktlinien zwischen patriarchaler Norm und weiblicher Klugheit. Die Spannung zwischen sozialer Rolle und individueller Neigung treibt die Handlung – und spiegelt historische Realitäten vormoderner Gesellschaften.
Lachen und Körperlichkeit sind historisch situiert. Die Tradition des Derben, die Markt- und Wirtshauskultur sowie das Festwesen erlauben zeitweilige Inversionen sozialer Ordnung. Solche Karnevalslogiken – später oft als „karnevalesk“ beschrieben – wurzeln in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Praktiken des Aussetzens von Normen. Balzacs Geschichten spielen diese Energie gegen Dogmen und Starrheit aus, ohne die Ordnung grundsätzlich zu leugnen. Gerade das Nebeneinander von Benimm und Übermut, Predigt und Spott, zeigt eine Welt, in der Normen sozial ausgehandelt werden. Dadurch lassen sich in historischen Masken wiederkehrende Muster von Macht und Begehren studieren.
Die Sammlung reflektiert auch Selbstbilder des 19. Jahrhunderts. Der Begriff des „gaulois“ – verstanden als herzhaft-derbe, direkte Ausdrucksweise – wurde in Frankreich als nationale Stilmarke gehandelt. Balzacs witzige Archaismen und seine Lust an Doppeldeutigkeiten knüpfen an dieses kulturelle Selbstverständnis an, ohne es kritiklos zu feiern. Im Spiel mit Überlieferung entsteht eine Art Sprachmuseum, das die soziale Vielfalt der Vergangenheit hörbar macht und zugleich eine Debatte der Gegenwart über Natürlichkeit, Zierde, Urbanität und Provinz aufnimmt. Historische Mimikry dient so der Reflexion über Identitätspolitiken des 19. Jahrhunderts.
Die Veröffentlichung in drei dizains strukturierte die Rezeption: Jede Folge bot ein Bündel thematisch variierender, jedoch stilistisch verwandter Geschichten. Zeitgenössische Lesende lobten Witz und Stofffülle, monierten aber teils Freizügigkeit und sprachliche Derbheit. Im Vergleich zu Balzacs Romanen der Comédie humaine blieb die Sammlung randständiger, ohne je aus dem Kanon zu verschwinden. Spätere illustrierte Ausgaben festigten ihren Rang als Kuriosum hohen stilistischen Anspruchs und komischer Tradition. Die Kombination aus historischer Pose, erzählerischer Kürze und sprachlichem Überschwang machte die Bücher attraktiv für Sammler und für Leserinnen und Leser jenseits akademischer Kreise.
Bezüge zu konkreten Orten und Personen der Loire-Region – etwa zu Azay oder zur Provinz Touraine – stärken den Quellencharakter der Geschichten, auch wenn sie als Fiktionen gelten. Balzac nutzte topographische und chronistische Überlieferungen, ohne auf dokumentarische Treue zu zielen. Indem er bekannte Monarchen, Klöster oder Städte streifte, band er das Lokale an nationale Geschichte. Die Geschichtsbilder sind dadurch anschlussfähig für Lesende, die in Reiseführern, Chroniken und Denkmallisten der Julimonarchie die sichtbaren Spuren der Vergangenheit neu wahrnahmen und mit Erzählungen verknüpften.
Im deutschsprachigen Raum zirkulierten Balzacs Werke bereits im 19. Jahrhundert in Übersetzungen; die Tolldreisten Geschichten erhielten dabei den einprägsamen Titel, der sich durchsetzte. Sie wurden in verschiedenen Sammlungen und Gesamtausgaben aufgenommen und fanden Leserinnen und Leser, die sich für die Verbindung aus Historienreigen und Sprachwitz interessierten. Im Umfeld einer wachsenden literarischen Öffentlichkeit, in der französische Autoren breit rezipiert wurden, fungierte die Sammlung als Beispiel für französischen Humor, historische Maskenspiele und erzählerische Virtuosität jenseits der großen Gesellschaftsromane Balzacs und ihrer strengen Gegenwartsorientierung. Diese Rolle prägte ihre deutschsprachige Wahrnehmung nachhaltig.|“,
Synopsis (Auswahl)
Dem Dichter zum Preise!
Ein spielerischer Lobgesang auf Dichtung und Erzählen, der die folgenden Schwänke mit einem Augenzwinkern rahmt. Der Text feiert Einbildungskraft und Derbheit als Quellen von Wahrheit und Heiterkeit und setzt den Ton zwischen Respektlosigkeit und Kunstsinn.
Imperia-Erzählungen (Die schöne Imperia; Der schönen Imperia Ehezeit 1–2)
Die schöne Imperia bewegt sich als kluge Hofdame zwischen Mächtigen und Geistlichen und macht Liebe zur Währung politischer und sozialer Spiele. Ihre Ehezeit zeigt sie als Strategin und Opfer eigener Finten, wenn Begehren, Eitelkeit und Kalkül zusammenprallen. Der Ton ist elegant-spöttisch, mit erotischer Intrige und beißender Hof- und Kleruskritik.
Die läßliche Sünde – Folge (Die läßliche Sünde; Was eine ‚läßliche Sünde‘ besagt; Wie und durch wen das Kindlein zustande kam; Wie die Liebessünde gar traurige Buße fand)
Ein vermeintlich kleiner Fehltritt wird mit gelehrter Spitzfindigkeit beschönigt, führt aber zu handfesten Folgen und zu einem Kind, dessen Herkunft alle beschäftigen. Die Serie verfolgt die moralische Salamitaktik von der Verharmlosung bis zur Buße und spielt mit Beichtkasuistik, sozialer Heuchelei und den Kosten des Vergnügens. Leichtfüßige Komik verbindet sich mit moralischer Zweideutigkeit.
Hof- und Königsanekdoten (Des Königs Liebste; Die Späße König Ludwigs des Elften; Franz’ des Ersten Fastenfreuden; Des Konnetabels Weib)
Diese Episoden zeigen Höfe als Bühnen für Launen, Liebesabenteuer und taktische Scherze, auf denen Nähe zur Macht stets zweischneidig ist. Herrscher prüfen Loyalität und Tugend gern mit komischen oder anzüglichen Proben, während die Liebe zwischen Privatem und Politik zerrieben wird. Der Ton ist anekdotisch, schnell und respektlos, mit Sinn für die Pointen höfischer Scheinwelten.
Azay-Zyklus (Der Pfarrer von Azay-le-Rideau; Wie das Schloß zu Azay entstand)
Aus Dorfgeistlichkeit und Lokalgeschichte spinnt Balzac eine Mock-Chronik, in der Ehrgeiz, fromme Schwächen und Baukunst aufeinanderprallen. Der Pfarrer gerät zwischen Pflicht, Neigung und Klatsch, während die Entstehung des Schlosses mit listigen Umwegen erklärt wird. Der Ton mischt Provinzkolorit, Farce und schelmenhafte Historiographie.
Geistliche und Kloster-Satiren (Die klatschhaften Nonnen zu Poissy; Die Predigt des fröhlichen Pfarrers von Meudon; Wie der Mönch Amador ein glorreicher Abt ward; Eine teure Liebesnacht)
Klöster und Kanzeln werden zu Schauplätzen irdischer Schwächen: Redselige Nonnen, ein lebensfroher Prediger und ein karrierebewusster Mönch verheddern sich in Eros, Ehre und Eloquenz. Die Texte entlarven Frömmelei und Organisationslogik geistlicher Institutionen mit derb-komischer Freude am Detail. Rhetorische Brillanz trifft auf handfeste Körperkomik.
Übernatürliches und Dämonisches (Des Teufels Erbe; Der Buhlteufel 1–4)
Erbschaften aus der Hölle und Anklagen wegen eines vermeintlichen Succubus zeigen, wie leicht Begierde in Dämonenglauben übersetzt wird. Der Zyklus um den Buhlteufel entfaltet sich als Parodie auf Verfahren, Gelehrsamkeit und Hexenjagd, inklusive listiger Ausbrüche und Fehlurteilen. Der Ton ist verspielt-gotisch, eher skeptisch als schauerromantisch.
List, Betrug und Schwänke (Die drei Zechpreller; Buckelchen; Ein vergeßlicher Profoß; Wie der wackere Herr Bruyn ein Weib nahm; „Wie der Seneschall sich mit seines Weibes …“; Die Waffenbrüder; Eine Geschichte, die erweisen soll, daß das Glück)
Zechkumpane, Kumpanei und Kurzschlüsse der Obrigkeit treiben turbulente Verwechslungen und kleine Gaunereien an, bei denen Witz oft mehr gilt als Status. Eheanbahnung, Amtsmissbrauch und Kameradschaft kippen zwischen Kalkül und Tollpatschigkeit, wobei Streich auf Gegenschlag folgt. Der Ton ist picaresk, schnell und von der Wendung im letzten Augenblick getragen.
Liebe, Tugend und ihre Fallstricke (Liebesverzweiflung; Standhafte Liebe; Die Gefahren übergroßer Tugend; Die Edelfrau als Dirne; Die Jungfrau von Thilhouze; Wie das schöne Mägdelein von Portillon)
Zwischen Standesehre, Gerücht und Begehren werden Liebende auf die Probe gestellt, oft gerade durch zu strenge Tugend. Rollen verkehren sich: Vornehme Damen geraten in unwürdige Lagen, hartnäckige Keuschheit provoziert Skandal, und Unschuld wird durch Weltklugheit beleuchtet. Der Ton schwankt zwischen zarter Sentimentalität und kecker Entlarvung.
Die reuige Sünderin (1–3)
Berthas Weg führt von einer unvollendeten Ehe über die Entdeckung der Liebe zu selbstauferlegter Strenge. Die drei Teile zeigen Scham, sozialen Druck und körperliche Kasteiung als Stationen eines moralischen Konflikts. Unter der satirischen Oberfläche liegt ein ernster Blick auf Schuld und Selbstbestimmung.
Kleine Gespräche und Volkswitz (Kitzliche Reden dreier Pilger; Kinderschnabelweisheit)
In geselligen Gesprächen und kindlichem Spruchwitz blitzen Lebensklugheit, Doppeldeutigkeiten und derbe Pointen auf. Pilger und Kinderstimmen kontrastieren erfahrene List mit naiver Direktheit und bringen Alltagsmoral zum Klingen. Leichte, dialogische Miniaturen mit hoher Pointendichte.
Wiederkehrende Themen und Stil
Die Sammlung verbindet Rabelais’sche Derbheit mit spöttischer Moralität: Geistliche, Adelige und kleine Leute werden an denselben Maßstab irdischer Triebe gelegt. Typisch sind Rollentausch, Listen, Prozessparodien und mock-historische Erzählweisen, die Autorität und Scheinlogik bloßstellen. Über allen Schwänken liegt ein munter-archaisierender Ton, der Lust am Körperlichen mit skeptischer Vernunft verbindet.
Tolldreiste Geschichten
Dem Dichter zum Preise!
Wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über! sagte einst der Mann, der uns das Sprachgebäude schuf, so wie es uns nun seit Jahrhunderten lieb und wert geworden ist. Und doch muß ich schier nach Worten suchen, um Dir, wohledler Herre von Balzac, ein Lied des Preises anzustimmen: denn wo soll ich beginnen, wo bei des Segens Überfülle dasRechte, den Anbeginn richtig fassen? Soll ich Deiner so tiefen Menschenkenntnis vor allem gedenken, die mit ebensoviel Ernst als Anmut den Schleier vor der ‚Menschlichen Komödie‘ aufhob, soll ich Deiner unerschöpflichen Heiterkeit den Vorrang einräumen, die dem allverehrten Meister Rabelais nichts nachgab und Dir das vorliegende Werk in seiner knappen und doch so vieldeutigen Sprache diktierte? Oder soll Deines Lebens wundersam-buntes Puppenspiel den Anfang machen, um uns den Schlüssel zu Deinen Werken zu liefern? Nicht eines und nicht das andere wäre richtig, denn kaum das Ganze könnte Dich uns zurückzaubern so wie Du warst, so wie Du das Leben dichtetest, wie Du im Dichten lebtest! Wie Du die unvereinbarlichsten Gegensätze zu verschmelzen wußtest, ein unnachahmlicher Arbeiter und ein beneidenswerter Lebensgenießer zu sein, im Golde zu wühlen und doch nie einen Pfennig in Deiner Tasche zu haben, die wildeste Tragik in herzerquickenden Scherz zu hüllen, unter fast unerlaubt schrankenlosen Spaßen tiefernste Wahrheiten zu verstecken, Deine Träume zum Leben zu erheben und das Leben als Traum abzutun.
Bände brauchte ich, um Dich ganz zu werten, Bände voll zahlloser, engbedruckter Seiten so wie Du uns eine schier endlose Zahl solcher Bände schenktest, darin Du Dein Ich ausgeschüttet hattest. Deine Hand war so freigiebig, Dein Geberwille so grenzenlos, daß Du oft genug jene Mauern sprengtest, die ein wohlerzogenes Kunstwerk ausweisen sollte, um bis ins Letzte hinein vollendet zu sein. Dir wahrlich lief der Mund dessen über, wessen Dein Herz voll war. Und wenn auch der Feinschmecker Dir über Stock und Stein mit Freuden folgt, so gibt es doch bisweilen Nörgler, die sich an der Überfülle Deiner Gedankengaben in dem Titanenwerke der ‚Menschlichen Komödie‘ stoßen und ihren Bedarf auf einige wenige erlesene Werke wie vor allem ‚Eugenie Grandet‘ beschränken. Aber alle sind sie mit Dir in dem einen einig: »Daß Deine ‚drolligen Geschichten‘ Dir die Unsterblichkeit sichern werden, auch wenn all Deine anderen Werke verloren gingen!« So sagtest Du einst, und wenn wir auch die Erfüllung des Nachsatzes nicht erhoffen, so stimmen wir dem Vordersatze um so begeisterter zu. Nicht deshalb nur, weil Du in diesem Werke, wie gesagt, den Schritten Meister Rabelais in Geist und Sprache zu folgen wußtest. Eher schon, weil es Dir gelungen ist, es zugleich auch dem unsterblichen Boccaccio gleichzutun, dessen Dekameron in seiner sieghaften Pracht soviele Nachahmer, so wenig ernsthafte Nebenbuhler fand. Und als das Schicksal der Königin von Navarra die Feder aus der Hand nahm, also daß ihr kongeniales Werk mit der zweiundsiebenzigsten Geschichte ein jähes Ende fand, da war Gallia‘s Hoffnung auf ein französisches Dekameron endgültig geschwunden und man begnügte sich, ein »Heptameron« mit güldenen Lettern in seine Akten einzutragen. Aber das Schicksal hatte es anders bestimmt! Du selbst, wohledler Herre von Balzac, solltest das Werk der königlichen Dichterin zum Dekameron ründen, ohne Dir dessen bewußt zu sein! Als Du Dich an die Niederschrift der ‚Drolligen Geschichten‘ machtest, hattest Du den Plan gefaßt, ein neues Dekameron zu schreiben. Aber Du vermochtest das erste Viertelhundert nicht wesentlich zu überschreiten, – wie Du am Ende im Scherze sagtest, und wie Doré’s Schlußbild unterschrieben ist: »Wahrhaftig. es ist eine Schand-Arbeit, hundert drollige Geschichten auszudenken!« Nein, wohledler Meister, uns darfst Du solchen Bären nicht aufbinden! Dein nimmermüder Schöpfergeist konnte uns ein und gar mehrere Dekamerones bescheren, ohne dabei zu erlahmen. Aber es war Dir bestimmt, das Werk der königlichen Dichterin zu vollenden, das Du genugsam zu rühmen wußtest, nicht zum mindesten am Schlusse der zwölften Geschichte. Es war bestimmt, daß der Königin Margarethe»Heptameron« zusammen mit Deinen ‚drolligen Geschichten‘ das französische Dekameron bilden sollte, das mit gleichem Glänze neben seinem italienischen Vorgänger die Herzen der Leser labt und wärmt. [S. das “Heptameron”, Erzählungen der Königin von Navarra. Ins Deutsche übertragen von C. TH. V. Riba. (Mit Bildern des Marquis de Bayros.) Verlag Wilhelm Borngräber.]
So entstand Dein Meisterwerk, von dessen Geschichten Du sagtest, daß sie echt französisch sind durch ihre überschäumende Fröhlichkeit durch die ausgelassenen Bocksprünge, französisch vorn, französisch hinten; daß sie »mehr dazu geschaffen sind, die Moral der Freude zu predigen, denn durch Moralpredigten Freude zu schaffen.« O du tiefsinniger Spötter, wie hast Du Dich und die Deinen recht erkannt! Aber Du vergaßest zu sagen, daß sie alle rechte Balzac-Kindlein sind, die ihres Vaters Ruhm durch alle Lande tragen, und sein Spiegelbild dazu. Daß sie Dich konterfeien als den Mann, der in seinen Phantasien lebte, als wären sie die Wirklichkeit (man gedenke Deines Wortes, als jemand von Deiner kranken Schwester redete: »Das ist ja recht schön, aber bleiben wir bei der Wirklichkeit, sprechen wir lieber von Eugenie Grandet!«). Und konterfeien doch die Wirklichkeit in der sich Dein Leib erging: ein nicht gar großer, aber kugelrunder Genießerleib, der in den Zeiten, da er die Überhand über Deinen Geistesdrang gewann, von Fest zu Feste eilte, in Leckerbissen und köstlichen Weinen schwelgte, holde Frauen in Wonnen umfing, feine Behausung mit der Pracht eines Königs schmückte und mit jeder dieser Künste die Sinnefreuden als Meister bis auf den letzten Tropfen auszukosten, sie in schier unwahrscheinlichen Ausmaßen zu genießen, das wahrlich nicht prüde Paris in staunende Aufregung versetzte; der dann wieder wie ein Asket abgeschlossen und genügsam, die Höhen und Tiefen der Menschenseele durchmaß und auch die verborgensten Züge, die verhehltesten Geheimnisse rücksichtslos, aber mit unwiderstehlichem Lächeln ans Licht zog und so wechselseitig die beiden Grundzüge des menschlichen Lebens ineinanderstrahlen ließ, beide zu einem vollkommenen Ganzen verschmolz, ungleich den meisten seiner Kollegen, die die Gesamtheit sezierend zerlegen, vielmehr das Einzelne im Rahmen und durch die harmonische Gesamtheit hindurch darwies.
Nicht will ich hier mehr darauf hinweisen, wie lebenswahr Du die Zeiten wiedererwachen ließest, in denen sich die drolligen Geschichten abspielen, nicht die Daten Deines Lebens aufzählen, die man allerorten nachlesen kann. Denn alles das könnte zu Dem nichts hinzufügen, was Du selbst von Dir kündest, wenn Du in diesem Buche zu uns sprichst! So ziehe denn weiter Deinen Siegesweg, Du des Irdischen entkleideter Dichter, zieh hin mit Deinen drolligen Kindlein, und mag Dir keiner begegnen, der sich an Dir ärgert, weil Du seinen geheimen Fehlern allzuarg und offen auf die – Füße getreten hast!
St. Petersburg, im Frühjahr 1914
Theodor v. Riba.
Die schöne Imperia
Zum Gefolge des Erzbischofes von Bordeaux gehörte in der Zeit, da selbiger zum Konzile nach Konstanz kam, ein hübsches Pfäfflein aus der Touraine, das in Wort und Wesen gar gefällig war. Galt es doch auch allenthalben für einen Sohn der Soldée und des Gouverneurs. Der Erzbischof von Tours hatte ihn seinem Amtsbruder bei dessen Durchreise freundschaftlichst zum Präsent gemacht, wie das unter diesen Herren voll glaubensfrohen Dranges üblich ist. Solchermaßen kam das Pfäfflein also zum Konzil und fand im Hause seines sittenstrengen, hochgelahrten Prälaten Unterkunft. Diesem Gönner ein pflichtgetreuer und würdiger Untergebener zu sein, war Philippus von Mala (so hieß das Priesterlein) wohl entschlossen. Doch sah er bald, daß männiglich Besucher selbigen gottgelahrten Konziles ein gar lockeres Leben führten und dabei obendrein mehr Ablässe, Goldgulden und Pfründen einheimsten als fromme Tugendbolde. Und so blies ihm der Teufel in einer anfechtungsreichen Nacht den Gedanken ein, sichs lieber wohl sein zu lassen und gleich den andern aus dem Borne unserer heiligen Mutter Kirche zu schöpfen, des Unerschöpflichkeit allein gar wundersam des lieben Gottes Gegenwart erwiese. Das ging unserm Pfäfflein wohl ein und es schwur sich zu prassen und zu schlemmen, solange man nur seinem guten alten Erzbischof (der sich, allerdings nur mehr der Not gehorchend, derart einen Heiligenschein zugelegt hatte). Doch schuf ihm das oft schwere Anfechtung und trübselige Stunden, maßen er allenthalben die schmuckhaften, verführerischen Buhlerinnen sah, die gen Konstanz geeilt waren, um der Kirchenväter Sinne zu erleuchten. Er platzte schier vor Grimm über die Art, wie jene losen Elstern den Kardinälen, Würdenträgern, Fürsten und Markgrafen auf der Nase herumhüpften, als wären es arme Schlucker, derweilen er nicht wußte, wie er eine fangen könnte. Allabendlich nach dem Gebete erwog er zierliche Liebessprüche und wappnete sich für zärtliches Geplänkel. Traf er aber dann tags darauf solch eine Prinzessin, die in prunkender Sänfte inmitten reichen Geleites ihrer Fülle Pracht stolz darbot, dann blieb er mit offenem Maule stehen und klotzte ihr blinkes Antlitz an, bis ihm die Glut zu Kopfe stieg.
Der Sekretarius seines edlen Gönners tat ihm nun einmal kund, daß die hohen Herrschaften die Gunst jener zieren Kätzlein keineswegs so mir nichts, dir nichts gewännen, vielmehr Gold und Geschmeide in schwerer Menge dafür hingäben. So begann denn der ahnungslose Tropf die Groschen, die durch des Erzbischofes Güte für ihn abfielen, in seinem Strohsack zu sammeln, und er erhoffte solchermaßen einen Schatz zusammen zu sparen, mit dem er sich dann holde Gunst erkaufen wollte. Des weiteren gab er sich in Gottes Hand und wandelte nächtens lüstern durch die Gassen, wenngleich er in seiner schäbigen Gewandung einem Edelmanne nicht mehr glich, als eine nachthaubengeschmückte Ziege einem Edelfräulein. Ohne sich um die Hellebarden der Söldner zu scheren, schaute er zu, wie in den Häusern die Kerzen entzündet wurden und durch Fenster und Türen hinausblinkten, horchte auf das geile Lachen der schlemmenden Kirchenfürsten, die der Frau Venus ihr Halleluja sangen, und holte sich dabei gern einen Sack voll Püffe. Denn der Teufel verblendete ihn mit der Hoffnung, früher oder später auch bei solch holder Buhlin den Kardinal spielen zu können, und das machte ihm Mut.
So drang er denn eines abends tollkühn wie ein brünstiger Hirsch in das schönste Haus der Stadt, davor er schon so manche Haushofmeister, Offiziere oder Pagen ihrer Herren beim Fackelscheine harren gesehen hatte. »Ach, die da drinnen muß schön und zärtlich sein[1q]!« seufzte er. — Ein waffenstarrender Landsknecht vermeinte, jener gehöre zum Gefolge des bayrischen Kurfürsten (der soeben das Haus verlassen hatte) und käme mit einem Auftrage seines Herrn. Darum kam Philippus hinein und ließ sich, gleich einem Rüden auf der Spur einer läufigen Hündin, von süßen Düften stracks in das Gemach führen, wo sich die Herrin des Hauses von flinken Zofen umringt ihrer Gewänder entledigte. Verdutzt wie ein erwischter Dieb blieb er stehen. Schon war die Huldin ohne Rock und Mieder und bald stand sie hüllenlos in prunkender, anmutsvoller Nacktheit da, also daß dem beglückten Pfäfflein ein liebeheißes »Aah!« entfuhr.
»Was willst du, Kleiner?« fragte die Schöne.
»Bei Euch verscheiden,« ächzte er gierigen Blickes.
»So komm morgen wieder,« meinte sie, um ihn zu necken. Und Philippus, des Antlitz glühte, rief stracks: »An mir solls nicht fehlen!«
Da hub sie an wie toll zu lachen, also daß Philippus verblüfft, doch wohlgemut stehen blieb und lüsternen Auges weiter ihre wunderzieren Liebesreize bestaunte: ihr prachtvolles Haar, das zwischen lockigen Flechten den Zauber eines Nackens enthüllte — blink und blank wie Elfenbein; strahlende Augen, die feuriger waren als die Rubinen eines Geschmeides ob ihrer schneeweißen Stirn. Die schimmerten von den Tränen ihres hellen Lachens; und dieweil sich die Holde vor Kichern wand, entglitt ihr ein güldener Schuh und so kam ein nacktes Füßlein hervor, ein Füßlein, das schier kleiner war als der Schnabel eines Schwanes.
Ja, die Schöne war heut guter Laune; sonst hätte sie den Kleinen längst kühllächelnd zum Fenster hinauswerfen lassen. Und eine der Zofen meinte: »Er hat schöne Augen!« Eine andere fragte: »Woher mag er kommen?« Und die Herrin rief: »Das arme Kindlein! Seine Mutter wird ihn suchen. Wir müssen ihm den rechten Weg weisen!« Aber unser Pfäfflein ließ sich nicht aus der Fassung bringen und weidete sich wonneächzend an dem Anblick des brokatgeschmückten Lagers, darauf die Huldin alsbald ihren prangenden Leib betten sollte. Solch liebesdurstiger Augenschmaus entflammte die Einbildungskraft der Schönen, die darob halb scherzend, halb bereits verliebt wiederholte: »Also morgen!«, und den Burschen sodann mit einer Handbewegung, die keinen Widerspruch duldete, entließ.
»Ach, hehre Frau, da habt Ihr wieder einmal ein Keuschheitsgelübde in Liebessehnen verwandelt!« kicherte ein Zöflein. Und wieder platzten alle heraus, also daß das Gemach wie unter Hagelschlägen erzitterte. — Derweile machte sich Philippus von dannen, nicht ohne blindlings mit dem Kopf wider die Pfosten zu rennen. Denn der leckere Anblick hatte ihn völlig geblendet. Doch prägte er sich die Torwappen sorglich ein und kehrte voll lüsterner Teufeleien und schlechter Gedanken zu seinem biederen Erzbischofe zurück. In seinem Kämmerlein zählte er während der ganzen Nacht seine Batzen: mehr als vier Taler kamen freilich nie heraus, aber da dies sein einzig Gut war, das er so der Schönen hingeben wollte, vermeinte er, sie würde wohl zufrieden sein.
Dem Erzbischof ging seines Schreibers Seufzen und Ächzen mählig auf die Nieren. »Was ist Euch nur?« fragte er endlich. Und das Pfäfflein entgegnete kläglich: »Ach wehe, hoher Herr! Mir will nicht in den Sinn, daß so ein zieres, zartes Mägdelein einem also schwer das Herze bedrücken mag.« Da legte jener sein Brevier (darin der Edle für die andern las) zur Seite und erkundigte sich: »Welche ist’s denn?«
»Ach Jesus! Weh, edler Herr und Gönner, verdammt mich nicht. Gewißlich gehört die zum mindesten einem Kardinale an, in die ich mich vergaffte… Und nun weine ich, da mir noch manch verflixter Taler fehlt, um sie mit Eurer Erlaubnis zum Guten zu bekehren.« Der Erzbischof furchte die dachförmige Falte über seiner Nase unter bedenklichem Schweigen, also daß der Pfaff vor Angst zu beben anhub und sein Geständnis bereute. Doch schon fragte der heilige Mann weiter: »Sollte sie denn gar so viel kosten?« worauf jener ächzte: »Ach! schon manche Mitra hat sie geplündert, manchen Krummstab seiner Zier beraubt.«
»Ei, ei, Philippus: so du von ihr lässest, will ich dir dreißig Taler aus der Armenbüchse geben!« Aber das Kerlchen gierte nach dem Wonneschmaus, also daß es rief: »Oh, dabei käme ich noch immer zu kurz!«
»Philippus,« versetzte darob der gute Alte, »so willst du denn dereinst zur Hölle fahren, von Gott mißachtet gleich all unsern Kardinälen?« Und schmerzbewegt begann er zum Schutzherrn der Keuschlinge, dem heiligen Sabianus, für seines Dieners Heil zu beten. Und weiter mußte der Bursch niederknien und seinerseits den heiligen Philippus anflehen. Aber der verdammte Pfaff erbat insgeheim, daß der Heilige ihm morgen einen huldreichen Empfang bei der Dame beschere, und darum betete er so voller Inbrunst, daß der gute Erzbischof beglückt rief: »Nur Mut, der Himmel wird dich erhören!«
Tags darauf (derweile der edle Greis im Konzil wider die Schamlosigkeit geistlicher Hirten donnerte) verschleuderte Philippus seine sauer erworbenen Taler für Riechwässer, Bäder und ähnliches Gedüft. Wohl gesalbt wie ein Pomadenhengst wandelte er sodann durch die Stadt, bis er seiner Herzens-Königin Haus erspäht hatte. Als er aber jemanden fragte, wem denn selbiges Haus gehöre, das grinste der und rief: »Was für ein grindiger Schelm, der noch nichts von der schönen Imperia gehört hat!«
Nun ward dem Pfäfflein Angst, sein Geld zum Fenster hinausgeworfen zu haben, denn der Name lehrte ihn, in welch arge Schlinge er aus freien Stücken seinen Kopf gesteckt hatte. War doch Imperia die anspruchsvollste und launischste Dirne des Erdenrundes und nicht sowohl für ihre unübertroffene Schönheit, als für ihre Kunst bekannt, gleichermaßen Kardinäle, Leuteschinder und rauhe Krieger zu knechten. Die Höchsten wie die Kühnsten umwarben sie, ein Wink von ihr konnte einem das Leben kosten, und selbst unerbittliche Tugendbolde krochen bei ihr auf den Leim und tanzten gleich den andern nach ihrer Pfeife. Unserm Philippus ward bänglich zu Mut und so wandelte er in der Stadt umher, ohne an Essen und Trinken zu denken. Hatte ihm doch Imperias Anblick sogar die Lust nach andern Frauen verdorben.
Und als die Nacht kam, da hatte der Stolz den hübschen Bengel also gebläht, die Gier ihn gepeitscht und einige Flüche ihn soweit ermuntert, daß er kecklich zu der eigentlichen Königin des Konziles, vor der sich alle beugten, hineilte. Der Hausmeister, der ihn nicht kannte, wollte ihn freilich hinauswerfen, als just ein Zöflein oben vom Treppenabsatz rief: »Nicht doch, Meister Imbert! Das ist ja der Kleine von der Gnädigen!« Und schamrot wie ein Jüngferlein stolperte der arme Philippus wonnebebend die Treppe hinauf. Alldorten nahm ihn die Zofe bei der Hand und führte ihn in das Gemach, darinnen die Gnädige bereits vor Erwartung kochte und also leicht bekleidet war wie eine Frau, die mutvoll höheren Genüssen entgegenblickt. In strahlender Schönheit saß sie bei einem prunkhaft gedeckten Tische, dessen Leckerbissen jedem das Wasser in den Mund getrieben hätten — auch unserm Pfäfflein, wäre er nicht so über die Maßen verliebt gewesen. Denn alsbald ward Frau Imperia dessen inne, daß die Blicke des zieren Kleinen nur ihr allein galten. Und sie, die eigentlich an verliebte Demut geistlicher Herren gewöhnt war, ergötzte sich doch baß an seiner Huldigung, maßen sie sich seit gestern Nacht immer mehr in den Schlingel vernarrt hatte und er ihr tagsüber schon gar nicht mehr aus dem Sinn gekommen war. Nun waren die Vorhänge zu und die Gnädigste so holder Laune, als gälte ihr Empfang einem kaiserlichen Prinzen. Und als solcher fühlte sich der Bengel auch, da ihm die Gunst der hochheiligen Schönheit zu Kopfe stieg. Aufgebläht stolzierte er herzu und machte einen Kratzfuß, der nicht übel gelang. Alsbald beglückte den Wonneschaudernden ein glühender Blick und die Holde sprach: »Setzt Euch neben mich; ich sehe, Ihr habt Euch seit gestern verändert.«
»Ei freilich,« brüstete er sich. »Gestern liebte ich Euch — und heute lieben wir uns: so ward ich armer Schlucker reicher als ein König!«
»I du kleiner Strick,« kicherte sie, »mir scheint vielmehr, der junge Pfaff ist ein alter Teufel geworden.«
Damit kauerten sie sich zusammen vor dem Kaminfeuer hin, dessen Glut ihnen noch weiter einheizte. Sie mißachteten die guten Bissen auf dem Tisch und fraßen sich mit den Augen; und schon waren sie im besten Zuge, als sich vor der Tür ein groß Geschrei erhob und Hiebe prasselten.
»Was gibts?!« rief stracks die Gnädige, machtbebend wie ein König, den man kecklich stört.
»Der Erzbischof von Chur«, hauchte ein Zöflein.
»Hol’ ihn der Teufel! — Sag ihm, ich habe das Fieber, so lügst du nicht, denn dieses Pfäfflein macht mir heiß und kalt.«
Kaum hatte sie das gesagt und dabei des Philippus Hand so hold gedrückt, daß es dem in allen Gliedern zuckte, da tauchte schon der feiste Bischof wutschnaubend vor ihnen auf und hinter ihm seine Leute mit einer güldenen Schüssel, darauf eine Lachsforelle frisch und lecker prangte, mit vielerlei würzigduftenden Gerichten, mit Obst und Früchten und holden Schnäpsen, wie die heiligen Nonnen sie in den Klöstern brauen.
»Uf,« polterte der grob, »um zur Hölle zu fahren, brauche ich mich von dir nicht vorher peinigen zu lassen, mein Täubchen…«
»Euer Wanst wird eines Tages eine schicke Degenscheide abgeben,« erwiderte sie und furchte die Brauen, und ihre vorher so sanften, lieben Augen wurden hart und grausam.
»Und der Chorknabe hier soll wohl schon den Totengesang anstimmen?« pöbelte der Erzbischof weiter und wandte sein rotgedunsenes Antlitz wider den zieren Philippus. Der meinte: »Hochwürden, Madame will mir beichten.«
»Was!! kennst du nicht die Regeln?! Damenbeichten zu dieser Stunde sind den Bischöfen vorbehalten. Fort mit dir zu deinen Nonnen!«
»Nein, hiergeblieben!« schmetterte Imperia, die zugleich von Zorn und Liebe verschönt sich selbst übertraf, »Ihr seid hier zu Hause, teurer Freund« (da ward Philippus ihrer Liebe gewiß!) »Sind nicht, wie da geschrieben steht, alle Menschen vor Gott gleich? So sollt auch ihr beide vor mir gleich sein, da ich hinieden eure Göttin bin. Setzt euch und eßt!«
So sprach sie, denn der Lachs und die Schleckereien taten es ihr doch an. Ihrem Schlingel aber zwinkerte sie lsitig zu, daß er sich vor dem Dickwanst nicht zu bangen brauche, den sie bald abfertigen würde. So ward denn der Bischof von der Zofe am Tische verstaut und ein gewaltiges Prassen hub an. Das Pfäfflein freilich aß keinen Bissen, da ihn nach Imperia hungerte, und schweigend an sie geschmiegt redete er nur jene Sprache, die jedem Weibe auch ohne Laute und Buchstaben verständlich ist. — Der feiste Bischof war ein wüster Schlemmer: ein Gläslein Würzwein nach dem andern ließ er sich von zarter Hand darreichen und schon hallte fröhlich sein erster Rülpser, als von der Straße lautes Pferdegetrappel heraufscholl. Der Lärm ließ zum mindesten eines liebestollen Fürsten erwarten und richtig stürmte gleich darauf der Kardinal von Ragusa rücksichtslos ins Gemach. Dieser gerissene Italiener, des Anwartschaft auf den heiligen Stuhl man kannte, dieser langbärtige Haarespalter überblickte sofort die Situation. Von seiner Mönchsgeilheit hergetrieben, wollte er natürlich auf seine Kosten kommen, und so winkte er sich nach einer Sekunde Überlegung Philippen herbei.
»Komm ‘mal her, Freundchen!« — Der Ärmste war mehr tot wie lebendig, denn nun wurde die Sache brenzlich. Dienstbereit nahte er dem furchtbaren Rothute, und der führte ihn zur Stiege, sah ihm stracks in die Augen und sagte ohne langes Fackeln: »Schockschwerenot! du scheinst mir ein lieber Kumpan, den ich nicht gern um einen Kopf kürzen möchte. Also glatt heraus: willst du dich lieber mit einer Abtei auf Lebenszeit vermählen oder heut Nacht mit der Gnädigen, aber dann morgen verscheiden?«
Der arme Bengel murmelte ganz verzweifelt: »Aber wenn Eure Glut gestillt ist, Hochwürden, — dürfte ich dann wiederkommen?« — Der Kardinal verbiß sich das Lachen: »Galgen oder Mitra — wähle!«
»Na,« meinte unser Pfäfflein verständnisinnig, »wenn die Pfründe schön fett ist…« Da ging der Kardinal flugs ins Gemach zurück und schrieb ein Certificat aus. Der Schlingel suchte darin den Namen der Abtei zu entziffern und derweile grinste er: »Den Bischof von Chur werdet Ihr nicht so leicht abhalftern wie mich. Doch will ich Euch meine Dankbarkeit erzeigen und mich mit einem guten Rate aufdienen. Ihr wißt ja, wie ekel und ansteckend die Seuche ist, die in Paris wütet: sagt ihm also, Ihr kämet just vom Sterbebette des lieben alten Erzbischofes von Bordeaux — dann wird er verschwinden wie die Wurst im Spinde.«
»Hoho,« blökte der Kardinal, »du verdienst ja sogar noch mehr als eine Abtei — hier, Schockschwerenot! Freundchen, hier nimm noch hundert Gülden für die Reise…«
Als Imperia die Worte hörte und inne ward, daß Philippus aus dem wonnigen Bereiche ihrer liebesüßen Schmeichelaugen verduftete, da ahnte sie feigen Verrat und hub voll ingrimmiger Enttäuschung an zu schnauben wie ein Delphin. Die tödlichen Blicke, die sie dem Pfäfflein nachsandte, taten dem Kardinal natürlich wohl, denn nun durfte der italienische Lüstling hoffen, seine Abtei recht bald wieder zu bekommen.
Philippus indes ahnte nichts böses, nur trollte er sich davon wie ein begossener Kater. Und die Schöne tat einen tiefen Seufzer: hei, wie wäre sie jetzt gern mit dem Mannsvolk umgesprungen, wo lohe Glut sie erhitzte und draußen wie drinnen zu wabern schien. Denn das war, weiß Gott, das erste Mal, daß ein Pfaff sie verschmähte.
Derweile lächelte der verschmitzte Rothut und vermeinte, nun blühe sein Weizen erst recht. Stracks ging er den Bischof an: »Ach, liebwertester Gevatter, wie ich mich freue, diesen Nichtsnutz verjagt zu haben und nun Eure Gesellschaft genießen zu können. Wahrlich, der Bursch war der holden Frau nicht wert und zudem — wie leicht hätte er den Tod ins Haus bringen können…«
»Was?? Wieso?!«
»Aber er ust doch der Schreiber des Erzbischofes von Bordeaux, der sich heute früh die Pest…«
Des Bischofs Mund sperrte, als sollte er einen Käase schlucken: »Woher wißt Ihr?«
»Tja —« meinte jener, und ergriff des biedern Deutschen Hand, »ich habe ihm doch die letzte Wegzehrung gegeben und nun schwebt der Heilige dem Paradiese zu.« Schon zeigte der Bischof, daß Fettwänste auch mal springen können wie Gummibälle: hups, war er zur Tür hinaus und ohne Adieu kugelte er bereits angstschwitzend, schnaufend und totenbleich die Stiege hinab. Als er durchs Tor auf die Straße rollte, hub der Herre von Ragusa gewaltig an zu lachen:
»Na, mein Püppchen, bin ichs nicht wert, Papst, und mehr noch — heut Nacht dein Schatz zu werden?« Und da er Imperia bedrückt sah, trat er herzu, um sie schmeichlerisch zu umhalsen und bezärteln, was ja die Herren Kardinäle besser verstehen als jeder andere. Doch sie entwich und giftete:
»Hah, du toller Narr, du willst also meinen Tod!… dir geilem Bock geht das Vergnügen über alles, und was aus mir wird, schert dich nicht?! Pack dich mit deiner Pest fort, rühr’ mich nicht an, oder ich laß dich diesen Dolch kosten!« Und damit zückte sie ein zierliches Stilett, mit dem sie, für alle Notfälle gewappnet, gar wohl umzugehen verstand.
»Aber mein Herzenstäubchen,« entgegnete er lachend, »merkst du denn nicht den Braten?… Wie wäre ich denn anders den alten Bullen aus Chur losgeworden?!«
»Schon gut, ich werde ja sehen, ob ihr mich liebt. Trollt Euch auf der Stelle! Ich kenne Euch: habt Ihr die Pest im Leibe, dann macht Euch mein Tod auch keine Sorge mehr. Mir aber geht mein Leib und Eigen über alles. Seht, und hat Euch der Sensenmann inzwischen nicht erwischt, dann könnt Ihr ja morgen wiederkommen.«
»Imperia!« rief der Kardinal und warf sich ihr zu Füßen, »Du holde Heilige, verspotte mich nicht!«
»Nein —,« erwiderte sie, »mit heiligen und geweihten Dingen treibe ich auch keinen Spott.«
»Hah, verdammte Vettel! Exkommunizieren werde ich dich — morgen! Satansbraten — ach, du Holde, Feinsliebchen… Willst du mein ganzes Geld… einen Splitter vom heiligen Kreuz?… Hexe, umgarnt hast du mich! Auf den Scheiterhaufen mit dir!… Süßes, zieres Täubchen!… Den schönsten Platz im Himmel schaffe ich dir!… Wie? Was?… Du willst nicht?! Dann zum Henker mit dir, du Hexe!!« Und er schäumte vor geiler Wut. »Ihr werdet überschnappen,« spottete sie, »geht lieber heim!« — »Wenn ich Papst werde…« — »Werdet Ihr mir auch gehorchen müssen, jawohl!« — »Und was soll ich heut Abend tun, um dir zu gefallen?« — »Verduften…«
Und damit schlüpfte sie hurtig wie eine Bachstelze in ihre Kammer, schob flink den Riegel vor und ließ den Kardinal draußen wettern, bis er es satt bekam und abschob. Und als die Schöne dann einsam ohne ihr Pfäfflein vor dem Kamin hockte, da zerriß sie grimmig ihre güldenen Kettlein und murmelte: »Beim dreimal doppeltgehörnten Teufel! Wenn mir der Bengel diese Kardinalssuppe eingebrockt und mich zudem noch angesteckt hat, ohne daß ich meine Lust über und über an ihm gestillt habe, dann will ich ihn vor meinem Tode noch lebend geschunden und zerstückt vor mir sehen. — Ach wehe!« Und diesmal waren ihre Tränen echt! — »Was für ein Jammerleben, — für ein bischen Glück rackst man wie ein Hund und gibt noch sein Seelenheil daran.« Und sie heulte wie ein Schloßhund… als sie mit einem Male hinter einem venezianischen Spiegel das Pfäfflein gewahrte, das gar verschmitzt hervorlugte.
»I du Prachtkerl, du frecher, zuckersüßer Fratz!« rief sie. »Gibts denn in diesem heiligen, verliebten Konstanz noch einen zweiten Spitzbuben wie dich? Ach, komm, du Toller, du Zierer, Feiner, mein Herzensschatz, mein Wonneparadies! Laß mich deine Äuglein trinken, dich schlecken und vor Liebe fressen! Komm, kleiner Pfaff, ich will dich zum König, Kaiser, Papst — will dich glücklicher machen als alle zusammen!… Zeig deine Glut, nun bin ich dein, nun sollst du bald Kardinal sein, und sollte ich mein Herzblut vergießen, um dein Barett damit zu färben.«
Und mit glückzitternden Händen füllte sie des Bischofs güldenen Humpen mit griechischem Wein und bot ihn kniend ihrem Liebsten dar, sie, deren Füßlein die Fürsten der Welt inbrünstiger küßten als des Papstes Pantoffel. Aber das Pfäfflein blickte sie schweigend an mit liebesgierigen Augen, also daß sie wonneschauernd hauchte: »Still, Kleiner! Komm!… Greif zu!«





























