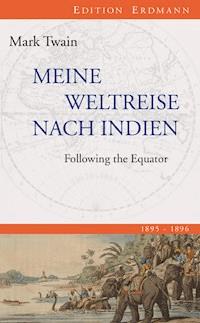13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In neuer, kongenialer Übersetzung: Tom Sawyers Abenteuer - die berühmte Geschichte eines cleveren Waisenkindes, das sich gegen die starren Regeln der Erwachsenen durchzusetzen weiß. Da haben Sonntagsschule, Tante Polly und puritanische Tugendvereine keine Chance, wenn es darum geht, zu schwimmen, zu rauchen und einen Mord aufzuklären – immer wieder ein Lesevergnügen für groß und klein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Abenteuerlust, echte Freundschaft und die Rebellion gegen die Erwachsenen – darum dreht sich alles bei dem aufmüpfigen Tom. Man kann nun mal kein Musterschüler sein, wenn man ein gefürchteter Pirat werden will.
Im tiefsten amerikanischen Süden an den Ufern des Mississippi treibt Tom Sawyer mit seinen Freunden sein Unwesen und widersetzt sich erfolgreich den Erziehungsversuchen der Schule und seiner Tante Polly. Ständig auf der Flucht, um den »ungerechten« Strafen der Erwachsenen zu entgehen, heckt er einen Streich nach dem anderen aus. Doch das richtige Abenteuer beginnt erst, als eines Nachts auf dem Friedhof ein Mord passiert und nur Tom und sein Freund Huck Finn gesehen haben, wer der Mçrder ist. Und dann ist da noch Toms Liebe zu Becky Thatcher ... Immer wieder ein Lesevergnügen für groß und klein.
Mark Twain wurde 1835 als Samuel Langhorne Clemens in Florida/ Missouri geboren. Er arbeitete als Journalist, Goldgräber, Publizist und Lotse auf einem Mississippi-Dampfer. Als Schriftsteller wurde er v. a. mit seinen Romanen über die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer bekannt. Twain starb 1910 in Redding/Connecticut. Von ihm sind im insel taschenbuch außerdem erschienen: Bummel durch Deutschland (it 3472), Mark Twain für Boshafte (it 3473) und Abenteuer von Huckleberry Finn (it 3528).
Mark Twain
Tom Sawyers Abenteuer
Aus dem Englischenvon Gisbert Haefs
Insel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2011
© Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2007
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Hinweise zu dieser Ausgabe am Schluß des Bandes
Umschlag: bürosüd, München
Umschlagfoto: FPG/Getty Images
eISBN 978-3-458-75900-3
www.insel-verlag.de
Vorwort
Die meisten der in diesem Buch aufgezeichneten Abenteuer haben sich wirklich ereignet; eines oder zwei habe ich selbst erlebt, die übrigen sind Erlebnisse von Jungen, die meine Schulkameraden waren. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, Tom Sawyer ebenfalls, allerdings nicht nach einem bestimmten Individuum – er ist eine Kombination der Charakteristika dreier Jungen, die ich kannte, und gehört daher zur Ordnung der Komposit-Architektur.
Zu der Zeit, da diese Geschichte spielt – das heißt, vor dreißig oder vierzig Jahren –, herrschten die erwähnten seltsamen Formen des Aberglaubens sämtlich bei Kindern und Sklaven im Westen.
Wenn mein Buch auch vor allem zur Unterhaltung von Jungen und Mädchen gedacht ist, hoffe ich doch, daß Männer und Frauen es nicht deshalb meiden werden, denn es war Teil meiner Absichten, Erwachsene auf ersprießliche Weise an das zu erinnern, was sie einmal selbst waren, und daran, wie sie gefühlt und gedacht und geredet und auf welch merkwürdige Unternehmungen sie sich bisweilen eingelassen haben.
Hartford, 1876 Der Verfasser
1. Kapitel
»Tom!«
Keine Antwort.
»Tom!«
Keine Antwort.
»Wo steckt der Junge bloß, frag ich mich? Du, TOM !«
Keine Antwort.
Die alte Dame zog die Brille nach unten und blickte über sie durchs Zimmer; dann schob sie sie hoch und blickte unter ihr hervor. Selten oder nie sah sie hindurch nach einem so kleinen Ding wie einem Jungen; es war nämlich ihre Staatsbrille, ihr ganzer Stolz, geschaffen für »Eleganz«, nicht zur Benutzung – ebensogut hätte sie auch durch ein Paar Herdringe schauen können. Einen Moment wirkte sie verblüfft, und dann sagte sie, nicht zornig, aber doch laut genug, daß die Möbel es hören konnten:
»Also, wenn ich dich erwische, dann . . .«
Sie beendete den Satz nicht, denn inzwischen hatte sie sich gebückt und stocherte mit dem Besen unterm Bett herum, also brauchte sie ihren Atem, um den Stößen Nachdruck zu verleihen. Sie förderte nichts zutage als die Katze.
»So was wie diesen Jungen hab ich noch nie gesehn!«
Sie ging zur offenen Tür, blieb darin stehen und ließ den Blick über die Tomatenstöcke und Stechapfelbüsche schweifen, die den Garten darstellten. Kein Tom.
Also hob sie die Stimme in einem auf Fernwirkung berechneten Winkel an und rief: »Du-u-u, TOM !«
Hinter ihr gab es ein leises Geräusch, und sie wandte sich gerade rechtzeitig, um einen kleinen Jungen am Jackenzipfel zu erwischen und seine Flucht zu bremsen.
»Da bist du ja! An den Wandschrank hätt ich auch denken können! Was hast du denn da drin getan?«
»Nichts.«
»Nichts! Kuck mal, deine Hände. Und dein Mund. Was ist das für Zeug?«
»Weiß ich nicht, Tante.«
»Na, aber ich weiß es. Das ist Marmelade. Vierzig Mal hab ich dir gesagt, laß die Finger von der Marmelade, sonst gerb ich dir das Fell. Gib mir die Gerte.«
Die Gerte schwebte in der Luft – es war höchste Gefahr –
»Vorsicht, Tante! Hinter dir!«
Die alte Dame fuhr herum und raffte ihre Röcke, um sie in Sicherheit zu bringen. Sofort flüchtete der Junge, kletterte über den hohen Bretterzaun und verschwand.
Tante Polly stand einen Augenblick verdutzt da und brach dann in leises Lachen aus.
»Zum Kuckuck mit dem Jungen! Werd ich’s denn nie lernen? Hat er mir nicht genug solche Streiche gespielt, daß ich mich endlich vor ihm in acht nehme? Aber alte Narren sind die schlimmsten. Nem alten Hund kann man keine neuen Kunststücke lernen, wie man so sagt. Aber, du liebe Güte, er macht’s immer anders, jeden Tag, und wie soll man wissen, was diesmal kommt? Er weiß wohl genau, wie weit er’s mit mir treiben kann, bis mir der Hut hochgeht, und er weiß, wenn er mich nur einen Augenblick ablenken oder zum Lachen bringen kann, dann ist’s wieder vorbei, und ich kann ihm keinen einzigen Schlag überziehen. Ich tu meine Pflicht nicht an dem Jungen, wahrhaftig nicht, das weiß der liebe Himmel. Schone den Stock und verdirb das Kind, so steht’s in der Bibel. Sünde und Leid bring ich über uns beide, das weiß ich. Er steckt voller Teufeleien, aber du lieber Gott! Er ist ja der Junge von meiner toten Schwester, der Arme, und irgendwie krieg ich’s nicht fertig, ihn zu prügeln. Immer wenn ich ihn so davonkommen lasse, beißt mir das Gewissen, und immer wenn ich ihn schlage, bricht’s mir fast das alte Herz. Ach ja, der Mensch, der vom Weibe geboren ist, hat nur eine kurze Zeit, und die ist voller Sorgen, wie die Schrift sagt, und so ist es wohl. Heut nachmittag wird er die Schule schwänzen, und da bin ich einfach gezwungen, ihm zur Strafe morgen eine Arbeit aufzubrummen. Ganz schön hart, ihn samstags arbeiten zu lassen, wenn alle Jungen freihaben, aber Arbeit haßt er mehr als alles andere, und ich muß doch meine Pflicht an ihm tun, sonst bin ich dem Kind sein Verderben.«
Tom schwänzte wirklich, und er hatte viel Spaß dabei. Er kam gerade noch rechtzeitig nach Hause, um Jim, dem kleinen farbigen Jungen, vor dem Abendbrot das Feuerholz für den nächsten Tag sägen und spalten zu helfen – zumindest war er noch früh genug da, um Jim seine Abenteuer zu berichten, während Jim drei Viertel der Arbeit tat. Toms jüngerer Bruder (oder vielmehr Halbbruder) Sid war mit seinem Teil (Späne aufsammeln) schon fertig; er war nämlich ein stiller Junge und hatte nichts Abenteuerlustiges, Aufmüpfiges an sich.
Während Tom sein Abendbrot aß und Zucker stibitzte, sobald sich die Gelegenheit bot, stellte ihm Tante Polly sehr listige, verfängliche Fragen – sie wollte ihn nämlich zu belastenden Enthüllungen verlocken. Wie viele schlichte Seelen bildete sie ein, sie hätte Talent für dunkle und geheimnisvolle Diplomatie, und gern hielt sie ihre durchsichtigsten Finten für Wunderwerke tückischer List.
Sie sagte: »Tom, es war ziemlich warm in der Schule, oder?«
»Hmja.«
»Furchtbar warm, was?«
»Hmja.«
»Hattest du nicht Lust zum Schwimmen, Tom?«
Ein leichter Schreck durchzuckte Tom – ein leiser unbehaglicher Verdacht. Er forschte in Tante Pollys Gesicht, aber es verriet ihm nichts. Deshalb sagte er:
»Nee – jedenfalls nicht viel.«
Die alte Dame streckte die Hand aus und befühlte Toms Hemd, dann sagte sie:
»Jetzt bist du aber nicht so warm.« Es schmeichelte ihrem Stolz, entdeckt zu haben, daß das Hemd trocken war, ohne daß irgend jemand ahnte, worauf sie hinauswollte. Trotzdem wußte Tom aber nun, woher der Wind wehte. Darum kam er dem zuvor, was ihr nächster Schachzug sein mochte:
»Ein paar von uns haben sich Wasser über den Kopf gepumpt – meiner ist noch feucht. Siehste?«
Tante Polly ärgerte sich bei dem Gedanken, daß sie dieses Indiz übersehen und sich so einen Schlich hatte entgehen lassen. Dann kam ihr eine neue Eingebung:
»Tom, du hast dir doch den Hemdkragen nicht abmachen müssen, wo ich ihn angenäht hab, um dir Wasser über den Kopf zu pumpen, oder? Mach mal die Jacke auf.«
Aus Toms Gesicht schwand alle Besorgnis. Er öffnete die Jacke. Sein Hemdkragen war fest angenäht.
»Verflixt! Na, geh schon. Ich war sicher, daß du die Schule schwänzt und schwimmen gehst. Aber ich vergeb dir, Tom. Dir geht’s wohl ähnlich wie ner Katze, die sich mal versengt hat, wie man so sagt – du bist besser, als du aussiehst. Diesmal.«
Halb war sie traurig, daß ihr Scharfsinn versagt hatte, und halb froh, daß Tom dies eine Mal auf den Weg des Gehorsams gestolpert war.
Aber Sidney sagte: »Komisch, ich hab gemeint, du hättst seinen Kragen mit weißem Garn angenäht, aber das da ist schwarz.«
»Na klar hab ich ihn mit weißem angenäht! Tom!«
Aber Tom wartete den Rest nicht ab. Als er zur Tür hinauslief, rief er: »Siddy, dafür kriegst du Haue!«
An einem sicheren Ort untersuchte Tom zwei große Nadeln, die in seinen Jackenaufschlägen steckten und mit Garn umwickelt waren – eine mit schwarzem, die andere mit weißem. Er sagte:
»Sie hätt’s nie gemerkt, ohne Sid. Verflixt! Manchmal näht sie’s mit Schwarz und manchmal mit Weiß. Ich wünschte, sie würd zum Kuckuck bei einer Sorte bleiben – wie soll ich das denn behalten. Wetten, Sid verdresch ich aber dafür. Dem werd ich’s zeigen!«
Er war nicht der Musterknabe des Ortes. Den Musterknaben kannte er aber sehr gut und verabscheute ihn.
Zwei Minuten später, oder noch schneller, hatte er alle seine Sorgen vergessen. Nicht, weil sie für ihn auch nur ein bißchen leichter und weniger bitter gewesen wären als die eines Mannes für diesen, sondern weil ein neues, starkes Interesse die Oberhand gewann und sie vorläufig vertrieb – genau wie Männer in der Erregung über neue Unternehmungen ihre Nöte vergessen. Dieses neue Interesse war eine reizvolle neue Art zu pfeifen, die er eben einem Neger abgeschaut hatte, und er wollte sie dringend ungestört üben. Es war ein seltsamer Vogellaut, eine Art schmelzender Triller, bewirkt dadurch, daß man zwischendurch in kurzen Abständen mit der Zunge den Gaumen berührt – der Leser weiß wahrscheinlich noch, wie das geht, falls er jemals ein Junge gewesen ist. Fleiß und Hingabe ließen ihn bald dahinterkommen, und er schlenderte die Straße hinunter, den Mund voller Harmonie und die Seele voller Dankbarkeit. Ihm war zumute wie einem Astronomen, der einen neuen Planeten entdeckt hat – was die Stärke, Tiefe und Reinheit der Freude betrifft, war aber zweifellos der Junge im Vorteil, nicht der Astronom.
Die Sommerabende waren lang. Noch war es nicht dunkel. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen. Ein Fremder stand vor ihm – ein Junge, ein bißchen größer als Tom. Für das arme kleine schäbige Dorf St. Petersburg war ein Neuankömmling jeden Alters und Geschlechts eine beeindruckende Kuriosität. Dieser Junge war auch noch gut gekleidet – und das an einem Wochentag. Das war einfach verblüffend. Seine Mütze war niedlich, seine fest zugeknöpfte blaue Tuchjacke neu und schmuck, und seine Hose ebenfalls. Er hatte Schuhe an – dabei war doch erst Freitag. Sogar eine Krawatte trug er, ein buntes Stück Band. Er hatte etwas Städtisches an sich, und das nagte an Tom. Je länger er das prächtige Wunder anstarrte, um so mehr rümpfte er die Nase über dessen Putz und um so schäbiger kam ihm seine eigene Kleidung vor. Keiner der beiden Jungen sagte etwas. Wenn sich der eine bewegte, bewegte sich auch der andere – aber nur seitwärts, im Kreis; sie behielten einander die ganze Zeit im Auge. Schließlich sagte Tom:
»Dich kann ich verdreschen!«
»Das möcht ich sehn.«
»Kann ich, ganz klar.«
»Nein, kannst du doch nicht.«
»Doch, kann ich.«
»Nein, kannst du nicht.«
»Kann ich wohl.«
»Kannst du nicht.«
»Kann ich doch.«
»Nee.«
Eine unbehagliche Pause. Dann sagte Tom: »Wie heißt du?«
»Geht dich das vielleicht was an?«
»Ich werd dir schon zeigen, daß es mich was angeht.«
»Na, warum tust du’s denn nicht?«
»Wenn du noch viel sagst, tu ich’s.«
»Viel – viel – viel. Da hast du’s.«
»Du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Wenn ich will, mach ich dich mit einer Hand auf den Rücken gebunden fertig.«
»Dann tu’s doch endlich und red nicht nur davon!«
»Wenn du so weitermachst, tu ich’s.«
»Ach ja? Das haben schon viele versucht!«
»Du kommst dir toll vor, oder? Mensch, was für n Hut!«
»Kannst ihn ja falten, wenn du ihn nicht magst. Hau ihn mir doch einfach vom Kopf – zähl aber vorher besser deine Knochen.«
»Du lügst!«
»Selber.«
»Du bist n Großmaul und feige!«
»Ach, geh doch weg.«
»Du, wenn du noch lange so weitermachst, nehm ich nen Stein und knall ihn dir gegen die Birne!«
»Na, klar machst du das!«
»Mach ich auch.«
»Na, warum machst du’s denn nicht, statt bloß zu erzählen, du willst es tun? Warum tust du’s denn nicht? Bloß, weil du Angst hast!«
»Hab ich nicht!«
»Doch!«
»Nein!«
»Doch!«
Wieder eine Pause, wieder gegenseitiges Anstarren und seitliches Umkreisen. Auf einmal standen sie Schulter an Schulter.
Tom sagte: »Hau bloß ab!«
»Hau doch selber ab!«
»Mach ich nicht!«
»Ich auch nicht.«
Sie standen da, jeder als Stütze einen Fuß zur Seite gestemmt, beide schoben aus Leibeskräften und funkelten einander haßerfüllt an. Aber keiner konnte die Oberhand gewinnen. Nachdem sie sich abgemüht hatten, bis sie heiß und hochrot waren, entspannten sie sich wachsam und vorsichtig, und Tom sagte:
»Ein Feigling bist du und n Fatzke. Ich sag’s meinem großen Bruder, der kann dich mit dem kleinen Finger verhauen, und ich sorg dafür, daß er’s auch tut.«
»Auf deinen großen Bruder pfeif ich. Ich hab nen Bruder, der viel größer ist, der wirft ihn wie nix über den Zaun da.«
(Beide Brüder waren erfunden.)
»Du lügst.«
»Bloß, weil du’s sagst, noch lange nicht.«
Tom zog mit dem großen Zeh einen Strich in den Staub und sagte: »Einen Schritt da drüber, und ich verdresch dich, bis du nicht mehr stehen kannst. Wer’s wagt, ist n toter Mann.«
Sofort trat der Neue über den Strich und sagte: »Du hast gesagt, du machst es, jetzt zeig mal, wie du’s machst.«
»Komm mir nicht zu nah, paß bloß auf!«
»Du hast gesagt, du machst es, warum machst du’s nicht?«
»Donnerwetter, für zwei Cent mach ich’s wirklich.«
Der Neue nahm zwei große Kupfermünzen aus der Tasche und hielt sie verächtlich hin. Tom schlug sie ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten und wälzten sich die beiden Jungen im Dreck, ineinander verkrallt wie Katzen; und eine Minute lang rissen und zerrten sie an Haaren und Kleidern, zerbleuten und zerkratzten einander die Nase und bedeckten sich mit Schmutz und Ruhm. Dann gewann das Durcheinander Form, und aus dem Dunst der Schlacht erschien Tom, der rittlings auf dem Neuen saß und ihn mit den Fäusten bearbeitete.
»Sag: genug!« rief er.
Der Junge kämpfte nur, um sich zu befreien. Er weinte – vor allem aus Wut.
»Sag: genug!« Toms Fäuste trommelten weiter.
Endlich stieß der Fremde ein ersticktes »Genug« aus; Tom ließ ihn aufstehen und sagte: »Das haste davon. Nächstes Mal paß auf, mit wem du dich anlegst.«
Der Neue lief davon, klopfte sich den Staub von der Kleidung, schluchzte und schnüffelte, blickte sich mehrmals um, schüttelte den Kopf und stieß Drohungen aus, was er mit Tom tun würde, wenn er ihn »das nächste Mal erwische«. Darauf antwortete Tom mit Hohngelächter und brach in bester Laune auf, und kaum hatte er sich umgewandt, als der Neue einen Stein ergriff, ihn nach Tom warf und zwischen die Schulterblätter traf; dann gab er Fersengeld und wetzte wie ein Wiesel davon. Tom jagte den Verräter bis zu dessen Haus und erfuhr so, wo er wohnte. Eine Zeitlang belagerte er das Tor und forderte den Feind auf, herauszukommen; der aber schnitt ihm nur durchs Fenster Grimassen und lehnte die Einladung ab. Schließlich erschien die Mutter des Feindes, nannte Tom ein schlimmes, böses, ordinäres Kind und scheuchte ihn weg. Also trollte er sich, sagte aber, den Jungen würde er sich noch vorknöpfen.
Er kam an dem Abend ziemlich spät heim, und als er vorsichtig durchs Fenster kletterte, geriet er in einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante; und als sie den Zustand seiner Kleidung sah, wurde ihr Beschluß, seinen freien Samstag in Gefangenschaft bei Zwangsarbeit zu verwandeln, ehern und unumstößlich.
2. Kapitel
Der Samstagmorgen war gekommen; die ganze Sommerwelt war hell und frisch und floß über von Leben. In jedem Herzen war ein Lied, und wenn das Herz jung war, kam die Musik über die Lippen. In jedem Gesicht lag Fröhlichkeit und in jedem Schritt ein Federn. Die Robinien standen in Blüte, und ihr Duft erfüllte die Luft. Der Cardiff-Hügel hinter und über dem Dorf war grün von Pflanzen und lag gerade weit genug weg, um ein Gelobtes Land zu scheinen, verträumt, ruhig und einladend.
Tom erschien auf dem Gehweg mit einem Eimer Tünche und einem langstieligen Pinsel. Er besah den Zaun, und alle Freude verließ ihn, und tiefe Schwermut senkte sich auf sein Gemüt. Ein dreißig Yards langer, neun Fuß hoher Bretterzaun. Das Leben erschien ihm hohl und das Dasein eine einzige Last. Seufzend tauchte er den Pinsel ein und zog ihn über die oberste Planke, wiederholte das Verfahren, dann noch einmal, verglich den unbedeutenden Streifen Tünche mit dem weitläufigen Kontinent ungetünchten Zauns und setzte sich entmutigt auf einen Baumkübel. Jim kam mit einem Blecheimer in der Hand aus dem Tor gehüpft und sang »Die Mädels von Buffalo«. Wasser von der Gemeindepumpe holen war in Toms Augen bisher immer scheußliche Arbeit gewesen, aber jetzt kam es ihm nicht so vor. Er dachte daran, daß es an der Pumpe Gesellschaft gab. Ständig warteten dort Weiße, Mulatten und Neger, Jungen und Mädchen, bis sie an der Reihe waren, ruhten sich aus, tauschten Spielsachen, zankten, stritten und alberten herum. Und er dachte auch daran, daß die Pumpe nur hundertfünfzig Yards entfernt war, Jim aber mit dem Eimer Wasser immer frühestens nach einer Stunde zurückkehrte – und selbst dann mußte ihn gewöhnlich jemand holen gehen.
Tom sagte: »Hör mal, Jim, ich hol das Wasser, wenn du ein bißchen streichst.«
Jim schüttelte den Kopf und sagte: »Geht nich, Master Tom. Die olle Missis hat gesagt, ich soll Wasser holen gehn und nich stehnbleiben und mit niemand Quatsch machen. Sie sagt, Master Tom wird wohl sagen, ich soll den Zaun streichen, und sie sagt, ich soll weitergehn und mich um meinen Kram kümmern – um das Streichen kümmert sie sich.«
»Ach, scher dich doch nicht um das, was sie sagt, Jim. So redet sie doch immer. Gib mir mal den Eimer – ich bleib nicht mal ne Minute weg. Sie wird’s nicht merken.«
»Uh, ich trau mich nich, Master Tom. Die alte Missis reißt mir den Kopf ab. Macht sie, ganz bestimmt.«
»Die! Die haut doch nie einen – klopft einem ein bißchen mit dem Fingerhut auf den Kopf, und wen stört das, möcht ich wissen? Sie schimpft schrecklich, aber Schimpfen tut nicht weh – wenigstens nicht, wenn sie nicht weint. Jim, ich geb dir ne Murmel. Nen weißen Glasklicker geb ich dir!«
Jim begann zu schwanken.
»Nen weißen Glasklicker, Jim! Und der rollt prima!«
»Ach, das is ne prima Murmel, muß ich sagen. Aber, Master Tom, ich hab Angst vor der ollen Missis . . .«
»Und wenn du willst, zeig ich dir auch noch meinen wehen Zeh.«
Jim war nur ein Mensch – diese Attraktion war zu viel für ihn. Er setzte den Eimer ab, nahm die weiße Murmel und beugte sich hingerissen über den Zeh, während der Verband abgewickelt wurde. Im nächsten Moment flog er mit dem Eimer und einem prickelnden Hintern die Straße hinab, Tom strich, was das Zeug hielt, und Tante Polly zog sich, einen Pantoffel in der Hand und Triumph im Blick, vom Schlachtfeld zurück.
Toms Energie hielt aber nicht lange vor. Ihm fiel der Spaß ein, den er für heute geplant hatte, und sein Kummer vervielfachte sich. Bald mußten die freien Jungen auf allen möglichen feinen Expeditionen hier vorbeikommen, und sie würden ihn furchtbar auslachen, weil er arbeiten mußte – schon der Gedanke daran brannte wie Feuer. Er holte seine weltlichen Schätze hervor und betrachtete sie –Teile von Spielsachen, Murmeln und Plunder; genug, um vielleicht eine Mitarbeit zu erkaufen, aber nicht genug für auch nur eine halbe Stunde lauterer Freiheit. Deshalb steckte er seine beschränkten Mittel wieder in die Tasche und gab den Gedanken an den Versuch auf, die Jungen zu kaufen. In diesem düsteren, hoffnungslosen Augenblick kam ihm eine Eingebung! Nichts Geringeres als eine grandiose, fabelhafte Inspiration.
Er nahm den Pinsel und machte sich ruhig an die Arbeit. Bald kam Ben Rogers in Sicht – genau der Junge, vor dessen Spott er sich am meisten gefürchtet hatte. Bens Gang war ein einziges Hüpfen, Tanzen und Springen – Beweis genug, daß sein Herz leicht und voller Vorfreude war. Er aß einen Apfel und stieß in regelmäßigen Abständen ein langes, melodisches Heulen aus, dem ein tiefes Ding-dong-dong, Ding-dong-dong folgte, denn er stellte einen Dampfer dar. Als er näher kam, drosselte er die Geschwindigkeit, hielt sich in der Straßenmitte, lehnte sich weit nach Steuerbord über und drehte umständlich und mit großem Aufwand bei, denn er war der Dampfer Big Missouri und wußte, daß er neun Fuß Tiefgang hatte. Er war Schiff, Kapitän und Maschinentelegraph in einem, deshalb mußte er sich vorstellen, wie er auf dem Sturmdeck stand, Befehle erteilte und sie auch noch ausführte.
»Stop, Sir! Dingelingeling.« Er machte kaum noch Fahrt und trieb langsam auf den Gehsteig zu.
»Maschine volle Kraft zurück! Dingelingeling!« Er streckte die Arme steif an den Seiten hinab.
»Steuerbord achteraus! Dingelingeling! Tschuk-tsch-tschuk-tschuk-tschuk!« Seine rechte Hand beschrieb stattliche Kreise, denn sie stellte ein vierzig Fuß hohes Schaufelrad dar.
»Backbord achteraus! Bim-bim-bim! Tschuk-tsch-tschuk-tschuk!« Nun begann die linke Hand, Kreise zu beschreiben.
»Steuerbord stop! Dingelingeling! Backbord stop! Steuerbord langsame Fahrt voraus! Stop! Äußeres Rad langsame Fahrt! Dingelingeling! Tschuk-uk-uk! Bugleine raus! Los jetzt! Kommt – raus mit der Trosse – was tut ihr denn da? Die Doppelpart am Poller festmachen. Ran an die Landungsbrücke jetzt – los! Alle Maschinen stop – jetzt, Sir! Dingelingeling! Scht! Scht! Scht!« (Das waren die Dampfventile.)
Tom tünchte weiter – er kümmerte sich nicht um den Dampfer. Ben starrte ihn einen Augenblick an und sagte dann: »He! Du steckst aber in der Patsche, was?«
Keine Antwort. Mit dem Auge des Künstlers begutachtete Tom seinen letzten Strich, zog dann den Pinsel noch einmal mit leichtem Schwung darüber hinweg und prüfte das Ergebnis von neuem. Ben ging neben ihm längsseits. Beim Anblick des Apfels lief Tom das Wasser im Munde zusammen, er blieb jedoch bei seiner Arbeit.
Ben sagte: »Hallo, alter Junge, du mußt arbeiten, was?«
Tom fuhr jäh herum und sagte: »Ach, du bist’s, Ben. Ich hab dich gar nicht bemerkt.«
»Ich geh schwimmen, hörst du? Würdst du das nicht auch lieber? Aber du willst ja lieber schuften, oder? Na klar!«
Tom betrachtete den Jungen ein Weilchen und sagte dann: »Was nennst du denn Arbeit?«
»Na, ist das vielleicht keine Arbeit?«
Tom machte sich wieder ans Tünchen und sagte gleichmütig: »Na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur eins: Tom Sawyer gefällt’s.«
»He, komm schon, willst du etwa behaupten, das macht dir Spaß?«
Der Pinsel fuhr weiter. »Ob’s mir Spaß macht? Warum soll’s mir denn keinen Spaß machen? Kriegt man etwa jeden Tag die Gelegenheit, nen Zaun zu streichen?«
Das warf ein neues Licht auf die Sache. Ben hörte auf, an seinem Apfel zu knabbern. Tom schwang seinen Pinsel feinfühlig hin und her – trat zurück, um das Ergebnis zu betrachten – setzte hier und da einen Tupfer hinzu – betrachtete wieder das Ergebnis, und Ben beobachtete jede Bewegung und wurde immer interessierter, immer stärker gefesselt.
Nach einer Weile sagte er: »Du, Tom, laß mich auch mal n bißchen streichen.«
Tom dachte nach, war schon drauf und dran zuzustimmen, überlegte es sich dann aber wieder anders. »Nee, nee, geht nicht, Ben. Weißt du, Tante Polly ist ganz eigen mit dem Zaun hier – direkt an der Straße – wenn’s der hinten wär, dann wär’s mir ja egal und ihr auch. Ja, ganz eigen ist sie mit dem Zaun, der muß ganz sorgfältig gestrichen werden; ich glaub, von tausend Jungen ist kaum einer imstand, das so zu machen, wie sich’s gehört – vielleicht nicht mal einer von zweitausend.«
»Wirklich? Ach komm, laß mich bloß mal versuchen. Bloß ein bißchen – an deiner Stelle würd ich dich lassen, Tom.«
»Ben, ich würd’s ja gerne tun, großes Indianerehrenwort; aber Tante Polly – weißt du, Jim wollte, und sie hat ihn nicht gelassen; Sid wollte auch, und den hat sie auch nicht gelassen. Siehst du nicht, wie ich in der Klemme sitz? Wenn du dich dranmachst und es passiert was damit . . .«
»Ach, Quatsch; ich mach’s genauso vorsichtig. Komm, laß mich mal versuchen. Du – ich geb dir den Kern von meinem Apfel, ja?«
»Also – ach, Ben, lieber nicht, ich hab Angst . . .«
»Ich geb dir den ganzen!«
Tom gab den Pinsel her, mit widerwilligem Gesicht, aber fröhlichem Herzen. Und während der ehemalige Dampfer Big Missouri in der Sonne arbeitete und schwitzte, saß der Künstler im Ruhestand daneben im Schatten auf einem Faß, ließ die Beine baumeln, verdrückte schmatzend den Apfel und plante, weitere Unschuldige dahinzumetzeln. An Material fehlte es nicht, immer wieder schlenderten Jungen vorbei; sie kamen zum Spotten und blieben zum Streichen. Als Ben abgekämpft war, hatte Tom schon die nächste Gelegenheit für einen gut erhaltenen Drachen an Billy Fisher verkauft, und als der nicht mehr konnte, kaufte sich Johnny Miller ein, mit einer toten Ratte samt Schnur, an der man sie herumschwingen konnte – und so weiter und weiter, Stunde um Stunde. Und als die Mitte des Nachmittags kam, da suhlte sich Tom, morgens noch ein bettelarmer Junge, buchstäblich im Reichtum. Neben den erwähnten Dingen besaß er zwölf Murmeln, ein Stück von einer Maultrommel, ein Stück blaues Flaschenglas zum Durchgucken, eine Wickelspule, einen Schlüssel, der in kein Schloß paßte, ein Stück Kreide, den Glasstöpsel von einer Karaffe, einen Zinnsoldaten, ein paar Kaulquappen, sechs Knallfrösche, ein einäugiges Kätzchen, eine Türklinke aus Messing, ein Hundehalsband – aber keinen Hund –, einen Messergriff, vier Stückchen Orangenschale und einen morschen alten Fensterrahmen.
Die ganze Zeit hatte er behaglich gefaulenzt und eine Menge Gesellschaft gehabt – und den Zaun bedeckte eine dreifache Schicht Farbe! Wäre Tom nicht die Tünche ausgegangen, hätte er sämtliche Jungen des Orts bankrott gemacht.
Tom sagte sich, die Welt sei doch nicht so hohl und leer. Er hatte, ohne es zu wissen, ein wichtiges Gesetz des menschlichen Handelns entdeckt, daß man nämlich etwas nur schwer erreichbar machen muß, damit ein Mann oder ein Junge es begehrt. Wäre er ein großer weiser Philosoph gewesen wie der Verfasser dieses Buches, dann hätte er jetzt begriffen, daß Arbeit das ist, wozu man verpflichtet ist, und Vergnügen das, wozu man nicht verpflichtet ist. Das hätte ihn verstehen lassen, weshalb es Arbeit ist, künstliche Blumen herzustellen oder oben auf einer Tretmühle zu turnen, Kegel schieben oder den Montblanc ersteigen dagegen bloß ein Vergnügen. Es gibt in England reiche Herren, die im Sommer täglich verkehrende vierspännige Reisekutschen zwanzig oder dreißig Meilen weit lenken, weil dieses Vorrecht sie ziemlich viel Geld kostet; wenn man ihnen aber Lohn für diesen Dienst böte, würde er zur Arbeit, und dann gäben sie ihn auf.
Der Junge dachte eine Weile über die große Veränderung nach, die sich in seinem weltlichen Besitz ereignet hatte, und machte sich dann zur Berichterstattung auf ins Hauptquartier.
3. Kapitel
Tom machte Meldung bei Tante Polly, die am offenen Fenster einer gemütlichen, nach hinten gelegenen Stube saß, die Schlafzimmer, Frühstückszimmer, Speisezimmer und Bibliothek in einem war. Die linde Sommerluft, die geruhsame Stille, der Duft der Blumen und das einschläfernde Summen der Bienen hatten ihre Wirkung getan, und sie war über ihrem Strickzeug eingenickt – denn ihre einzige Gesellschaft war die Katze, und die lag schlafend auf ihrem Schoß. Die Brille hatte sie sicherheitshalber auf ihren grauen Scheitel geschoben. Tante Polly hatte geglaubt, Tom sei natürlich längst desertiert; daher war sie erstaunt, als er sich jetzt derart furchtlos in ihre Gewalt begab.
Er sagte: »Kann ich jetzt nicht endlich spielen gehn, Tante?«
»Was, schon? Wieviel hast du denn geschafft?«
»Alles fertig, Tante.«
»Tom, lüg mich nicht an – das kann ich nicht vertragen.«
»Tu ich ja gar nicht, Tante; es ist wirklich alles fertig.«
Tante Polly setzte wenig Vertrauen in solche Aussagen. Sie ging hinaus, um selbst nachzusehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie auch nur zwanzig Prozent von Toms Behauptung bestätigt gefunden. Als sie den ganzen Zaun getüncht fand, und nicht nur einfach getüncht, sondern kunstvoll mit mehreren Anstrichen versehen und sogar die Erde mit einem Streifen verziert, da war ihr Erstaunen fast unbeschreiblich.
Sie sagte: »Nein, so was! Das muß man dir lassen, wenn du willst, kannst du arbeiten, Tom.« Dann verwässerte sie das Kompliment, indem sie hinzusetzte: »Aber du willst nur ganz selten, muß ich sagen. Na, lauf schon und spiel, aber sieh zu, daß du nicht erst nächste Woche wiederkommst, sonst gerb ich dir das Fell.«
So überwältigt war sie vom Glanz seiner Leistung, daß sie ihn mit in die Speisekammer nahm, dort einen prächtigen Apfel aussuchte und ihm diesen überreichte, wobei sie ihm einen erbaulichen Vortrag darüber hielt, wie sehr es den Wert und Genuß einer Gabe steigert, wenn man sie ohne Sünde, nur durch tugendhaftes Streben erworben hat.
Und während sie mit einem schmückenden Bibelzitat schloß, ließ er einen Pfannkuchen mitgehen.
Dann schlüpfte er hinaus und sah, wie Sid eben die Außentreppe hinaufstieg, die zu den hinteren Räumen des oberen Stocks führte. Erdklumpen lagen genug herum, und im Nu war die Luft voll davon. Sie prasselten rings um Sid nieder wie ein Hagelsturm, und bevor Tante Polly ihre von Überraschung benommenen Sinne zusammenraffen und einen Ausfall zu Sids Rettung unternehmen konnte, hatten bereits sechs oder sieben Erdklumpen ihr Ziel getroffen, und Tom war über den Zaun und verschwunden. Zwar gab es eine Pforte, im allgemeinen hatte er es aber zu eilig, um sie zu benutzen. In seiner Seele herrschte Friede, nun, da mit Sid abgerechnet war, weil er die Aufmerksamkeit auf den schwarzen Zwirn gelenkt und ihn in eine Klemme gebracht hatte.
Tom lief um den Häuserblock und gelangte auf einen schmutzigen Weg, der hinter dem Kuhstall seiner Tante vorbeiführte. Bald war er sicher vor Gefangenschaft und Strafe, und er eilte zum Platz in der Dorfmitte, wo sich einer Verabredung gemäß zwei »militärische Formationen« der Jungen getroffen hatten, um sich eine Schlacht zu liefern. Tom war General der einen Armee, Joe Harper, ein Busenfreund von ihm, General der anderen. Diese beiden großen Heerführer ließen sich nicht etwa herab, persönlich am Kampf teilzunehmen – das kam vielmehr dem unbedeutenderen Fußvolk zu –, sondern sie saßen zusammen auf einer Bodenerhebung und leiteten die Operationen auf dem Schlachtfeld durch Befehle, die von Adjutanten überbracht wurden. Nach langem harten Kampf errang Toms Armee einen großen Sieg. Dann wurden die Toten gezählt, die Gefangenen ausgetauscht, man einigte sich über die Bedingungen der nächsten Uneinigkeit, und der Tag für die notwendige Schlacht wurde festgesetzt; danach formierten sich die Armeen und marschierten davon, und Tom wandte sich allein heimwärts.
Als er an dem Haus vorbeikam, in dem Jeff Thatcher wohnte, sah er im Garten ein fremdes Mädchen stehen – ein reizendes kleines blauäugiges Geschöpf mit blondem Haar, das zu zwei langen Zöpfen geflochten war, in einer weißen Sommerbluse und bestickter Rüschenhose. Der mit frischem Ruhm bekränzte Held fiel, ohne einen Schuß abgefeuert zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence schwand aus seinem Herzen und ließ nicht einmal eine Erinnerung darin zurück. Er hatte geglaubt, er liebe sie bis zur Raserei, er hatte seine Leidenschaft für Anbetung gehalten, aber siehe da, es war nichts weiter als eine armselige, flüchtige kleine Zuneigung gewesen. Monate hatte er damit verbracht, das Mädchen zu gewinnen; kaum eine Woche war es her, seit sie ihm ihre Liebe gestanden hatte; vor sieben kurzen Tagen war er der glücklichste und stolzeste Junge der Welt gewesen, und nun war sie in einem einzigen Augenblick aus seinem Herzen geschwunden wie eine zufällig vorbeigekommene Fremde, deren Besuch beendet ist.
Verstohlen betete er diesen neuen Engel an, bis er sah, daß sie ihn entdeckt hatte; dann tat er, als wisse er nichts von ihrer Anwesenheit, und begann, auf alle mögliche verdrehte, jungenhafte Weise anzugeben, um ihre Bewunderung zu erringen. Ein Weilchen trieb er seine Possen, dann aber, mitten in einer gefährlichen gymnastischen Übung, schielte er zur Seite und sah, daß die Kleine zum Haus ging.
Tom trat an den Zaun und lehnte sich darauf, bekümmert und voller Hoffnung, sie werde noch ein Weilchen bleiben. Auf der Treppe stand sie einen Moment, ging dann zur Tür. Als sie den Fuß auf die Schwelle setzte, stieß Tom einen schweren Seufzer aus. Aber sogleich erhellte sich sein Gesicht, denn in dem Augenblick, bevor sie verschwand, warf sie ein Stiefmütterchen über den Zaun.
Der Junge rannte zu der Blume und blieb einen oder zwei Schritt vor ihr stehen, beschattete die Augen mit der Hand und blickte die Straße hinunter, als habe er dort etwas Interessantes entdeckt. Dann hob er einen Strohhalm auf und versuchte, ihn mit weit zurückgeworfenem Kopf auf der Nase zu balancieren, und während er sich dabei hin und her bewegte, rückte er dem Stiefmütterchen immer näher; schließlich ruhte sein nackter Fuß darauf, seine biegsamen Zehen schlossen sich darum, er hüpfte mit dem Schatz davon und verschwand um die Ecke. Dort blieb er aber nur eine Minute lang, nur bis er die Blume in seiner Jacke über dem Herzen geborgen hatte – vielleicht aber auch über dem Magen, denn er war in Anatomie nicht allzu bewandert und auf jeden Fall nicht übermäßig kritisch.
Dann kehrte Tom zurück und trieb sich, bis es Abend wurde, in der Nähe des Zaunes herum; er gab an, wie zuvor, das Mädchen ließ sich jedoch nicht mehr blicken, wenn Tom sich auch ein wenig mit der Hoffnung tröstete, daß sie inzwischen an ein Fenster gekommen sein und seine Aufmerksamkeiten bemerkt haben könnte. Schließlich ging er widerstrebend heim, den armen Kopf voll Visionen.
Während des ganzen Abendessens war er so guter Dinge, daß sich seine Tante verwundert fragte, »was wohl in den Jungen gefahren« sei. Er erhielt tüchtig Schelte, weil er Sid mit Erdklumpen beworfen hatte, und es schien ihm nicht das mindeste auszumachen. Er versuchte, direkt vor der Nase der Tante ein Stück Zucker zu stibitzen, und bekam dafür eins auf die Finger. Da sagte er: »Tante, Sid haust du nicht, wenn er eins nimmt.«
»Na, der quält einen auch nicht so wie du. Wenn ich nicht auf dich aufpaßte, würdst du immer an den Zucker gehen.«
Kurz darauf ging sie in die Küche, und im Vollgefühl seiner Straffreiheit langte Sid nach der Zuckerdose, mit einem Ausdruck des Triumphierens über Tom, der fast unerträglich war. Aber Sids Finger glitten ab, die Zuckerdose fiel zu Boden und zerbrach. Tom war von Wonne berauscht. So sehr berauscht, daß er sogar seine Zunge im Zaum hielt und schwieg. Er beschloß, kein Wort zu sagen, nicht mal, wenn seine Tante hereinkäme, sondern mucksmäuschenstill dazusitzen, bis sie fragte, wer das angerichtet habe, und dann wollte er es sagen, und nichts in der Welt würde herrlicher sein, als zusehen zu können, wie dieser Musterknabe es kriegte. Er war so voller Frohlocken, daß er kaum an sich halten konnte, als die alte Dame zurückkam, vor den Scherben stand und über ihre Brille hinweg Blitze des Zorns schleuderte. Er sagte sich: »Jetzt kommt’s!« Und im nächsten Augenblick lag er auf dem Boden! Schon hatte sich die kräftige Handfläche zu neuem Schlag erhoben, da rief Tom:
»Halt, warum haust du mich? Sid hat sie doch kaputtgemacht!«
Tante Polly hielt verdutzt inne, und Tom erwartete linderndes Mitleid. Als sie die Sprache wiederfand, sagte sie jedoch nur:
»Umph. Also, bestimmt hast du nicht umsonst Prügel gekriegt. Du hast sicher irgendwelchen anderen frechen Unfug angestellt, als ich nicht da war.«
Dann setzte ihr das Gewissen zu, und es drängte sie, irgend etwas Freundliches, Liebevolles zu sagen; sie fand jedoch, es werde als Eingeständnis ausgelegt werden, daß sie im Unrecht war, und die Disziplin ließ dies nicht zu. Also schwieg sie und ging bekümmerten Herzens ihrer Beschäftigung nach. Tom schmollte in einer Ecke und steigerte sich in seinen Schmerz hinein. Er wußte, daß seine Tante im Herzen vor ihm auf den Knien lag, und dieses Bewußtsein gab ihm eine finstere Befriedigung. Er würde keine Signalflaggen setzen und keine beachten. Er wußte, daß hin und wieder durch einen Tränenschleier ein sehnsuchtsvoller Blick auf ihn fiel, aber er weigerte sich, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Er malte sich aus, daß er todkrank daliege, während seine Tante sich über ihn beuge und ihn um ein einziges kleines Wort der Vergebung anflehe, er aber das Gesicht zur Wand wende und sterbe, ohne das Wort gesagt zu haben. Ha, was würde sie dann empfinden? Und er malte sich aus, daß man ihn vom Fluß heimbrächte, tot, mit nassen Locken, das wunde Herz zur Ruhe gekommen. Wie würde sie sich dann über ihn werfen; wie Regen würden ihre Tränen fließen, und ihre Lippen würden zu Gott beten, er möge ihr den Jungen zurückgeben, sie wolle ihn auch nie, nie mehr mißhandeln. Er aber läge kalt und bleich da und gäbe kein Zeichen mehr von sich – ein armer kleiner Dulder, der ausgelitten hätte. Mit diesen tragischen Vorstellungen steigerte er seine Gefühle dermaßen, daß er immerzu schlucken mußte, so sehr war ihm, als ersticke er; vor seinen Augen verschwamm alles hinter einem wäßrigen Schleier, der, als er zwinkerte, überlief, hinunterrann und ihm von der Nasenspitze tropfte. Er schwelgte derart in seinem gehegten Kummer, daß er nicht ertragen konnte, sich durch irgendwelche weltliche Fröhlichkeit oder irgendein schrilles Vergnügen darin stören zu lassen; sein Schmerz war ihm zu heilig für eine solche Berührung, und als kurz darauf seine Kusine Mary hereingetanzt kam, übersprudelnd vor Freude, wieder daheim zu sein, nachdem sie zu einem ewig langen Besuch eine Woche auf dem Lande gewesen war, stand er auf und begab sich, in Wolken und Finsternis gehüllt, zur einen Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte.
Er wanderte weit fort von den Plätzen, an denen sich die Jungen gewöhnlich herumtrieben, und suchte trostlose Orte, die mit seiner Stimmung in Einklang standen. Ein im Fluß schwimmendes Floß lud ihn ein; er hockte sich auf das äußerste Ende und blickte über die trübsinnige Weite des Stromes; dabei wünschte er sich nur, ertrinken zu können, im Nu, ohne es zu merken und ohne erst die unangenehme Prozedur durchzumachen, welche die Natur dafür ersonnen hat. Dann fiel ihm seine Blume ein. Er zog sie hervor; sie war zerknittert und verwelkt, und ihr Anblick verstärkte machtvoll seine düstere Seligkeit. Er fragte sich, ob sie wohl Mitleid mit ihm hätte, wenn sie wüßte? Ob sie dann wohl weinen und wünschen würde, sie dürfe ihm die Arme um den Hals legen und ihn trösten? Oder würde sie sich kalt abwenden wie die übrige schnöde Welt? Diese Vorstellung brachte ihm ein solches Übermaß wonnevollen Leidens, daß er sich das Bild in Gedanken immer wieder ausmalte und in neuem, immer verschiedenem Licht erscheinen ließ, bis es seinen Reiz einbüßte. Schließlich erhob er sich seufzend und ging ins Dunkel.
Gegen halb zehn oder zehn Uhr kam er durch die einsame Straße, in der die angebetete Unbekannte wohnte; er blieb einen Augenblick stehen; kein Laut traf sein lauschendes Ohr; eine Kerze warf ihren matten Schein auf den Vorhang eines Fensters im zweiten Stock. War dort die geheiligte Person? Er kletterte über den Zaun und wand sich verstohlen durch die Pflanzen, bis er unter jenem Fenster stand; er blickte lange und bewegt hinauf; dann legte er sich darunter auf den Boden, streckte sich auf dem Rücken aus und hielt über der Brust in den gefalteten Händen seine arme, verwelkte Blume. So wollte er sterben – draußen in der kalten Welt, ohne Dach über dem heimatlosen Haupt, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirn wischen, ohne ein liebevolles Gesicht, das sich mitleidsvoll über ihn beugen würde, wenn der große Todeskampf begönne. So sollte sie ihn erblicken, wenn sie hinaussah in den heiteren Morgen, und ach, würde sie wohl eine Träne auf seine arme, leblose Gestalt fallen lassen, nur einen einzigen kleinen Seufzer ausstoßen, wenn sie ein strahlendes junges Leben so jäh erloschen, so unzeitig dahingemäht sähe?
Das Fenster öffnete sich; die mißtönende Stimme eines Hausmädchens entweihte die heilige Stille, und ein Wasserguß durchtränkte die sterblichen Überreste des dahingestreckten Märtyrers!
Mit einem erleichternden Prusten sprang der dem Ersticken nahe Held auf. In der Luft war ein Sausen wie von einem Geschoß, vermischt mit dem Murmeln eines Fluchs, es folgte ein Laut wie von knirschendem Glas, und eine kleine, undeutlich sichtbare Gestalt schwang sich über den Zaun und schoß im Dunkeln davon.
Als Tom kurz darauf, bereits zum Schlafen ausgekleidet, beim Schein eines Talglichts seine durchnäßten Sachen besichtigte, erwachte Sid; falls er aber die Absicht gehabt hatte, auch nur die geringste Anspielung zu machen, so überlegte er es sich und hielt Frieden, denn aus Toms Augen blitzte Gefahr.
Tom legte sich hin, ohne sich noch der zusätzlichen Plage eines Gebets zu unterziehen, und Sid notierte im Geiste diese Unterlassungssünde.
4. Kapitel
Die Sonne ging auf über einer stillen Welt und strahlte wie ein Segen auf das friedliche kleine Dorf herab. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly die Familienandacht ab; diese begann mit einem Gebet, das von Grund auf aus soliden Schichten von Bibelzitaten gebaut war, die von einem dünnen Mörtel eigener Einfälle zusammengehalten wurden, und von der Höhe dieses Gebäudes, wie vom Berge Sinai herab, verkündete sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes.
Danach gürtete Tom gewissermaßen seine Lenden und machte sich an die Arbeit, um »seine Verse zu bewältigen«. Sid hatte seine Lektion bereits vor Tagen gelernt. Tom verwandte seine ganze Energie darauf, sich fünf Bibelverse einzuprägen, und er wählte sie aus der Bergpredigt, weil er keine kürzeren finden konnte. Nach einer halben Stunde hatte er eine unbestimmte Vorstellung von seiner Lektion, mehr aber nicht, denn sein Geist durchschweifte alle Bereiche menschlichen Denkens, und seine Hände waren mit ablenkenden, unterhaltsamen Dingen beschäftigt. Mary nahm sein Buch, um ihn abzufragen, und er versuchte, seinen Weg durch den Nebel zu finden.
»Selig sind, die da . . . äh . . . äh«
»Geistlich . . .«
»Ach ja, geistlich; selig sind, die da geistlich . . . äh . . . äh«
»Arm . . .«
»Arm . . . Selig sind, die da geistlich arm sind, denn, denn . . . . .«
»Das Himmelreich . . .«
»Das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie . . . sie . . .«
»S . . .«
»Denn sie . . . äh . . .«
»So . . .«
»Denn sie so . . . Ach, ich weiß nicht, wie es heißt!«
»Sollen!«
»Ach ja, sollen! Denn sie sollen . . . denn sie sollen . . . äh . . . äh . . . sollen Leid tragen . . . äh . . . äh . . . selig sind, die da . . . die . . . äh . . . die da Leid tragen, denn sie sollen . . . äh . . . was sollen sie? Warum sagst du’s mir nicht, Mary? Warum bist du so gemein?«
»Aber Tom, du armer Dummkopf, ich will dich doch nicht ärgern. Das würd ich nie tun. Du mußt dich hinsetzen und es noch mal lernen. Verlier nicht den Mut, Tom, du schaffst das schon – und wenn du’s geschafft hast, dann geb ich dir was ganz Feines. Also los, sei ein guter Junge.«