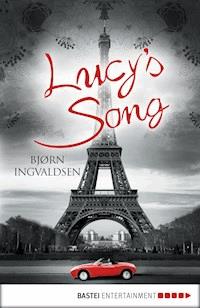9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hoch geht's her im Norden, vor allem, wenn Frauen knapp sindWie kann man heirats- und arbeitswillige Frauen auf die kleine norwegische Insel Hogna locken, damit der Junggesellenclub endlich seine Existenzberechtigung verliert? Klar, mit einem Junggesellenfestival, auf dem Robbie Williams als Zugpferd auftreten soll. Der Megastar sagt tatsächlich zu, die Vorbereitungen laufen an, denn neben anderen Kleinigkeiten verlangt Robbie nach einem Bentley. Leider ist das Geld knapp, doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der führt über explodierende Spielautomaten, verdorbenen Rakefisch, eine vergiftete finnische Rockgruppe und andere lästige Leichen mehr oder weniger direkt auf einen Kartoffelacker, auf dem der beglückende Event stattfinden soll.Ein Bombardement von irrwitzigen Ideen, ein Füllhorn von Absurditäten und eine hemmungslose Komik – dieses Buch wird Sie vor Lachen zum Japsen bringen.Rasant, witzig, absurd, mit Überraschungen bis zur allerletzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Bjørn Ingvaldsen
Tote Finnen essen keinen Fisch
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bjørn Ingvaldsen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bjørn Ingvaldsen
Björn Ingvaldsen wurde 1962 in Odda/Norwegengeboren. Er war einige Jahre Journalist und arbeiteteam Museum für Archäologie in Stavanger. Er hat bishervor allem Kinderbücher verfasst, von denen zweiauf Deutsch erschienen sind.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Hoch geht’s her im Norden, vor allem, wenn Frauen knapp sind
Wie kann man heirats- und arbeitswillige Frauen auf die kleine norwegische Insel Hogna locken, damit der Junggesellenclub endlich seine Existenzberechtigung verliert? Klar, mit einem Junggesellenfestival, auf dem Robbie Williams als Zugpferd auftreten soll. Der Megastar sagt tatsächlich zu, die Vorbereitungen laufen an, denn neben anderen Kleinigkeiten verlangt Robbie nach einem Bentley. Leider ist das Geld knapp, doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der führt über explodierende Spielautomaten, verdorbenen Rakefisch, eine vergiftete finnische Rockgruppe und andere lästige Leichen mehr oder weniger direkt auf einen Kartoffelacker, auf dem der beglückende Event stattfinden soll.
Ein Bombardement von irrwitzigen Ideen, ein Füllhorn von Absurditäten und eine hemmungslose Komik – dieses Buch wird Sie vor Lachen zum Japsen bringen.
Rasant, witzig, absurd, mit Überraschungen bis zur allerletzten Seite.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Ungkarsfestivalen
Copyright © by Wigestrand Forlag, Stavanger 2007
All rights reserved
Aus dem Norwegischen von Christel Hildebrandt
© 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © patrimonio designs – www.fotolia.com; piumadaquila – www.fotolia.com; RoHe – www.fotolia.com; Loic Le Brusq – www.fotolia.com
ISBN978-3-462-30452-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Zur Erinnerung an Kolbjørn
Es war meine Mutter, von der ich lernte, das Meer zu lieben. Für sie gab es nichts Schöneres, als die Klippen entlangzulaufen oder auf einem Felsen zu sitzen und auf die offene See zu starren, Wasser soweit das Auge reichte. »Wir stammen aus einer Seefahrerfamilie«, sagte sie immer, »einer Seefahrerfamilie, in der die Frauen es gewohnt waren, in die Ferne zu schauen und an die zu denken, die sich irgendwo dort hinter dem Horizont befanden.«
Wir haben oft Spaziergänge gemacht und auf die Wellen geschaut, sie und ich. Mein erster Gedanke war, dass ich sie hierher einladen musste.
Ich stand am Bug des Schiffs und blickte meiner neuen Welt entgegen. All die kleinen Inseln. Hier sollte ich also wohnen. Ein Stück Land, das gerade eben aus den Wellen hervorlugte. Der Leuchtturm stand auf dem höchsten Punkt, ein Hügelchen, kaum mehr als zwanzig Meter über dem Wasser. Eigentlich war es merkwürdig, dass sich überhaupt jemand so weit draußen im Meer angesiedelt hatte, auf dieser kargen Inselgruppe. Vielleicht war es aber doch nicht so merkwürdig, schließlich besteht die gesamte Küste aus solchen Ortschaften. Seltsam war doch eher, dass die Leute immer noch hier wohnten und nicht schon vor langer Zeit weggezogen waren. Dass nicht alles verlassen war.
Auf einer Landzunge unterhalb des Leuchtturms entdeckte ich eine Gestalt. Zunächst konnte ich nicht viel erkennen, aber als das Schiff näher heranfuhr, sah ich, dass es sich um eine Frau handelte. Sie schaute mit festem Blick auf den Horizont, ganz wie meine Mutter. Vielleicht war es ja auch die Fähre vom Festland, auf der ich mich befand, der sie entgegensah. Ihr langes Haar flatterte im Wind. Wie ein Sturmvogel, dachte ich. Plötzlich warf sie sich in die Wellen. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich die Besatzung alarmieren sollte, doch dann tauchte sie einige Meter weiter wieder auf. Sie entdeckte mich an der Reling, sah, dass ich sie beobachtete, und winkte mir zu.
Hartvigsen erwartete mich am Kai in Hognavåg. »Dann bist du also nicht ganz freiwillig hier«, sagte er.
»Hat es sich schon herumgesprochen?«, fragte ich.
»Nein, und das soll es auch nicht. Die Wohnung ist geputzt und bezugsfertig. Das hat die Frau für mich gemacht, die auch in der Bank putzt. Die meisten Möbel gehören dem Hausbesitzer, ein paar Stühle mir. Aber die kannst du ruhig behalten, ich will sie nicht mehr haben. Außerdem bleibst du ja nicht lange.«
»Ein halbes Jahr«, sagte ich. »Die Leitung hat beschlossen, dass die Filiale vor dem ersten Oktober geschlossen werden soll. Und ich habe nicht vor, auch nur einen Tag länger zu bleiben.«
»Sei nicht so negativ«, sagte Hartvigsen. »Wenn das Wetter gut ist, kann es hier draußen richtig nett sein. Und die meisten Einwohner sind ganz in Ordnung. Vielleicht ein bisschen einfach gestrickt, einige jedenfalls. Aber es wohnen trotz allem eine ganze Menge Leute hier. Auch wenn man sich oft fragt, wo eigentlich. Es ist eine spannende Gegend, geografisch. Mit ein bisschen gutem Willen und wenn man ein paar Felsen dazuzählt, kommt man auf gut 365 Inseln, die zur Gemeinde gehören. Es war mein Hobby hier, so viele wie möglich davon zu besuchen.«
Ich schaute mich auf dem Kai um. Ein paar Lagerhäuser mit eigenem Anleger davor schienen leer zu stehen. An der Straße, die vom Kai wegführte, konnte ich Gebäude erkennen, die aussahen, als wären die Läden darin schon vor Jahren geschlossen worden. Ein Schild an der Fassade eines Lebensmittelladens deutete darauf hin, dass das Postamt als »Postshop im Supermarkt« eingezogen war. Zwei rostige Fischerboote waren nicht weit vom Fähranleger entfernt an einer Boje vertäut. Ich sehnte mich schon jetzt zurück in die Stadt.
»Dann wünsche ich dir viel Glück«, sagte Hartvigsen und gab mir ein Schlüsselbund. »Was du sonst noch wissen musst, steht alles in einem Brief auf meinem … äh, auf deinem Schreibtisch. Ich habe dir alles Wichtige für die ersten Tage aufgeschrieben. Für alle Fälle.«
Ich winkte hinter ihm her, als er an Bord der »Hogna« verschwand, der Fähre, die den Namen der Inselgemeinde trug, in der ich wohnen sollte.
Zwölf Jahre lang hatte ich in der Bank auf eine Beförderung hingearbeitet. Als einer der Abteilungsleiter zum Jahreswechsel in Pension ging, rechneten alle damit, dass ich den Posten bekam. Ich auch. Doch dann hatte mich der Bankdirektor mit seiner Frau im Bett erwischt. Da war es leider Essig mit der Beförderung. Und als sie kurz darauf ans andere Ende des Landes zog und die ganze Bank von der bevorstehenden Scheidung wusste, musste ich mir eingestehen, dass meine Tage in der Bank gezählt waren. Da mein Chef mich natürlich nicht mit so einer Begründung rausschmeißen konnte, musste er dafür sorgen, dass ich aus freien Stücken kündigte. Er konnte mir also entweder so langweilige Aufgaben geben, dass ich nicht mehr bleiben wollte, oder er ließ mich die schlimmste Dreckarbeit erledigen. Der Bankdirektor entschied sich für Letzteres. Er veranlasste meine Versetzung hierher. Dazu gehörte die Spezialaufgabe, die Filiale abzuwickeln. Der Auftrag war geheim: Man wollte so lange wie möglich damit warten, diesen Beschluss bekannt zu geben, wahrscheinlich fürchtete man sich davor, dass die Aktionäre auf Hogna ihren Anteil verkaufen würden, wenn das herauskäme. Und wenn alle verkauften, dann konnte das schnell eine Kettenreaktion bei den anderen Aktionären an ähnlich kleinen Standpunkten nach sich ziehen. Was dem Ruf einer Bank schaden würde, die gut hundert Jahre dazu gebraucht hatte, sich als die Bank dieser Region zu positionieren. Dabei war der Ruf momentan ganz besonders wichtig: Sie wurde nämlich gerade von einem großen Bankkonzern geschluckt. Wenn sie erst einmal Teil der großen Bank war, konnte der Ruf so sein, wie er wollte, der Konzern war zu groß, um sich um solche Kinkerlitzchen zu kümmern. Deshalb war es mein Job, dafür zu sorgen, dass alle mit der Filiale vor Ort zufrieden waren, bis die Neuigkeit der Fusion in einer Pressekonferenz veröffentlicht wurde. Dann konnte man behutsam andeuten, dass es notwendig war, den Betrieb ein wenig zu rationalisieren. Abgesehen von der Lokalzeitung würde niemand von der Schließung einer Filiale hier draußen im Meer berichten.
Als ich das Angebot annahm, freute ich mich, für ein paar Monate von der Zentrale wegzukommen. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass der Bankdirektor mich gelinkt hatte. Denn wenn die Bank verkündete, dass die Filiale auf Hogna geschlossen werden sollte, dann war ich ja als einziger Mensch dort angestellt. Und wenn mein Arbeitsplatz wegrationalisiert wurde, konnte mir gekündigt werden. Ich konnte zwar fordern, bei der Vergabe freier Stellen bevorzugt zu werden, aber die würde es nach der Fusion nicht geben. Ich musste also die Zeit hier draußen im Inselreich dazu nutzen, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Vielleicht war die Zeit reif, etwas Neues anzufangen.
Die Bank lag ungefähr in der Mitte der einzigen Straße des sogenannten Zentrums von Hogna. Ich blieb auf der anderen Straßenseite stehen und musterte das Gebäude. Die Bankfiliale lag im Erdgeschoss, während das, was für das kommende halbe Jahr mein Zuhause werden sollte, sich im ersten Stock befand. Wie alle Zweigstellen hatte man auch diese Filiale optisch angepasst. Gleichwohl sah sie ein wenig zusammengezimmert aus. Trotz des Logos, das vor ein paar Jahren eingeführt worden war, und der Plakate mit der Aufforderung, das Geld in unsere spannenden Aktienfonds zu investieren, lag ein Hauch von den Sechzigern über dem Ort. Ich wartete fast darauf, auf ein kleines Mädchen mit langen geflochtenen Zöpfen zu stoßen, das mit dem Sparschwein unter dem Arm eintrat.
Der Eingang zur Wohnung befand sich auf der Rückseite des Hauses. Ich schloss auf und fand die vier Pappkartons, die mein vorläufiges Umzugsgepäck ausmachten, unten im Treppenhaus. Hartvigsen hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie hochzutragen.
Nachdem ich mir die Wohnung angeschaut hatte, trug ich die Kartons nach oben. Sie enthielten in erster Linie Kleidung und andere Dinge für den Hausgebrauch, die ich vorausgeschickt hatte. Ich würde ja meine Wohnung in der Stadt behalten, während ich hier wohnte, sie würde zur Ferienwohnung werden und sicher zum notwendigen Refugium, um sich am Wochenende zu erholen, wenn ich das Gefühl hatte, dass das Dorfleben mir zu sehr auf die Pelle rückte. Vom Wohnzimmerfenster aus schaute ich direkt auf eine Hauswand. Nach dem Fensterschmuck zu urteilen, handelte es sich um ein Altersheim. Mit anderen Worten: Die Aussicht verhieß nicht gerade beste Unterhaltung. Ich dachte kurz nach. In der Stadt besitze ich eine Wohnung mit großer Veranda und Blick auf den Fjord, mit Whirlpool und einem Extrakühlschrank für Wein. Diese Räume hier, mit ihrer Hintertreppe in den Kassenraum, konnte man höchstens als »Unterkunft« bezeichnen. Ja, genau, wenn man etwas als Unterkunft definieren wollte, dann musste es sich um so etwas wie das hier handeln. Ich stopfte meine Kleider in die Schränke und Schubladen des kleinen Schlafzimmers, bezog das Bett, das Hartvigsen bis vor Kurzem benutzt hatte, warf Handtücher ins Bad und setzte mich in den Sessel vor den Fernseher. Es war Freitagabend, und ich hatte nicht daran gedacht, etwas fürs Wochenende einzukaufen. Tveits Kolonialwarenladen ein Stück die Straße hinunter schloss in der Woche um 17 Uhr und am Samstag um 13 Uhr. Nach einer Tankstelle oder einem Kiosk mit heißen Würstchen und Hamburgern brauchte ich gar nicht erst zu suchen. Wenn Hartvigsen nicht ein Paket Knäckebrot im Küchenschrank zurückgelassen hatte, würde das ein magerer Abend werden. Hätte ich doch wenigstens ein paar Weinflaschen mitgenommen …
Es vergingen einige Sekunden, bevor mir klar wurde, woher das Geräusch kam. Ich glaube, das Pfeifen der hellgrauen Telefonapparate habe ich seit den Achtzigern nicht mehr gehört. Das Telefon stand auf einem Regal hinter der Tür.
»Die Bank hier, guten Abend«, war das Beste, was mir einfiel.
Sie stellte sich als Nancy Nordbø vor. Ich wusste, ich hatte den Namen schon einmal gehört, konnte ihn aber nicht gleich einordnen, bis sie sagte: »Ich bin die Bürgermeisterin dieser Gemeinde.«
Nancy lud mich zu sich nach Hause ein.
»Es ist sicherlich nicht besonders gemütlich, an so einem Abend allein zu Hause zu sitzen. Am ersten Abend an einem neuen Ort und nichts zu tun? Hast du keine Lust, bei mir vorbeizuschauen? Ich bin allein mit den Kindern, Eddi ist auf der Nordsee, und das Lammen hat angefangen.«
Dankend nahm ich an. Ich hatte bereits herausgefunden, dass auf dem kleinen Fernsehapparat nur die beiden öffentlichen Kanäle liefen, sonst nichts. Ein Besuch bei der Bürgermeisterin würde Zerstreuung und vielleicht auch etwas zu essen bedeuten.
Ich musste ein paar Kilometer laufen, aber bei so wenigen Straßen war es leicht zu finden. Ich klopfte an die Tür, und ein verwuschelter Jungenkopf schaute heraus und verkündete, dass Mama im Schafstall war. Glücklicherweise tauchte Nancy im gleichen Moment auf, sodass ich keine gebärenden Schafe betrachten musste.
»Das war das Letzte für heute Abend«, verkündete sie, »jetzt werden bis morgen früh keine mehr kommen.«
Ich hätte sicher fragen sollen, woher sie das so genau wissen konnte, ließ es aber bleiben. Es gibt Menschen, die wissen wollen, wie Rindviecher sich fortpflanzen. Und es gibt Menschen, die nicht sonderlich daran interessiert sind. Ich gehöre zu Letzteren.
Nancy Nordbø, die Bäuerin von Nedre Nordbø, war eine muntere Frau Ende dreißig. Sie begrüßte mich herzlich, bevor sie mich in die Stube schob und selbst unter die Dusche ging. Ich guckte dort zusammen mit dem Hoferben Håvard Fernsehen. Er kannte alle Figuren eines Zeichentrickfilms, in dem sich gute und böse Kräfte in einer Galaxie weit draußen im Sternennebel bekämpften. Laut diesem Zeichentrickfilm würde die Menschheit alleine mithilfe von Laserpistolen und Schwert überleben.
»Ich hoffe, du bist hungrig«, rief Nancy von der Küche her, »denn ich habe großen Hunger, wir haben seit heute Mittag nichts mehr gegessen.«
Ich schaute auf die Kaminuhr im Wohnzimmer. Es war fast sieben Uhr. Zu dieser Tageszeit aß ich sonst auch immer. Was ich ihr gegenüber aber nicht erwähnte. Sie kam mit einer Platte belegter Brötchen herein.
»Du musst entschuldigen, dass die nicht selbst gebacken sind«, sagte sie, als sie die Platte hinstellte. »Bei all dem Lammen schaffe ich es einfach nicht.«
Noch ein Junge tauchte auf, mit ebenso zerzausten Haaren wie der erste. Wir aßen Brötchen und sahen zu, wie ständig neue Horden von Raumschiffen Laserbomben auf die Zivilisation des Planeten X29 fallen ließen. Einige Male nahm Nancy die Fernbedienung, um den Kanal zu wechseln, dann tauchten Bilder schlafender Schafe auf dem Schirm auf.
»Ist das ein Teil des Standardfernsehangebots hier in der Gemeinde?«, fragte ich.
»Nein, nein«, wehrte Nancy ab. »Eddi hat eine Kamera draußen im Schafsstall installiert, damit wir sehen können, ob mit dem Lammen alles klappt. So muss ich nicht alle halbe Stunde rübergehen, um nachzugucken.«
»Vielleicht sollte ich mir so einen Kanal auch besorgen. Dann hätte ich schon drei zur Auswahl.«
»Und was willst du überwachen? Das Leben im Altersheim?«
»Das schaffe ich vom Fenster aus«, erwiderte ich. »Vielleicht gibt es irgendwelche Schafe, die ich beobachten kann?«
»Ach, das ist nicht so spannend«, sagte sie und schickte die Jungs raus, damit sie sich den Rest des Zeichentrickfilms in ihrem Zimmer ansahen. »Aber es gibt sicher so einige Leute hier auf der Insel, die dir gern in die Karten gucken würden.«
»Mir? Das ist aber nicht besonders spannend.«
»Sag das nicht. Jeder Neuankömmling ist spannend. Und jemand mit deinem Ruf ist besonders interessant.«
»Was für einen Ruf habe ich denn?«
»Wir sind eine kleine Gemeinde. Und dein Vorgänger als Filialleiter war nicht gerade der Diskreteste, wenn du verstehst, was ich meine. Wir haben so einiges über dich gehört, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.«
»Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass das nicht besonders vorteilhaft für mich ist«, erwiderte ich.
»Kommt drauf an. Die Fantasie so manchen Kerls wurde wieder ordentlich auf Trab gebracht.«
»Dann wissen die Leute …?«
»Genau, es wissen ziemlich viele, warum du bei deinem Direktor in Ungnade gefallen und hier ans Ende der Welt versetzt worden bist. Aber nimm es nicht so schwer, die Menschen in einem solch winzigen Ort tratschen halt gern. Bis eine neue Kuh durchs Dorf getrieben wird. Und da du einen wichtigen Posten bei der Bank hast, wird sich niemand trauen, hinter deinem Rücken zu reden, aus Angst, du könntest davon etwas mitbekommen und eine Kontoüberziehung oder einen Kredit verwehren. Wird schon gut gehen. Man muss hier draußen geboren sein, um alle Mechanismen und Meinungsschwankungen zu kennen. Und um richtig dazuzugehören, musst du mindestens in der dritten Generation einen Hof besitzen. Davon kann ich ein Lied singen, denn ich bin selbst nur zugezogen.«
»Und trotzdem hast du es geschafft, Bürgermeisterin zu werden?«
»Nun ja, das war nicht besonders schwer. Wenn man eigene Ansichten hat und sich traut, bei den Zusammenkünften das Wort zu ergreifen, dann wird man schnell auf irgendeinen Posten gewählt. Einer wird Vorsitzender des Elternrats, ein anderer landet im Gemeinderat, der Dritte wird Geräteverwalter im Sportverein oder bekommt die Verantwortung für die Kuchenlotterie des Spielmannszugs der Schule. Jeder, der den Mund aufmacht, bekommt ein Amt.«
»Aber Bürgermeister«, sagte ich, »dafür muss man ja wohl Mitglied einer Partei sein und …«
»Nein, nein«, wehrte Nancy ab. »Parteien machen nur Politik. Die Leute, die hier leben, sind bodenständige Menschen, die so etwas nicht mögen. Politisches überlassen sie den Politikern in der Stadt. Hier haben wir Ortslisten. Die sind so unpolitisch, dass alle dafür stimmen können, ob sie nun gläubig sind oder Heiden. Nachdem ich beantragt hatte, am Nordbøveien Straßenbeleuchtung zu installieren und dass die Fähre am Samstagabend eine Fahrt zusätzlich macht, wurde ich gefragt, ob ich nicht auf der Liste ganz oben stehen wollte. Und zu so einer Ehre sagt man nicht Nein, zumindest nicht, wenn man zugezogen ist.«
»Ist es nicht schwer, das alles zu schaffen? Kinder, Haus, Tiere? Und dann auch noch die Politik?«
»Doch, natürlich ist es das. Manchmal muss ich andere um Hilfe bitten. Eddis Eltern wohnen in der Nähe, wenn ich in die Stadt zu Sitzungen muss, passt die Schwiegermutter auf die Kinder auf und der Schwiegervater auf die Schafe. Wenn man Bürgermeisterin ist, stellt man den Terminplan selbst auf. Und deshalb richten sich die Termine der Gemeindesitzungen größtenteils nach Eddis Schichtplan. Die Leute, die im Büro in Tananger sitzen und die Schichten auf der Ölplattform Valhall zusammenstellen, wissen garantiert nicht, dass sie gleichzeitig die Gemeindesitzungen an einem Ort weit draußen in Norwegen planen. Aber so ist es nun einmal.«
»Ist das viel Arbeit? Die Politik? Im Gemeinderat zu sitzen?«
»Viel mehr, als ich gedacht hatte, bevor ich gewählt wurde. Und obwohl ich vorher schon eine Wahlperiode lang als einfaches Mitglied dabei war, hatte ich keine Ahnung, wie viel Arbeit es bedeutet, Bürgermeisterin zu sein. Ich muss die Finger in allem haben, was hier draußen passiert. Es wird kaum eine Baugenehmigung für eine Garage erteilt, ohne dass irgendjemand beim Gemeinderat Einspruch erhebt. Und dann muss ich mich jedes Mal um die Sache kümmern.«
»Dann wird hier also gerne diskutiert?«
»O ja, in gewisser Weise schon. Aber nicht so, wie man in der Stadt diskutiert. Hier steht keiner auf und vertritt seine Meinung. Sondern es geht darum, möglichst raffiniert vorzugehen. Oft habe ich den Eindruck, dass es wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass die anderen ihre Wünsche nicht durchkriegen, als die eigenen durchzusetzen.«
»Das hört sich ziemlich anstrengend und nicht gerade sehr kreativ an.«
»Als ich anfing, habe ich das auch gedacht. Aber nach einer Weile habe ich eingesehen, dass das System funktioniert. Viele sinnlose Pläne treffen auf so viel Widerstand, dass sie gar nicht erst durchgeführt werden. Und die Projekte und Pläne, die überleben, sind so gründlich diskutiert und durchgetestet worden, dass sie sich in der Regel dann auch wirklich durchführen lassen. Du wirst sicher einige Anträge auf Kredite bekommen, die du nicht gern bewilligen wirst. Aber wenn in deiner Bank kein Geld zu holen ist und trotzdem Interesse am Projekt besteht, dann gibt es andere Möglichkeiten, die Sachen zu finanzieren.«
»Durch eine andere Bank?«
»Nein, das macht man selten. In der Regel sind es nur Zugezogene, die daran denken. Wenn was dran ist an einem Projekt, dann gibt es immer jemanden, der die Möglichkeit sieht, daran ein wenig Geld zu verdienen. Und dagegen haben die wenigsten etwas. Also wird eine Genossenschaft gegründet, die Geld in das Projekt steckt. Und wenn die Genossenschaft anfängt, Geld zu verdienen, dann wird sie wiederum Genossenschaftsmitglied in einem neuen Projekt. Die meisten, die hier wohnen, haben Genossenschaftsanteile an fast allem, was man sich vorstellen kann, ob direkt oder indirekt.«
»Dann ist die Bank ja überflüssig?«
»Ach, das will ich nicht sagen. Aber wir würden wohl auch ohne auskommen. Und bald müssen wir das ja ohnehin. Du bist doch hier, um die Filiale zu schließen, oder?«
»Woher weißt du das?«
»Das ist nicht so schwer zu erraten. Filialleiter hier zu sein, das wäre der Traum eines treuen Bankangestellten, der aufs Land ziehen, Schafe züchten, sich im Sportverein und in der Kirche engagieren wollte. Du bist das absolute Gegenteil. Und du willst doch nur für kürzere Zeit hierbleiben, oder?«
Ich nickte.
»Du hast recht. Aber erzähle das bitte keinem weiter. Wenn jemand bis jetzt noch nicht weiß, was da im Gange ist, dann braucht er es auch jetzt nicht zu erfahren. Das nützt weder der Bank noch der Gemeinde. Sonst kommen plötzlich alle auf die Idee, ihre Sparkonten auf andere Banken zu überführen. Unsere Bank ist bemüht, ihre Kunden als Kunden zu behalten, solange diese Filiale hier besteht.«
»Dann kommt hier ein Geldautomat hin?«, fragte Nancy.
»Wohl kaum«, antwortete ich. »Bei einem Geldautomaten muss ja jemand kommen und Geld nachfüllen. Und das kostet. Ich schätze, ihr werdet euch mit Onlinebanking und Geldabheben im Laden begnügen müssen. So läuft das im Bankwesen. Man möchte möglichst ohne Bargeld auskommen und den Kunden auch keins geben. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da haben wir gelernt, an der Kasse zu sitzen, heute soll man ein möglichst guter Portfolioverwalter sein.«
»Mein Portfolio ist mein Kredit bei der Landwirtschaftsbank«, erklärte Nancy.
»Das ist ein wertvolles Portfolio!«, nickte ich.
Nancy nahm die Fernbedienung und schaltete auf den Schafskanal.
»Na, da lammt doch noch eine«, sagte sie. »Ich habe heute Abend keins mehr erwartet. Dann muss ich mich wohl wieder in meinen Overall schmeißen und helfen.«
»Ich werde dann mal aufbrechen«, sagte ich.
»Ach was. Du kommst mit. Du hast bestimmt noch keinem Lamm auf die Welt geholfen. Oder einem anderen Lebewesen. Ich suche dir einen Overall, und dann kommst du mit. Wenn du in einem Schafsdorf wie diesem wohnen willst, dann musst du in der Lage sein, ein oder zwei Lämmer in Empfang zu nehmen.«
Und somit hatte ich keine andere Wahl, ich musste in einen Overall vom Konsum schlüpfen und in Anglerstiefel, die vier Nummern zu groß für mich waren. Eines der Schafe lag auf der Seite, als wir in den Schafstall kamen. Nancy scheuchte einige Schafschwestern in einen anderen Pferch und ließ sich neben der werdenden Mutter auf die Knie nieder.
»Sie ist ein bisschen eng. Es ist das erste Mal für sie.«
Das Schaf blökte und wusste wohl nicht so recht, was da hinten vor sich ging. Nancy schob einige Finger in die Öffnung, aus der das neue Lamm herauskommen sollte.
»Das wird schon klappen«, erklärte sie mir.
Das Mutterschaf zappelte mit allen vier Beinen und sah nicht so aus, als ob es auch dieser Meinung wäre. Eine Flüssigkeit lief aus ihm heraus, und das Ganze sah ziemlich eklig aus. Kurz darauf guckte ein strubbeliger Kopf aus dem Hinterende der Mutter hervor. Nancy packte den nassen, glitschigen Kopf am Nacken und half, das Lamm herauszuziehen. Mit einem leisen Plopp verließ das Junge die Gebärmutter seiner Mama. Nancy wischte das Gesicht des Lamms mit etwas Heu ab und vergewisserte sich, dass es atmete. Ein jämmerliches kleines Blöken verriet uns, dass in dem Kleinen Leben war und die Lunge funktionierte. Nancy legte das Lamm vor den Kopf der Mutter. Die schaute sowohl Nancy als auch das Lamm ein wenig verwundert an, bevor die richtigen Instinkte im Schafskopf klickten. Die Mutter fing an, den schleimigen Matsch abzulecken, der das Lamm immer noch umhüllte. Beide blökten ein wenig, als wollten sie einander begrüßen.
»Das war ja eine Vorstellung«, sagte ich, als Nancy sich aufrichtete. »Und was machen wir jetzt?«
»Jetzt warten wir auf das nächste Lamm«, antwortete sie. »In der Regel sind immer zwei Lämmer in einem Wurf. Und dieses Mutterschaf ist noch nicht fertig, das kann ich ihm ansehen. Da kommt bald noch ein Lamm.«
Das neugeborene Lamm versuchte bereits, auf die Beine zu kommen. Zuerst musste es die Hinterbeine unter sich ziehen, um dann zu versuchen, die Vorderbeine aufzustellen. Nach ein paar Versuchen richtete das Lämmchen sich auf.
»Mit dem sieht es schlechter aus«, sagte Nancy. Sie hatte die ganze Hand da reingesteckt, wo die Lämmer rauskommen.
»Es scheint festzustecken.«
»Soll ich den Tierarzt anrufen?«, fragte ich. Ich suchte schon in der Tasche nach dem Nokia.
»Ja, und bitte ihn, den Hubschrauber anzufordern«, antwortete sie.
»Ist das … ist das möglich?«
»Wenn du so spät einen Tierarzt haben willst, dann brauchst du ihn. Jetzt fährt keine Fähre mehr.«
»Das heißt, dass der Tierarzt vom Festland kommt?«
»Alles, was wir hier brauchen, kommt vom Festland. Wenn es einem meiner Jungs so dreckig ginge, dann könnten wir wohl einen Hubschrauber anfordern. Aber um Haustiere, die Probleme haben, kümmern wir uns selbst. Zumindest, wenn es etwas Akutes ist. Wenn wir den Pechvogel nicht retten können, dann steht dafür auf jedem Hof ein Gewehr. So sieht es aus. Aber ein Lamm, das sich in der Mutter verhakt hat, das haben wir immer noch rausgekriegt. Gib mir mal das Seil, das da hinten an der Wand hängt!«
Ich tat, worum sie mich gebeten hatte.
»So, und nun guck zu«, sagte sie kurz darauf. »Jetzt habe ich einen Fuß zu fassen gekriegt. Das heißt, ich kann das Seil um den Fuß binden und den Wurm rausziehen.«
»Und wie ergeht es dem Lamm dabei?«
»Das zeigt sich, wenn es draußen ist«, antwortete Nancy.
Es sah brutal aus, aber jedenfalls kam das Lamm heraus und schien in guter Verfassung zu sein. Nicht lange, dann stand auch das zweite Lämmchen auf zitternden Beinen und erhob Anspruch auf die Milch der Mutter.
»Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Nacht keine weiteren kommen. Und du siehst aus, als könntest du ein Glas Wein vertragen«, schmunzelte Nancy.
Womit sie sicher recht hatte. Am liebsten wären mir ein paar große Gläser Cognac gewesen. Aber wahrscheinlich hatte sie die nicht im Haus.
Etwas Aufregenderes als das würde ich bestimmt während meines gesamten Aufenthaltes auf Hogna nicht mehr erleben.
Nancy holte eine Flasche Rotwein hervor und stellte sie auf den Küchentisch. Ich nahm den Korkenzieher, den sie hingelegt hatte, während sie sich im Bad umzog. Als sie herauskam, trug sie einen Bademantel.
»Lass uns hier sitzen bleiben«, meinte sie und setzte sich an den Tisch. Ich goss uns beiden ein.
»Also«, sagte ich, »wenn die Fähre ihre letzte Tour abends gemacht hat, dann ist man hier draußen verraten und verkauft.«
»Das hört sich an wie eine Strafe.«
»Ja, aber … bevor es Hubschrauber gab, was hat man da gemacht?«
»Man ist halt gestorben«, antwortete sie. – »Nein, so schlimm war es nicht. Vergiss nicht, das ist eine Inselgemeinde. So gut wie jeder hier hat sein eigenes Boot. Und früher gab es auch einen Arzt, der auf der Insel gewohnt hat. Nicht, dass er viel hat helfen können, Klistier und Wollschal, das war meistens die gesamte Behandlung. Wenn es sich um etwas Ernstes handelte, dann hatten wir das Rettungsschiff, das Tag und Nacht bereitstand. Das gibt es immer noch, aber nicht mehr rund um die Uhr. Der Hubschrauber kümmert sich um die schlimmsten Krankheiten oder Unfälle. Und wenn etwas passiert und es nicht möglich ist, dass der Hubschrauber kommt, dann kriegt man immer einige Männer zusammen, die mit dem Boot aufs Festland fahren. Das ist alles.«
»Und wenn man auf dem Festland mal was unternehmen will? Ins Theater oder Kino gehen will?«
»Glaubst du, es gibt viele Theaterbesucher hier auf Hogna? Ein paar ältere Damen fahren ein paarmal im Jahr nach Stavanger oder Bergen, um sich eine Vorstellung anzuschauen. Zumindest, wenn Herborg Kråkevik mitspielt. Die nehmen die Fähre. Wenn du sonst was unternehmen willst, dann musst du selbst dafür sorgen, hin und zurück zu kommen. Jemanden überreden, dich in Nesset abzuholen.«
»Und damit sind alle zufrieden?«
»Zufrieden? Bist du verrückt? Hier draußen ist niemand zufrieden. Niemals. Alle jammern die ganze Zeit. Das ist es, was die Gemeinde zusammenhält. Aber wenn du wissen willst, ob an einer festen Verbindung zum Festland gearbeitet wird, ja, das wird es. Da kannst du dir sicher sein. Es gibt zwei Alternativen. Beide kosten ein Vermögen. Du wirst schon sehr bald in deiner Bank Besuch von einigen Herren bekommen, die möchten, dass du dich an der Finanzierung eines Planungsprojektes beteiligst.«
»Das hört sich ja spannend an«, sagte ich. »Wie sehen denn die Alternativen aus?«
»Die eine ist ein Tunnel unter dem Meer. Zuerst müsste man dafür zwischen Hogna und ein paar kleineren Inseln im Süden Land anschütten. Dann müsste eine Brücke nach Hognekalven gebaut werden und von dort der Tunnel unter dem Fjord nach Amnes und Kvitle.«
»Verstehe.«
»Die Alternative geht Richtung Norden. Eine Brücke von Brekstadhavn nach Mangøy, die Nachbargemeinde. Die haben bereits eine Festlandverbindung.«
»Und beide Projekte sind kostspielig?«
»Natürlich. Gut und gern jeweils eine Milliarde Kronen, so ungefähr. Wozu dann noch die unvorhergesehenen Kosten kommen.«
»Dann ist man schnell bei zwei Milliarden.«
»Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber beide Alternativen haben ihre Fürsprecher, was dazu führt, dass der Gemeinderat mehr oder weniger in zwei Hälften zerfällt. Die Sache ist nämlich die, dass es, auch wenn die Verbindung mit dem Festland an sich schon wichtig ist, noch viel entscheidender ist, wo man an Land kommt. Mangøy hat eine Verbindung mit Skålvik. Von dort sind es sechzig Kilometer Richtung Süden nach Amnes. Für diejenigen, die etwas in einer der beiden Städte zu erledigen haben, ist es schrecklich unpraktisch, wenn sie in der anderen Stadt ankommen, was hohe Kosten mit sich brächte. Die Hummerzüchter liefern nach Skålvik. Die weiterführenden Schulen liegen auf Amnes. Wenn die Schüler von Skålvik aus mit dem Bus fahren müssen, würde das furchtbar lange dauern. Wenn die Hummerzüchter über Amnes fahren müssen, vergeht der ganze Tag, bevor sie ihre Tiere abliefern können. Und das sind nur zwei Beispiele des Für und Widers. Ich könnte noch viele andere aufzählen.«
»Und das Ergebnis ist …?«, fragte ich.
»Das Ergebnis bis jetzt«, antwortete Nancy und schenkte Wein nach, »das Ergebnis bis jetzt ist, dass es für viele, viele Jahre zu überhaupt keiner Festlandsverbindung kommen wird. Und darauf lass uns anstoßen.«
»Darf ich das so interpretieren, dass du so eine Verbindung gar nicht haben willst?«
»Ganz genau. Ich möchte gern weiterhin das Meer zwischen uns und dem Rest der Welt behalten.«
»Um das Böse abzuhalten?«
»Nein, das kriegen wir hier auf den Inseln schon selbst ganz gut hin. Ich möchte den Zusammenschluss von Gemeinden möglichst lange vermeiden. Wenn wir eine feste Verbindung zu einer anderen Gemeinde bekommen, dann wird nicht viel Zeit vergehen, bis jemand auf die Idee kommt, die Gemeinden zusammenzulegen. Dann werden wir ein Teil einer Großgemeinde.«
»Was möglicherweise für dich das Gleiche ist wie das Böse an sich?«
»Ja, das stimmt. Ganz gleich, welcher Großgemeinde wir zugeschlagen werden, wir werden immer ein Randgebiet sein. Ein Randgebiet, zu dem man lange unterwegs ist. Zu lang für die Kommunalregierung. Und deshalb würden wir dann diejenigen sein, die zum neuen Gemeindezentrum fahren müssten, wenn wir nur eine Briefmarke kaufen wollten. Ich habe schon überlegt, eine dritte Alternative vorzuschlagen.«
»Damit der Streit sich noch ausweitet?«
»Auf jeden Fall gibt es dann noch mehr zu beraten und zu überprüfen.«
»Und was willst du mit Hogna verbinden?«
»Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Am liebsten einen kleineren Pupsort, mit dem wir uns zusammentun könnten, damit uns dann die gesamte Gemeindeverwaltung zufällt.«
Ich musste lachen.
»Den Plan unterstütze ich«, erklärte ich und hob das Glas. Nancy antwortete, indem sie anstieß.
»Natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, wie schön es wäre, eine sichere Verbindung zum Festland zu haben«, erklärte sie dann. »Es ist nicht witzig, wichtige Termine platzen lassen zu müssen, nur weil ein Unwetter es unmöglich macht, über den Fjord zu kommen. Wenn der Orkan sich am dritten Tag noch nicht gelegt hat, dann fangen wir schon mal an, uns isoliert zu fühlen. Wenn der Laden keine Waren mehr hat und wir eine Krisensitzung mit der Gefriertruhe halten müssen. Das ist schon klar.«
»Aber es ist eine schöne Bootsfahrt, die Fahrt über den Fjord.«
»Ja, schön ist sie, aber nur wenige können von dem Schönen leben. Touristen und Leute aus Oslo, die wissen so etwas zu schätzen, zumindest, wenn sie nicht abhängig davon sind. Aber Mütter, die ihre Kinder in die Schule schicken wollen, freuen sich weniger über Straßen mit Lawinengefahr und eingestellte Fährverbindungen.«
Eine Weile saßen wir nur schweigend da. Der Wein wärmte angenehm, langsam hatte ich das Bild von gebärenden Mutterschafen verdaut. Auf jeden Fall hatte dieser Abend mich eines gelehrt: Ich würde niemals Schafe züchten wollen. Aber wer weiß, vielleicht würde ich ja hier draußen mitten im Meer wohnen bleiben, wenn meine Zeit in der Bank vorüber war? Sehr wahrscheinlich erschien mir das zwar nicht, aber unverhofft kommt bekanntermaßen oft. Das ist es wohl, was das Leben ausmacht. Der eine Zufall jagt den anderen. Niemand weiß, was kommt. Banal, aber wahr. Als ich in die Oberstufe ging, war mir der Gedanke, in einer Bank zu arbeiten, ungefähr so fremd wie die Überlegung, zum Mond zu reisen. Während des Konfirmandenunterrichts fühlte ich mich auserwählt und beschloss, Medizin zu studieren und nach Afrika zu gehen, um den armen, Not leidenden Kindern dort zu helfen. Als ich wieder zur Vernunft kam und mich vom Kinderglauben verabschiedete, blieb ich dennoch bei der Idee eines Medizinstudiums. Aber nicht mehr mit dem idealistischen Ziel, kleinen Kinderchen in Afrika zu helfen. Einige meiner Bekannten wurden revolutionär und nahmen an Demonstrationen teil. Andere wurden wirtschaftsliberal und von der Wirtschaft geschluckt. Die Revolutionäre haben heute Jobs in der Kulturverwaltung der Landkreise, während die Anhänger des Marktliberalismus die Investitionen der Börsenmakler verwalten. Ich hatte mich in eine verliebt, die bei einer Zeitung arbeitete, und besorgte mir dort auch einen Job, statt nach Oslo zu gehen und Medizin zu studieren. Meine Zensuren waren sowieso nicht gut genug. Als meine Angebetete mit einem Typen aus Alta zusammenzog, hörte ich bei der Zeitung auf und besorgte mir stattdessen eine Stelle bei der Bank. Viele Jahre und einige Fusionen später saß ich also hier in der Küche der Bürgermeisterin der Kommune als Chef in der Bankfiliale. Eine Karriere mit ebenso vielen Höhepunkten wie ein Familienbegräbnis.
Nancy schien zu wissen, woran ich dachte.
»Du könntest dir nicht vorstellen, hier für immer zu bleiben?«, fragte sie.
Ich schluckte den Wein hinunter, bevor ich antwortete.
»Hier? Wenn die Bank geschlossen wird? Was sollte ich dann hier noch tun? Ich habe ja nichts …«
»Hast du denn so viel mehr in der Stadt? Nach allem, was Hartvigsen erzählt hat, steht deine Bank-Karriereleiter nicht besonders sicher, wenn du verstehst, was ich meine. Und bei den wenigen Banken findest du sicher nicht so schnell einen Konkurrenten, zu dem du gehen kannst. Außerdem haben auch die Leute in der Stadt inzwischen begriffen, dass man nicht so ohne Weiteres einen Job im Ölgeschäft kriegt und dann viermal so viel wie normale Menschen verdient. Wobei ich mir nicht denken kann, dass die Ölbranche dich locken könnte. Zumindest nicht draußen auf der Nordsee. Nach allem, was Eddi erzählt, kommen damit nur diejenigen zurecht, die in ihren freien Wochen viel um die Ohren haben. Die können damit leben, da draußen rund um die Uhr zu arbeiten, um dann die verdienten Wochen an Land zu genießen.«
»Ja, ja«, stimmte ich zu. »Aber wenn ich mich hier niederlassen wollte, wovon sollte ich dann leben? Ich kann doch schlecht eine eigene Bank gründen. Und ich denke, weder fischen noch Schafszucht ist was für mich.«
»Ich gebe dir mal einen Tipp«, sagte Nancy. »Viele hier in der Gemeinde sind selbstständige Unternehmer. Deshalb brauchen sie Hilfe bei der Buchführung. Und der Typ, der die Firma Hogna-Buchhaltung leitet, ist alt und vergesslich. Keiner traut sich mehr, sich an ihn zu wenden, aus Angst vor einer Buchprüfung. Und als Bankperson hast du doch sicher viel Ahnung von Buchführung, oder?«
»Doch, das stimmt schon«, antwortete ich und dachte darüber nach. »Buchhaltung kann ich und ein Revisorexamen könnte ich auch noch schaffen, falls es nötig sein sollte. Ich kann mir das ja mal überlegen.«
Nancy holte noch eine Weinflasche hervor.
»Mein Schwiegervater kümmert sich morgen früh um die Schafe. Damit ich länger schlafen kann.«
»Hat er auch Schaf-Fernsehen?«
»Ja klar, er kann die Schafe sehen wie wir. Manchmal habe ich den Verdacht, dass meine Schwiegermutter auch gern eine oder zwei Kameras hier im Haus hätte.«
»Es ist bestimmt nicht immer einfach, so nahe bei den Schwiegereltern zu wohnen?«
»Das kann man wohl sagen«, seufzte sie. »Es hat ein paar Jahre gedauert, bis sie mich akzeptiert haben, das haben sie mich spüren lassen. Anfangs wohnten Eddi und ich in einem kleinen Haus, während sie hier wohnten. Als wir den Hof übernommen haben, haben sie sich ein Altenteil gebaut, sodass wir hier im Haupthaus wohnen konnten, wie Schwiegermutter es immer nennt. Es fiel ihr nicht leicht zu akzeptieren, dass ich einiges anders haben und machen wollte als sie. Deshalb war es wichtig für mich, so viel wie möglich zu ändern. Um sie irgendwie loszuwerden. Dafür war es nur gut, dass Eddi durch seinen Job so viel Zeit hatte, um die Küche zu erneuern und ein neues Bad einzubauen. Schwiegermutter und Schwiegervater hatten nur eine Dusche draußen in der Scheune. Das war mir zu umständlich.«
»Aber jetzt läuft es gut zwischen euch?«
»Na ja, solange wir uns nicht zu sehr auf den Füßen herumtrampeln, geht es. Ich glaube, es war nicht nur das Problem für meine Schwiegermutter, dass sie eine Schwiegertochter bekam, mit der sie nicht klarkam. Sie hätte es sicher gern gesehen, wenn es eine hier von den Inseln gewesen wäre. Eine, deren Eltern und Großeltern sie kannte und die gelernt hatte, genauso wie sie zu denken. Denn auch wenn ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, sind es doch ganz andere Verhältnisse, aus denen ich stamme. Ein Gebirgshof tief im Hardangergebirge wird anders geführt als ein Hof hier draußen auf den Inseln. Wir haben die Schafe im Sommer auf die Alm getrieben und sie den ganzen Winter über im Stall gehabt. Hier laufen die Schafe das ganze Jahr über draußen auf den Weiden herum.«
Nancy teilte den Rest des Weins zwischen uns auf.
»Sag mal«, wechselte ich das Thema, »als ich heute mit der Fähre angekommen bin, da habe ich eine Frau draußen auf einer Landspitze stehen sehen, gleich neben dem Fähranleger. Sie ist ins Meer gesprungen. Zuerst habe ich gedacht, sie wäre hineingefallen, aber als sie wieder auftauchte, hat sie fröhlich gewinkt. Weißt du, wer das gewesen sein kann?«
»O ja«, nickte Nancy. »Das weiß ich. Das ist Ann. Sie kommt aus Thailand und ist mit Toralf verheiratet, das ist derjenige, der den Laden unten in Vågen betreibt. Eigentlich heißt sie anders, aber keiner kann ihren Namen richtig aussprechen, und ein Teil davon klingt so ähnlich wie ›Ann‹, deshalb wird sie so genannt. Er hat sie wohl durch eine Partnervermittlung kennengelernt, die Reisen für heiratswütige Junggesellen organisiert. Ich glaube, das ist jetzt so zehn, zwölf Jahre her. Sie arbeitet zusammen mit Toralf in dem Laden. ›Tveit Handel‹ hieß er früher, jetzt gehört er zu einer Kette. Sie haben auch die Post übernommen, du hast doch bestimmt das Schild unten bei der Bank gesehen.«
Ich nickte.
»Geht sie immer im Meer schwimmen?«
»Jeden Tag, das ganze Jahr hindurch. Toralf behauptet, sie wäre daheim in Thailand Perlentaucherin gewesen. Lange Zeit war es fast eine Attraktion zuzugucken, wie sie sich in die Wellen wirft, aber inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Vor ein paar Jahren stand sogar mal was in der Zeitung über sie, eine Reportage über die furchtlose Frau aus dem warmen Thailand, die in den kalten Norden gekommen ist und selbst mitten im Winter im Meer badet, bei Wind und Schnee.«
Nancy lachte. Ich auch, aber sie lachte am lautesten. Sie war schön, wie sie so lachte, ihr ganzes Gesicht schien zu strahlen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie vor zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren ausgesehen hatte. Bevor sie Eddi traf, bevor sie Kinder bekam, bevor sie hierher zog.
Die Flaschen und die Gläser waren leer, und ich sah, dass Nancy ein Gähnen unterdrückte. Ich wäre gerne noch etwas geblieben, beschloss aber, höflich zu sein, und bedankte mich für den Abend.
»Das … das war richtig nett«, sagte ich, als ich ihre Hand schüttelte und mich verabschiedete. »Du hast mir den Abend gerettet. Und mir ein Erlebnis geschenkt, das ich nie vergessen werde. Mit anzusehen, wie Lämmer geboren werden, das war schon heftig.«
Sie grinste.
»Vielleicht sollte ich eines nach dir benennen«, sagte sie.
»Das wäre doch schön. Aber sie werden später geschlachtet, oder?«
»O ja, aber nicht vor dem Herbst. Und bis dahin ist die Bank geschlossen und du bist verduftet.«
»Dann werde ich im Herbst kein Lammfleisch essen«, erwiderte ich. »Der Gedanke, etwas zu essen, was nach mir benannt wurde, ist nicht gerade verlockend.«
Als ich nach Hause in die Bank kam, blieb ich in meinem Wohnzimmer sitzen. Komisch, der Gedanke. »Nach Hause in die Bank.« Fast als hätte ich ein persönliches Verhältnis zu ihr. Im Radio lief das Nachtprogramm, Menschen schickten Grüße an ihre Bekannten und Liebsten in der weiten Welt. Vielleicht saßen die von ihnen Bedachten ja mit ihnen in einem Zimmer. Und bestimmt schickte auch jemand sich selbst Grüße. Vielleicht sollte ich das auch tun. Anrufen und einen Gruß schicken an einen einsamen Bankmenschen irgendwo draußen im Meer.
Das Bett war ungewohnt, und ich wachte mehrere Male in der Nacht auf. So ist es fast immer, wenn ich an einem fremden Ort übernachten soll. Als ich am nächsten Morgen gegen neun Uhr aufstand, freute ich mich schon auf Freitag. Dann würde ich die Fähre zum Festland und von dort den Bus nach Hause nehmen. Nach Hause, dorthin, wo ich eigentlich wohnte. Weg von meiner Bankheimat. Ich hatte Lust, jemanden anzurufen. Nur um zu hören, wie ein Mensch, der sich in einer Stadt befand, anhörte. Aber mir fiel niemand ein, der so früh an einem Samstagmorgen schon wach sein könnte.
Mein Kühlschrank war immer noch leer, also zog ich mich an und ging die paar Meter die Hauptstraße von Hognavåg hinunter zum Supermarkt von Toralf Tveit. Obwohl der Laden schon seit Langem zu einer großen Kette mit einer Fernsehreklame gehörte, die die meisten mitsummen können, hieß der Laden immer noch wie sein Besitzer. All die Jahre über hatte es zwei Einkaufsmöglichkeiten hier gegeben, den Genossenschaftsladen und Tveit. So war es immer noch, auch wenn der Genossenschaftsladen inzwischen Plastiktüten mit gelbem Logo verteilte und Tveit zu der Kette mit den grünen Tüten gehörte.
Ich hoffte, ich würde die badelustige Ann dort treffen, aber offenbar hatte sie frei; die Dame, die an der Kasse saß, sah aus, als wäre sie fast achtzig. Es hätte mich nicht verwundert, wenn ihr Name Tveit und sie Toralfs Mutter gewesen wäre. Ich nahm ein Glas Marmelade und geschnittenes Dauerbrot. Vielleicht sollte ich den Genossenschaftsladen testen, wenn ich meinen Einkauf für den Sonntag machte? Als Repräsentant des Bankwesens durfte ich ja keinen Unterschied zwischen den Betrieben machen, die ich betreuen sollte.
Da stand ein Typ vor der Bank und rüttelte an der Tür. Als er merkte, dass das nichts nützte, trommelte er gegen die Scheibe.
»Wir haben geschlossen«, sagte ich. »Heute ist Samstag.«
Der Typ drehte sich um und sah mich an.
»Snypsjonkkoiik«, sagte er. Oder etwas, das sich ungefähr so anhörte.
»Closed«, sagte ich. »Gelsyssd. Finito. Komm Montag zurück. Monday.«
Ich zeigte auf meine Uhr, damit er verstand, was Montag war. Er murmelte irgendwelche Phrasen in einer Sprache, von der ich annahm, dass sie auf den Balkan gehörte, und ging seines Weges.
Eigentlich hätte ich die Stunden nutzen sollen, um die Papiere in der Bank durchzusehen und herauszufinden, was in den ersten Tagen getan werden musste. Aber ich ging davon aus, dass Hartvigsens Notizen so deutlich waren, dass ich keine Probleme haben würde. Auf jeden Fall hatte ich jetzt keine Lust dazu. Ich frühstückte und überlegte kurz, was ich machen konnte. Dann entschloss ich mich, das zu tun, was die meisten tun, die sich an so einem tristen Ort aufhalten: Ich ging spazieren.
Ich drehte eine Runde durch Hognavåg. Eine Schule gab es hier, die Kirche, einige Kapellen. Ich fand die Konsumgenossenschaft und das Jugendzentrum, ich fand zwei Fischanlandestellen und ein paar Läden. Nach zehn Minuten hatte ich alles erkundet, was mit einigem guten Willen als Zentrum bezeichnet werden könnte. Dann ging ich weiter die Küstenfelsen entlang, um mir die Natur anzusehen. Vielleicht würde ich ja auch Ann treffen. Der Leuchtturm war leicht zu finden, ich ging in seine Richtung.
Meine Güte, wie schön das hier draußen war! Das Wetter war angenehm, eine leichte Brise wehte von der Nordsee her, und die Sonne hatte schon einige Kraft, obwohl es doch noch so früh im Jahr war. Ich ärgerte mich, dass ich meinen Fotoapparat nicht mitgenommen hatte, daran musste ich unbedingt beim nächsten Mal denken, wenn ich wieder in der Stadt war. Als ich mich dem Leuchtturm näherte, entdeckte ich einen Graureiher weit draußen auf einer Landspitze, es sah aus, als spähte er auf etwas in weiter Ferne. Ich weiß nicht, ob Reiher so weit draußen in der Fjordmündung beheimatet sind, bisher hatte ich sie nur in Fjorden und auf Wiesen gesehen. Ich musste unbedingt nächstes Mal auch mein Vogelbuch mitbringen. Und ein Fernglas. Im Laufe des Frühlings würde es sicher eine Menge interessanter Vogelarten zu sehen geben. Ich hockte mich hinter einen Felsen, um den Reiher zu beobachten. Vielleicht sollte ich versuchen, mit meinem Handy ein Foto zu machen. Der Graureiher stand auf beiden Beinen und reckte seinen Hals, um ihn gleich wieder einzuziehen. Er versuchte etwas zu fokussieren. Vielleicht einen Fisch. Ein Frosch konnte es ja hier draußen kaum sein …