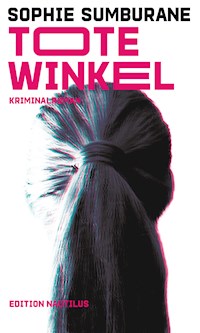
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Valentina Zinnow ist die Gattin des »Kneipenkönigs«, sie lebt in einem adretten Haus in Potsdam mit zwei reizenden Töchtern. Mittwochs kommt ein Student zum Putzen, und sie postet hübsche Fotos aus dem Alltag mit Kindern und Vorstadtidylle. Dass sie zwanghaft zählt, dass sie dissoziiert und nicht immer weiß, was sie gerade tut oder getan hat, merkt keiner. Eines Tages bekommt sie einen Anruf von der Polizei, ihr Mann sei verhaftet worden, er habe eine Frau vergewaltigt und dies auch zugegeben. Das Opfer heißt Katja Sziboula. Sie ist Journalistin, Sachbuchautorin, kühl, beherrscht, sie lebt in einer symbiotischen Ehe und konstruktiven Arbeitsbeziehung mit Kay, Linguistik-Koryphäe aus Südafrika, in Potsdam lehrend. Als Valentina zur Polizeiwache kommt, zeigt ihr der Polizist ein Foto des Opfers – doch darauf erkennt sie sich selbst, mit blauem Auge und blutiger Lippe. Hat ihr Mann die beiden Frauen wirklich einfach verwechselt, wie sie zunächst glaubt? Ist Katja ihr totgeglaubter Zwilling, dessen Geburts- und Sterbeurkunde sie besitzt? Abwechselnd erzählen Valentina, Katja und Kay eine Geschichte, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht – spannend, erschütternd, ungeheuerlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOPHIE SUMBURANE, geboren 1987 in Potsdam, studierte Germanistik und Afrikanistik an der Universität Leipzig sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und promoviert an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt über forensische Linguistik. Sie ist Autorin mehrerer Kriminalromane, schreibt für verschiedene Medien und engagiert sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Sie ist Teil des Netzwerks »Herland – feministischer Realismus in der Kriminalliteratur« und wurde 2019 ins PEN-Zentrum Deutschland gewählt.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2021
Deutsche Erstausgabe September 2022
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
Porträt der Autorin auf Seite 2:
© Ben Gross Portraitfotografie
1. Auflage
ISBN ePub 978-3-96054-300-8
INHALTSWARNUNG Dieser Kriminalroman enthält Passagen mit expliziten Schilderungen sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt, auch gegen Kinder und Jugendliche.
Für Frau K., für J. mit den goldenen Tapeten, die wunderschöne St. und für R. und ihre leere Pillenschachtel an meinem Geburtstag. Nicht zu vergessen K., S., B. und P. und euch anderen für die Teile zum Puzzle.
Every lie creates a parallel world, the world in which it is true.
Momus
Du kannst das Paradies nicht finden, ohne es zu zerstören.
Georg Forster
INHALT
VORSPIEL 1986
TEIL I
1 HEUTE
2 ALS ICH NOCH EIN KIND WAR
3 AM TAG DANACH
4 UND WENN ICH NICHT ALLEIN WAR
5 LASS MICH IN RUHE, ABER NICHT ALLEIN
6 WENN DU DICH TRAUST, ZU VERTRAUEN
7 MÖGLICHE WELTEN
TEIL II
1 EIN ABSCHIEDSBRIEF AN EINE TOTE
2 WO NUR IST DIE TÜR?
TEIL III
1 BEWEGUNGSLOS
2 ZERSTÖRTES PARADIES
VORSPIEL
1986
Ich bin 28 und trage eine Windel. Um mich herum sind ausschließlich frisch entbundene Frauen mit Windeln, doch keine von ihnen würde laut sagen, dass es so ist.
Ich stehe am Fenster mit Blick auf eine Baustelle, sehe den Kränen beim Drehen zu und spüre, wie Blut aus mir herausläuft.
Das mintgrüne, schlauchförmig geschnittene Krankenhaushemd, das es nur in Größe XL oder XXL zur Auswahl gab, spannt an meiner Brust und am Bauch, schlackert sonst um meinen Körper und hat ominöse Flecke an Stellen, die ich selbst nicht sehen kann. Erste Tropfen der einschießenden Milch, Blut, Tränen, von wem ist unklar. Die weißen Knöpfe kurz unter dem Schritt sind offen, ich komme nicht an sie heran, um das zu ändern, außerdem hat hier sowieso schon jede meine Windel gesehen. Eitelkeiten haben sich abgespalten von mir, wie meine Selbstwahrnehmung überhaupt. Nicht einmal meiner Augenfarbe bin ich mir sicher, während ich hier stehe, frisch entbunden, aber ohne Baby, dafür mit großen Mengen an gegensätzlichen Gefühlen im Bauch. Und jetzt steigt er wieder hoch in mir, der Schwindel, ich sollte mich setzen, ins Bett legen und schlafen, endlich schlafen, doch ich stehe hier und versuche, mich auf den Kran vor dem Fenster zu konzentrieren, an dem etwas Schweres hängt, von dem mir scheißegal ist, was. Ich kralle mich an das Fensterbrett, von dem die Lackfarbe abblättert, sehe hinaus auf die vereinzelt vorbeifahrenden Autos, die trotz der Helligkeit mit eingeschalteten Scheinwerfern fahren, sehe die sich im Wind biegenden Bäume mit den ersten Frühlingszeichen. Die Birke dort blüht, die Esche auch. Die grünen Blüten verkünden den März, ich kann sie riechen durch die Scheibe, möchte sie riechen können, denn gerinnendes Blut hat einen eher unangenehmen Geruch. Rund um die Esche führt ein Sandweg, auf dem die Menschen von mir weg oder zu mir hin laufen, auf dem Weg zur Arbeit, zur frisch entbundenen Freundin mit dem ersten Baby, zum Bäcker, zur Darmspiegelung oder der todbringenden Diagnose. Ihren Gesichtern ist das nicht anzusehen. Die Menschen unter der Esche, die stehen bleiben, um nach der Lungenkrebsdiagnose erstmal eine zu rauchen, die das Gegenüber überschwänglich grüßen und hoffen, der merke nicht, dass einem der Name entfallen ist, ja alles klar, alles gut, alle gesund, klar grüße ich zu Hause. Ihnen stehen die LaLeLu-Gespräche auf den Lippen. Ich sehe die Menschen vor dem Krankenhausfenster, die leben, als sei der heutige Tag wie der gestrige, und fühle mich plötzlich abgehängt. Wie früher im Kindergarten, wenn ich wie so oft das Bild der anderen zerrissen hatte und ihnen nun von der weißen Wand aus beim Spielen zusehen musste. Das Spiel des Lebens, ich habe es noch nie gemocht, aber mitspielen will man ja trotzdem. Hier jedoch kommen zehn Jahre jüngere Praktikantinnen mit Plastikschild an der gestärkten Bluse aus Lakenstoff ins Zimmer, fragen mich nach meinem Stuhlgang und haben die Macht, mir zu verbieten, aufs Klo zu gehen. Genau wie im Kindergarten. Zurückgeworfen um Jahrzehnte durchs Kinderkriegen. Dieses Verbot ist nun eine halbe Stunde her, etwa so lange, wie ich schon hier stehe und gegen den Schwindel kämpfe. Um mich herum klingen die Gespräche der anderen Frauen, ihr Stöhnen und Weinen, wie ein entferntes Brummen, das Hin und Her der Hebammen, die von Frau zu Frau immer wieder die Trennwände aus Stoff umrunden, wie leises Klappern. Immer weiter weg sind die Geräusche, immer kleiner mein Sichtfeld, immer deutlicher die Bilder der letzten Nacht. Plötzlich die Platzangst, sie lähmt mich, wie gut, dass ich in einem Krankenhaus bin.
»Ich weiß auch nicht, was los war. Danke, geht schon. Ja, kurz war mir schlecht.«
Ich liege wieder in meinem Bett, ein Glas Wasser an den Lippen, die Hälfte davon auf der Bettdecke.
»Die Hormone, Schwindel. Kenn das ja schon, ist ja nicht mein erstes Kind. Danke. Es geht wieder.«
Die Schwesternschülerin schaut mich noch einmal prüfend an, zieht ihren Arm vor meinem Gesicht weg und nickt. »Aber klingeln, wenn was ist«, sagt sie und schiebt die Brille den Nasenrücken hinauf.
Aus mir heraus laufen Blut und Tränen, in mich hinein strömen die Erinnerungen an die vergangene Nacht. Ich lasse den Kopf ins Kissen sinken und schließe die Augen, um mich herum fängt das Dunkel an sich zu drehen, ein Stimmengewirr in meinem Kopf.
»Susi?«, hatte mein Mann vorhin, kurz nach der Geburt, mit dem Bündel im Arm gesagt, im Gesicht ein dünnes Lächeln. Irgendwo im Raum schrie ein Baby, mein Baby, wusste ich, sah es nicht, doch das Bündel dort war vollkommen still.
»Willst du ihn nehmen?«, fragte mein Mann und meinte unseren Sohn. Ich sagte nichts, bekam das Bündel von ihm auf den Bauch gelegt und konnte es nicht ansehen. »Willst du dich verabschieden, Susanne?« Meine Tochter dagegen schrie, die Hebamme drehte sie herum, legte ein Maßband an den winzigen Körper, verkündete eine Zahl und versuchte, Freude zu verbreiten. Die Sensoren auf meinem leeren Bauch hingen funktionslos an mir, keine Herztöne mehr da, die es zu überwachen galt, keine Wehen mehr zu messen, kein Leben mehr zu retten. »Was für eine Hübsche«, rief die Hebamme, legte das Maßband um den rot angelaufenen Kopf, verkündete eine weitere Zahl und versuchte es erneut mit der Freude. Mein Sohn aber lag noch immer auf meinem Bauch, in ein Handtuch gewickelt, und schrie nicht. Wenn er doch wenigstens einmal geschrien hätte. Nur ein einziges Mal seine Stimme hören, einen einzigen Atemzug hatte ich mir gewünscht, nichts bekommen. »Deine wunderschöne Tochter«, sagte mein Mann.
»Hier ist sie, sieh nur, bei mir weint sie nicht mehr. Sie ist so klein.«
»Geben Sie sie ihr erst später«, hörte ich die Hebamme sagen.
Später, da werde ich wissen, dass ich in diesen Stunden unter Schock stand. Später, da wird mein Sohn eingeäschert und begraben sein, ganz so, wie wir es für ihn vorbereitet haben. Später, ja später wird alles geklärt sein. Jetzt saß ich im Kreißbett, mit einem toten Baby im Arm, das mein Sohn war. Seit 21 Wochen habe ich gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Gewusst, dass ich einen Zwilling gebären werde, der direkt danach stirbt, tatsächlich schon tot zur Welt kommt. Doch was bringt mir dieses Wissen heute? An Tag X ist es vorbei mit der Hoffnung, die eigentlich nie da war. Anenzephalie ist Anenzephalie, ob ich nun hoffe oder nicht.
TEIL I
1
HEUTE
So oder so ähnlich muss es abgelaufen sein, damals, bei meiner Geburt. Sagt meine Mutter. Ich habe gelernt, ihr nicht zu widersprechen, also weiß ich heute, ich bin der lebende Zwilling am Ende einer Tragödie, die es in der damaligen DDR wohl nicht sehr häufig gab. Meistens wurden und werden noch heute solche Schwangerschaften abgetrieben. Ich verdanke mein Leben also der Sturheit meiner Mutter. Ich lebe gut mit diesem Wissen. Sagt meine Mutter. Es ist alles gut heute. Bei ihr, wie auch bei mir. Alles ist gut, ich und meine beiden älteren Schwestern sind erwachsen geworden. Ich bin heute selbst Mutter von zwei kleinen gesunden Kindern, bin um Tragödien und Kaiserschnitte herumgekommen. Ich bin verheiratet mit einem gut verdienenden Mann, wir haben ein Häuschen am Stadtrand mit viel landschaftlichem Grün hinterm Gartenzaun und alles ist gut. Jeden Mittwoch kommt ein junger Student, dem ich 15 Euro auf das kleine Schränkchen neben der Haustür lege, damit er die fünf Zimmer und zwei Bäder putzt. Jeden Mittwoch, wenn ich nicht zu Hause bin, obwohl ich, wie mein Mann sagt, nicht arbeite. Ich nehme dann mein Buch, fahre mit dem Rad 20 Minuten in die Innenstadt und setze mich unter irgendeinen Sonnenschirm in irgendein Café auf der Brandenburger Straße oder auf die Wiese der Freundschaftsinsel, die links und rechts von Seitenarmen der Havel umschlossen ist. Ich sitze dort, lese mein Buch, bleibe nur so lange hier, wie es braucht, bis der putzende Student fertig ist, denn ich will nicht sehen, wie er putzt, meine Arbeit tut, mir zeigt, dass ich es nicht selber tun will. Ich lese, bis der Staubsauger wieder in der Abstellkammer steht, der Glasreiniger auf dem Regal, das so weit oben als Hängeboden über den Türrahmen gebaut ist, dass ich nicht herankomme. Dann stecke ich den Schlüssel ins Schloss unseres Hauses, atme den Geruch von Laminat-Reiniger und weiß, alles ist gut, unsere Mauern dick, alles gut.
Ich liebe den Mittwoch, denn ich bekomme ein sauberes Haus, saubere Böden, saubere Fenster, Bad, Küche, Kinderzimmer.
Ich hasse den Mittwoch, denn ich muss mich morgens duschen und Haare kämmen, ordentlich anziehen, schminken, Nägel lackieren, feilen und polieren. Ich muss mir die Beine rasieren, Hämatome und Pickel überschminken, den Leberfleck am Kinn tolerieren, die Haare flechten, mit Haarspray besprühen und hoffen, dass sie liegen bleiben, wie sie sollen. Alles in festgelegter Reihenfolge. Drei Mal die Bürste des Maskaras über die Wimpern links, dann rechts. Bis 15 zählen, bevor das Shampoo ausgewaschen wird. Bis 20 bei der Spülung. Die Fingernägel schrubben, bis das Nagelbett blutet. Mir wünschen, ich könnte all das lassen. Und dann muss ich in der Stadt mit übergeschlagenen Beinen auf dem Stuhl sitzen, oder auf der Wiese, und meine Füße am Einschlafen hindern und muss freundlich auf Fragen antworten, die der Kellner mir stellt, muss einen Milchkaffee trinken, obwohl ich Milch hasse, lächeln, charmant sein und nicht zu viel reden. Und wenn ich es wieder nach Hause geschafft habe, meine Welt zurück habe und die Kinder dabei habe, muss ich herumlaufen und sie ermahnen, dies und das nicht anzufassen, das ist frisch geputzt, gerade sauber, ordentlich eingeräumt, erst heute abgewischt, bis ich nach 30 Minuten aufgebe und zusehe, wie der umgekippte Apfelsaft vom Tisch auf den Boden tropft. Die Große mit ihren drei Jahren hockt sich drunter, lässt die Tropfen in ihren Mund segeln, und ich lasse die Kleine in ihrem Hochstuhl das Ganze beklatschen und auch ihren Becher umkippen, der die Große mit einem Schwall im Gesicht trifft, und beide lachen und ich weiß, jetzt muss ich auch ihre Haare waschen. Und irgendwann, wenn ich fertig bin, lange schon fertig bin, wird der Schlüssel ins Schloss geschoben und mein Mann kommt nach Hause, stellt seine Tasche irgendwo ab, meistens mitten im Türrahmen, lässt sich auf die Couch fallen und sagt, bevor ich sagen kann »Ich habe Soljanka / Hühnchen / Nudeln / Chili gekocht und mit dem Essen auf dich gewartet«: »Ich hab schon gegessen, Schatz.«
Mein Mann nimmt Rücksicht auf mich, er trägt die Haare kurz, keinen Bart, dafür eine Brille mit modischem Rand. Jeden Morgen rasiert er sich, das sehe ich im Waschbecken, jeden Morgen putzt er seine Brille, das sehe ich an dem Putztuch, das auf dem Küchentisch liegt. Jeden Morgen kocht er sich genau eine Tasse Kaffee, stellt die Tasse auf den Geschirrspüler, gibt seinen drei Mädels, wie er sagt, jeweils einen Kuss und verlässt das Haus.
Es ist alles gut bei uns.
So auch an diesem Morgen, an dem ich bereits die Kinder in die Kita gebracht und eingekauft hatte, die Sonne durch die noch frisch geputzten Fenster in die Küche schien und ich nun auf das Durchlaufen des Kaffees wartete. Meine Fingernägel klickten auf der Arbeitsplatte, ich schloss die Augen und zählte die Töne. Sah vor meinem inneren Auge fünf Stunden leere Zeit sich ausbreiten wie ein Teppich aus Teer, den ich wegzuwischen hatte. Trank den Kaffee. Bügelte die Wäsche. Las das Buch von gestern weiter. Brachte nichts von dem, was ich tat, zu Ende. Fünf Minuten, dann ließ ich alles stehen und lief im Haus auf und ab, fasste die Kinderzimmermöbel an, als müsse ich mich immer wieder neu davon überzeugen, dass all das wirklich hier war. Real, existent. Ich warf mich gegen den Kleiderschrank, wahrscheinlich schrie ich auch kurz, und rutschte am Holz entlang auf den Boden. Ging in die Küche, trank noch einen Kaffee, wischte die Maschine aus, jeder Pulverkrümel musste verschwinden. Ich bügelte wieder. Dann weinte ich kurz, bevor ich den Trockner anstellte, in dem die Wäsche von gestern seit gestern lag, der losbrummte und mir kurz das Gefühl gab, etwas erledigt zu haben. Schon 13 Uhr, dachte ich, mit Blick auf die Wohnzimmeruhr, paralysiert vom Sekundenzeiger. Ich stand gerade mitten im Raum, sagte mir mit neuen Tränen über der Netzhaut, es ist doch so schön, außer Bügeln nichts zu tun zu haben, tu doch was Schönes, dir selbst was Gutes, alles ist gut, als das Telefon klingelte. Ich zögerte kurz. Das muss die Kita sein, dachte ich, eines der Kinder ist krank, also ging ich doch ran und hörte eine Männerstimme fragend meinen Namen sagen. Doch nicht die Kita. Ich wollte auflegen, fing an, im Zimmer umherzulaufen, stieß gegen eine am Boden liegende Puppe.
Ich lebe ein entspanntes, ruhiges Leben, sagen die Menschen in meinem Umfeld über mich, mit einem tollen Mann, der sich kümmert und immer so lieb ist und so viel arbeitet und sich um uns sorgt, und alles ist gut, dachte ich mit dem Telefon in der Hand in meinem Vorstadtwohnzimmer.
Darum fiel ich aus allen erdenklichen Wolken, als ein Mann anrief, um mir zu sagen, mein Mann sei verhaftet worden. Ein Polizist, dessen Name vollkommen uninteressant ist, sagt das einfach so, am Telefon, um ein Uhr mittags an einem Donnerstag und denkt keine Sekunde darüber nach, ob ich vielleicht gerade beschäftigt sein könnte.
Und überhaupt, natürlich war das ein Fehler, falsche Verdächtigung, was auch immer. Natürlich. Alles, aber nicht die Wahrheit. Dennoch bat er mich, ins Polizeipräsidium zu kommen. Gab mir eine Adresse, ich wollte nirgendwo hin. Doch ich zog mich an, das gelbe Kleid mit den blauen Blumen, eins zwei drei, die blauen Sandaletten dazu, eins zwei drei, denn ich hatte noch die blauen Fingernägel und keine Zeit (keine Lust), sie umzulackieren. Ich kämmte durch meine kinnlangen blonden Haare, eins zwei drei, fädelte die Ohrringe in ihre Löcher, eins zwei drei, schlang mir das dünne gelbe Tuch um den Hals, eins zwei drei, und nahm das Auto zum Polizeipräsidium neben dem Lustgarten. Während der Fahrt verfluchte ich mich, meinen ständigen Zwang zu zählen, eins zwei drei, der schlimmer wurde, wenn ich nervös war, unkontrollierbar, eins zwei drei. Was hatte es mich an Training gekostet, bis ich das Zählen nur im Kopf tun konnte statt laut. Eins zwei drei, jedes Mal, bevor ich etwas tat. Nun stieg ich aus, kaufte einen Parkschein und lief das Stückchen Straße entlang, an zwei Einsatzfahrzeugen vorbei. Das von außen rosafarbene Gebäude war eingepasst zwischen andere Altbauten, verziert und so anders, als ich mir ein Polizeigebäude vorgestellt hätte. Nur das blaue Schild am Eingang gab einen Hinweis, nur der Pförtner hinter dickem Glas war ein Zeichen. Er summte mir die Tür zum Wartebereich auf, ich klingelte dort wie auf der angebrachten Tafel beschrieben, jemand holte mich ab, führte mich durch zu viele Türen, die piepsten und summten, während sie sich automatisch öffneten, bis ich in einem kleinen Büro stand, in dem ein zweiter Polizist saß und sich erhob. Mir die Hand entgegenstreckte, ich ergriff sie nicht, blieb weit genug von ihm entfernt im Raum stehen.
»Frau Zinnow, vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten«, sagte er, deutete mit der Hand jetzt auf einen Stuhl vor dem Schreibtisch und setzte sich selbst wieder. Schob ein paar Papiere vor und zurück und sah schließlich auf den Computerbildschirm, an dessen Rand bunte Postits klebten. Der Polizist, der mich abgeholt hatte, setzte sich dazu, deutete ebenfalls auf den Stuhl und rieb sich die zu große Nase. Sein Drei-Tage-Bart schien mir keine Mode zu sein, eher eine Zeitangabe für Schichtlängen.
»Setzen Sie sich doch bitte. Würden Sie uns nochmal Ihren Ausweis? Danke. Valentina Zinnow, richtig? Ja. Also, Ihr Mann, das haben Sie ja jetzt gehört, ist verhaftet worden«, setzte der an, der auf den Bildschirm schaute, schien etwas zu suchen, hielt den Finger auf den Monitor und quatschte, um die Zeit bis zum Finden zu überbrücken. Ich zählte innerlich: eins zwei drei, eins zwei drei, bis er fertig war, setzte mich endlich, eins zwei drei. Strich mein Kleid glatt, obwohl es glatt war, immer wieder, schaute meinen Händen dabei zu, um mich nicht umschauen zu müssen und sicher sein zu müssen, dass ich war, wo ich war.
Der Polizist begann zu sprechen, einleitendes Bla, Zeug und Dinge, von denen ich wusste, die ich abnickte, und sagte dann trocken, was passiert war. Ein läppischer Satz zwischen vielen stieß mir vor den Kopf. Ich war schockiert zu hören, mein Ehemann habe eine Frau vergewaltigt. Sie sei vor seinem Restaurant vorbeigelaufen, als er dabei war, Getränkekisten vom Lastwagen zu laden, er hätte sie angesprochen, in den leeren Gastraum gezerrt und zwischen den Tischen und Bänken zum Sex gezwungen. Ich war erschrocken, als ich hörte, dass sie sich gewehrt hat, weinte, und er nicht aufhörte. Die beiden Polizisten, die hinter ihrem Tisch vor mir saßen, Taschentücher anboten und so viel sagten, wie sie sagen konnten, zeigten mir schließlich ein Foto der Frau. Doch erst, nachdem sie mich eine unendlich lange Weile angestarrt hatten, ohne dass ich ihr Starren verstand, bis sie es vor mich legten, das Foto. Jetzt nestelte ich an meinem Halstuch herum, wickelte fester, wieder lose und fester, und sie flüsterten sich gegenseitig Fragen ins Ohr, diese beiden Männer in Blau, nur um mich plötzlich viel zu laut zu fragen, ob ich diese Frau schon mal gesehen hätte. Eine Frage, die sie selbst nicht verstanden. Denn was sie mir da zeigten, schien ein Foto von mir selbst zu sein. Mit blauem Auge und Blut an der Lippe.
Ich wünschte, ich wäre schamlos. Ich bräuchte einen Schalter im Kopf, mit dem sich Gefühle ganz einfach abschalten ließen. Scham, Angst, Schmerz, Wut, klick und weg. Vielleicht kann ich den Schalter auch einfach nicht finden, während ich hier sitze, auf dem Gyn-Stuhl des Krankenhauses, untenrum nackt. Mir gegenüber an der Wand hängt ein flacher Monitor, ausgeschaltet und dennoch präsent. Ich weiß, er überträgt die Ultraschallbilder von ungeborenen Kindern für deren Eltern, doch ich befürchte, er kann noch mehr und ich bekomme dort gleich eine Großaufnahme von Spermaresten zwischen meinen Schamlippen zu sehen, Katja Sziboula in Großaufnahme, wie nett. Langsam fangen die Beine in den Halterungen zu zittern an, niemand ist im Raum, dennoch sitze ich schon bereit. Ein wenig wird so, rede ich mir ein, das Brennen gemildert. Eine Schmerztablette könne ich schließlich noch nicht bekommen, sagte man mir, der Bluttest stünde noch aus, ein bisschen noch warten, den Schmerz noch ertragen, Frau Sziboula, es tut uns leid, dass das nötig ist, sagen sie. Und ich frage mich, warum es in diesem riesigen Krankenhaus offenbar niemanden gibt, der schnell mal Blut abnehmen kann.
Erst als sich die Tür öffnet, die links hinter meinem Kopf ist, verdeckt von einer schiebbaren Wand aus Vorhang, schaffe ich es immerhin kurz, mich auf dieses Zimmer um mich herum zu fokussieren. Einen Moment nur, bis ich wieder auf dem Betonboden liege, mit den zahllosen Stuhlbeinen und Tischbeinen um mich herum, Tischplatten von unten betrachtend, beklebt mit Kaugummiresten, wie in der Schule. Immer wieder haben sie mich gebeten, alles zu beschreiben. Ganz genau. Jedes Detail. Kleinigkeiten. Haarfarbe, Augenfarbe, Sockenfarbe, Wandfarbe, Deckenhöhe, Bodentemperatur, Anzahl der Küsse, Schwanzlänge, Intonation, Klang der Stimme während des »Na? Geil, wa?«
Nur nach den Kaugummis haben sie nicht gefragt, die hätte ich ihnen beschreiben können, ganz genau, jeden Zahnabdruck, Lippenstiftrest und jede Fingerspur, denn ich weiß genau, eigentlich hing ich auch dort, unter der Tischplatte, neben den Kaugummis, und sah auf das Geschehen hinab.
Ich erinnerte mich, während ich versuchte zu vergessen. Ich durchsuchte die Bilder, die sich an meine Netzhaut geheftet hatten, danach, wie er ausgesehen hatte, geguckt hatte, zugegriffen hatte, wie selbstverständlich, all das wollten sie wissen. In diesem Büro, in dem ich vor dieser Untersuchung gewesen war, das keine Tür zu haben schien. Das zu dem meistgenutzten Gang der Welt zu führen schien. Ein Büro in einem Polizeipräsidium, vor dem Warnschilder stehen mussten: Bitte hineinsehen! Bitte davor stehen bleiben! Bitte den Kopf schief legen! Bitte nachschauen, ob man der Frau untenrum schon was zum Anziehen gegeben hat!
Und während die Vorbeigehenden pflichtgemäß taten, was die Schilder ihnen befahlen, hatte ich auf einem mit kratzendem Stoff bezogenen Stuhl ohne Armlehnen gesessen, mit rundem Rücken und vor der Brust verschränkten Armen, um zu erzählen, und vermisste meine Schuhe. Der Beamte hinter dem Computerbildschirm schien der einzige Mensch in diesem Polizeigebäude zu sein, den all das nicht interessierte. Er tippte teilnahmslos auf seiner Tastatur herum, sah immer wieder auf die Uhr hinter mir an der Wand. Wahrscheinlich hatte er bereits Feierabend. Ich versaute ihm den Nachmittag mit seiner Freundin im Park oder Schwimmbad. Wer will bei diesem schönen Wetter schon in einem solch stickigen Büro sitzen, um sich anderer Leute Zipperlein anzuhören? Endlich hatte er einen Haken unter die Befragung machen und mich an die nächste Stelle auf meinem Trip durch die Hölle abschieben können. Und nun sitze ich in einem anderen Raum, in einem Krankenhaus, und natürlich ist es ein männlicher Gynäkologe, der nun hinter dem Vorhangraumtrenner hervorkommt und freundlich lächelt. Natürlich schaut er mir ganz angestrengt ins Gesicht, gibt mir die Hand und sagt: »Na dann wollen wir mal«, als sei ich ein Kreuzworträtsel. »Bleiben Sie einfach ganz entspannt.« Und plötzlich geht er an, der Monitor, und vor mir erscheint knallrote Haut, dunkles Blut und Dreck. Und plötzlich bemerke ich den zweiten Mann, der hinter dem Vorhangraumtrenner hervorgekommen ist, mit einer Fernbedienung in der Hand, auf den Monitor zielend und starrend. Ich bemerke die Digitalkamera in seiner anderen Hand, wie er sie jetzt hebt, auf mich richtet und abdrückt. Nachzuladen scheint, näher kommt und abdrückt. Jeder Schuss ein Treffer, Name drauf und ab in die Akte, fertig, um bald vielen weiteren Männern vorgelegt zu werden. Dieser hier ist definitiv eine Pflegekraft. Der einzige Mann im Krankenschwesternberuf. Aber hey, immerhin weiß ich jetzt, was ich mit meinem Körper anfangen kann, ich werde ihn einfach ausziehen, ja genau das mache ich jetzt, ich ziehe meinen Körper aus, er hat mir noch nie richtig gefallen und nun ist er auch noch kaputt und offenbar in der Werkstatt gelandet, also weg damit. »Ihr könnt den eigentlich auch hier behalten«, sage ich. »Dann müsst ihr nicht so viele Fotos machen.«
Pausenlos vibrierte mein Smartphone. Brumm brumm in meiner Tasche, unaufhörlich und wieder von Neuem, bis ich irgendwann die Hand in meine Hosentasche schob und die Finger um das Gehäuse schloss. Was war geblieben von meiner goldenen Regel, während wichtiger Meetings niemals einen Anruf entgegenzunehmen? Nicht einmal daran zu denken? Sie war wohl einfach noch nie so sehr strapaziert worden, seit bereits sieben Minuten. Der Klang der Vibration hallte durch den gesamten Raum, ich war sicher, alle Anwesenden hörten mein Telefon, doch niemand schaute mich an. Der Doktorand, der vorn an der altmodischen Tafel stand und ungerührt sprach, präsentierte der Prüfungskommission die bisherigen Ergebnisse seiner Promotionsarbeit, die ich betreue, trat nervös von einem Fuß auf den anderen und hielt sich an seinem Blatt fest, als gäbe es ihm Halt, falls er fällt. Er hatte außerdem einzelne Blätter mit Magneten an die Tafel geheftet, niemand von uns konnte erkennen, was darauf stand, doch es zeigte sein Vorbereitetsein, also monierte auch niemand diesen Versuch zu visualisieren. Ich kannte die Blätter, hatte sie gestern in meinem Büro begutachtet, darauf wurden drei mögliche Versuchsanordnungen skizziert, die mir alle drei erfolgversprechend erschienen. Und genau das würde ich auch sagen, wenn am Ende alle auf meine Einschätzung warteten, alle waren eigentlich nur meinetwegen hier. Der Doktorand, der Institutsdirektor, die Forschungsgruppe wollten hören, was ich dachte, welcher Weg der beste sein könnte. Dennoch zog ich das Smartphone jetzt ein Stück aus der Hosentasche, versuchte, mit einem Ohr weiter zuzuhören, obwohl ich die Arbeit bis zum jetzigen Punkt sowieso schon kannte, und sah ihre Nummer. Katja. Sie wusste, wo ich bin. Kannte die Regeln. Hörte nicht auf. Der Doktorand sprach weiter, er hörte das Vibrieren offenbar wirklich nicht. In den Händen hielt er jetzt gelbe Karteikarten, das Blatt von eben lag vor ihm auf dem Tisch. Sein bestes Hemd tragend stand er vor seiner Präsentation, voller Selbstbewusstsein und Gewissheit, Kluges von sich zu geben und die Spracherwerbsforschung revolutionieren zu können, obwohl er bis zum heutigen Tag vor allem damit beschäftigt war, den aktuellen Forschungsstand zu reproduzieren, und noch immer offensichtlich nervös von einem Bein aufs andere wechselte. Diese Pflichtaufgabe des Reproduzierens gehörte natürlich dazu, langweilte mich jedoch, da wir alle diesen Stand kannten. Also entschuldigte ich mich doch für einen Moment und verließ den Raum, alle Augen verwundert auf mir, ich drückte das Kreuz durch und tat, als sei mein Gehen selbstverständlich. Meine Schritte hämmerten in meinen Ohren, die Glattlederschuhe knarrten über den Seminarraumboden. Die Luft ließ ich erst vor der Tür wieder aus den Lungen.
»Katja, was soll das?«, nahm ich den Anruf entgegen, die Stimme aggressiver als gewollt.
»Kay, kannst du kommen? Hab nichts Sauberes anzuziehen.« Ihre Stimme dünn, kostbar, als sei sie begrenzt und fast aufgebraucht.
»Was? Katja, es tut mir wirklich leid, ich bin in der Präsentation. Darüber hatten wir doch heute Morgen gesprochen, ich ruf dich später an, ja?«, fragte ich, ohne wirklich zu fragen.
»Kannst du kommen?«, sagte sie erneut, als wären meine Worte ein Rauschen. Ich hörte ihr Atmen an meinem Ohr, es klang schwerer als sonst, sicher liegt das an der schlechten Verbindung, sagte ich mir und atmete selbst tief ein.
»Ich komme gleich, sobald ich hier weg kann.«
Ich sah auf die Uhr, meinte, ein brummendes Murmeln durch die Tür zu hören, sie redeten, fragten sich, was ich tat, was das soll, was soll das, die Kardinalfrage: »Was soll das, Katja?«
»Ich warte einfach hier.«
»Ich kann hier nicht grundlos weg, das weißt du doch. Entschuldige, ja?«
Sie beendete das Gespräch ohne ein weiteres Wort, fast gleichzeitig kam eine WhatsApp, die ich nicht las. Ich checkte stattdessen kurz die Mails, sah, dass drei Studenten bei mir ihre Masterarbeit schreiben wollten, Exposés einreichten, und ab jetzt minütlich ihre Postfächer aktualisieren würden, auf meine Antwort wartend. Lächelnd steckte ich das Smartphone wieder in die Hosentasche, krempelte die Hemdsärmel ein wenig hoch und ging zurück zum Seminarraum, kurze Entschuldigung, weiter im Text, auch wenn ich nicht aufhören konnte mich zu fragen, was mit Katja los war, und noch immer ihr schweres Atmen hörte. Doch ich zwang mich, nicht mehr daran zu denken, wieder hier zu sein, in diesem Raum.
Ich liebte meinen neuen Job, seit drei Semestern hatte ich nun die Professur inne, schon zwei Doktoranden und stets volle Seminare. Diesen nur scheinbar gewonnenen Kampf konnte ich jederzeit noch verlieren, wenn ich auch nur die kleinste Angriffsfläche bot. Und wie die Kollegen mich ansahen, die drei Professoren der Prüfungskommission, der Dekan und die beiden studentischen Hilfskräfte meiner Forschungsgruppe, gab mir ein Gefühl von Macht, das ich nie zuvor hatte und mir von niemandem mehr würde nehmen lassen.
Ich dachte immer mal wieder an Katja, während der Student sprach, Theorien erläuterte, seine Hypothesen aufstellte und besprach, wie er methodisch vorzugehen gedachte.
Ich konnte diesen Doktoranden nicht unterbrechen mitten in seinen Überlegungen zu Chomsky, dann Tomasello und schließlich seiner Idee, ihn nicht einfach erneut kommen lassen, oder alles ungehört abnicken, nur weil Katja schwer durchs Telefon atmete. Er verließ sich auf mich, wollte meine Meinung, Gedanken, Erfahrung, und ich liebte ihn dafür, wie man jemanden liebte, der einem das Gefühl gab, überlegen zu sein.
Erst nach weiteren zweieinhalb Stunden hatte ich Katjas Nachricht gelesen und verstanden, dass sie im Krankenhaus war. Dort auf mich wartete. Und rannte los. Stellte nach einer gefühlten Ewigkeit eines dieser Carsharing-Autos, die immer vor der Uni standen, im Parkverbot ab und fand meine Frau in eine Decke gewickelt im Gang des Krankenhauses. Auf einem Stuhl, der aus zwei gebogenen Stahlrohren bestand und leise quietschte, weil ihr Körper darin hin und her wippte. Sonst saß sie völlig reglos da, mit geschlossenen Augen, die kurzen blonden Haare wie ein Helm an den Kopf gedrückt. Sie saß da, mit Blut an der Lippe, einem dunkler werdenden Ring ums Auge, den Körper komplett in das hellblaue Laken gehüllt. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter, sagte: »Katja?« Nichts. »Wir können gehen. Ich bin da.« Nichts. Immerzu liefen Menschen an mir vorbei, Menschen in Schlafanzügen, blauen sterilen Kitteln oder Jeans und T-Shirt. Wie auf einem Bahnsteig liefen sie den Gang auf und ab, sahen mich an, musterten mich von oben bis unten, dann Katjas Gesicht, meine Hände, meine Füße, und ich fühlte mich plötzlich von ihrer Hilflosigkeit überfallen, bloßgestellt und vorgeführt. Um Gottes willen!, dachte ich, spürte Wut in mir aufsteigen, Wut über so viel Hilflosigkeit, und wollte Katja unter die Arme greifen, sah immer wieder die Menschen an, hoffte, einer käme, um mir zu sagen: Sie bleibt hier, keine Sorge, wir kümmern uns, aber niemand kam, also schob ich meine Hände unter ihre Achseln, um sie hier herauszuziehen, als sich endlich die Tür öffnete, neben der Katja saß. Ein Arzt in langem Kittel und blauer Hose trat heraus, in seinen weißen orthopädischen Schuhen, lächelte jovial und hielt mir die Hand hin. »Sie müssen Kay Sziboula sein. Schön, dass ich Sie vor Schichtende noch sehe. Kommen Sie doch bitte kurz herein.« Fester Händedruck. Ein Deuten auf einen der Stühle ihm gegenüber.
»Ihre Partnerin ist vergewaltigt worden«, was für eine Gesprächseröffnung. »Da gibt es keinen Zweifel. Die Verletzungen zeigen da ein deutliches Bild und unterstützen ihre Aussage.« Dieser sachliche Tonfall, der Ärzte umgibt, dieses noch immer in seinem Gesicht hängende Lächeln gaben mir das Gefühl, in einem schlechten Film zu sitzen. Ohne Popcorn und Cola, ohne Bier oder Nachos. Vergewaltigt hatte dieser Mann gesagt, sie hat hier Nudeln mit Tomatensoße zu essen bekommen, hätte er dem Tonfall nach genauso gut gesagt haben können.
»Vergewaltigt? Davon hat sie aber am Telefon nichts gesagt.« Was für ein dummer Satz.
»Das ist wohl auch nur schwerlich von ihr zu erwarten. Was ich sagen möchte: Bitte gehen Sie die nächste Zeit vorsichtig mit ihr um. Ich habe hier einen Ausdruck, lesen Sie ruhig schon, mit Adressen. Von Psychologen. Spezialisierten. Ist ja so eine Art Trauma, was Ihre Partnerin da heute erlebt hat. Sollte unbedingt verarbeitet werden können. Hier haben Sie eine zweite Liste, ich leg die jetzt mal hier drüber, mit Anzeichen für eine Depression, auf die Sie achten sollten. Wenden Sie sich auch gern an mich, wenn Sie Fragen haben, ja?«
»Vergewaltigt?«





























