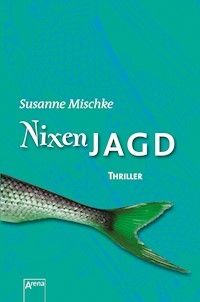8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Meterhoch schlagen die Flammen des Osterfeuers. Und der wohlvertraute Geruch brennenden Holzes zieht durch das Dorf. Auch Kommissar Bodo Völxen will den Samstagabend traditionsgemäß bei Bier und Schnaps genießen – bis in den glühenden Scheiten des Feuers eine Leiche entdeckt wird. Bis zur Unkenntlichkeit verkohlt, liefert nur eine auffällige Gürtelschnalle einen ersten Hinweis. Doch bald wird nicht nur Bodo Völxen klar, dass der Tote mehr als eine Todsünde begangen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage November 2010
ISBN 978-3-492-95140-1
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Umschlagabbildung: plainpicture (Hintergrund)
Datenkonvertierung E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Ostersonntag
»Gib auf, Völxen!«
Na klar, das würde denen so passen. Bodo Völxen umkrallt den Lenker und tritt mit aller Kraft in die Pedale. Die Herausforderung, vor die ihn der Vörier Berg stellt, ist größer als vermutet.
»He, Torpedo! Pass auf, dass du nicht umfällst!«
Köpcke hat gut lästern. Der Nachbar und seine beleibte Frau sind zu Fuß unterwegs. Eine kluge Entscheidung, erkennt Völxen.
Dabei hat er sich gerade nur verschaltet, das kann bei einundzwanzig Gängen schon mal passieren. Von den Tücken eines Hightech-Trekkingrades hat dieser stiernackige Hühnerbaron natürlich keine Ahnung, woher auch, Köpcke fährt John Deere und einen uralten Benz.
Aber absteigen und schieben kommt nicht infrage. Verdorben von einschlägigen Fernsehkrimis, erwarten die Bewohner von ihrem Dorf-Schimanski, wie sie ihn hintenherum nennen, eine gewisse körperliche Fitness. Zudem fürchtet Völxen Sabines und Wandas spöttische Kommentare, die im Falle einer Kapitulation gnadenlos auf ihn niederprasseln würden. Schlimm genug, dass sie ihn bereits am Fuß der Anhöhe abgehängt haben. Dabei waren es die beiden, die ihn überredet haben mitzukommen. »Wir müssen uns aktiver am Dorfleben beteiligen«, hat er die Worte seiner Frau Sabine noch im Ohr.
»Warum müssen wir das?«, hat Völxen wissen wollen, aber als Antwort nur ein Augenrollen erhalten. Seine Tochter Wanda dagegen meinte, Rad fahren wäre gut für seine Linie. Beim Wort »Linie« vermaßen ihre Blicke die Wölbung seiner Körpermitte auf eine ziemlich respektlose Weise. Wanda war es auch, die kürzlich eine Tabelle an die Badezimmertür geheftet und darauf sein Idealgewicht mit Leuchtstift markiert hat. Von dieser giftgelben Zahl angespornt, hat Völxen dem Unternehmen »Radtour zum Osterfeuer« zugestimmt. Dennoch würde er jetzt viel lieber auf dem Sofa liegen und verfolgen, wie sich Hannover 96 beim HSV schlägt. Was ist schon ein Feuer, auch wenn es ein großes ist? Er war noch nie pyromanisch veranlagt.
Die anderen offenbar schon: Das ganze Dorf ist auf den Beinen und bewegt sich bergwärts. Ziel der Prozession ist eine fette Rauchwolke, die schwarz in den Abendhimmel steigt.
Völxen hustet. Die Luft riecht süßlich-klebrig nach Raps und Brandbeschleuniger. An Letzterem haben die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr wieder einmal nicht gespart, was sie natürlich nie zugeben würden, schon gar nicht vor ihm.
Meter für Meter quält Völxen sich die Straße hinauf, immerhin ist eine Differenz von fünfundsechzig Höhenmetern zu bewältigen. Rechts und links von ihm blühen Tulpen, Narzissen und Forsythien in den Gärten, von Zwergen bewacht, doch dafür hat Völxen keinen Blick übrig. Er beißt die Zähne zusammen, löst sein Gesäß vom Sattel und zieht vorbei an einer alten Dame in Begleitung eines ebenso betagten Dackels und an einem jungen Mann, der einen Kinderwagen die Straße hinaufschiebt. Der Mann muss aus dem kürzlich erschlossenen Neubaugebiet kommen, ein Vertreter dieser neuen Vätergeneration, die sich für alles hergibt, urteilt Völxen, während er sich mit hochrotem Kopf vorankämpft. Kein Wunder, dass seine Kondition heute nicht mehr die allerbeste ist, denn über die Feiertage hat er schwer geschuftet: Er hat die Gelegenheit des Osterfeuers genutzt und rund um sein Anwesen die Hecken und Büsche gestutzt und die Apfelbäume auf der Schafweide beschnitten. Das Schnittgut liegt nun auf dem großen Haufen oben auf dem Hügel. Heute musste der Zaun der Weide ausgebessert werden, danach hat er den vier Schafen und dem Bock die Klauen gesäubert und geschnitten. Eine Schramme an seiner Stirn zeigt, was Amadeus von Fußpflege hält.
Nur noch ein kurzes Stück, los, das schaffst du! Nicht aufgeben, sonst sind Blut, Schweiß und Tränen vergeblich geflossen! Völxen übt sich in stummen Durchhalteparolen, während er den himmelblau bemalten Klowagen am Straßenrand hinter sich lässt. Aus dem Verleih des zur Bedürfnisanstalt umgebauten Bauwagens bezieht der örtliche Gesangverein seine Einkünfte. Das ist lohnender, als wenn sie Gagen für ihre Auftritte verlangen würden. Unzählige Male hat man Völxen in den vergangenen zwanzig Jahren aufgefordert, sich den Sängerknaben anzuschließen, aber Völxen kann und will nicht singen, und er mag keine Vereine.
Schweißgebadet, aber stolz auf seine Leistung erreicht er die Partyzelte am Ende der Straße. Auch ein Löschwagen der Freiwilligen Feuerwehr steht bereit, falls der Brand außer Kontrolle geraten sollte. Aber auch jetzt gibt es hier schon einiges zu löschen. Ein Bierchen geht immer, kleine Schnapsfläschchen werden hinterhergekippt, auf dem Grill bräunen rote und weiße Bratwürste und Schweineschnitzel, angepriesen als Schinkengriller.
Völxen steigt vom Rad. Wie gut es doch tut, wieder eine aufrechte Körperhaltung anzunehmen. Er schließt sein Gefährt an Sabines Hausfrauenrad an, denn man kann nicht vorsichtig genug sein. Sein neues Fortbewegungsmittel hat fast ein halbes Monatsgehalt gekostet.
Die Feuerstelle liegt vom kulinarischen Zentrum ungefähr zweihundert Meter weit weg, was den Vorteil hat, dass man beim Essen und Trinken nicht von Rauch und Funkenflug belästigt wird. Aber im Allgemeinen halten sich die erwachsenen Besucher des Osterfeuers ohnehin nur kurz in der Nähe der Flammen auf, dafür umso länger an den Biertischen. Dorthin zieht es nun auch Völxen. Das Feuer wird er sich ansehen, wenn es dunkel ist und der Haufen richtig brennt, im Augenblick holt man sich dort oben nur eine Rauchvergiftung.
Heute wird die Vereinskasse der Landjugend, die das Feuer organisiert, sicherlich gut aufgefüllt werden, denn bei diesem Anlass wird erfahrungsgemäß reichlich getrunken. Auch das Wetter spielt mit. Der Apriltag war warm und sonnig, noch immer weht ein lauer Wind, der einen Hauch von Schweinemist heranträgt. Der Abendhimmel ist klar, nur über dem Deister hängen ein paar dünne Schleierwolken, rot eingefärbt von der untergehenden Sonne.
Völxen zieht ein großes Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche und wischt sich damit den Schweiß von Stirn und Nacken. Was sind das für komische Stiche in der Lunge? Er beschließt, die Zeichen der Überanstrengung einfach zu ignorieren, was ihm nicht schwerfällt, denn nun steigt ihm der Duft von Gegrilltem in die Nase. Er sieht sich um. Seine Frau Sabine unterhält sich mit der Frau des Bürgermeisters und dem Pfarrer, Tochter Wanda flirtet mit einem Mitglied der Feuerwehr – die Damen seines Hauses sind also beschäftigt. Eine gute Gelegenheit, eine Wurst zu essen und zu testen, wie das Bier hier oben, einhundertsiebenundvierzig Meter über Normalnull, so schmeckt. Die Würste allerdings haben ihre Garzeit schon seit einer Weile überschritten und sehen Vanillestangen ähnlicher als Würstchen, also bestellt Völxen lieber einen Schinkengriller. Der jugendliche Grillmeister, der über seiner Tätigkeit fast einzuschlafen droht, reicht ihm ein großes, fettglänzendes Stück Schweinefleisch, eingebettet in zwei Brötchenhälften.
»Senf und Ketchup.« Der Junge deutet auf zwei verschmierte Plastikflaschen auf dem improvisierten Tresen und gähnt dabei unverhohlen.
»Völxen, setz dich zu uns!« Auch Jens Köpcke und seine Frau Hanne sind inzwischen an ihrem Ziel angekommen und haben sich zu drei lodengrün gekleideten Herren und zwei Damen an den Tisch gesetzt. Völxen ist nicht scharf auf die Gesellschaft der Waidmänner, aber die Einladung auszuschlagen wäre ein Affront. Also lässt er sich mit einem Gruß neben Hanne Köpcke auf der Bierbank nieder. Deren Ehemann stellt eine Flasche Gilde vor Völxen hin. Ein großer Schluck entschädigt den Kommissar für die zurückliegenden Strapazen, händereibend nimmt er seine Mahlzeit ins Visier. Natürlich ist ihm klar, dass Schweinefleisch eine Todsünde ist, aber diesen Happen hat er sich jetzt redlich verdient. Bei der Bergfahrt haben seine Muskeln garantiert eine Menge Kalorien verbrannt, und für ein paar Minuten wird man eine Diät ja wohl auch mal unterbrechen dürfen.
»Guten Abend zusammen. Rück doch mal, Bodo.« Schon pflanzt sich Sabine neben ihn auf die Bank, und Völxen, der keine Lust auf einen ihrer Vorträge hat, schiebt den Schinkengriller dezent zu Jens Köpcke hinüber. Geistesgegenwärtig erkennt der Nachbar die Brisanz der Situation, zwinkert Völxen komplizenhaft zu, und gleich darauf muss dieser zusehen, wie sein Gegenüber herzhaft in das saftige Fleisch beißt, während es ihm selbst geht wie dem pawlowschen Hund. Für einen sehnsüchtigen Moment denkt der Kommissar an seine Mitarbeiterin Oda Kristensen. Sie hat ihn und Sabine eingeladen, die Ostertage in Frankreich zu verbringen. Im Dorf ihres Vaters gäbe es günstige Ferienwohnungen und zwei exzellente, preiswerte Restaurants, hat sie ihn gelockt und hinzugefügt: »Du musst auch keinen Lammbraten essen, versprochen.« Er hat abgelehnt mit dem Hinweis auf liegen gebliebene Arbeit in Haus und Garten, was ja auch stimmt. Das ehemalige Bauernhaus, das er vor zwanzig Jahren in einem Anflug von Romantik gekauft hat, befindet sich seither im Zustand der Renovierung. Sicher, es ist einiges entstanden: der Kaminofen, der Wintergarten, und doch ist noch so viel zu tun. Und auch die Schafe halten ihn ziemlich auf Trab. Trotzdem – wie schön wäre es, jetzt in einem Restaurant zu sitzen, in Erwartung eines opulenten Menüs.
»Wer sind die Leute?«, fragt er Sabine leise, denn Köpcke hat es versäumt, ihn vorzustellen. Wahrscheinlich nimmt sein Nachbar an, dass Völxen ebenso wie er jeden im Dorf kennt, was jedoch nicht der Fall ist. Ab und zu bekommt er unfreiwillig Klatsch geboten, mit dem ihn Köpcke über den Zaun hinweg versorgt, aber meistens hört er dabei gar nicht richtig hin. Sabine Völxen, seit jeher besser ins Dorfleben integriert, klärt ihren Mann mit flüsternder Stimme auf: »Die zwei Herren am Tischende sind Gutensohn und Lammers, die haben die Jagd hier in der Gegend gepachtet. Lammers ist der Dürre mit dem Pferdegebiss, der massige Mittfünfziger mit den Hängebacken ist Gutensohn. Die Frau mit der Herta-Müller-Frisur gehört zu Lammers und die Blonde da drüben zu Kolbe, den kennst du ja.«
Wolfgang Kolbe, der eine Schreinerei im Dorf hat, ist Völxen allerdings bekannt. »Den kann ich gleich fragen, wo die Bretter für den neuen Zaun so lange bleiben.« Schweigsam, hungrig und etwas gelangweilt lauscht Völxen dem Tischgespräch.
»Hoffentlich gibt es dieses Jahr nicht gar so viele Wildschweine«, seufzt Lammers und streicht sich bekümmert über seinen sorgfältig gestutzten grauen Vollbart.
»Die Hoffnung kannst du begraben«, antwortet Karl-Heinz Gutensohn, der Völxen schräg gegenübersitzt. »Ich habe die Tage eine Bache mit neun Frischlingen beobachtet. Neun Stück!«
»Dann müsst ihr Jäger halt was dagegen tun«, fordert Jens Köpcke forsch.
»Genau. Es ist nicht lustig, wenn sie einem den Gemüsegarten umwühlen«, stößt seine Frau ins gleiche Horn und nickt dazu so heftig, dass ihr Doppelkinn bebt und ihre Glubschaugen jeden Moment aus den Höhlen zu springen drohen. Wenn es um ihre Plantage geht, versteht Hanne Köpcke überhaupt keinen Spaß.
»Das ist leichter gesagt als getan«, beteuert Schreiner Kolbe, ein großer, breitschultriger Typ mit Bauchansatz.
»Wir kommen dieses Jahr einfach nicht nach«, jammert Gutensohn. »Wir haben im Winter schon einige Nächte auf dem Hochsitz verbracht, mein Junge und ich. Aber die Biester sind scheu und verdammt schlau. Gleich morgen werde ich wieder ansitzen«, verkündet er. »Vielleicht gibt’s doch noch ’nen fetten Osterbraten.«
»Falls es heute nicht zu viele Bierchen werden«, grinst Köpcke.
»Apropos Bier«, meint Gutensohn und leert die zweite Hälfte seiner Bierflasche, ehe er in Richtung der Zelte ruft: »He, Torsten! Bring uns noch eine Lage!«
Ein großer, kräftig gebauter Junge schlurft wenig später heran und stellt neun Flaschen Gilde auf den Tisch. Gutensohn reicht seinem Sohn einen Zwanziger. »Behalt den Rest. Ist ja für eure Kasse.« Der Junge nickt und bewegt sich in Zeitlupe zurück zum Zelt.
»Die sind total übernächtigt«, stellt Frau Lammers fest. Die gut erhaltene Brünette mit der markanten Frisur ist bisher ebenso schweigsam gewesen wie das farblose Wesen neben Schreiner Kolbe.
»Die Jungs haben heute Nacht durchgemacht und das Feuer bewacht«, erklärt Wigbert Lammers und bleckt sein Pferdegebiss zu einem Lächeln, wobei er den Kopf in Richtung Grill wendet. »Unser Ole schläft beim Würstchenumdrehen auch fast ein.«
Das kann Völxen bestätigen, aber er hält den Mund, um sich nicht bei Sabine zu verraten.
»Die ganze Nacht habe ich schlecht geschlafen und Albträume gehabt, bis der Bengel heute Morgen endlich wohlbehalten zu Hause war«, bekennt Frau Lammers und seufzt so tief, dass die Härchen ihres Fuchskragens in Bewegung geraten. Bestimmt ist dieser Kragen einst quicklebendig um den Süllberg herumgestreift, vermutet Völxen, der dem Waidwerk noch nie viel abgewinnen konnte.
Jeder am Tisch weiß, worauf die Gattin des Jägers anspielt. Es herrscht ein übler Brauch, dem Nachbardorf den Brenngutstapel bereits in der Nacht vor dem Osterfeuer anzustecken. Vor einigen Jahren sind dadurch in einem Dorf bei Northeim fünf Jugendliche verbrannt, die sich zum Schlafen zwischen das gestapelte Schnittgut gelegt hatten.
»Ich dachte immer, die vielen Maisfelder sind schuld daran, dass es so viele Sauen gibt«, lenkt Sabine Völxen von dem traurigen Thema ab.
»Richtig. Mais für Biosprit, der schiere Irrsinn!«, pflichtet ihr Köpcke bei, der damit bei seinem Lieblingsthema angekommen ist: dem Wahnsinn des weltweiten Agrarwesens im Allgemeinen und den Zumutungen der Agrarpolitik der EU im Besonderen.
»Der Mais ist schuld und der Klimawandel, vor allem die milden Winter!«, ergänzt Lammers.
Nachdem man sich lang und breit über die Verfehlungen der EU-Politik verbreitet und auch Völxen eine Lage Bier spendiert hat, meint Sabine: »Wollen wir mal Wanda suchen und zusammen zum Feuer gehen?«
Völxen ist dankbar für diesen Vorschlag. Als er aufsteht, merkt er die drei Bier. »Ich muss was essen!«
»Tu das«, rät ihm Sabine. »Ich koche heute sowieso nicht mehr. Warum hast du denn Köpcke deinen Schinkengriller gegeben?«
Völxen kauft sich eine rote Bratwurst mit viel Senf, die er hastig verschlingt. Wanda kreuzt ihren Weg, und zu dritt gehen sie den Feldweg entlang und nähern sich dem prasselnden Feuer. Auch in diesem Jahr ist wieder ein gewaltiger Haufen Brandgut zusammengekommen, und das Feuer braucht die Konkurrenz der Nachbardörfer nicht zu fürchten. Schön, dass wir mal wieder was zusammen unternehmen, denkt Völxen. Sind selten geworden, diese Anlässe.
Während sich Sabine und Wanda den Flammen nähern, bleibt Völxen am Wegrand stehen und wendet sich nach Norden. Von hier oben hat man einen weiten Blick über die Landeshauptstadt und darüber hinaus. Sein Jagdrevier. Die andere Welt, in die er eintaucht, sobald er dieses Dorf verlässt und den Dienst antritt. Die Stadt funkelt wie ein Teppich aus Tausenden von Lichtern, darüber wölbt sich ein orangefarben leuchtender Himmel. Die dunklen Stellen am Boden sind die Eilenriede, das große Waldgebiet, das Hannover durchzieht, und der Maschsee.
Völxen war ein Stadtkind, aber die Ferien verbrachte er immer bei seinem Großvater auf dem Land. Großvater Friedhelm hatte einen Hof in Isernhagen, züchtete Hannoveraner und baute Obst an. Fragt man Völxen nach dem Beruf seines Vaters, wird er jedoch schweigsam. Von Jugend an war ihm dessen Beruf peinlich, und das ist sogar noch heute so, obwohl sein Vater schon seit fünf Jahren tot ist. Denn es ist Bodo Völxen so oft passiert, dass, kaum dass er das Wort Friseur ausspricht, automatisch – ausgesprochen oder nicht – die Frage im Raum steht. Nein, er war nicht schwul! Otto Völxen wurde vermutlich nur deshalb Friseur, um sich von seinem dominanten, kernigen Vater abzugrenzen. Friedhelm Völxen war ein kräftiger Hüne, der selbstverständlich einen »richtigen Kerl« aus seinem zarten Ältesten machen wollte – und natürlich einen Bauern. Nein, Otto Völxen war nicht schwul, er war vielmehr ein ziemlicher Hallodri, der Völxens Mutter verließ und zu einer anderen Frau zog, als sein Sohn Bodo fünfzehn war. Ein weiterer Grund, weshalb Völxen nicht gerne über seinen Vater spricht. Ihr Verhältnis war seither getrübt, und was Charakter und Statur betrifft, kommt Völxen ohnehin ganz nach seinem Großvater Friedhelm.
»Jetzt wird mir klar, warum du Polizist geworden bist!«, hat Oda Kristensen seinerzeit ausgerufen, als sie davon erfahren hat. »Abgrenzung, der Klassiker. Ein Machoberuf musste her.«
»Stimmt. Ursprünglich wollte ich Boxer werden.«
»Warum nicht Bauer?«
»Den Hof erbte mein Onkel, der hat ihn im Plümecke versoffen. Und zum Boxer hat es leider nicht gereicht.«
Heute erkennt Völxen sehr wohl die feine Ironie des Schicksals: Als sich Wanda vor gut einem Jahr in einen Bauernsohn verliebte und verkündete, sie wolle Biobäuerin werden, war er derjenige, der sich am meisten darüber aufgeregt hat. Die Beziehung der beiden ging kurz nach Weihnachten in die Brüche, über die Gründe hat sich seine Tochter ausgeschwiegen. Sie hat lediglich verlauten lassen, dass sie nun nicht mehr Landwirtschaft studieren möchte, sondern »was mit Medien«. Zurzeit macht sie ein Praktikum bei Leine-TV, einem privaten Fernsehsender, was Völxen wiederum für Zeitverschwendung hält. Allerdings ist er nicht nach seiner Meinung gefragt worden.
Er versucht, im Nachtglühen der Stadt seine Arbeitsstelle auszumachen, die Polizeidirektion Hannover. Schräg links vom Maschsee müsste sie liegen … Als ihm bewusst wird, was er da tut, schimpft er sich einen Idioten, wendet sich ab und nähert sich dem Feuer. Der riesige Haufen ist schon ein gutes Stück heruntergebrannt, in der Mitte hat sich grellgelbe Glut gebildet, oben züngeln die Flammen gierig nach Nahrung. Scheite, die aus dem Haufen stürzen, sprühen Funken. Kinder toben johlend herum und stochern mit qualmenden Stöcken in der Glut, um rasch zurückzuspringen, wenn sie es vor Hitze nicht mehr aushalten. Ihre Köpfe sind knallrot. Mütter und Väter in Jack Wolfskin-Parkas und mit Bierflaschen in den Händen unterhalten sich mit ihresgleichen, während sie ihren zündelnden Nachwuchs im Auge behalten.
»Jonas, nicht so nah ans Feuer«, warnt eine Frau mit einer Stimme wie eine Kreissäge, und das nicht zum ersten Mal, dazu bellt ein Hund unaufhörlich. Liebespärchen küssen sich im Schein der Flammen, Jugendliche stehen grüppchenweise beisammen, Bierflaschen klirren aneinander, einer rülpst. Gelächter. Wanda hat Freunde getroffen, man macht Fotos von sich und dem Feuer. Übermorgen wird in den Zeitungen der exzessive Alkoholgenuss der Jugendlichen bei den diversen Osterfeuern beklagt werden, so wie jedes Jahr. Als ob sie dazu das Osterfeuer bräuchten, denkt Völxen und: Wen wundert’s, die Alten saufen ihnen ja seit Jahren etwas vor.
»Jonas, geh nicht so nah ans Feuer. Ich sag’s nur einmal!«
Völxen wünscht, es wäre so. Er stellt sich neben seine Frau Sabine, die sich ganz der archaischen Faszination der Flammen überlässt. Ihre Wangen sind rot, auch Völxen spürt die Hitze im Gesicht. Er legt den Arm um sie, sie lächeln sich an. Ein kleiner, schwereloser Glücksmoment.
Das Feuer ist inzwischen arg in die Breite gegangen. Ein Trecker wird angeworfen. Der junge Mann hinter dem Steuer scheint noch nüchtern zu sein. Geschickt hantiert er mit der großen Schaufel, um das glühende Brandgut wieder zusammenzuschüren. Es qualmt. Die, die in Windrichtung stehen, fliehen rasch auf die andere Seite.
»Jonas, nicht so nah ans Feuer, sonst gehen wir sofort nach Hause!«
Die Umstehenden husten, während sie den Vorgang interessiert beobachten und Ratschläge erteilen, die der Fahrer ohnehin nicht hören kann.
Völxen fragt sich besorgt, ob die Glut nicht die Reifen des Treckers beschädigt. Aber der Fahrer macht das offensichtlich nicht zum ersten Mal, der wird schon wissen, was er tut. Funken stieben, als er eine größere Ladung glühender Holzstücke auf die Schaufel lädt.
Plötzlich geht ein Schrei durch die Menge, dann noch einer. Instinktiv weichen die Menschen ein paar Schritte zurück, Hände pressen sich auf aufgerissene Münder und verdecken Kinderaugen, Männer fuchteln wild mit den Armen, um dem Fahrer zu bedeuten, dass er die Schaufel nicht über dem Feuer auskippen soll. Endlich scheint der Mann zu verstehen, dass etwas nicht stimmt, er legt den Rückwärtsgang ein. Langsam senkt sich die Schaufel herab, bis sie den Boden berührt. Für einen kurzen Moment hört man nur das Knacken und Knistern des Feuers und den Treckermotor im Leerlauf. Sogar der Köter hat aufgehört zu bellen. Dann kreischt eine Mädchenstimme: »Iiiihhh! Eine Leiche!«
Sie hat recht. Inmitten des glühenden Geästs liegt die verbrannte Leiche eines Menschen. Bodo Völxen stockt der Atem, er verspürt den Impuls, sich abzuwenden, die Augen zu schließen, aber er zwingt sich, hinzusehen.
Der Körper ist verkrümmt. Fechterstellung würde Dr. Bächle sagen, tritt bei Brandopfern durch Zusammenziehen der Sehnen und Schrumpfung der Muskulatur ein. Nur ein Arm hat sich dieser Regel offenbar widersetzt, er ragt über den Rand der Schaufel hinaus, die Finger sind zur Faust geballt und die zittert gespenstisch im Takt des Motors, als wollte sie den Umstehenden drohen. Die Haut ist schwarz und an einigen Stellen aufgeplatzt. Völxen muss unwillkürlich an die eben verzehrte Wurst denken, die genauso aussah, er kann sich nicht gegen diesen schändlichen Gedanken wehren, obwohl er es versucht, schon aus Selbstschutz. Mit hechelnden Atemstößen kämpft er gegen die aufsteigende Übelkeit an. Er weiß, dass er jetzt etwas tun muss, dass in diesen Augenblicken seine Geistesgegenwart und Umsicht gefragt sind, jetzt oder nie. Schließlich ist er der leitende Hauptkommissar im Dezernat 1.1.K, der Abteilung für Todesermittlungen und Delikte am Menschen, das weiß jeder im Dorf, und man erwartet nun mit Recht von ihm, dass er die Situation irgendwie regelt, organisiert, dass er das Kommando übernimmt. Stattdessen steht er da wie ein Schauspieler, der seinen Text vergessen hat. Er kann nicht mehr hinsehen, es geht einfach nicht. Dieser verkohlte menschliche Leib da auf der Schaufel ist nicht die erste verbrannte Leiche, mit der er konfrontiert wird, aber es ist auch nicht der grässliche Anblick, der ihn lähmt und ihm den Magen umdreht, sondern das Gefühl, dass soeben eine Grenze überschritten wurde.
Tod und Gewalt sind Dinge, denen er sonst nur im Dienst begegnet, wohlvorbereitet durch einen Anruf der Leitstelle und die Fahrt zu einem Leichenfundort, wo meistens schon die Spurensicherung auf ihn wartet. Jetzt hat ihn das Grauen völlig überraschend und mit seiner ganzen elementaren Wucht dort getroffen, wo er es am wenigsten erwartet hat: in seinem Refugium, an dem Ort, an dem er sich normalerweise davon erholt. Seine zwei Welten haben sich überschnitten. Schweiß bricht ihm aus allen Poren, er ringt nach Luft. Hektisch reißt er am Kragen seiner Jacke und redet sich ein, dass es an der Hitze des Feuers liegt, dass seine Atemnot mit dem Sauerstoff zu tun hat, den die Flammen verzehren. Dann, ganz langsam, beginnt sein Polizistenhirn wieder zu arbeiten. Die Tragödie mit den verbrannten Jugendlichen, auf die seine Tischgenossin vorhin anspielte, fällt ihm ein. Nein, unmöglich. Dieser Junge müsste ja nicht nur die vorangegangene Nacht, sondern auch den ganzen Tag in dem unbequemen Haufen verbracht haben. So betrunken kann man ja gar nicht sein, oder?
Den Schrecksekunden folgt ein großes Durcheinander. Entsetzte weichen schockiert zurück und prallen auf die ersten Neugierigen, die sich nach vorn drängeln. Schlichtere Gemüter bleiben einfach gaffend stehen, Teenager kreischen, Eltern brüllen hysterisch nach ihren Kindern und zerren sie weg, als würde von dem Leichnam eine unmittelbare Gefahr ausgehen.
Auch Völxen gerät nun endlich in Bewegung. Reflexartig fasst er Sabine bei den Schultern und dreht sie herum. Viel zu spät natürlich. Solche Bilder, das weiß er aus Erfahrung, fräsen sich binnen Sekundenbruchteilen unauslöschlich ins Gehirn. Wanda! Wo ist Wanda? Er kann sie nirgends sehen. Mechanisch zieht er das Handy aus der Brusttasche seiner Jacke und informiert die Leitstelle in kurzen Worten über den Vorfall.
»Mensch, Kalle, mach doch mal den Motor aus!«, ruft jemand. Der verwirrte Fahrer stellt endlich den Trecker ab, springt herab und weicht stolpernd zurück, als er sieht, was er da aus der Glut aufgegabelt hat.
Die ersten Fotoblitze zucken auf. Ein rasch anschwellender Zorn vertreibt nun die letzten Reste von Völxens Lethargie. Denn im selben Moment, in dem er diese widerliche Smartphone-Bande, diese schamlosen, schäbigen Voyeure, denen nichts, aber auch gar nichts mehr heilig ist, verflucht, sieht er seine Tochter Wanda, die ebenfalls ihr Fotohandy auf die Leiche gerichtet hat.
Bodo Völxen hat seine Tochter nie geschlagen, und wenn es ihm doch einmal nötig erschien, hat er den Konflikt an Sabine delegiert. Aber in diesem Moment verspürt er einen sehr starken Drang, das Versäumte nachzuholen. Mit den Worten »Hast du denn überhaupt keinen Anstand mehr?« packt er ihren erhobenen Arm und reißt ihr den Apparat aus der Hand. Wanda will protestieren, aber als sie die unbändige Wut im Gesicht ihres Vaters sieht, hält sie lieber den Mund.
Völxen hat alle Schwäche endgültig überwunden. Er holt tief Luft und brüllt: »Hier spricht Hauptkommissar Völxen von der Polizeidirektion Hannover. Alle Anwesenden verlassen jetzt bitte sofort die Feuerstelle und machen den Weg für die Einsatzfahrzeuge frei!«
Die Mehrzahl der Leute scheint nur darauf gewartet zu haben, dass ihnen jemand sagt, was sie tun sollen. Man weicht zurück. Ein paar hartnäckig Fotografierende brauchen jedoch eine deutlichere Aufforderung: »Verschwindet, ihr Idioten, ehe ich mich vergesse!« Und einen jungen Mann muss Völxen tatsächlich am Kragen packen und ihn unter Androhung wüster Gewalt eigenhändig wegzerren. Als das geschehen ist, wendet er sich um zu Frau und Tochter und raunzt beide an: »Los, steht hier nicht rum. Stellt euch an den Weg und notiert Namen und Adressen der Leute. Das sind alles Zeugen.«
Feiertage sollten abgeschafft werden! Jule Wedekin geht zum Kühlschrank und gießt sich ein Glas Pinot Grigio ein. Kein Alkohol vor Sonnenuntergang, diese Regel hat sie sich selbst gesetzt. Aber nun ist es fast dunkel, und ein Glas ist drin, auch wenn sie Dienst hat. Früher hat sie Sonntage und Feiertage herbeigesehnt und genossen, doch seit einigen Monaten sind sie für Jule die schiere Qual. Ostersonntag. Das heißt, morgen droht noch so ein leerer Tag. Ein Tag, an dem Tristesse und Einsamkeit aus den Zimmerecken kriechen, ein endloser Tag, an dem sie zwar deutlich erkennt, dass in ihrem Leben gerade etwas falsch läuft, es aber dennoch nicht fertigbringt, den Kurs zu korrigieren. Sie hätte doch mit ihrer Mutter nach Mallorca fahren sollen, auch wenn diese ihr nach einem halben Tag gründlich auf die Nerven gegangen wäre.
Mit dem Glas in der Hand steht sie auf dem Balkon. Der Abend ist warm. Man könnte hier sitzen, auf den blau lackierten Stühlen, eine Flasche Wein, zwei Gläser, leise Gespräche beim Flackern eines Windlichtes … Sie blinzelt die Bilder weg. Durch einen Tränenschleier schaut sie hinunter auf die Straße, die von prächtigen Altbauten gesäumt wird. Es ist nicht viel los in der List. An einem solchen Tag sitzen die Familien zusammen und essen Lammbraten. Sie muss an ihren Chef denken, Bodo Völxen, der Schafe als Kuscheltiere hält und sich bei jeder Gelegenheit über »diese verdammte Lämmerfresserei« aufregt.
Selber schuld, ich müsste heute nicht alleine sein, sagt sich Jule. Sie hat die Einladung ihres Vaters zum gemeinsamen Abendessen mit seiner neuen Lebensgefährtin ausgeschlagen. Regelmäßig redet sie sich ein, diese Person nicht leiden zu können. Aber wenn sie ganz ehrlich ist, muss sie zugeben, dass sie dieser Frau unrecht tut. Unter anderen Voraussetzungen würde sich Jule vielleicht sogar ganz gut mit ihr verstehen – sie ist ja nur wenige Jahre älter als sie selbst. Tief in ihrem Inneren weiß Jule, dass bei der Ablehnung dieser Frau nicht nur Solidarität mit ihrer Mutter eine Rolle spielt, sondern auch eine Portion Neid mitschwingt. Was hat sie, das ich nicht habe? Warum verlassen andere Männer, sogar ihr eigener Vater, ihre Frauen, nur er nicht? Ob er wohl gerade am Tisch sitzt und die Lammkeule anschneidet? Sie verbietet sich den Gedanken an das Familienleben ihres – ja, was eigentlich? Freund? Nein, dafür sieht man sich zu selten und stets heimlich. Liebhaber? Geliebter? Verhältnis? Egal wie man es nennt, es ist ein unbefriedigender Zustand, dessen Beendigung sie sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche vornimmt. Aber immer wieder schiebt sie die Entscheidung auf oder macht sie so rasch rückgängig, dass ihr Geliebter gar nichts davon merkt. Schon wieder ertappt sie sich dabei, wie sie nach ihrem neuen Mobiltelefon schielt und den Apparat in Gedanken beschwört, doch endlich einen Laut von sich zu geben. Er könnte ja wenigstens eine SMS schicken, ihr zeigen, dass er an sie denkt. Falls er das überhaupt tut.
Okay, Alexa Julia Wedekin, du schwörst jetzt und hier einen heiligen Eid: Wenn er sich bis morgen Abend nicht bei dir gemeldet hat, dann machst du am Dienstag Schluss, und zwar endgültig. Und wenn du noch einen Funken Selbstachtung besitzt, dann hältst du dich dieses Mal daran.
Jule zuckt zusammen, als es klingelt. Es ist nicht ihr Telefon, sondern die Türklingel. Der Wein schwappt aus dem Glas über ihre Hand. Jule stellt es ab und durchquert mit raschen Schritten ihre Wohnung.
Er hat sich loseisen können für ein paar Stunden, er hat sich mit seiner Frau gestritten, er hat sie verlassen, steht mit einem großen Koffer und einem verlegenen Lächeln vor der Tür. Feiertage wirken ja oft wie ein Katalysator auf angeknackste Beziehungen, auch wenn Weihnachten dafür eher prädestiniert ist …
»Na, schöne Frau, bist du fertig?«
Thomas, der in schwarzen Jeans und einem weißen Hemd vor ihr steht, schaut sie prüfend an, um dann festzustellen: »Du hast es vergessen.«
Jule dämmert es. Da war so eine vage Verabredung, neulich, als sie Thomas und Fred im Hausflur getroffen hat. »Verdammt, die Party im Ernst August. Stimmt, tut mir leid.«
Schon steht ihr Nachbar in ihrem Flur. »Macht nichts. Wir sind früh dran, ich genehmige mir ein Weinchen, bis du fertig bist.«
»Ist es schlimm, wenn ich nicht mitkomme? Ich bin gerade gar nicht in der Stimmung für so was, ich …«
Thomas schließt die Tür hinter sich und schüttelt den Kopf. »Keine Ausreden. Du kommst mit. Oder willst du dir etwa das Oster-Fernsehprogramm reinziehen und dich dazu betrinken?«
»Was spricht dagegen?«
»Los jetzt, wasch dich, schmink dich und zieh dich sexy an, die Konkurrenz schläft nicht.«
Jule seufzt und verschwindet im Bad.
»Na also, geht doch«, bemerkt Thomas zwanzig Minuten später. Jule trägt ein weit ausgeschnittenes brombeerfarbenes T-Shirt, einen kurzen schwarzen Rock und schwarze Sandaletten mit für ihre Verhältnisse schwindelerregend hohen Absätzen. Leonard mag hohe Absätze. Sie packt ihr Handy ein.
»Dein Lover wird sowieso nicht anrufen, der macht in Familie.«
»Ich habe Bereitschaftsdienst.« Das kommt davon, wenn man sich mit diesen Kerlen bekifft und dann Dinge sagt, die man besser für sich behalten hätte. Aber das Gras, das es ein Stockwerk höher zu rauchen gibt, ist wirklich erstklassig, und Jule ist im Grunde froh, Thomas und Fred als Nachbarn zu haben.
»Noch immer dieser Bulle?«, erkundigt sich Thomas, als sie in der Stadtbahn sitzen.
Jule nickt. Ihr Blick wandert zum Fenster, aber sie sieht nur eine junge Frau mit dunklen, kinnlangen Haaren, honigfarbenen Katzenaugen und einem zu roten Lippenstift.
»Dann wird es erst recht Zeit, dass du unter Leute kommst. Wer weiß, vielleicht wartet an der Bar schon dein Ritter auf dem weißen Pferd auf dich.«
»Ich wusste gar nicht, dass Pferde ins Brauhaus dürfen«, meint Jule und probiert ein Lächeln, das ihr aber kläglich entgleist.
»Scheiß auf den Ritter«, meint Thomas. »Ich finde, wir sollten endlich Sex haben.«
»Du meinst, aus therapeutischen Gründen?«
»Der Grund ist mir egal. Aber ich wette, danach schaust du den Kerl nie mehr an.«
Der Satz könnte auch von ihrem Kollegen Fernando Rodriguez stammen – vielleicht weniger unverblümt, denn hinter seiner Machofassade ist Fernando ein verklemmter Romantiker, der heimlich Bollywoodfilme guckt.
»Ich überleg es mir.«
»Das sagst du seit Monaten. Fred hat sich auch schon darüber beklagt.«
Nicht, dass Jule nicht auch schon daran gedacht hätte, in schwachen Momenten. Es gibt ja nichts, was dagegen spricht. Thomas ist nett und durchaus vorzeigbar, ebenso sein Mitbewohner Fred. Aber Leonard Uhde hat sich in ihr Innerstes gefressen wie ein Krebsgeschwür. Jule ist nicht naiv. Sie weiß, dass es nicht schmerzlos enden wird.
Sie verlassen die Bahn an der Station Marktkirche. Der Wind fegt über den Platz, er ist mild und seidenweich und führt einen verheißungsvollen Duft nach Frühling mit sich. Irgendetwas in Jule zieht sich zusammen, ihr Blick sucht Halt an der Fassade des gewaltigen Kirchenbaus. Sie weist Thomas auf die elegante Backsteingotik aus dem vierzehnten Jahrhundert hin, aber die Aufmerksamkeit ihres Begleiters gilt im Augenblick den Hinterteilen zweier Frauen in sehr kurzen Röcken, die vor ihnen den Kirchplatz überqueren. Die Absätze ihrer hohen Stiefel hacken auf das Pflaster ein, fast klingt es wie Pferdegetrappel. Seufzend über so viel Ignoranz stöckelt Jule neben Thomas her.
Das Brauhaus Ernst August liegt nur ein paar Meter um die Ecke, Jule kennt das Lokal hauptsächlich aus ihrer Zeit als Streifenpolizistin im Revier Mitte. Drinnen läuft ein alter Song von Nena. Jule bleibt wie angewurzelt vor dem Eingang stehen. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Das ist nur am Anfang so. Später wird die Musik besser, wirklich«, versichert Thomas.
»Ich meine das da!« Sie weist auf das Schild neben der Tür: Single-Oster-Party – Open End. »Vergiss es, ich geh da nicht rein!«
»Jetzt sei nicht so versnobt.«
»Ich bin nicht versnobt«, sagt Jule wütend. Oder doch? Erst kürzlich hat Fernando sie ein »verwöhntes Professorentöchterchen« genannt – sie hat vergessen, was der Anlass dafür war, sie weiß nur noch, dass sie mit »verzogenes Muttersöhnchen« gekontert hat und dass danach einen halben Tag Funkstille zwischen ihnen im Büro herrschte.
»Du bist doch Single, oder? Wo ist das Problem?«
Das Problem? Das Problem ist, dass der Besuch einer solchen Veranstaltung in Jules Augen einer Kapitulation gleichkommt.
»Geht doch mal weiter, andere wollen auch noch rein«, beschwert sich eine eunuchenhafte Männerstimme hinter ihnen. Jule macht dem Eiligen Platz und taxiert das Publikum. Viel solariumgebräunte nackte Haut, etliche Tattoos, breite Gürtel, billiger Schmuck, ein Muschelkettchen, das eine haarige Brust ziert. Die Stiefelmädchen sind auch schon da und unterhalten sich mit zwei Typen mit rasierten Köpfen und Balkenbrillen. Jule hat genug gesehen. Sie wird jetzt auf der Stelle nach Hause fahren und sich bei einer Flasche Wein Stirb langsam ansehen. »Eins ist gut: Seit es Ed Hardy gibt, erkennt man die Idioten wenigstens sofort«, meint sie zu Thomas und wendet sich zum Gehen.
Thomas legt ihr die Hand auf die Schulter. »Komm schon, du musst ja keinen von denen heiraten. Aber man kann hier wunderbar ablästern. Ein Bier wenigstens, dann können wir immer noch woanders hin.«
»Woanders hin« klingt gut in Jules Ohren. Eine Kleinigkeit essen wäre auch nicht schlecht. »Okay, ein Bier. Und bilde dir ja nicht ein, dass ich hier tanze.«
»Und was machst du so beruflich?« Sandras blaue Puppenaugen sind erwartungsvoll auf Fernando gerichtet.
»Ich bin bei der TUI.«
»Ah.«
Wie – ah? Ah, klasse, oder ah, verdammt? »Ich bin Leiter der Abteilung für Luxushotels.«
»Ah ja.« Sie streicht ihr Blondhaar zurück und piepst: »Musst du diese Hotels denn auch ab und zu selbst testen?«
»Ich muss nicht. Meistens gönne ich meinen Mitarbeitern den kleinen Kurztrip. Aber wenn ich möchte, könnte ich das natürlich. Mit einer so hübschen Begleitung wäre es allerdings noch schöner.« Fernando, der in lässiger Pose an der Bar lehnt, lächelt sie gönnerhaft an. Neben ihm kichert Antonio in seinen Bierkrug. Sandra hebt die zu dünn gezupften Augenbrauen und lächelt. Na also, geht doch! Antonio verdreht die Augen, Fernando tritt ihm heimlich gegen das Schienbein. Der soll ihm bloß nicht die Tour vermasseln!
Sandra. Nettes Stupsnäschen, gut gefüllte Bluse, bisschen zu dicker Hintern, aber noch einigermaßen in Form. Und endlich mal eine, die sogar mit ihren hohen Absätzen noch ein gutes Stück kleiner ist als Fernando.
»Wie heißt du noch mal?«, fragt sie.
»Fernando. Fernando Rodriguez.« Er versäumt nicht, sämtliche Rs seines Namens ausgiebig zu rollen. Frauen finden das sexy.
Prompt beißt Sandra an. »Du bist Spanier?«
»Meine Familie stammt aus Sevilla, der Stadt der Leidenschaft. Der Vater meiner Mutter war ein bekannter Stierkämpfer.«
»Stierkämpfer, ja klar!« Sie schnaubt herablassend, nicht ahnend, dass Fernando gerade den ersten wahren Satz von sich gegeben hat.
»Seine Mutter hat einen Laden für spanische Weine und Lebensmittel in Linden«, mischt sich nun Antonio in die Unterhaltung ein. »Der liegt genau gegenüber von meiner Autowerkstatt.«
Wenn Antonio ihr erzählt, dass ich mit Mama in einer Wohnung lebe, breche ich ihm jeden Knochen einzeln, beschließt Fernando und wirft seinem Kumpel einen warnenden Blick zu.
»Ich sammle Oldtimer«, protzt Antonio. »Wenn du willst, kann ich sie dir mal zeigen.«
»Das sind keine Oldtimer, das sind Schrottkisten zum Ausschlachten«, lästert Fernando. Kann sich Antonio eigentlich kein eigenes Objekt zum Anbaggern suchen? Ist doch grob unfair, ihn die ganze Vorarbeit machen zu lassen und dann sozusagen auf das gesattelte Pferd aufzuspringen. Fernando zieht die Notbremse: »Möchtest du tanzen, Sandra?«
Sie nickt, und Fernando lotst sie durch das Getümmel. Hinter seinem Rücken zeigt er Antonio den gestreckten Mittelfinger. Dieser verdammte Spaghetti soll gefälligst an seinen Autos rumschrauben, nicht an Fernandos Eroberungen.
Aber das darf doch nicht wahr sein! Eben war der Sound noch ganz erträglich, jetzt hat der DJMarquess aufgelegt. Nur kann er jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Schon hüpft Sandra wie ein Flummi zu den pseudospanischen Rhythmen auf der Tanzfläche herum, und Fernando bleibt nichts anderes übrig, als hüftwackelnd den feurigen Südländer zu geben. Die nächste Nummer ist von Shakira – auch nicht viel besser. Wann macht der verdammte DJ endlich Schluss mit dieser Tussi-Pussi-Mucke und legt was Cooles auf? Aber es wird noch schlimmer. Als ein Stück von Silbermond läuft, ist die Schmerzgrenze definitiv überschritten, und Fernando schlägt vor: »Lass uns kurz an die frische Luft gehen.« Sandra ist einverstanden, beide schleusen sich in Richtung Ausgang. Im Vorbeigehen mustert Fernando zwei blutjunge Mädchen in hohen Stiefeln. Hübsche Beine, doch, ja.
Die beiden bemerken seinen Blick, und Fernando bekommt gerade noch mit, wie die eine naserümpfend zu ihrer Freundin sagt: »Jetzt kommen sie sogar schon zum Sterben hierher.«
Während er noch in Schockstarre verharrt, wird er von einem angetrunkenen Tänzer gegen den Rücken einer Frau geschubst, die an der Bar steht.
»Tschuldigung.« Die Frau fährt herum. »Jule?«
»Nein. Was du siehst, ist mein Avatar.« Ihr Tonfall klingt wenig begeistert, und sie sieht nicht so aus, als würde sie sich über die Begegnung freuen. Aber auch Fernando ist an einer Unterhaltung mit der Kollegin nicht gelegen, überhaupt nicht. »Ja dann – viel Spaß noch«, sagt er und dirigiert Sandra rasch in Richtung Ausgang.
Herrgott, ist das peinlich! Ausgerechnet Fernando muss Jule hier treffen, die größte Klatschbase der ganzen Polizeidirektion. Ihr reicht es jetzt. Nichts wie raus hier. Augenblick – bildet sie sich das ein, oder hat ihre Handtasche gerade vibriert. Leonard? Hektisch wühlt sie nach ihrem Telefon. Tatsächlich, das Ding klingelt, was man bei dem Krach hier drin kaum hört.
»Frau Wedekin?«
Das ist nicht Leonard. Es ist Hauptkommissar Völxen, der ihr etwas von einer verbrannten Leiche in einem Osterfeuer erzählt. Auch wenn Jule es vorgezogen hätte, ein Lebenszeichen von ihrem Geliebten zu hören, so ist sie doch nicht unglücklich über den Anruf. Nicht, dass sie wild auf eine verkohlte Leiche wäre, aber nun hat sie einen trefflichen Grund, diesen Ort zu verlassen. Sie wendet sich an Thomas, der noch immer die beiden Stiefelmädchen anbalzt.
»Zahl bitte meine Cola, ich muss los.«
»Jule, nun sei doch nicht sauer!«
»Ich habe einen Einsatz.« Sie drängelt Richtung Ausgang. Vielleicht wird sie dieser Fall über die tristen Ostertage hinweg beschäftigen, sodass sie nicht mehr pausenlos an ihn denken muss.
Draußen steht Fernando neben einer kleinen Blonden, die eine Zigarette raucht. Seine Hand ruht auf der Gesäßtasche ihrer Jeans, die sich wie eine Wursthaut um ihr dralles Hinterteil spannt.
»Los, Rodriguez, vamos, hol deine Jacke, wir müssen aufs Land.«
»Was? Wieso?« Hektisch wie Flipperkugeln gleiten seine Blicke zwischen Jule und seiner Begleitung hin und her. Letztere wirkt irritiert.
Jule unterdrückt ein Grinsen. »Völxen hat angerufen. Leichenfund in seinem Dorf.«
»Du bist ein Bulle?« Sandras runde Puppenaugen haben sich in zwei misstrauische Schlitze verwandelt.
»Und zwar der Böse. Der Gute bin ich«, grinst Jule.
»Äh, ich … bin gleich zurück, Sandra!« Fernando eilt ins Lokal.
»Was war er diesmal, NDR-Redakteur oder TUI-Manager?«, erkundigt sich Jule neugierig.
Sandra tritt wütend ihre Zigarette aus. »So ein Arschloch!« Sie stöckelt auf die Eingangstür zu, aus der Fernando gerade wieder herauskommt, mit seiner Lederjacke über dem Arm. »Ich kann das erklären. Weißt du, ich arbeite undercover, ich durfte dir gar nicht die Wahrheit …«
»Verpiss dich!« Ohne ihn noch einmal anzusehen, verschwindet Sandra.
»Mist. Ich war so kurz davor«, beschwert sich Fernando und sieht Jule verärgert an.
»Ehrlich währt am längsten«, antwortet diese und ruft ein Taxi heran, das sie zur Dienststelle bringen soll.
»Das hat dir wohl Spaß gemacht, was?«, fragt Fernando, als sie im Wagen sitzen und auf der B 217 Richtung Deister fahren.
»Ich bitte dich«, sagt Jule, die das Steuer übernommen hat. »Woher sollte ich wissen, dass du dem Blondchen die Hucke vollgelogen hast? Warum tust du das eigentlich?«
»Sagst du den Kerlen immer gleich, dass du Polizistin bist?«
»Welchen Kerlen?«
»Na, Typen eben. Die du so kennenlernst.«
»Klar, warum denn nicht? Schließlich war das mal mein Traumberuf.«
»Ha! Und was ist mit deinen Nachbarn? Ich kann mich noch gut erinnern, dass du mich diesem Thomas mal als Kollegen vom – was war’s noch gleich? – Landesrechnungshof vorgestellt hast.«
»Das war nur, weil die beiden zu der Zeit noch ihre Hanfplantage auf dem Balkon hatten. Ich wollte sie nicht erschrecken. Aber du lügst ja, um die Mädels ins Bett zu kriegen, das ist was anderes.«
»Ja, klar, bei mir ist das natürlich was ganz anderes als bei dir!«, ereifert sich Fernando.
»Ja, ist es.«
Fernando verteidigt sich: »Ich habe damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. Entweder die Leute mögen prinzipiell keine Bullen, dann hat man eh schon verloren. Andere stellen mir tausend Fragen und wollen gruselige Geschichten hören, sobald ich erwähne, wofür ich zuständig bin. Oder die Mädels kommen auf dumme Ideen, von wegen Sex mit Handschellen und solchen Quatsch.«
»Was spricht denn dagegen?«, feixt Jule, die sich im Stillen über Fernando amüsiert. »Es gibt ja doch nur Ärger, wenn es später rauskommt.«
»Es kommt aber ganz oft gar nicht raus.«
»Okay, wenn man nur auf ’nen One-Night-Stand aus ist …«
»Auf was sollte man denn sonst aus sein, wenn man ins Brauhaus geht?«, entgegnet Fernando.
Jule wirft einen grimmigen Blick zu ihm hinüber. »Wie? Du denkst, ich …«
»Ich denke gar nichts.« Fernando grinst.
»Nein, es ist nicht so, wie du denkst! Thomas hat mich mitgeschleppt, ich hatte keine Ahnung, was da läuft.« Jule merkt selbst, wie kläglich das klingt.
»Ja, ja, schon gut.« Fernando winkt ab.
Die Knöchel an Jules Händen werden weiß, so fest umklammert sie das Lenkrad. Die Schnellstraße wird einspurig, sie passieren das Ortschild mit der Aufschrift Holtensen.
»Immerhin haben sie ’nen McDonald’s«, stellt Fernando überrascht fest.
»Warst du mal bei Völxen zu Hause?«, fragt Jule, die sich wieder beruhigt hat und gern das Thema wechseln möchte.
»Nein, noch nie. Er erzählt nur immer vom Umbau seines Hofes und von der große Fete, die er machen will, wenn alles fertig ist. Also in ungefähr zwanzig Jahren.«
»Diese Schafe würde ich ja gern mal sehen«, bekennt Jule. »Die haben sogar Namen.«
Fernando schüttelt den Kopf. »Der Mann steckt voller Marotten, wie hält seine Frau das bloß aus?«
»So übel ist er nun auch wieder nicht«, verteidigt Jule ihren Chef.
»Ja, sicher gibt’s viel, viel Schlimmere. Aber ich krieg regelmäßig Zustände, wenn er wieder Klopapierfetzen im Gesicht hängen hat, nur weil er sich mit diesem komischen Messer rasiert hat, das noch von seinem Großvater stammt.«
Jule lächelt. »Aber ich mag sein Auto.«
»Die alte DS – ja, die Karre ist große Klasse. Schade, dass er damit nicht mehr zur Dienststelle fahren kann. Verdammte Umweltplakette, wer denkt sich solchen Schwachsinn aus?«
Sie biegen von der Hauptstraße ab und passieren eine angeleuchtete Kirche.
»Hübsch hier«, urteilt Fernando. »Ach, weißt du übrigens schon, dass ich mir wahrscheinlich ein neues Motorrad kaufen werde? Ich muss nur noch den Banker weichklopfen.«
»Eine schwarze Moto Guzzi Bellagio mit 90° V2, Viertaktmotor, 940 ccm Hubraum, 75 PS und einem Sechsganggetriebe – ja, du hast es mal erwähnt«, antwortet Jule. Seit Wochen kennt Fernando kein anderes Gesprächsthema, er nervt die ganze Abteilung damit, und sein Schreibtisch ist bedeckt von Motorradprospekten.
»Hier rechts, den Berg hoch«, sagt Fernando gekränkt.
Jule fährt Schritt, denn auf der Straße kommen ihr zahlreiche Menschen entgegen. »Die reinste Völkerwanderung!«, wundert sie sich. Es handelt sich um Paare und Einzelpersonen, die kleine Kinder an der Hand führen. Die Erwachsenen wirken bedrückt, aber auch die Kinder trotten ungewöhnlich ruhig neben ihnen her. Vermutlich hat Völxen die Leute, die Kinder dabei haben, nach Hause geschickt, kombiniert Jule. Schlimm genug, wenn ein vermeintlich harmloses Sonntagsvergnügen mit dem Anblick einer Leiche endet. Ein Gedanke zuckt auf. Was, wenn er hier ist? Ein österlicher Ausflug mit Frau und Kind, hinaus aufs Land, wo die Osterfeuer größer und prächtiger sind als in der Stadt. Das wäre doch denkbar. Sie ertappt sich dabei, wie sie die entgegenkommenden Leute abscannt und schimpft sich eine dumme Pute. Auf halber Höhe der Straße parken drei Streifenwagen. Jule stellt den Dienst-Audi dahinter ab.
»Der kommt gerade recht!« Fernando springt aus dem Auto und verschwindet rasch im Inneren eines himmelblau gestrichenen Bauwagens, über dessen Eingang Toiletten steht. Jule nutzt die Zeit, um Völxen anzurufen und ihm ihre Ankunft mitzuteilen.
»An den Bierständen vorbei, dann links den Feldweg entlang, und dann sehen Sie es schon.«
Sichtlich erleichtert kommt Fernando aus dem Bauwagen, und zusammen gehen sie das letzte Stück den Berg hinauf, wobei Jule ihr unpassendes Schuhwerk verflucht. Die noch verbliebenen Besucher des Osterfeuers haben sich grüppchenweise zusammengerottet, sämtliche Bierbänke und Stehtische sind besetzt, doch die Stimmung ist sehr gedämpft.
Fernando winkt zwei Frauen zu, die zielstrebig auf sie zukommen. Man begrüßt sich, Jule wird vorgestellt.
»Wanda kennen Sie ja noch, Herr Rodriguez?«, fragt Sabine Völxen.
Früher war Wanda oft dabei, wenn der Kommissar Wein im Laden von Fernandos Mutter gekauft hat; ein blondes Gör mit Zahnspange und Babyspeck um die Hüften. Doch inzwischen hat Völxens Tochter die gleiche schlanke Figur wie ihre Mutter und ebenso strahlend blaue Augen. Nur das kräftige Kinn stammt offensichtlich vom Vater – und wenn man diesem glauben darf, dann hat sie wohl auch seinen Dickkopf geerbt.
»Hallo, Wanda!« Ob er sie überhaupt noch duzen darf?
»Hi, Fernando.«
»Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt, Frau Wedekin«, verrät Sabine Völxen und fügt hinzu: »Aber nur Gutes.«
»Und was erzählt er von mir?«, will Fernando wissen.
»Sagen wir – das meiste davon ist gut.«
Jule unterdrückt ein Grinsen.
Ende der Leseprobe