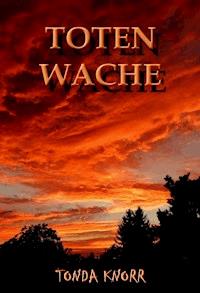
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sarah Fender, eine Berliner Polizistin, gerät bei einem Polizeieinsatz, von ihren Kollegen im Stich gelassen, in einen Hinterhalt. Verprügelt und vergewaltigt, wird sie für dienstunfähig erklärt und in den Ruhestand versetzt. Nach ihrer langjährigen Genesung nimmt sie das Angebot ihres Vaters an, auf einem alten Gutshof zur Ruhe zu kommen. Als dort menschliche Knochenreste gefunden werden, wird bei Sarah langsam wieder der polizeiliche Instinkt geweckt. Der eigentlich wegen Befehlsmissachtung suspendierte Kommissar Frank Wagner, muss sich des Falles annehmen. Was sich anfangs als uninteressanter Fall darstellt, wird zu einer geheimnisvollen Reise durch die deutsche Vergangenheit. Sarah unterstützt den Kommissar bei seiner akribischen Kleinarbeit und wird mehr und mehr zur treibenden Kraft. Zögerlich entwickelt sich zwischen den Beiden, während sie dem Geheimnis der Toten nur schleppend auf die Spur kommen, eine persönliche Zuneigung. Der Fall nimmt ungeahnte Ausmaße an. Der Kreis der Verdächtigen, Opfer und Täter wird immer undurchsichtiger bis der Fall eine ungeahnte Wende nimmt. Der jahrzehntelangen Geheimniskrämerei müde, öffnen sich mehr und mehr die bisher unbeteiligt wirkenden Dorfbewohner, wobei jeder seine eigene Geschichte hat und sich erst heute erkennen lässt, wie weit diese miteinander verflochten sind. Es zeigt sich, dass die gefundenen Knochenreste nicht nur die Überbleibsel eines Kapitalverbrechens sind, sondern führt die Beiden auch zu einem spektakulären Fund. "Totenwache" ist ein Kriminalroman der sich in verschiedene Handlungsebenen aufteilt, wobei der Leser nie den roten Faden verliert, sondern immer den Bezug zum Gesamtablauf herstellen kann. Inhaltlich wurde ein weit verzweigtes Netz gespannt, welches sich nach und nach, versehen mit verschiedenen Spannungskurven, entwirrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 902
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tonda Knorr
Totenwache
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2 - Ein Jahr später
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18 - Drei Monate später
Kapitel 19
Impressum neobooks
Kapitel 1
Dumpfe Basstöne dröhnen zu nachtschlafender Zeit durch die Dunkelheit. Die Straße ist eine der zahlreichen unscheinbaren Nebenstraßen, abseits der schillernden Berliner Flaniermeilen. Kreuz und quer parken die Autos, rechts und links der Straße, und man hat das Gefühl, die Straßenverkehrsordnung wurde hier außer Kraft gesetzt. Die Gegend gehört nicht zu den Vorzeigeadressen Berlins. Arbeitslosigkeit, soziale Armut und Verbrechen sind hier an der Tagesordnung. Das Iron Fist, eine abgehalfterte Diskothek, sollte schon längst geschlossen werden, aber ein aufs andere Mal haben es windige Anwälte geschafft, die Schließung zu verhindern oder aufzuschieben. Eingaben von Anwohnern, besorgten Eltern oder die Beanstandungen der zuständigen Ordnungsämter, nichts hat ausgereicht, um diesen Ort zu resozialisieren. Das Iron Fist ist Treffpunkt von Zuhältern, Nutten, Verbrechern, Geldschiebern, Drogendealern und Rockern. All die Leute, denen man nachts nicht auf der Straße begegnen will. Nichtsdestotrotz ist der Laden Woche für Woche gerammelt voll. Prostituierte und Drogenabhängige jeden Alters geben sich hier die versiffte Klinke in die Hand. Die tägliche Präsenz der Polizei, ob in zivil oder in Uniform, wird ignoriert, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Stadtverordnete, die sich das Problem vor Ort anschauen sollten, wurden hier noch nie gesehen. Heute sollte sich daran etwas ändern. Zumindest ein wenig.
Es ist ein lauer Frühsommerabend. In zwei Zivilwagen warten sechs Polizisten auf den lang vorbereiteten Zugriff. Maasji Haagedorn, Kopf einer großflächig strukturierten Organisation und Drahtzieher diverser Verbrechen, will hier und heute den großen Deal abwickeln und sich dann nach Holland absetzen.
Es ist Mai, und wir schreiben das Jahr 2005. Es soll Sarahs großer Tag werden. Sarah Fender ist Hauptkommissarin, fünfunddreißig Jahre alt, bildhübsch und seit fünfzehn Jahren im Polizeidienst. Ihre Liste von Verhaftungen und Verdiensten füllt Seiten. Seit Jahren ist sie hinter Haagedorn her. Immer wieder konnte er ihr und ihren Kollegen entwischen, aber heute schien alles zu klappen. Ein Informant konnte sich nur durch diesen Tipp einer ihn erwartenden härteren Bestrafung entziehen. Nach und nach hatte die Hauptkommissarin das Netz um Haagedorn enger gezogen, und heute sollte die ewige Jagd endlich ein Ende haben. Nachdem sie den Tipp bekommen hatte, fragte sie sich Tag für Tag, ob das eine Falle sein könnte. Für Haagedorn stand aber zu viel auf dem Spiel. Seit sich Europa immer mehr in Richtung Osten erweitert, haben Menschenhandel, Prostitution und Geldwäsche Hochkonjunktur. Auch an diesem Tag sollte eine siebenstellige Summe im Austausch gegen harte Drogen den Besitzer wechseln. Sarah schaute konzentriert die Straße entlang. Ihre Angst war unbegründet. Er war da. Haagedorn war da. Sein dunkelgrüner Hummer stand vor der Tür. Eine hässliche, schwarze Spinne zierte in Miniaturausgabe nicht nur Haagedorns linke Wange, sondern auch Fahrer- und Beifahrertür. Geschmacklos auffällig, wie Sarah fand. Das Einzige, was fehlte, war das SEK und das BKA. Sarah schienen die Diskussionen um die Zuständigkeit endlos und unsinnig. Man einigte sich auf ein gemeinsames Vorgehen, und jetzt, als es soweit war, waren weder das SEK noch das BKA zur Stelle. Sie und ihre Kollegen sollten eigentlich auch nicht da sein. Das ist Sache der Sonderkommandos, wurde ihr gesagt, aber sie ließ sich aus dem Fall nicht ausschließen, und wie man sieht, hatten sich ihre Befürchtungen bewahrheitet. Keiner war rechtzeitig hier. Immer wieder wanderte der Blick der Hauptkommissarin von ihrer Uhr auf die Eingangstür des Iron Fist. Fast zwanzig Minuten war Haagedorn jetzt schon da drin, und von den Einsatzkommandos immer noch keine Spur. Jeden Augenblick konnte er mit seinen Leuten rauskommen, einen prallgefüllten Koffer voller Geldscheine in der Hand, um dann ein für alle Male aus Deutschland zu verschwinden. Die Ware war schon drin. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt für den Zugriff gewesen. Das Geld, die Drogen und einen der meist gesuchten Drogendealer, alles wie auf dem Silbertablett serviert. Sarah wurde von Sekunde zu Sekunde unruhiger. Haagedorn konnte nur durch die Vordertür rauskommen. Sie wusste, dass der Laden unter anderem geschlossen werden sollte, weil ein zweiter Ausgang fehlte. Unvorstellbar für eine Diskothek, aber diesmal kam ihr das zugute. Sie zuckte jedes Mal zusammen, wenn hinter den fetten Einlassern die Tür aufging. Und genauso erleichtert war sie, wenn stets nur eine betrunkene Nutte mit einem nicht weniger betrunkenen zwielichtigen Typen raustorkelte, um sich in einem dunklen Treppenaufgang ein paar Meter weiter einem Straßenfick hinzugeben.
„Wann kommen die bloß? Wir können nicht mehr lange warten“, fragte Sarah ungeduldig.
„Wir warten. Wir können da nicht mit sechs Mann reingehen. Die machen uns alle.“
Büttner hielt sich an die Vorschriften. Genervt blickte Sarah in die teilnahmslosen Augen ihres Kollegen.
Schon klar, dachte sie sich. Du Pfeife sitzt dir lieber den Arsch breit, als eine eigene Entscheidung zu treffen.
Büttner und sie konnten sich nicht besonders gut leiden. Sie hatten beide gleichzeitig die Ausbildung begonnen. Er war in ihrem Alter und wurde die letzten Jahre öfter mal übergangen, als es darum ging, befördert zu werden. Er war ein Kerl wie ein Baum. Oft schon hatte Sarah sich darüber amüsiert, wie er sich mühsam hinter das Lenkrad zwängte. Auch die anderen Kollegen gehörten nicht zu ihrem Freundeskreis. Eine junge Polizistin, die nicht nur gut aussah, sondern auch noch erfolgreicher war als ihre männlichen Kollegen, hatte es nicht leicht. Immer wieder war sie kleinen Sticheleien ausgesetzt, und es wurden nicht weniger, seitdem Lisa, ihre beste Freundin, auf ihrer Dienststelle angefangen hatte. Es nutzte auch nichts, dass ihr der Polizeidirektor, den sie aufgrund dessen Freundschaft zu ihrem Vater auch privat kannte, wohl gesonnen war. Ganz im Gegenteil. All das war ihr heute aber egal. Ihr ging es nur darum, Haagedorn endlich aus dem Verkehr zu ziehen.
„In fünf Minuten gehen wir rein!“, entschied Sarah.
„Bist du bescheuert? Hier geht keiner irgendwo rein.“ Büttner war sich nicht sicher, ob er Sarahs eindringlichen Vorschlag ernst nehmen sollte.
„Ich leite die Ermittlungen. Wir gehen da rein, wenn keiner kommt“, wiederholte Sarah bestimmend.
„Das BKA leitet die Ermittlungen.“
„Wo siehst du hier das BKA oder sonst irgendwen außer uns?“, fauchte Sarah ihren Kollegen an.
Büttner drehte sich zu ihr um. Sie erwiderte den mürrischen Blick.
„Mach dir keine Sorgen, wenn es sein muss, gehe ich da allein rein. Ihr müsst mir nur den Rücken freihalten. Diese Absteige hat keinen zweiten Ausgang.“
„Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns vielleicht nicht leiden können, aber das ist doch Wahnsinn. Was ist mit Fenstern? Woher willst du wissen, ob er überhaupt noch drin ist?“
Sarah verzweifelte innerlich. Das konnte doch nicht wahr sein. Hatte er nicht zugehört, was sie gerade gesagt hatte?
„Gib mir das Funkgerät.“ Büttner reichte ihr widerwillig das Gerät.
„Fuhrmann? Kommissar Fuhrmann?“
„Ja?“
„Wo bleibt das SEK, das BKA?“
„Sind unterwegs. Zwanzig Minuten. Die Stadt ist dicht.“
Sarah warf das Funkgerät auf das Polster, während sie mit verschlossenen Augen auf der Rückbank des BMWs kniete.
„Scheiße“, fluchte sie.
Sie begann an ihrem Gürtel und dem Pistolenhalfter rumzuzerren.
„Was hast du vor?“, fragte Büttner skeptisch.
Während Sarah das Funkgerät wieder in die Hand nahm, blickte sie Büttner direkt in die Augen.
„Zugriff.“
„Was?“
„Fuhrmann!“, brüllte sie erneut in das Funkgerät. „So viel Zeit ist nicht mehr. Zugriff. Ich gehe rein, drei Mann von dir hinterher. Büttner hält uns den Rücken frei.“
Das „Nein, auf keinen Fall“ hörte sie schon nicht mehr. Sie stand im Dunkel der Hauswand. Ihr Pistolenhalfter flog auf den Rücksitz. Sie steckte sich ihre Waffe hinten in den Hosenbund. Die Jeansjacke, mit zwei Magazinen versehen, verdeckte den Knauf, irgendwie musste sie ja an dem Einlasser vorbeikommen, ohne dem gleich ihre Knarre unter die Nase zu halten.
„Fender, mach keinen Quatsch.“
Fast schon sorgenvoll klang die Stimme von Büttner, aber Sarah war schon auf die knapp fünfzig Meter Laufweg fixiert und registrierte gerade noch so, wie von dem anderen Polizeiwagen die Türen aufgingen. Ihr Schritt war ruhig. Sie war fest entschlossen.
„Die Jungs gehören zu mir“, beruhigte sie den Einlasser.
„Welche Jungs auch immer du meinst, immer rein mit dir.“
Das Lachen des schmierigen Türstehers, der eklige Mundgeruch, seine Bierfahne und der Gestank seiner pissigen Lederklamotten schockte sie nicht so wie der Blick zurück über ihre Schulter. Sie war alleine. Keiner war ihr gefolgt. Jetzt bloß nichts anmerken lassen. Sie stand schon in der offenen Tür und tauchte ein in ein Bad von Nebelschwaden, blitzender und grell flackernder Lichter, dröhnend lauter Musik und dem fürchterlichen Gestank von all dem, was man sich durch Rauchen reinziehen konnte. Sie war die drei Stufen noch nicht ganz unten, da hatte sie schon das Gefühl eines stechenden Kopfschmerzes. Sie bemerkte, wie einige Typen sie am Ärmel zerrten. Alles lief in Sekundenschnelle ab. Durch das wilde Flackern des Lichtes nahm sie um sich herum nur kurz die verschiedenen Gesichter wahr. Sie wollte sich aus den lästigen Umklammerungen befreien, da sah sie für einen kurzen Augenblick sein Gesicht. Die tätowierte Spinne unter seinem Auge erkannte sie sofort, und auch er sah sie. Haagedorn grinste und schaute ihr ins Gesicht. Wieder spürte sie den stechenden Schmerz im Kopf und dann, wie etwas Warmes ihren Hals runterlief. Sie registrierte, wie nicht nur der Griff an ihren Armen fester wurde, sondern sah auch die Blutspuren auf ihrer Schulter. Sie hatte einen stumpfen Gegenstand gegen den Kopf bekommen. Die Arme, mit denen sie zu kämpfen hatte, rammten ihr eine Spritze in den Hals. Gleichzeitig bemerkte sie den Griff einer fremden Hand an ihrer Dienstwaffe. Im Nu drehte sich alles. Sie konnte ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen, ihre eigene Stimme hörte sie nur noch wie weit entfernt. Es war keine Gegenwehr gegenüber den sie festhaltenden Händen möglich, und weit und breit war keiner ihrer Kollegen zu sehen. Halb abwesend versuchte sie, ihre Sinne zu konzentrieren. Keine Chance. Die Männer zerrten sie über die Tanzfläche. Aus den Augenwinkeln konnte sie verschwommen erkennen, dass kein Gast sich für diesen Angriff interessierte und keiner auf ihre gestammelten Hilferufe reagierte. Plötzlich sah sie wieder Haagedorn, der mit zwei seiner Schläger in Richtung Klotür ging. Aus den Augenwinkeln lächelte er ihr zu. Seine schulterlangen Haare hingen rechts und links zottelig an seinem Kopf herunter. Sie wollte ihm gerade ein „Verhaftet!“ hinterher rufen, als sie spürte, wie die Hände, die sie bisher so schmerzhaft festhielten, plötzlich und mit Schwung ihre Arme losließen und sie achtkantig durch die Klotür flog, um gegen das erstbeste Waschbecken zu knallen. Die Fliesen, auf denen sie lag, waren kalt. Alles war verschwommen. Einer der Männer blieb draußen vor der Tür stehen. Sie spürte wieder diese nasse, klebrige Wärme an ihrem Kopf.
Sie versuchte, sich aufzurichten und bemerkte, dass ein Teil ihrer Klamotten mit Blut befleckt war. Ein Fußtritt von Haagedorn gegen ihre Schulter ließ sie wieder zurücksacken.
„Sie sind verhaftet“, stammelte Sarah und sah dabei sehnsüchtig zur Tür, in der Hoffnung, endlich einen ihrer Kollegen oder das SEK oder irgendjemanden, der ihr nur helfen würde, zu sehen.
„Hast du blöde Fotze wirklich gedacht, dass du hier einfach so reinspazierst und mich in meinem eigenen Laden hochnehmen kannst?“, sagte Haagedorn ganz ruhig, in fast schon freundlichem Ton.
Für kurze Zeit schloss Sarah die Augen. Also doch eine Falle. Sie konzentrierte sich wieder.
„Jeder Idiot kann dich hochnehmen …“ Noch bevor sie den Satz zu Ende gestammelt hatte, spürte sie, wie sie von Haagedorns Leuten hochgerissen wurde und ihrem Ebenbild entgegen flog. Mit Müh und Not riss sie ihre linke Hand hoch, konnte aber nicht verhindern, dass das zerberstende Spiegelglas ihre Handfläche aufschlitzte und ihr das Blut durch die Finger ran. An ihrem Hals spürte sie den Druck einer Hand, die weiter versuchte, ihr Gesicht gegen die Spiegelscherben an der Wand zu drücken. Sie wollte sich wehren und zappelte wie verrückt. Ihre Knochen wollten ihr einfach nicht gehorchen. Was immer ihr dieser fette, bärtige Typ nach dem Einlass in den Hals gerammt hatte, es wirkte noch immer. Plötzlich wurde ihre Jeansjacke bis auf halbe Höhe der Arme runtergezerrt. Sie hörte, wie die Magazine und ihr Handy auf die Fliesen aufschlugen und musste feststellen, dass sie sich nun fast überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Haagedorn zog sie an den Haaren und drehte ihren Kopf zu sich.
„Von wem hast du den Tipp bekommen?“
Doch keine Falle, und trotzdem hatte Haagedorn gewusst, dass sie kommen würde.
„Hast du gedacht, mir fällt nicht auf, wie ihr dämlichen Bullen jeden Tag um meinen Laden schleicht?“
Wieder schloss sie die Augen. Keine Auffälligkeiten in der Nähe des Iron Fist, hatte sie ihre Kollegen immer wieder ermahnt. Wieder fragte sie sich, wo die anderen blieben. Sie hatte das Gefühl, schon seit Ewigkeiten in dem Laden zu sein. Ihr schmerzten alle Glieder, und aus ihrer Hand quoll ununterbrochen das Blut. Sie öffnete ihre Augen und sah das verschmitzte Lächeln von Haagedorn.
„Fick dich, du …“ Wieder schaffte sie es nicht, den Satz zu beenden. Sie schrie auf, als sie einen fürchterlichen Schmerz an ihrer linken Schulter spürte. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr jemand mit etwas Scharfkantigen, eine Art Schlagring oder Kralle die Haut von der Schulter ziehen. Haagedorn wandte seinen Blick von der Hauptkommissarin ab und redete auf seinen übereifrigen Schläger ein.
„Was soll der Quatsch? Hast du keine Ohren? Sie will nicht verprügelt werden, sie will gefickt werden.“ Hämisches Gelächter machte sich breit.
Er wandte sich wieder an Sarah.
„Es tut mir leid, ich muss mich für meine Leute entschuldigen.“
Diesmal kam Haagedorn nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Eine Ladung Blut traf ihn, aus Sarahs Mund. Er schmunzelte, während er sich das Blut mit einem sauber gefalteten Taschentuch aus dem Gesicht wischte.
„Nein, mach dir keine Hoffnung. Ich fick keine Bullen, aber meine Leute sind da nicht so wählerisch. Wie das so ist, gutes Personal findet man schwer, und bei euch hier in Deutschland ja bekannter Weise sowieso nicht.“
Akzentfrei. Wieso sprach dieses holländische Arschloch so akzentfrei? Sarah glaubte das hämische Lachen der anderen Typen zu hören, war sich aber nicht sicher, da der ohrenbetäubende Lärm selbst durch die Klotür noch alles übertönte. Ihre Schulter schmerzte fürchterlich, ihre Hand spürte sie kaum noch. Immer noch lag eine schwere Pranke an ihrem Hals.
„Ich denke mal nicht, dass du mir deinen Informanten verrätst, oder? Ich würde ein bisschen Zeit sparen. Helfen kannst du ihm sowieso nicht mehr, aber dir könntest du helfen.“
Haagedorn ließ ihr etwas Zeit, aber Sarah reagierte nicht. Wenn sie könnte, würde sie ihn noch mal anspucken, aber ihr Kopf wurde mit einer solchen Kraft gegen die Wand gedrückt, dass ihr das nicht möglich war.
„Na dann, Frau …“ Haagedorn musterte ihren Dienstausweis. „Frau Hauptkommissarin, wünsch ich Ihnen viel Spaß.“
Er ließ sich auf einem Klodeckel nieder, zündete sich eine Zigarette an und nahm das Magazin aus ihrer Waffe. Jede einzelne Patrone ließ er aus dem Magazin schnappen. Er musterte ihren Dienstausweis.
„Fünfunddreißig Jahre, so schön und schon Hauptkommissarin. Hättest du mich heute verhaftet, hätten sie dich bestimmt befördert, und du hättest dich nicht weiter hochvögeln müssen.“
Endlich wurde die Umklammerung an ihrem Hals gelöst. Sie bekam wieder Luft, und bei jedem Atemzug bildeten sich Blutbläschen auf ihren Lippen. In den Spiegelresten an der Wand sah sie die widerliche Fratze des Typen, der sie bis eben so fest gegen die Wand gedrückt hatte. Sie wollte den Augenblick nutzen, um ihren Ellenbogen ihm in das Gesicht zu hauen, dass sie so abfällig angrinste. Aber bevor sie in ihrem benommenen Zustand ihre Kraft zusammennehmen konnte, wurde sie schon wieder nach unten gepresst. Der Wasserhahn drückte sich in ihr Gesicht. Sie hörte das Schnappen eines Springmessers und spürte im gleichen Moment, wie sich die kalte Klinge zwischen ihren Körper und ihre Hose schob. Mit einem Ruck gab die Hose nach. Ihr Blick hing an Haagedorns Gesicht. Der hatte sich auf dem Klo zurückgelehnt und sah ihr in die Augen. Seine Hand, mit der er seine brennende Zigarette hielt, lag auf seinem hochgestellten Bein auf. Ihn interessierte nicht, was seine Leute mit ihr vorhatten, seine Augen starrten sie an. Mit der anderen Hand schmiss er die entladene Waffe in das Waschbecken vor ihr. Von dem Weiß des Porzellans war kaum noch was zu erkennen. Das Blut aus ihrer Hand und ihrer Schulter tropfte unaufhörlich in das Becken. Sie fühlte sich so elend wie noch nie in ihrem Leben. Ihr Hass verteilte sich auf die ganze Welt. Warum hilft mir nur keiner? Sie war doch schließlich Polizistin. Sie war doch die Gute. Wo blieb nur das SEK?
„Na…? Wenn du könntest, würdest du mich jetzt erschießen?“ Sarah nahm Haagedorns Gerede nur als Wortfetzen wahr. Sie spürte die Hände der schmierigen Typen am ganzen Körper. Eine Hand drückte ihren Kopf permanent gegen diesen beschissenen Wasserhahn, die anderen Hände hielten ihre Arme. Ihre Hose hing mittlerweile zerrissen auf Höhe ihrer Kniekehlen. Sie war so müde. Ihr war, als ob sie gleich fürchterlich kotzen müsste. Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen. Das warme, brennende Gefühl des verschmierten Blutes in ihrem Gesicht und ihr eigener Stolz ließen sie daran zweifeln, dass sie bisher geweint hatte, aber in dem Augenblick, als sie nicht nur die kratzige, stopplige Haut des ekelhaft stinkenden Mannes an ihrem Hintern spürte, konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie schloss die Augen.
„Maasji, das SEK kommt.“ Eine schrille Stimme ließ sie aufschrecken.
Wie lange sie auf der Erde gelegen hatte, wusste sie nicht. War sie ohnmächtig, oder hatte ihr nur die Spritze in ihrem Hals jegliche Wahrnehmung genommen? Sie wusste es nicht, spürte nur die kalten Fliesen auf ihrer Haut und den Schmerz zwischen ihren Beinen. Sie sah ihr Handy neben sich liegen. „Los, raus hier! Zur Not ballern wir uns den Weg frei. Solange die wissen, dass hier einer ihrer Leute drin ist, schießen die nicht.“
Hektik machte sich breit. Das Durchladen von schweren Maschinenpistolen war zu hören.
„Wo ist ihre Knarre? Sucht ihr Handy.“
„Raus hier! Raus hier!“
„Den Koffer. Passt auf den Koffer auf.“
„Die haben die Straße gesperrt.“
„Raus hier. Da kommen wir durch.“
„Wir nehmen sie mit.“
„Zu spät, raus hier. Wo ist ihr Handy?“
Die Stimmen wurden immer hektischer. Plötzlich spürte Sarah wieder den Griff in ihren Haaren. Ihr Kopf wurde hochgerissen. Ein Fuß stand auf ihrer von den Spiegelscherben zerschnittenen Hand.
„Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.“
Sie sah in Haagedorns Gesicht. Seine Augen waren kalt und leer. Kein Anzeichen einer emotionalen Regung. Hässlich prangte die kleine, tätowierte Spinne unter seinem Auge.
„Du kleine, dreckige Fotze. Beim nächsten Mal wechsle lieber die Seiten. Wie du siehst, von deinen Leuten hilft dir keiner, und für einen geilen Fick wie dich ist bei uns allemal Platz.“ Dann ließ er ihre Haare los, und ihr Kopf knallte auf die Fliesen. Sie hörte Schüsse und versuchte nur noch, mit zittriger Hand durch die Scherben auf dem Fußboden ihr Handy zu erreichen. So schwer es ihr auch fiel, danach zu greifen, noch schwerer tat sie sich dabei, es zu öffnen. Mit ihrer blutverschmierten, geschwollenen Hand konnte sie die Tasten kaum bedienen. Es gab keine Stelle an ihrem Körper, die ihr nicht wehtat. Das war das Letzte, was ihr aus dieser Nacht in Erinnerung geblieben ist. Haagedorns letzte Worte, die tätowierte Spinne und der Anblick ihres Handys in ihrer blutenden Hand.
Kapitel 2 - Ein Jahr später
Ein Jahr später
„Was ist los?“
Nur durch Zufall bemerkte Polizeidirektor Bernhard Kuntz die Hektik bei den Leuten der Polizeiwache. Eigentlich hatte Kuntz mit dem ganzen Drumherum der Fußball WM genug um die Ohren, trotzdem wollte er von seinen Gewohnheiten nicht abweichen. Ab und an machte er seine Stippvisiten in den verschiedenen Polizeiwachen von Berlin. So auch heute.
„Ein Fahrzeug mit holländischem Kennzeichen hat eine Polizeikontrolle durchbrochen. Ein verletzter Kollege. Fahrzeug auf der Flucht.“
„Was für eine Kontrolle war das?“
„Eine ganz normale Fahrzeugkontrolle. Näheres wissen wir auch nicht.“
„Wie viel Fahrzeuge sind dran?“
„Drei sind direkt dahinter, eins davon ist ein Zivilfahrzeug. Hubschrauber ist unterwegs. Straßensperren sind teilweise aufgebaut, aber Sie wissen ja selber, bei der Menge Auf- und Abfahrten an der Autobahn ist das ein Katz-und-Maus-Spiel. Außerdem haben wir immer noch Berufsverkehr.“
„Besonnen bleiben, Kollegen, dran bleiben und abwarten, was uns die Hubschrauberbilder bringen. Wichtig ist, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen. Solche Verrückten sind unberechenbar.“
Bernhard Kuntz versuchte, Ruhe in das entstehende Chaos zu bringen. Zu lange war er schon im Polizeidienst. Er hatte schon Verbrecher gejagt, als die Hälfte der Leute hier noch gar nicht auf der Welt war.
„Sie sind lustig. Der hat in der letzten Viertelstunde schon fünf zivile Autos beschädigt, darunter einen Reisebus. Glücklicherweise leer. Der bremst nicht. Ein Wunder, dass es noch keine Toten gab.“
„Was?“ Kuntz wandte sich verwundert an den Kollegen am Funkgerät. „Womit fährt der denn? Mit ’nem Panzer?“
Der Wachtmeister wusste nicht, wie er reagieren sollte.
„So ungefähr.“
Kuntz drehte sich um, und während er sich durch die Haare strich, ging er langsam zum Fenster.
„Was heißt, so ungefähr?“
„Kein Panzer, ein Hummer, so ein amerikanisches Ding, womit die immer in den Krieg ziehen. “
Kuntz zuckte innerlich zusammen. Ihm lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Er hatte das Gefühl, als würde ihm das Blut in den Adern gefrieren. Ganz langsam drehte er sich um.
„Was sagen Sie da?“
„Ein Hummer. Von der Navy.“ Der Wachtmeister blickte erstaunt zu Kuntz.
„Ich weiß verflucht noch mal, was ein Hummer ist. Geben Sie her.“ Kuntz riss dem Wachtmeister das Funkgerät aus der Hand.
„Hier Polizeidirektor Kuntz. Den Flüchtenden nicht bedrängen. Nur dranbleiben.“
Kuntz klickte das Gerät kurz aus.
„Wann ist der Hubschrauber da?“
„Zwei Minuten.“
„Wir brauchen Nahaufnahmen.“
Kuntz machte das Gerät wieder an.
„Kollegen, nur dranbleiben. Auf keinen Fall bedrängen. Abstand halten, dann bleibt er erst mal auf der Autobahn, und wir haben eine Unbekannte weniger. Wer ist am nächsten dran?“
„Hier Alpha 6. Wir sind direkt hinter ihm, Herr Direktor. Was für eine Unbekannte?“
„Fußgänger. Auf der Autobahn haben wir keine Fußgänger, die er über’n Haufen fahren kann. Farbe? Welche Farbe und was für ein Kennzeichen?“
Kuntz musste die Antwort nicht abwarten. Der Wachtmeister gab ihm einen Zettel, auf dem das Kennzeichen und die Farbe standen.
„Scheiße, die Farbe stimmt nicht.“
„Was ist denn los?“
„Hubschrauber ist da. Wir kriegen gleich die Bilder!“, schallte es durch den Flur.
Kuntz klappte eilig sein Handy auf und redete, während er die Nummer eingab, weiter mit dem Wachtmeister.
„Fragen Sie, ob auf dem Hummer Spinnen drauf sind.“
„Was?“
„Mensch, ob auf den Türen Spinnen aufgemalt sind. Fragen Sie schon!“ Parallel zu seinem Dialog hielt er sich das Handy ans Ohr.
„Hallo Theresa. Auf meinem Schreibtisch muss noch irgendwo die Akte von Sarah Fender liegen. Die Sache mit der Diskothek, letztes Jahr. Ich brauch die Farbe und das Kennzeichen von Haagedorns Auto. Schnell bitte.“
Kuntz wartete und schaute den immer noch erstaunt blickenden Wachtmeister fragend an.
„Nein, keine Spinnen.“
Auf den Monitoren waren endlich die Bilder zu sehen. Die Anwesenden standen wie erstarrt vor den flackernden Szenen. „Er soll versuchen, den Fahrer ins Bild zu kriegen. Wir müssen wissen, ob er unterm Auge eine Tätowierung hat.“
„Auch eine Spinne?“, flüsterte der Wachtmeister, ohne sich Gedanken über die Ernsthaftigkeit seiner Frage zu machen. Umso erstaunter war er, als Kuntz ihm unbeteiligt zunickte.
„Ja Theresa.“ Kuntz verglich die Kennzeichen. „Alles klar. Sofort zwei Einheiten vom SEK alarmieren. Am liebsten wäre mir, wenn wir Wagner und Minsky hinzuziehen könnten. Sind die in der Nähe? Moment …“ Kuntz sah, dass der Wachtmeister ihm was sagen wollte.
„Ein Kommissar Wagner ist vor Ort, der sitzt in dem zivilen Wagen.“
„Alles klar.“ Er wandte sich wieder an Theresa
„Theresa, Wagner ist schon dran. Wichtig fürs SEK, kein Zugriff. Ich versuche, vor Ort zu sein. Bis dahin übernimmt Wagner das Kommando.“
„Herr Direktor, denken Sie an Ihren Termin. Die Kollegen machen das schon. Was ist denn los?“ Theresa, Bernhard Kuntz’ Sekretärin, klang besorgt.
„Später. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, er ist wieder da. Sagen Sie den Termin ab.“
„Wer ist wieder da?“
Kuntz klappte sein Handy zu, ohne zu antworten. Aus dem Funkgerät krächzte eine Stimme:
„Negativ. Fahrer trägt Sonnenbrille. Keine Tätowierung sichtbar.“
Kuntz zeigte auf den Monitor.
„Da.“ Er ging ein Stück näher. „Er soll das ranzoomen! Ranzoomen! Die Fahrertür ranzoomen!“
Das Bild auf dem Monitor wurde immer größer.
„Sehen Sie die Beschädigungen an der Tür und am Kotflügel? Er soll versuchen, die Farbe zu erkennen, die da drunter ist.“
„Grün. Dunkelgrün, vielleicht dunkelblau, aber mehr dunkelgrün!“, schrie jemand aus dem Funkgerät. „Hallo, Herr Direktor. Haben Sie nüscht zu tun, oder hat man Sie versetzt?“
„Mensch Wagner, halt die Klappe. Bist du sicher?“
„Na, sagen Sie’s mir. Welche Farbe hat die Sonne?“ Kuntz ließ sich auf das Spiel ein. „Gelb.“
„Und welche Farbe hat das Auto jetzt?“
„Beige. Typisch für die Dinger. Sandbeige. Dunkelbeige. Was soll der Quatsch?“
„Richtig. Sind wir uns ja schon mal in zwei Farben einig. Also wenn das beige ist, dann ist die Farbe darunter dunkelgrün.“ Kuntz verstand Wagners Logik zwar nicht, aber das war nicht wichtig.
Auf der Wache war es ruhig geworden, und auch aus dem Funkgerät war nichts zu hören. Alle verfolgten die Bilder der Hubschrauberkamera. Die Verfolgungsfahrt vollzog sich noch immer in einem Höllentempo. Kuntz konnte Wagner in dem zivilen Auto hinter dem Hummer erkennen. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, das Licht auf dem Dach zu befestigen. Wagner schaute hoch zum Hubschrauber, als würde er ahnen, dass Kuntz ihn beobachtete. Er griff zu seinem Funkgerät.
„Sehen Sie mich? Alter Bekannter?“, fragte er.
Kuntz kniff die Augen ein bisschen zusammen und zögerte. „Mach dein Licht aufs Dach. Wie blöd muss man denn sein?“, flüsterte er vor sich hin. Wagner antwortete nicht, schaute nur verwundert in die Kamera.
„Nicht du, entschuldige. Wenn wir Glück haben, ist das Haagedorn.“
„Sagt mir nichts.“
„Maasji Haagedorn. Da war mal was. Sei vorsichtig. Der ist eine ganz große Nummer. Letztes Jahr hatten wir ihn fast, und dann ist er von der Bildfläche verschwunden. Hat einer Kollegin böse mitgespielt …“ Kuntz stockte der Atem. „Der kommt hier sogar mit demselben Kennzeichen an. Das SEK ist unterwegs.“ Ihm war bei dem Gedanken an Haagedorn überhaupt nicht wohl. Die Geschichte im Iron Fist war circa ein Jahr her, aber Kuntz kam es vor, als wäre es gestern gewesen. Er schaltete das Funkgerät wieder aus und führte leise Selbstgespräche.
„Warum ist der bloß wiedergekommen?“
Wieder kehrte Ruhe ein. Alle beobachteten die Monitore.
„Okay, bleiben Sie in Verbindung. Ich mach mich auf den Weg. Ich will immer wissen, wo die sind.“
„Im Moment sieht es so aus, als ob er zu den alten Hallen am Güterbahnhof will.“
Kuntz musterte die Bilder.
„Das sehe ich auch so. Gut so, da sind wenig Leute, wenn überhaupt.“
„Aber die alte Fußgängerüberführung ist lang und schwer zugänglich für uns, auch wenn da kaum Leute lang laufen.“
„Die sollte doch schon lange abgerissen sein?“
„Ist sie ja teilweise auch, aber sie wird immer noch benutzt, weil die neue Fußgängerbrücke noch nicht fertig ist.“
„Wir werden sehen.“ Kuntz eilte aus der Wache.
*
Am Güterbahnhof angekommen, musterte er das Gelände. Schon von weitem sah er die Einsatzwagen des SEK.
„Da will man nur mal kurz ’ne Wache inspizieren und dann das“, schimpfte er vor sich hin, während er ausstieg. Das Gelände, ein brachliegendes Industriegebiet, war unübersichtlich. Keine hundert Meter vor ihm, etwas abseits, stand der Hummer mit niederländischem Kennzeichen. Die Fahrertür stand offen, als ob jemand fluchtartig das Auto verlassen hätte. Die Beamten des SEK hatten Stellung bezogen. Zwei Mann begutachteten mit der Waffe im Anschlag den Hummer. Kommissar Wagner stand ohne Deckung neben einem in Stellung gegangenen Beamten. Langsam ging Kuntz auf ihn zu.
„Wo ist er?“
Ohne sich umzudrehen, antwortete Wagner:
„Sie werden ihn gleich sehen.“
„Was ist los?“
„Wir hatten ihn fast, aber dann konnte er aus seinem Auto flüchten und nun das.“
Kuntz stand jetzt neben Frank Wagner. Der SEK-Beamte, geschützt durch eine fast eingerissene Mauer, hockte neben dem Kommissar. Kuntz postierte sich genau hinter ihm.
„Wo ist er?“
Wagner drehte sich kurz zu Kuntz um.
„Na da.“
Sein Blick ging in die Richtung, die Wagner mit dem Kopf andeutete.
„Verflucht. Wo hat er die denn her? Wie kommen hier denn Zivilisten her?“
Wagner taxierte die Umgebung.
„Eine Abkürzung. Die Leute benutzen das Gelände, um zur S-Bahn zu kommen.“
Kuntz suchte weiter die Gegend ab.
„Sonst noch welche?“
Wagner lachte kurz auf.
„Eine reicht ihm doch. Ist aber ne Frage der Zeit, bis hier irgendwo ein paar Schaulustige aufkreuzen. Vor allem die Kids lungern hier oft rum.“
„Na, die sind ja wohl in der Schule.“
„Die Kids, die hier abhängen, gehen nicht zur Schule.“
Kuntz wandte sich an den Einsatzleiter des SEK.
„Absperren, weiträumig absperren. Ich will hier keine Zivilisten sehen, und schon gar keine Touristen mit Fotoapparat.“
„Schon passiert.“
Kuntz kam aus seiner Deckung hervor und stellte sich hinter den Kommissar.
„Wo ist eigentlich Minsky?“
„Hat frei.“
„Frei?“
„Frei.“
„Kannst du was sehen?“
„Ne verängstigte Frau“, entgegnete Wagner trocken.
„Warum ist der bloß wiedergekommen?“ Kuntz schien verzweifelt.
„Na, um Ihnen den Tag zu versauen.“ Wagner schaute in das angespannte Gesicht des Polizeidirektors. „Was machen Sie überhaupt hier?“
Kuntz erwiderte Wagners Blick.
„Zufall. Zum falschen Zeitpunkt die falsche Polizeiwache besucht.“
Wagner schmunzelte.
„Sollten Sie nicht machen. Ich dachte, Sie haben mit der Fußball-WM genug zu tun?“
„Ja, das dachte ich auch.“
„Der liebe Gott mag Sie nicht. Woher kennen Sie den?“
Wieder deutete Wagner in die Richtung von Haagedorn.
„Kennen ist übertrieben. Haagedorn ist einer von der ganz üblen Sorte. An dem haben wir uns schon mächtig die Zähne ausgebissen. Letztes Jahr hatten wir ihn fast, aber dann hat er uns so richtig …“ Kuntz verschluckte wohlweislich den Rest des Satzes und beantwortete Wagners Blick mit einem Kopfschütteln.
„Warum ist der mir noch nicht untergekommen?“
„Weil Berlin kein Dorf ist und du nicht überall sein kannst.“
„Wollen wir jetzt hier noch lange rumstehen, oder ziehen Sie Ihre Leute ab?“, rief Haagedorn.
Wagner und Kuntz blickten zu Haagedorn.
„Gibt es hier ein Megaphon?“
Kuntz schaute sich fragend um.
„Brauchen Sie nicht, der versteht uns schon.“
Kuntz kam einen Schritt aus der Deckung.
„Was verlangen Sie?“, rief er zurück.
„Wer sind Sie?“, wollte Haagedorn wissen.
„Nicht“, beschwichtigte Wagner seinen Vorgesetzten. Kuntz musterte ihn kurz.
„Vielleicht bringt es ja was.“
Kuntz postierte sich neben dem Kommissar.
„Polizeidirektor Bernhard Kuntz.“
Noch bevor Kuntz seinen Satz beendet hatte, peitschte eine Kugel gegen die Tür des Hummers.
„Deckung!“, schallte es vom Einsatzleiter des SEK, und die Beamten, die das Auto noch immer musterten, folgten dem Befehl. Auch Kuntz sprang wieder hinter den Mauervorsprung. Wagner verzog keine Miene und stand noch an derselben Stelle.
„Bist du lebensmüde?“
„Der will uns nicht treffen.“
„Wieso bist du dir da so sicher?“
„Aus der Entfernung hätte er getroffen. Der kann es sich nicht leisten, einen Polizisten umzulegen. Der hat irgendwas anderes vor.“
Hauptkommissar Wagner kniff die Augen ein wenig zusammen, und sein Blick traf den von Haagedorn.
„Hast du ne Ahnung. Der macht keinen Halt vor Polizisten.“
„Hat wohl nicht viel genutzt, dass Sie sich als Polizeidirektor vorgestellt haben.“
Wagner schaute den SEK-Beamten, der einen halben Meter neben ihm kniete, prüfend an.
„Deine Knarre!“
„Was?“
„Gib mir deine Knarre!“
Fragend drehte sich der Beamte erst zu seinem Einsatzleiter und dann zu Kuntz um.
„Na nun machen Sie schon.“
Wagner nahm die Waffe in Anschlag.
„Was hast du vor?“ Kuntz Stimme wurde aufgeregter.
„Mit dem Zielfernrohr näher ranholen, oder haben sie ein Fernglas parat?“
„Es wird nicht geschossen, Wagner.“ Die Stimme des Polizeidirektors wurde ernster.
„Eine hässliche Spinne …“
Kuntz war sich nunmehr ganz sicher. Maasji Haagedorn war tatsächlich zurückgekommen. Er beugte sich vor.
„Warum sind Sie zurückgekommen?“
Haagedorn lachte.
„Ich habe ihn genau im Visier“, unterbrach Wagner leise das Gespräch.
„Nein, das geht nicht. Was ist, wenn du die Geisel triffst?“, flüsterte Kuntz.
„Ich hab hier letztes Jahr was vergessen. Musste leider weg“, erwiderte Haagedorn indessen mit einem aufgesetzten Lächeln. „Sie hätten sich ein anderes Kennzeichen ans Auto machen sollen.“
„Das hätte ich machen sollen. Ich dachte, ihr habt mit eurer WM genug zu tun, und bis hierher bin ich ja auch ganz gut durchgekommen.“
„Eben, bis hierher. Lassen Sie die junge Frau gehen.“
Haagedorn lachte schallend.
„Sie wissen doch, ich stehe auf junge Frauen.“
„Ich kann schießen“, meldete sich Wagner wieder leise zu Wort.
„Nein. Das ist ein Befehl. Es wird nicht geschossen.“
Die Stimme des Polizeidirektors wurde harsch.
„Sie kommen hier nicht weg, Haagedorn.“
Haagedorns Gesicht wurde ernst.
„Das sehe ich anders. Sehen Sie mal, was ich in meiner anderen Hand halte.“
Haagedorn drehte sich mitsamt der Geisel zur Seite. Kuntz konnte nichts erkennen.
„Was hat er da?“
„Sieht aus wie ein Schalter, ein Zünder. Ein Sprengzünder!“
„Was? Der wird sich doch nicht mit der Geisel in die Luft jagen?“
Wagner ließ Haagedorn nicht aus den Augen.
„Nein, aber sein Auto.“
Kuntz drehte sich urplötzlich um und sah die Beamten in der Nähe des Autos.
„Deckung! Weg vom Auto!“, rief Kuntz den Beamten zu. „Weißt du, was passiert, wenn er das Ding in die Luft jagt?“
„Vertrauen Sie mir. Der wollte mit dem Ding noch zurückfahren, und wenn er was vergessen hat, könnte das in dem Auto sein. Der jagt doch nicht das in die Luft, weshalb er zurückgekommen ist. Außerdem ist das Ding für Kriegseinsätze gebaut. Das ist ein Original Hummer. Das rumst zwar mächtig, aber ansonsten passiert nicht viel.“ Kuntz schaute abwechselnd zu Wagner und zu dem Auto.
„Du kennst den nicht. Der hat keine Skrupel.“
„Aber ich sehe sein Gesicht, und das kann ich ihm wegblasen.“
„Nein.“
Wagner konnte durch das Zielfernrohr jede Bewegung von Haagedorn sehen. Er sah auch das Gesicht der Geisel. Sie war jung, und die Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Keine Angst, junge Lady, es ist gleich vorbei“, murmelte Wagner vor sich hin.
„Nein!“, schrie Kuntz Wagner an.
„Was ist denn nun?“, meldete sich Haagedorn wieder zu Wort.
„Keine Chance. Ich kann Sie hier nicht einfach so weglassen. Lassen Sie uns reden“, erwiderte Kuntz.
„Sie hätten an Ihrem Schreibtisch bleiben sollen.“
„Oh ja, das hätte ich“, sagte Kuntz mehr zu sich selbst.
„Genug geredet.“ Obwohl der Tonfall von Haagedorn bedeutend leiser geworden war, konnte Wagner ihn genau verstehen. Er sah das hämische Grinsen in seinen Augen.
„Deckung!“, brüllte Wagner, und im selben Augenblick sah er, wie Haagedorn den Knopf in seiner Hand betätigte. Ein fürchterlicher Knall erschütterte das bis eben totenstille Gelände. Frank drückte genau in dem Augenblick ab, als Haagedorn sich mit der Geisel, die Explosion ausnutzend, wegdrehen wollte. Ruckartig sackte die Geisel vorne über, aber Wagner sah genau das Loch in Haagedorns Stirn und schoss erneut. Wie von einem Schlag getroffen, knallte Haagedorn gegen die Mauer hinter sich. Die Arme weit von sich gestreckt, ließ er seine Pistole fallen. Die junge Frau kroch fluchtartig auf allen Vieren vor ihm her. Sie schrie und weinte. Wagner rannte zu ihr hin, die Waffe weiter auf Haagedorn gerichtet. Der sackte langsam an der Wand runter. Die Schuhe gruben sich in den Sand und hinterließen eine Furche. Wagner stand jetzt einen Meter vor ihm, nahm die Waffe runter und hob mit dem rechten Arm die junge Frau auf.
„Ich blute“, jammerte sie. „Ich blute.“
„Das ist nicht ihr Blut“, versuchte Wagner, sie zu beschwichtigen. „Es ist vorbei. Beruhigen Sie sich. Es ist vorbei.“
Die junge Frau weinte und schrie noch immer. Sie hämmerte mit den Fäusten auf Frank ein, der sie an sich presste.
„Beruhigen Sie sich. Es ist vorbei“, wiederholte er.
Die Frau sah Frank in die Augen. Er wollte sie mit einem Schmunzeln zur Ruhe bringen.
„Beruhigen? Sind Sie noch bei Trost? Ich soll mich beruhigen?“
Sie wollte wieder auf Wagner einhämmern, aber langsam verließ sie die Kraft. Weinend legte sie sich in Franks Arme. „Es ist vorbei.“
Frank strich ihr durch die Haare. Sein Blick richtete auf Kuntz. Alle waren aus ihrer Deckung gekommen. Der Polizeidirektor stand wie versteinert da. Seine Schultern hingen kraftlos runter. Der Einsatzleiter deutete mit einem gehobenen Daumen seine Wertschätzung an, wohl wissend, was hier eben passiert war. Aus dem Hummer stieg eine riesige Qualmwolke auf. Kleine Flammen loderten aus dem Innenraum des Wagens. Durch die Luft wirbelten unzählige Geldscheine. Wagner bewegte sich langsam mit der Frau im Arm in Richtung des Polizeidirektors. Kuntz drehte sich zum Einsatzleiter um.
„Absperren. Keiner, und ich sage keiner, kommt durch die Absperrung. Ordern Sie einen Krankenwagen, eine Feuerwehr und, wie es aussieht, einen Leichenwagen. Sie sind dafür verantwortlich, dass keiner ohne ausdrücklichen Befehl das Gelände betritt. Informationssperre, haben Sie verstanden? Machen Sie das Ihren Leuten klar. Und einer soll das beschissene Geld einsammeln.“
Kuntz musterte weiträumig das Gelände. Sein Blick verharrte bei der jungen Frau.
„Geht’s?“
Die Frau nickte nur kurz. Frank löste die Umarmung und schaute sie lächelnd an. Sie erwiderte, sichtlich unter Schock stehend, seinen Blick.
„Ich glaube, ich bin Ihnen was schuldig.“
Frank verneinte.
„Sie schulden mir nichts, dafür bezahlen Sie schließlich Steuern“, versuchte er zu scherzen. Einer der Beamten nahm sich ihrer an. Nach ein paar Schritten drehte sich die Frau noch mal um.
„Danke.“
Frank schaute ihr hinterher. Er stand jetzt fast neben Kuntz. Der Polizeidirektor schaute in die Richtung, wo Haagedorns Leiche sitzend an der Wand lehnte. Er ging ihr zwei, drei Schritte entgegen.
Frank Wagner gab dem Beamten seine Waffe wieder, zog seine Jacke aus und setzte sich auf die Reste der alten Mauer.
„Wie machst du das?“
Frank krempelte sich die Ärmel hoch.
„Was?“
Der junge SEK-Beamte schaute ihn voller Bewunderung an. Mit seinen Handflächen rieb er sich verlegen auf den Oberschenkeln. Frank sah, wie seine Hose den Schweiß aufsog.
„Keine Angst zu haben. Du hättest die Geisel treffen können.“ Frank blickte zur Seite und sah in die aufgerissenen Augen des jungen Mannes. Er vermutete, dass er noch nicht allzu lange beim SEK war und noch nicht viele Einsätze dieser Art erlebt hatte.
„Wer sagt dir, dass ich keine Angst hatte?“
„Du hast so besonnen und eiskalt gewirkt.“
Frank legte die Hand auf seine Schulter.
„Seit wann bist du dabei?“
„Ein halbes Jahr.“
„Dein erster Einsatz dieser Art?“
Der Beamte nickte.
„Dann lass dir sagen, die Angst kommt immer erst hinterher.“ Frank nahm seine Hand von der Schulter und ließ sich den lauen Sommerwind ins Gesicht wehen. Er streckte seinen rechten Arm gerade nach vorne, und die beiden Polizisten beobachteten das Zittern seiner Hand.
„Siehste, hinterher darf das sein, dabei nicht.“
„Du kannst echt stolz sein. Du hast gerade eine Geisel befreit.“ Frank schaute ihm wieder ins Gesicht.
„Stolz? Mit Stolz hat das nichts zu tun. Vergiss nicht, ich habe gerade einen Menschen erschossen.“
„Aber der war doch ein Verbrecher.“
„Aber eben auch ein Mensch. Zwar ein schlechter Mensch, aber ein Mensch.“
„Aber …“
„Lassen Sie uns alleine“, wurde der Beamte von Kuntz unterbrochen. Langsam bewegte er sich auf Wagner zu. Der junge Beamte schaute ungläubig.
„Nun verschwinden Sie schon.“
Der Beamte stand auf, klopfte Frank auf die Schulter, gab ihm die Hand und verschwand.
„Siehste, jetzt kommt die Kehrseite.“
„Kehrseite?“, fragte er im Weggehen.
Der Einsatzleiter erwartete schon den jungen Mann.
„Was meint er mit Kehrseite?“
Zögernd blickte der Einsatzleiter in die fragenden Augen des Beamten.
„Ärger. Die Kehrseite heißt Ärger. Das, was du da gerade erlebt hast, ist eine Grauzone in den Dienstvorschriften. Wir nennen es Notwendigkeit, andere nennen es den finalen Schuss. Und das hier, das war ein Paradebeispiel für einen finalen Schuss. Der Direktor hat ihm den nicht ohne Grund untersagt.“
Beide beobachteten, wie Kuntz sich vor Kommissar Wagner postierte.
„Sichern Sie das Gelände. Die Feuerwehr kommt gleich.“
Der junge Beamte stand da wie angewurzelt.
„Nun machen Sie schon.“
Bernhards Gesicht sah alles andere als erleichtert aus.
„Hast du was mit den Ohren?“
„Na ja, nach der Explosion kann das schon sein.“
„Lass deine blöden Sprüche, Frank. Ich habe dir ganz klar einen Befehl erteilt.“
Frank begutachtete das Gelände.
„Was sollte ich denn machen? Sehen Sie sich doch mal um. Der hätte hier ohne weiteres abhauen können, und dann wäre er wieder weg gewesen.“
„Nicht schießen, habe ich gesagt. N-I-C-H-T“, buchstabierte Kuntz mit aufgebrachter Stimme.
Frank hob beschwichtigend die Arme.
„Ist doch alles gut gegangen.“
Fassungslos musterte der Polizeidirektor den Kommissar.
„Sag mal, willst du mich nicht verstehen, oder kannst du mich nicht verstehen? Steht in der Dienstvorschrift irgendetwas von dem, was hier gerade passiert ist?“
Frank erhob sich.
„Da steht nicht drin, dass es untersagt ist.“ Kleinlaut ergänzte Frank noch: „Glaube ich jedenfalls.“
Es war ihm immer ein Graus, den dicken Wälzer regelmäßig zu studieren. Wagner war stets der Meinung, wenn er instinktiv und schnell handeln muss, könne er es sich nicht leisten, erst mal die Dienstvorschrift durchzublättern, um rauszufinden, ob sein Handeln den Vorschriften entspricht. Oft genug hatte er sich mit dieser Auffassung, trotz seiner zahlreichen Verdienste, Ärger eingehandelt.
„Da steht aber auch nicht drin, dass es erlaubt ist.“ Kuntz setzte sich verärgert hin.
„Was wollen Sie denn eigentlich? Sie haben Haagedorn. Keiner hat was gesehen. Die Frau ist froh, dass sie noch lebt und …“
Kuntz sprang auf und unterbrach den Hauptkommissar.
„Mensch, halt bloß deine Klappe. Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich dir eine scheuern. Du bist Polizist! Es gibt Spielregeln, an die hat sich auch ein Kommissar Wagner zu halten.“
„Die Spielregeln sind aber Scheiße. Entscheidend ist doch das Ergebnis.“
Der Polizeidirektor musterte Frank. Er war sich nicht sicher, ob Wagner wusste, was er da von sich gab.
„Du hast ganz klar einen Befehl missachtet, und wenn das publik wird, können wir uns warm anziehen.“
„Publik wird? Habe ich hier was übersehen? Hier ist doch weit und breit keiner.“
„Ach? So einfach ist das für dich. Dann sag mir doch mal, was mit denen da ist, und was mit der Geisel ist?“ Kuntz fuchtelte wie wild mit den Armen und deutete auf die Beamten vom SEK, die aufmerksam den Disput der beiden verfolgten.
„Die gehören doch zu uns, und die Geisel ist doch …“ Wieder wurde er von Kuntz unterbrochen.
„Du willst mir jetzt allen Ernstes weismachen, dass die jetzt die Klappe halten? Die werden irgendwann in der Kneipe, wenn sie ordentlich einen gebechert haben, sich mit genau solch einer Geschichte zum Helden machen. Und die junge Frau hält doch nur so lange die Klappe, bis ihr einer erzählt, was hier gerade abgegangen ist.“
Frank nahm seine Jacke.
„Kann ich jetzt gehen?“ Bockig wartete er erst gar nicht eine Antwort ab.
„Morgen habe ich deinen Bericht auf meinem Schreibtisch liegen, nirgendwo anders.“
Wagner reagierte nicht und war schon ein paar Schritte weg.
„Deine Waffe und deine Marke.“
Plötzlich drehte er sich um.
„Was?“
„Deine Waffe und deine Marke. Du bist erstmal raus. Was hast du denn gedacht?“
Frank ging auf Kuntz zu.
„Das können Sie doch nicht machen.“
Kuntz stand auf.
„Das kann ich nicht nur, das muss ich sogar.“
„Was soll denn der Quatsch?“
„Das ist kein Quatsch. Du hast einen Befehl missachtet. Du bist suspendiert. Erstmal. Morgen reden wir weiter.“
Wagner verharrte für einen Augenblick. Dann wühlte er in seiner Jacke und legte seine Marke und seine Waffe auf den Mauerrest.
„Scheiße.“
„Das kann man so sagen. Und Frank, ich weiß, dass du noch eine zweite Waffe hast. Keine Extratouren. Du bist draußen, hast du das verstanden? Draußen!“
Frank musterte den Polizeidirektor, drehte sich um und ging. Kuntz schaute ihm noch für einen Augenblick hinterher, setzte sich wieder auf den Mauerrest und vergrub sein Gesicht in den Händen.
„Scheiße, verfluchte Scheiße.“
Kapitel 3
Der Tisch, auf dem Sarah saß, war aus robustem, altem Holz. In der Hand hielt sie eine Tasse kalten Kaffee. Ihre Füße stützten sich auf die davorstehende Bank. Sie nahm ihn nicht wahr, diesen herrlichen Blick über die Brandenburger Felder. Mit tosendem Lärm planierte eine alte Raupe die Flächen, nicht unweit vor dem alten Gehöft. Sie beobachtete uninteressiert den wild mit den Armen fuchtelnden Mann in seinem piekfeinen Anzug. Er sah aus, wie aus dem Ei gepellt. Der alte, graumelierte Mann versuchte krampfhaft, dem Raupenfahrer klarzumachen, was der selber am besten wusste. Aber so war er, der alte Mann. Alles wollte er lieber selber und natürlich besser machen. Die kreuz und quer verteilten, farbig gekennzeichneten Holzpfähle ließen erahnen, dass hier gebaut werden sollte. Sarah fragte sich noch immer, wie er mal wieder so schnell eine Baugenehmigung und dann noch mitten auf dem Feld bekommen hatte. Aber genauso schnell verwarf sie den Gedanken auch wieder. Ihr reichte das alte Haus, vor dem sie saß. Emotionslos hatte sie das Angebot ihres Vaters angenommen. Sie hatte auch keine große Wahl gehabt. Immer wieder dachte sie sich, wäre ein Platz auf dem Mond zu haben gewesen, sie hätte sofort zugesagt. Bloß weg, weit weg. Keinen sehen, keinen hören. Am liebsten hätte sie nicht mehr gelebt, aber irgendetwas ließ sie morgens immer wieder erwachen, um sich über den Tag zu quälen. Und das nun schon seit fast einem Jahr.
Ihr Vater hatte ihr den Hof besorgt. Da kannst du zur Ruhe kommen, waren seine Worte gewesen. Es war keine Rede davon, dass zu dem alten Gehöft noch zig Hektar Felder und Wiesen gehörten, und dass er da so ganz nebenbei bauen wollte. Sarah hatte eine Woche Zeit gehabt, um sich zu entscheiden. Sie fühlte sich mal wieder bevormundet, hin und her geschoben. Es war ihr egal, sie wollte nur irgendwo auf dieser Welt ihre Ruhe haben. Dass das Haus eine Grunderneuerung brauchte, registrierte sie kaum. Jeden Tag war sie in der Zeit des Ultimatums ihres Vaters da gewesen, aber nur ein einziges Mal war sie durch die zahlreichen Räume gegangen. Lustlos wie ein Geist. Die anderen Tage war sie nur auf der Bank gesessen und hatte in die Ferne geblickt. Ihr Blick hatte sich in den Horizont gebohrt, in der Hoffnung, jedes Mal ein Stück weiter sehen zu können. Sie hatte nicht abwägen müssen, um sich zu entscheiden. Sie hatte gewusst, am letzten Tag der Woche würde sie eine Entscheidung treffen. Genau wie früher in ihrem Job. Sie hatte immer im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung getroffen. Bis auf das eine Mal. Und wieder ertappte sie sich dabei, wie ihre Gedanken sie an die eine fatale Nacht erinnerten, die ihr Leben aus den Angeln gehoben hatte. Was sie auch dachte, wohin ihre Gedanken sie auch führten, immer und immer wieder hatte sie die Bilder dieser einen Nacht vor Augen.
„Na, weißt du, was du dir hier antust?“
Mit leisen Schritten hatte sich ihre Mutter an die Bank geschlichen. Eine kleine Kopfbewegung in Richtung ihrer Mutter und ein verschmitztes Lächeln waren die einzigen Anzeichen, dass doch noch etwas Leben in Sarah war.
„Du kannst auch weiter bei uns in Berlin wohnen. Das Haus ist groß genug für uns alle.“
Sanft klang die Stimme ihrer Mutter. Wie eine Lady setzte sie sich neben Sarah auf die Bank. Grazil, attraktiv, und immer besonnen war sie. Was sie sagte, war stets durchdacht. Nie hatte sie Sarah und ihrem Bruder ihren Willen aufgedrängt. Wenn überhaupt, wollte sie nur Ratgeber sein. Eigene Entscheidungen zu fällen, hatte sie keinem abgenommen. Auch in der Firma ihres Mannes hielt sie die Fäden in der Hand. Sarahs Blick verharrte auf dem Gesicht ihrer Mutter. Sie war eine hübsche Frau. Mit sechsundfünfzig Jahren wollte Sarah auch noch so aussehen wie ihre Mutter. Schon immer wollte sie so aussehen wie ihre Mutter. Ohne großen Aufwand strahlte Marianne Fender immer eine natürliche Schönheit aus. Sie hatte sich nie viel aus teuren Klamotten, Beautyfarmen, wertvollem Schmuck oder anderen Statussymbolen gemacht. Obwohl sie sich das locker hätte leisten können. Die Firma von Sarahs Eltern lief gut. Sie lief schon immer gut, auch in rezessiven Phasen. Ende der sechziger Jahre hatte der Maschinenbau geboomt, und es war kein Ende in Sicht.
Ein solides Geschäft, hatte ihr Vater immer gesagt. Meistens war er dabei vor dem Fenster seines Büros in Tempelhof gestanden. Die Daumen in der Weste seines Anzuges vergraben, hatte er davon geträumt, dass die Mauer wieder fallen würde.
„Glaubt mir, der Osten braucht uns. Die haben noch Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg. Eines Tages …“ Den Rest seiner Zukunftspläne hatte er dann meist verschluckt. Als es soweit war, konnte Europa gar nicht groß genug für ihn sein. Und Sarahs Mutter war immer an seiner Seite gewesen. Alle Entscheidungen hatte er mit ihr oder sie mit ihm besprochen.
„Kaffee?“
„Kalt.“
„Macht nichts.“
Marianne Fender griff nach der Tasse, ohne ihren Blick von dem Mann im Anzug abzuwenden.
„Schmeckt ja scheußlich.“
„Mama, der Kaffee ist kalt.“
„Auch warm würde der nicht besser schmecken“, erwiderte Marianne. „Komm, ich mach uns einen neuen.“
„Lass mal gut sein, mir reicht’s für heute.“
„Aber vielleicht will ja dein Vater einen“, versuchte Marianne das Gespräch am Laufen zu halten. Viel zu wenig hatte sie die letzten Wochen und Monate mit ihrer Tochter gesprochen. Sie war einfach nicht an sie rangekommen. Die letzten fünf Minuten waren für Marianne schon ein kleines Erfolgserlebnis. „Wer ist die alte Frau da vorne?“
Sarah blickte zu der alten Frau rüber. Jeden Tag, an dem sie bisher hier gewesen war, hatte sie am gegenüberliegenden Straßenrand gesessen. Vor sich ein kleines Feuer, neben sich ein paar Reisigzweige und eine kleine alte Holzkiste. Das Grundstück lag am Ende der Dorfstraße. Bis heute hatte Sarah von ihr keine Notiz genommen. Sie wusste nicht mal, wo sie wohnte und warum sie jeden Tag an der Straße saß und wie gelähmt in das vor sich hin dümpelnde Feuer starrte. Sie passte einfach hierher. Glostelitz hieß das kleine Kaff. Sarah erwischte sich dabei, wie sie das erste Mal die Umgebung richtig wahrnahm. Im Gegensatz zu Berlin gab es hier nur eine Handvoll Häuser. Bis zum nächsten größeren Ort waren es ein paar Kilometer. Nach Brandenburg war es nicht allzu weit. Die Zeit schien hier stillzustehen. Keine der versprochenen blühenden Landschaften. Der alte Mann im feinen Nadelzwirn hätte nie gedacht, dass Sarah sein Angebot annehmen und sich hierher zurückziehen würde.
„Keine Ahnung. Die sitzt da immer“, hauchte Sarah leise.
„Und du bist dir sicher, dass du hier wohnen willst?“
„Mama, sonst wäre ich doch nicht hergezogen“, antwortete Sarah genervt.
Das Gespräch drohte zu kippen.
„Ich hab fließend Wasser, und Strom hab ich auch. Der Rest liegt auf der Straße.“
„Auf der Straße liegt hier gar nichts.“
Sarah blickte ihrer Mutter ins Gesicht. Schon immer hatte sie ihr gesagt, dass sie sich gewählt und korrekt ausdrücken soll. „Na gut, das Grundstück ist bautechnisch voll erschlossen. So recht?“
Verwirrt schaute Marianne ihre Tochter an.
„Die Ruhe, Mama, die Ruhe. Keine Busse, kein Straßenlärm, kein wildes Nachtleben. Nichts von alledem.“
Die beiden Frauen schauten sich an, und in ihren Gesichtern machte sich ein Grinsen breit.
„Ruhe nennst du das?“
„Na ja, wenn die Scheißplanierraupe nicht wäre, schon“, versuchte Sarah ihr Argument zu untermauern.
„Sarah“, tadelte Marianne ihre Tochter erneut.
„Und Scheiße sagen kann ich hier auch, wann ich will“, fügte Sarah trotzig hinzu.
Ihre Mutter wischte sich verstohlen übers Gesicht.
„Tschuldigung“, schickte Sarah dann doch reumütig hinterher.
„Bestimmt die dämlichste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, wetterte der Mann im Anzug, als er auf Sarah und Marianne zuging. „Gibt’s hier wenigstens einen Kaffee?“
Marianne sah ihre Tochter an. „Siehste.“
„Nur kalten.“
„Wäre ja auch zu schön gewesen“ stammelte Sarahs Vater vor sich hin, bevor ihr Gespräch unterbrochen wurde. Zwei Autos bretterten durch die Toreinfahrt auf das Grundstück.
„Na, krieg ich nun einen Kaffee?“
„Nö“, klang es gleichzeitig aus Mariannes und Sarahs Mund. „Du hast gleich ganz andere Sorgen“, entgegnete Marianne ihrem Mann mit einer Kopfbewegung in Richtung der vier Männer, die aus den Wagen stiegen und abwechselnd zur Planierraupe und zu Sarah und ihrer Mutter rüberschauten.
„Was ist denn hier los? Aufhören!“
„Das Einzige, was hier aufhört, ist ihr Rumkrakele“, erwiderte Herbert Fender ruhig und gefasst auf die Anweisung der Eindringlinge.
„Mach mal Pause“, war seine gezielte Anweisung an Gustav, den Raupenfahrer.
Wieder konnte sich Sarah einen leisen Seufzer nicht verkneifen. „Na was denn nun?“
Aus den Augenwinkeln nahm Herbert Fender Notiz von der Bemerkung seiner Tochter.
„Wer sind Sie?“, tönte indessen einer der Männer.
„Wer sind Sie?“, erwiderte Herbert Fender wieder ruhig und gefasst.
Sarah beobachtete ihren Vater. Das konnte er. Emotionslos sofort wieder umschalten. Privat ist privat, und Geschäft ist Geschäft, waren immer seine Worte. Hier schien es ums Geschäft zu gehen.
„Wir sind vom Landesbauamt. Falkner, mein Name, und das sind meine Kollegen.“
„Fender, von Fender Maschinenbau“, erwiderte Herbert und tat der Höflichkeit damit Genüge.
„Wie kommen Sie dazu, hier zu bauen?“
Herbert ließ seinen Blick über die Wiesen schweifen und stellte sich demonstrativ neben Falkner.
„Wie kommen Sie denn darauf, dass hier gebaut wird?“
Sarah sprang auf. Das ist es, was sie an ihrem Vater so sehr hasste. Machtspielchen. Falkner drehte sich langsam zu Herbert Fender um. Er war fast einen ganzen Kopf kleiner. Sein Anzug saß etwas schief, und sein Schlips ließ Rückschlüsse auf sein letztes Mittagsmahl zu. Er öffnete seinen obersten Hemdknopf. Man wusste nicht, ob er sich jetzt für eine handfeste Auseinandersetzung bereit machte oder schon klein beigeben wollte.
„Ich kriege gerade so einen Hals“, erwiderte er leise.
„Na dann müssen Sie den obersten Knopf aufmachen“, setzte Sarahs Vater noch einen drauf.
„Ihr Berliner Typen kommt hier mit euren dicken S-Tonnen aufs Land, kauft billig unsere Felder auf und verwüstet sie dann. Das ist landwirtschaftliche Nutzfläche“, wurde sein Ton zum Ende des Satzes lauter.
Marianne blickte fragend zu Sarah, schwieg aber.
„Mercedes, S-Klasse, schweres Auto, so werden die genannt“, flüsterte Sarah ihrer Mutter zu. Marianne machte ein Gesicht, als ob sie das schon immer einmal ihren Mann hatte fragen wollen. Aber hatte sie das überhaupt gemeint?
„Also wenn Sie nicht wissen, wie ich dazu komme, wer dann? Außerdem ist das Bauerwartungsland“, redete Herbert Fender auf den Beamten ein. „Ich habe eine Baugenehmigung, die mir erlaubt, auf dem Grundstück zu bauen. Unterzeichnet vom Landrat.“
Beiläufig, als ob er es eigentlich nicht müsste, zog Herbert Fender aus seiner Jacketttasche ein akribisch zusammengefaltetes Blatt, das er Falkner so dicht vors Gesicht hielt, dass der es mit der Nase hätte lesen können. Falkner blickte Herbert Fender abschätzend an und reichte es, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, weiter an seine Kollegen.
Sarah beobachtete die Szene. Männer und ihre Machospielchen. Immer und immer wieder wurde sie mit solchem Blödsinn konfrontiert.
„Lasst mich raten. Sondergenehmigung vom Scherzinger.“
Ohne eine Antwort seiner Kollegen abzuwarten und ohne den Blick von Herbert zu lassen, redete Falkner weiter.
„Aus landwirtschaftlicher Nutzfläche wird Bauerwartungsland, und aus Bauerwartungsland wird Bauland. Und das innerhalb von sechs Wochen und immer in Form von Sondergenehmigungen.“
Falkner hatte den Disput verloren und war sich dessen nur allzu bewusst.
„Na dann wussten Sie doch schon Bescheid“, setzte Herbert nach.
Sarah schüttelte nur den Kopf. Wie bei den Gladiatoren. Abwarten, um dann den Todesstoß zu setzen. Ihr Vater war ihr als Geschäftsmann zuwider.
Falkner hatte nichts mehr zu sagen, wollte sich aber nicht einfach so von dannen machen.
„Wer sind Sie, und was wollen Sie hier in der Einöde?“
„Herbert Fender, sagte ich doch schon. Ich will hier bauen“, waren in einem strengen Ton die Worte, die den Abschluss eines ungleichen Kampfes bildeten. Die vier Herren gaben Sarahs Vater die Baugenehmigung zurück, drehten sich wortlos um und wollten gehen. Falkner hielt nach ein paar Metern inne und wandte sich an die beiden Frauen.
„Es tut mir leid, aber wir waren nicht das letzte Mal hier. Einen schönen Tag noch, die Damen.“
Herbert schaute zu seiner Frau, verzog das Gesicht und blickte dann zu Sarah. Keine der beiden verzog eine Miene, Sarah schon gar nicht.
„Lass uns fahren“, drängte Marianne ihren Mann. „Für heute soll es genug sein.“
Herbert Fender breitete kapitulierend die Arme aus.
„Mach Feierabend.“ Mit einem störrischen Nicken und einer Handbewegung erwiderte Gustav die Aufforderung seines Chefs.
Herbert wollte seiner Frau hinterher gehen, wandte sich aber vorher noch mal an seine Tochter. Erwartungsvoll blickte sie ihn an. Er schaute ihr ins Gesicht, dann auf die Hände und wieder ins Gesicht.
„Weißt du eigentlich, womit du da die ganze Zeit rumspielst?“ Sarah blickte in ihre Hand. Unbewusst hatte sie die ganze Zeit einen verwitterten Knochen in den Händen gewendet. Sie musste immer irgendetwas in der Hand haben. Die Kaffeetasse hatte sie schließlich ihrer Mutter gegeben.
„Na irgendein Knochen von einem Vieh“, entgegnete Sarah irritiert.
„Hach“, tönte es aus Herberts Mund. „Das Vieh zeig mir mal, das auf so dünnen Knochen stehen kann.“ Dann ging er davon.
„Mach’s gut, Sarah“, hörte sie ihre Mutter im Weggehen noch rufen. Sie drehte sich noch kurz um und winkte.
Sarah stand vor dem Haus, sah auf den Knochen in ihrer Hand und spürte wieder das Gefühl der Leere.
„Wer ist eigentlich diese Frau?“, vernahm sie noch von ihrem Vater, ohne dass dieser sich ihr zuwandte.
Sarah wusste, dass ihr Vater keine Antwort erwartete und sagte leise „Ja, ja.“
Marianne Fender wartete gedankenverloren im Auto. Herbert ahnte, dass irgendetwas nicht stimmte. Marianne war immer still, wenn sie auf eine ungestellte Frage eine Antwort haben wollte.
„Was?“, fauchte er sodann.
Marianne drehte sich zur Seite und blickte ihn an.
„Rede schon, was ist?“, wiederholte er in einem leiseren Ton.
„Wir sind jetzt seit über dreißig Jahren verheiratet. Eigentlich weiß ich immer, was los ist. Heute nicht. Hast du dafür eine Erklärung?“, fragte sie mit ruhiger Stimme. „Hab ich …?“
„Sesselfurzer“, unterbrach Herbert seine Frau. „Fühlen sich von Scherzinger übergangen, obwohl er ihr Boss ist“, raunte er mit der Hand vor dem Gesicht.
„Ich dachte, Scherzinger sei nur für die neue Fabrik zuständig?“, bohrte Marianne weiter.
„Ist er ja auch. Er hat aber mitbekommen, dass ich ein ruhiges Fleckchen auf dem Land suche und mir das Grundstück zu einem guten Preis angeboten.“
„In diesem Kaff?“
„Mädchen …“
„Lass das“, fuhr sie dazwischen. Herbert wusste, dass sie es nicht leiden konnte, wenn er mit ihr wie mit einem kleinen Schulmädchen sprach.
„Marianne, wir reden hier von vier Hektar Land, einem alten Bauernhof und einer Baugenehmigung für vier kleine Einfamilienhäuser.“
„Aber nicht legal?“, unterbrach sie ihn. Herbert nahm die Hand vom Gesicht.
„Definiere mir legal?“ Er machte eine kurze Pause. „Scherzinger wollte die Fabrik in seiner Region haben. Wir schaffen Arbeitsplätze. Er bot mir das Grundstück an, wie gesagt, zu einem günstigen Preis. Das steht angeblich seit der Wende leer. Schau dir das an, die Substanz ist doch intakt. Was soll daran nicht legal sein?“
„Die Baugenehmigung“, beantwortete Marianne ihm umgehend seine Frage, die eigentlich keiner Antwort bedurfte.
„Die Fabrik wird mitten auf einem Feld stehen. Jedes beschissene Gewerbegebiet wird irgendwo in der Walachei gebaut. Da fragt doch auch keiner, ob das mal landwirtschaftliche Nutzfläche war oder nicht. Hauptsache, die Leute haben Arbeit, und die Sesselfurzer können sich was auf die Fahne schreiben.“ Langsam begann Herbert, sich in Rage zu reden.
„Für das Gebiet um die Fabrik gibt es einen Bebauungsplan.“ So viel wusste Marianne, war sie doch seit Jahren in die Firma involviert. Alles, was bearbeitet werden musste an Genehmigungen, Anträgen und Schreibkram, ging über ihren Tisch.
„Na was denkst du denn, wie der so schnell zustande gekommen ist? Hier ein Anruf, da ein Anruf. Der Osten lechzt nach Investitionen. Endlich geht was voran im Land. Da wollen alle dabei sein. Politiker wollen gewählt werden. Ob das ganz oben ist oder der Scherzinger hier auf‘n Dorf. Für die zählt jeder Arbeitsplatz. Und der Maschinenbau verkauft sich besser als Landwirtschaft.“ Herbert wischte sich mit einem Taschentuch die Lippen ab. „Oder siehst du hier weit und breit einen Traktor das Feld bewirtschaften?“
Marianne nahm ihm das Taschentuch aus der Hand. Sie blickte ihn warnend an.
„Ich will mich bloß nicht irgendwann für etwas schämen müssen.“
Wieder lag ein gekünsteltes Lächeln auf Herberts Lippen.
„Schau dir das Gehöft doch an. Die müssten sich für jeden Euro schämen, den sie dafür genommen haben.“
„Ich denke, die Substanz ist in Ordnung, und immerhin wohnt unsere einzige Tochter darin.“
„Sie wollte es so haben.“
„Sie wollte auch zur Polizei, und was hat sie jetzt davon?“
Außer einem leisen, fast verschlucktem „Hm“ wollte Herbert nichts mehr erwidern. Sie saßen noch eine Weile im Auto, ohne ein Wort zu sprechen. Jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, beobachteten sie, wie die Abenddämmerung hereinbrach. Nicht weit entfernt von ihrem Auto flackerte ein kleines Feuer auf der Straße.





























