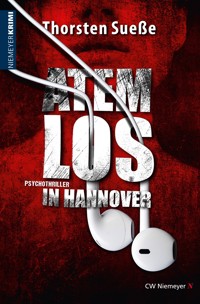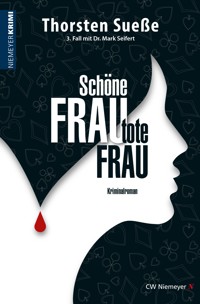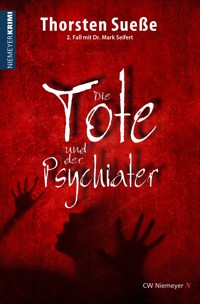6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hannover-Krimi
- Sprache: Deutsch
Hannover-Linden. Sebastian Rokahr, ein 18-jähriger Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums, wird ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Tod gleicht einer Hinrichtung. Das streckenweise kriminelle Verhalten des Opfers passte so gar nicht in das bisherige Bild der Lindener Vorzeigeschule: Diebstahl, Erpressung, sexuelle Belästigung einer Lehrerin, Kontakte zu Drogendealern und Einbrechern aus dem Hannoverschen Rotlichtmilieu. Außerdem hatte der intelligente und wortgewandte Sebastian einen psychologischen Kriegszug gegen einen seiner Lehrer, Carsten Sonnenberg, geführt und diesen über Monate im Unterricht gedemütigt. Sonnenbergs Frau Anna und ihr Kollege Bernd Kramer, zwei couragierte Lehrkräfte des Lindener Gymnasiums, sind bereit, sich auch mit unkonventionellen Maßnahmen für die Belange ihrer Schüler einzusetzen. Das führt sie ins Rotlichtviertel von Hannover, wo sie in eine lebensbedrohliche Situation geraten – und Bernd Kramer unter Mordverdacht. Zwei weitere Opfer, die eine Verbindung zum Hermann-Hesse- Gymnasium aufweisen, werden in ihren Wohnungen ermordet. Die polizeiliche Rekonstruktion der Geschehnisse am Tatort verweist auf einen Serienmörder. Welche Rolle spielt dabei die Plansprache Esperanto, die Sebastian und einige Personen seines Umfelds perfekt beherrschen? Dr. Mark Seifert, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Region Hannover und Psychiater mit kriminalistischem Spürsinn, hat einen guten Grund, sich zunehmend mit der geheimnisvollen Mordserie zu beschäftigen: seine Zuneigung zu Anna Sonnenberg, die alle Opfer gekannt hat. Er ahnt nicht, in welch tödliche Gefahr er sich dadurch begibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2012 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
unter Verwendung eines Motivs von shutterstock.com
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, Groβburgwedel
Printed in Germany
ISBN 978-3-8271-9454-1
E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
E-Book ISBN 978-3-8271-9822-8
Der Kriminalroman spielt hauptsächlich in Hannover, daneben in Hemmingen (überwiegend im Stadtteil Arnum) und auf Rügen. Personen und Geschehnisse sind frei erfunden, jedoch Parallelen zur Realität unvermeidbar. Die Beschreibung der unmittelbaren Tatorte, an denen es zu kriminellen Handlungen kommt, ist ausgedacht.
Über den Autor:
Dr. med. Thorsten Sueβe, geboren 1959 in Hannover, verheiratet, zwei Kinder, wohnt seit vielen Jahren mit seiner Familie am südlichen Rand seiner Geburtsstadt. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Bei der Darstellung der Handlung des vorliegenden Kriminalromans orientierte er sich an seinem eigenen Arbeitsalltag, der durch eine regelmäβige Zusammenarbeit mit der Polizei Hannover geprägt ist. Der Autor veröffentlichte bisher unter anderem ein Fachbuch über die NS-„Euthanasie“ in Niedersachsen, ein Theaterstück und zahlreiche Kurzgeschichten in diversen Anthologien, auβerdem schrieb er ein Drehbuch für einen Spielfilm. Daneben betätigte er sich als Schauspieler, hauptsächlich im Bereich Theater, hatte aber auch Sprechrollen in Fernseh- und Kinoproduktionen.
Er ist Mitglied im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen.
Weitere Informationen über den Autor unter:
www.thorsten-suesse.de
Gewidmet Dr. Ludwik L. Zamenhof, dem Begründer der Plansprache Esperanto, deren Grundlagen er erstmals 1887 veröffentlichte
Unu / Eins
Schon die Wettervorhersage lässt für den heutigen Tag nichts Gutes erahnen. Kriminalhauptkommissar Thomas Stelter blickt an diesem Morgen etwas missmutig von seinem Schreibtisch aus dem Fenster seines Büros im 4. Stockwerk an der Waterloostraße 9. Für heute, Mittwoch, den 7. Dezember 2011, sind für Hannover kräftiger Regen und Sturmböen angekündigt. Draußen sind momentan ungefähr vier Grad. Schnee hat es bis jetzt weder in diesem noch im Vormonat gegeben.
Stelter hat an diesem Tag zusammen mit seiner Kollegin Renner „Mordbereitschaft“, muss sich also sofort um neu gemeldete Mordfälle kümmern.
Er geht noch einmal das vor ihm liegende Vernehmungsprotokoll durch, als das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelt. Er nimmt den Hörer ab und hat einen Kollegen vom Kriminaldauerdienst am Apparat. Seine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ein Leichenfund im Hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte, Todesursache eindeutig Fremdeinwirkung. Während Stelter sich die wichtigsten Details anhört, gerät er innerlich zunehmend unter Anspannung. Er hält das Gespräch kurz, hat sich einige Notizen zu Name, Alter und Fundort des Opfers gemacht. Alles Weitere wird er persönlich vor Ort in Erfahrung bringen. Gerade, als er nach Beendigung des Telefonats kraftvoll den Hörer auflegt, betritt Kriminaloberkommissarin Andrea Renner das gemeinsame Büro. Mit einem Blick hat sie erkannt, was los ist.
„Ein Einsatz?“, fragt sie und mustert Stelter dabei aufmerksam. Ihre Frage ist eher rhetorisch gemeint. Die beiden Polizisten sind gut aufeinander eingespielt und wissen auch ohne viele Worte, was jeweils den anderen dienstlich beschäftigt.
Stelter nickt: „Richtig. Ein junger Mann ist heute Morgen ermordet in seiner Wohnung in Linden aufgefunden worden. Alles ziemlich grauenhaft.“
Stelter gibt die Informationen, die er hat, präzise an Andrea weiter. Dabei ziehen sich beide bereits ihre Winterjacken an und machen sich auf den Weg zu ihrem Dienstwagen, einem grauen VW Passat.
Stelter setzt sich mit großer Selbstverständlichkeit ans Steuer, Andrea nimmt wie immer auf dem Beifahrersitz Platz. Sie fahren zügig aus der Tiefgarage des Hauptgebäudes der Polizeidirektion Hannover. Ihr weißes fünfstöckiges Dienstgebäude liegt im zentralen Stadtteil Calenberger Neustadt. Stelter fährt von der Waterloostraße auf die Laves-Allee Richtung Leineschloss. Der Weg über Bremer Damm und Westschnellweg führt um diese Zeit am schnellsten nach Linden. Die beiden optisch sehr unterschiedlichen Polizisten, der etwas füllige Thomas Stelter, Anfang fünfzig, und die sehr sportlich wirkende Andrea Renner, Mitte dreißig, gehören zur Kriminalfachinspektion 1.1 K „Straftaten gegen das Leben“. Einsätze wie diese gehören zu ihrem normalen Arbeitsalltag, aber besonders, wenn das Opfer sehr jung ist, packt auch den sachlichen Stelter immer wieder eine merkliche Bedrücktheit. Der heutige Tote könnte vom Alter her sein Sohn sein. Seine Kollegin Andrea reagiert meistens sowieso viel emotionaler als er und lässt dann ihren Empfindungen freien Lauf. Die Unterhaltung der beiden Ermittler auf der Fahrt nach Linden-Mitte ist spärlich, gedanklich beschäftigen sich beide mit dem, was sie in einigen Minuten am Tatort erwarten wird.
Mit Linden, unterteilt in die Stadtteile Nord, Mitte und Süd, verbindet Stelter ansonsten Lebendigkeit und Abwechslung. Linden ist multikulti, hier leben zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund aus ganz unterschiedlichen Schichten – in der Regel völlig friedlich neben- und miteinander. Heute ist das friedliche Miteinander offenbar brutal unterbrochen worden.
Der Tatort befindet sich in einem Mietshaus in der Davenstedter Straße. Ungefähr zwei Minuten nach Verlassen des Westschnellweges biegt Stelter in die Davenstedter Straße ein und parkt den Wagen vor einer Apotheke. Hier finden sich zahlreiche mehrstöckige Häuser mit kleinen Türmchen im Jugendstil.
Es hat angefangen zu regnen. Stelter und Andrea steigen aus. Der Wind zerzaust Andreas lange braune Haare, bei Stelters schütterem grauen Haar gibt es nicht mehr viel zu zerzausen.
Stelter zeigt Richtung Fußgängerzone, wo einige Einsatzfahrzeuge der Polizei vor einem dreistöckigen rot verklinkerten Haus parken: „Da muss es sein!“
Die Fußgängerzone darf – außer von Fahrrädern – eigentlich nur von Stadtbahn oder Bus durchfahren werden.
Sie gehen schnellen Schrittes auf das Haus zu, vorbei an Bäckerei „Bernhardt“, Döner-Lokal „Antalya“ und Kiosk „Aladin“. Vor dem Haus befindet sich die Haltestelle der Stadtbahnlinie 9. Die Wartehäuschen für Fahrgäste auf beiden Seiten der Straße bemühen sich um Originalität: Zwei riesige runde Metallplatten, die wie überdimensionale Suppenteller aussehen, sind an der Rückfront der Wartehäuschen aufgehängt.
Der Bereich vor dem Hauseingang ist durch rotweiße Bänder abgesperrt. Mehrere uniformierte Polizisten sorgen dafür, dass keine Schaulustigen ins Haus gelangen. Trotz des Regens stehen einige Personen an der Absperrung und gucken neugierig, als sich Stelter und Andrea zielstrebig nähern. Stelter zeigt einem der Uniformierten seinen Dienstausweis und geht ungehindert unter dem Absperrband hindurch zum Eingang, gefolgt von Andrea. Ein Schild neben dem Eingang weist darauf hin, dass sich im Erdgeschoss eine Zahnarztpraxis befindet.
„Es ist im 2. Stock links“, ruft ihnen der uniformierte Polizist hinterher.
Stelter nickt und betritt den Hausflur. Im Vorbeigehen bemerkt er, dass das Haus über keine Gegensprechanlage verfügt. Das Erdgeschoss beherbergt die Briefkästen der Bewohner. Das Treppenhaus ist schmal, aber hell und freundlich. Im 2. Stockwerk steht die linke Wohnungstür offen. „Rokahr“ steht auf dem Namensschild oberhalb der Klingel. In der Wohnung erledigen die Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes in ihren weißen Overalls routiniert ihre Arbeit – Spurensicherung.
„Hallo Jungs“, sagt Stelter ohne erkennbare Emotion beim Betreten des Wohnungsflures und kann bereits von hier den Toten im Wohnzimmer sehen.
Die Overallträger halten kurz in ihrer Arbeit inne und begrüßen die Eintretenden: „Morgen, Thomas. Morgen, Andrea“. Das Wort „gut“ haben sie bewusst vermieden.
Der Tote liegt auf dem Rücken neben einem Stuhl im Wohnzimmer, Arme und Beine sind gefesselt. Der Rechtsmediziner von der Medizinischen Hochschule, Dr. Ulrich Lindhoff, kniet neben der Leiche und untersucht sie. Lindhoff unterbricht seine Arbeit und begrüßt Stelter und Andrea. Alle kennen sich seit Jahren und sind am Tatort ein eingespieltes Team.
„Der Ermordete heißt Sebastian Rokahr und ist 18 Jahre alt“, teilt Lindhoff mit.
Mit entsetztem Gesichtsausdruck schaut Andrea auf den ermordeten jungen Mann, der merklich älter als 18 wirkt.
Er sieht schon so erwachsen aus, geht es Andrea durch den Kopf. Zu Lebzeiten anscheinend ein gut aussehender junger Mann.
Hände und Füße von Sebastian Rokahr sind mit braunem Klebeband zusammengebunden. Die Arme befinden sich vor dem Oberkörper. Ein durchgeschnittenes Seil liegt auf dem Fußboden. Auf dem Teppichboden sind rote Flecke, sicherlich Blut. Ein brauner Klebestreifen auf Sebastians Mund hat offenbar verhindert, dass er sich unmittelbar vor seinem Tod durch Schreien hätte bemerkbar machen können. Er liegt auf dem Rücken, Jeans und Unterhose sind heruntergezogen und lassen einen Blick auf seine äußeren Geschlechtsorgane zu. Das Oberhemd ist gewaltsam aufgerissen worden, wie Stelter an einigen fehlenden Knöpfen erkennt. Das hochgeschobene Unterhemd gibt den Blick auf den muskulösen Oberkörper frei, in den vor Kurzem die beiden großen Buchstaben M und B blutig eingeritzt worden sind.
„Hier befinden sich Brandmale am Hals“, erklärt Lindhoff, der sich erneut neben den toten Körper gekniet hat.
„Und hier“ – er zeigt auf den entblößten Unterkörper – „sind weitere Brandmale im Bereich der Hoden des Opfers.“
Stelter schüttelt fassungslos den Kopf.
Der Arzt weist auf den rechten Oberarm:
„An dieser Stelle ist eine Stichverletzung, wahrscheinlich von einem Messer.“
Schließlich deutet er auf die Brust des Toten: „Ein Stich ins Herz hat vermutlich den Exitus herbeigeführt.“
„Das sieht ja regelrecht aus wie eine Hinrichtung“, stellt Andrea mit deutlicher Abscheu in der Stimme fest.
„Da hast du recht“, stimmt Lindhoff ihr zu. „Vorbehaltlich der Obduktion vermute ich momentan folgenden Tathergang: Die Totenstarre ist vollständig ausgebildet. Der Tod ist wahrscheinlich gestern im Verlauf des Abends eingetreten. Es sieht so aus, dass der Täter Sebastian Rokahr überwältigt und ihm anschließend Hände und Füße gefesselt hat. Dann könnte er ihm die Hosen heruntergezogen und ihn so in sitzender Position an den Stuhl gebunden haben. Fesselspuren an Oberkörper und Unterschenkel deuten darauf hin.“
„Und dann …?“, erkundigt sich Andrea.
„Dann hat der Täter vielleicht Sebastian die Brandmale an den Hoden beigebracht, ihm in den rechten Arm gestochen und ihn schließlich durch den gezielten Stich ins Herz getötet.“
Andrea vollzieht den Tathergang vor ihrem geistigen Auge.
„Nach Durchschneiden des Seils, mit dem das Opfer an den Stuhl gefesselt war, fällt der leblose Sebastian auf den Boden und der Mörder entblößt den Brustkorb des Opfers, um ihm die Buchstaben M und B in die Haut zu ritzen. Aber wie gesagt, zurzeit alles nur Vermutungen ohne Gewähr.“
„Gibt es Hinweise auf Raub?“, fragt Stelter sachlich.
Max Quast, einer der Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes, mischt sich ein: „Es ist nicht erkennbar, dass Schränke durchwühlt worden sind oder etwas weggekommen ist. Allerdings muss jemand das Notebook auf den Fußboden geworfen und in dessen Monitor getreten haben. Zusätzlich ist auch noch ein DVD-Rohling zerbrochen worden. Die Eingangstür weist keine Spuren von Gewalt auf. Das Opfer muss also seinen Mörder selbst in die Wohnung gelassen haben.“
Stelter schaut sich in der Wohnung um. Es ist eine Einzimmerwohnung mit Küche, Bad und einem kleinen Balkon. Sebastian hat anscheinend hier alleine gewohnt. In einer Ecke des Wohnzimmers sieht Stelter das beschädigte Notebook und den zerbrochenen DVD-Rohling auf dem Fußboden liegen. Ansonsten befinden sich im Wohnzimmer noch ein größerer Flachbildfernseher, ein Blu-ray-Spieler, ein Drucker-Scanner-Kombinationsgerät und zwei Spielekonsolen.
„Das haben wir zerknüllt im Wohnzimmer gefunden“, sagt Quast und hält Stelter ein Blatt Papier DIN-A4 entgegen. Stelter zieht sich Einmalhandschuhe an, nimmt das Blatt Papier an sich und betrachtet es voller Interesse. Es handelt sich dabei um den Ausdruck eines Fotos aus dem Internet. Das Foto zeigt eine größere Gruppe von Männern und Frauen unterschiedlichen Alters, die sich in mehreren Reihen für einen Fotografen in Positur gestellt haben. Der Kopf einer freundlich lächelnden Frau ist mit einem roten Filzstift umkringelt worden. Daneben steht mit roter Schrift: „Anna – geil“, ein mit dem Filzstift gezogener Pfeil zeigt auf das umkringelte Frauengesicht. Die Frau auf dem Foto ist ungefähr Anfang dreißig. Stelter ist sehr erstaunt, denn er kennt die Frau im Zusammenhang mit einem anderen ungeklärten Mordfall. Die Frau ist Lehrerin am Hermann-Hesse-Gymnasium. Sicherlich handelt es sich um ein Gruppenfoto des Lehrerkollegiums. Neben ihr steht ein Mann wahrscheinlich gleichen Alters, dessen Gesicht mit einem roten X durchgestrichen ist.
Andrea, die sich inzwischen ebenfalls Einmalhandschuhe angezogen hat, öffnet einen Schrank neben der Bettcouch.
„Oho, alles teure Markenklamotten“, sagt sie mit einer Mischung aus Bewunderung und Erstaunen. „Der junge Mann hat nicht schlecht gelebt.“
„Weiß Gott nicht“, sagt Quast, der gerade eine DVD-Plastikbox öffnet, die im Bettkasten unter der Couch gelegen hat. In der vermeintlich leeren DVD-Box kommen mehrere kleine bunte Pillen zum Vorschein, in die verschiedene Symbole eingestanzt sind.
„Sieht nach Ecstasy aus“, wertet Quast seinen Fund.
Andrea zieht hörbar die Luft durch die Nase. Da scheint einiges im Argen zu sein.
„Wer hat Sebastian heute Morgen gefunden?“, will Stelter wissen.
„Seine Mutter“, antwortet ein uniformierter Polizist. „Sie besitzt einen Schlüssel zur Wohnung und wollte ihrem Sohn heute saubere Wäsche bringen.“
„Wo ist die Mutter jetzt?“, fragt Andrea.
„Sie hat einen schweren psychischen Schock erlitten und musste in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Das habe ich veranlasst“, berichtet Lindhoff. „Nachbarn hatten sich vorher um die verstörte Frau gekümmert und die Polizei verständigt.“
„Und was ist mit dem Vater des Jungen?“, erkundigt sich Andrea weiter.
„Der Vater ist der Inhaber des Autohauses Rokahr in Hannover-Misburg. Wir haben versucht, ihn zu erreichen. Aber er ist auf einer Geschäftsreise. Inzwischen haben wir aber seine Handynummer“, weiß der Uniformierte zu berichten. „Außerdem wissen wir, dass Sebastian Rokahr Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums in Linden ist.“
„Ich gehe davon aus, dass der Täter bereits mit dem Vorsatz in diese Wohnung gekommen ist, Sebastian Rokahr zu ermorden“, bekundet Quast.
„Was muss da schon im Vorfeld im Kopf des Täters vorgegangen sein, dass er einen jungen Mann auf diese grausame Weise umbringt?“, murmelt Stelter und blickt dabei fragend den Arzt an, der nur ratlos mit den Schultern zuckt.
Thomas Stelter ist wieder an seinen Arbeitsplatz im Hauptgebäude der Polizeidirektion Hannover zurückgekehrt. Andrea hat den Vater des Toten ausfindig gemacht und sich mit ihm verabredet, um ihn schonend über den gewaltsamen Tod seines Sohnes zu informieren. Soweit erreichbar, sind die Nachbarn des Toten bereits befragt worden. Lediglich die Beobachtungen eines Pärchens sowie eines Kioskbesitzers könnten hilfreiche Hinweise sein.
Stelter durchforstet die ihm zugänglichen Polizeidaten und findet heraus, dass Sebastian Rokahr im September dieses Jahres polizeilich auffällig geworden ist – wegen Diebstahls.
Das Gruppenfoto auf dem zerknüllten Ausdruck geht Stelter nicht aus dem Kopf. Jetzt muss ihm das Internet weiterhelfen. An seinem PC gibt er bei Google „Hermann-Hesse-Gymnasium“ ein. Sofort gelangt er über den gefundenen Link direkt auf die Homepage des Lindener Gymnasiums. Auf der Seite befindet sich links der Button „Lehrerkollegium“, den er anklickt. Es öffnet sich eine Unterseite mit mehreren Bildern. Da das Lehrerkollegium aus ungefähr hundert Personen besteht, sind die Lehrkräfte auf drei Gruppenfotos verteilt. Stelter schaut sich das erste Gruppenfoto an. Es ist dasjenige, welches sich ausgedruckt in Sebastians Wohnung befunden hat. Sehr hilfreich ist die Legende unterhalb des Bildes, mit der sich die Namen der einzelnen Lehrer zuordnen lassen. Tatsächlich, bei der mit rotem Filzstift markierten Frau handelt es sich um Anna Sonnenberg. Neben ihr steht Carsten Sonnenberg, sicherlich ihr Mann. Sein Gesicht war auf dem zerknüllten Ausdruck durchgestrichen worden. Wenn Sebastian diese Kommentierungen vorgenommen haben sollte, geben sie bemerkenswerte Hinweise auf seine Beziehung zu diesem Lehrerehepaar.
Die Kollegen von der Kriminaltechnik sind dabei, die Festplatte des beschädigten Notebooks zu überprüfen. Auf dem zerbrochenen DVD-Rohling stand handschriftlich „Anna“.
Die in der Wohnung des toten Sebastians gefundenen Pillen, deren chemische Analyse noch aussteht, lassen bei Stelter den Verdacht aufkommen, dass Sebastians Tod im Zusammenhang mit dem Mord an einem anderen ehemaligen Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums stehen könnte.
Stelter sucht auf dem Gruppenfoto nach Bernd Kramer. Aber ihn kann er dort nicht entdecken. Erst auf dem zweiten Foto hat er Erfolg. Bernd Kramer steht hier gleich neben Jürgen Neuber, dem Leiter der Schule.
Als Stelter „Sebastian Rokahr“ in die Suchmaschine eingibt, wird er schnell fündig. Sebastian hat im Internet eine großspurig aufgemachte Homepage, auf der er zahlreiche Bilder von sich veröffentlicht hat – und seine Adresse, die mit dem heutigen Fundort seiner Leiche übereinstimmt.
Du / Zwei
Freitag, 2. September 2011.
Das Leben ist teuer, zumindest wenn man es wirklich genießen will. Es sind weniger die technischen Geräte, die man gelegentlich kauft, sondern mehr die zahlreichen Klamotten, die man täglich benötigt, um die eigene Rolle darstellen zu können. Und manchmal ist es auch die Chemikalie, die notwendig ist, um gelegentliche Tiefpunkte zu überwinden.
Sebastian Rokahr ist wieder unter die Stadtbahnfahrer gegangen. Seit er vor zwei Monaten wegen eines Autounfalls, an dem er als Fahrer unter Alkoholeinfluss beteiligt gewesen ist, seinen Pkw-Führerschein abgegeben hat, benutzt er notgedrungen wieder täglich die öffentlichen Verkehrsmittel. Heute Morgen hat er sich spontan dazu entschlossen, nicht in die Schule zu fahren. Seine Pläne, wie er stattdessen den Vormittag verbringen wird, sind noch diffus.
Gegen 10 Uhr verlässt er seine Wohnung in der Davenstedter Straße und steigt in die Stadtbahn. Um diese Zeit ist es nicht schwierig, sich einen Sitzplatz aussuchen zu können. Sebastian trägt ein kurzärmeliges weißes T-Shirt über der langen Jeans, über der rechten Schulter eine grünfarbene Umhängetasche. Er hat sich heute bewusst unauffällig gekleidet. Draußen ist es bereits angenehm warm. Nachdem die Monate Juli und August kaum mit Sommer in Verbindung zu bringen gewesen sind, soll es im September noch einmal richtig heiß werden. Sebastian ist das nur recht. Heißes sonniges Wetter ist nach seinem Geschmack. Das hat er mit Anna gemeinsam. Der Gedanke an seine Lehrerin löst ein wohliges Gefühl in ihm aus.
Die Stadtbahn taucht in den Tunnel ein und fährt unterirdisch weiter. An der U-Bahnstation Kröpcke verlässt Sebastian die Bahn und gelangt von dort aus wieder an die Oberfläche. Die über mehrere Ebenen verzweigte U-Bahnstation ist ein zentraler Punkt in Hannover. Von hier aus führt die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade mit ihren zahlreichen kleinen Geschäften, eine Art Untergeschoss der Bahnhofstraße, zum Hauptbahnhof.
Der Kröpcke-Platz ist das Herz der Stadt. An ihn grenzen Hannovers erste Geschäftsstraße, die Georgstraße, außerdem die von Hugendubel aufgekaufte große Traditionsbuchhandlung „Schmorl & von Seefeld“, das im Umbau befindliche Modegeschäft „Peek & Cloppenburg“, die für gewöhnlich gut besuchte Eisdiele „Giovanni L.“ oder das Café „Mövenpick“, vor dem schon die ersten Gäste draußen ihren Cappuccino genießen. Vom Kröpcke hat man einen guten Blick auf das Opernhaus und den Opernplatz.
Dafür interessiert sich Sebastian heute nicht. Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Geldautomatenhalle der Sparkasse in der Bahnhofstraße rechts neben „Schmorl & von Seefeld“. Langsam schlendert er in die Halle, in der sich nebeneinander 12 Auszahlungsautomaten befinden, außerdem mehrere Automaten zum Ausdrucken von Kontoauszügen und Tätigen von Überweisungen.
Einige Kunden sind in der Halle, um Geld abzuheben oder ihren Kontostand zu überprüfen. Sebastian holt umständlich seine eigene Sparkassen-Card aus seiner Umhängetasche. Während er die Karte in den Schlitz des Kontoauszugsdruckers steckt, sieht er aus dem Augenwinkel, wie eine junge Mutter mit einem Kinderwagen und einem ungefähr vierjährigen Mädchen an der Hand die Halle betritt. Die Frau nimmt den Rucksack von ihrer Schulter und holt aus einer der Vordertaschen ihr Portemonnaie, in dem sich ihre Sparkassen-Card befindet. Ihre kleine Tochter möchte gerne die Karte in den Schlitz des Geldautomaten stecken. Als die Mutter ihr mitteilt, dass das heute nicht geht, fängt die Kleine postwendend an zu quengeln, was dazu führt, dass das Baby im Kinderwagen zu weinen beginnt.
„Mama, du hast es beim letzten Mal versprochen!“
„Nein, nicht hier in der Stadt. Das darfst du wieder bei dem Automaten vor unserem Zuhause.“
„Aber ich will das. Du hast es versprochen …“
Das Baby weint immer lauter.
Die genervte Mutter gibt schließlich nach und reicht ihrer Tochter die Karte. Zweimal steckt das Mädchen die Karte verkehrt herum in den Schlitz.
„Du musst sie andersherum nehmen“, erklärt die Mutter.
Das Spektakel lässt es glaubwürdig erscheinen, dass Sebastian in aller Ruhe die junge Mutter mit ihren Kindern aufmerksam beobachtet. Beim dritten Mal gelingt es dem kleinen Mädchen, die Karte richtig in den Geldautomaten zu schieben. Die Mutter tippt Geldsumme und Geheimzahl ein. Sebastian kann genau sehen, wie die Frau das Geldbündel aus dem Automaten holt und nachzählt – dreihundert Euro in Fünfzigern. Die Frau steckt die Euroscheine in ihr Portemonnaie, was sie wiederum in der Vordertasche ihres Rucksacks verstaut. Die Vordertasche, sofort durch einen zugezogenen Reißverschluss gesichert, stellt für Sebastian kein Problem dar.
Die Mutter fasst mit der rechten Hand ihre vierjährige Tochter an, nimmt mit der linken Hand den Kinderwagen und verlässt langsam die Geldautomatenhalle. Den Rucksack hat sie sich jetzt über beide Schultern gehängt. Das Baby verhält sich wieder ruhig. Das kleine Mädchen will ihre Mutter Richtung „Galeria Kaufhof“ ziehen.
„Ich will zu den Spielsachen“, sagt sie zu ihrer Mutter.
„Nein, Mia. Komm jetzt. Wir müssen noch einige Sachen für Papa einkaufen.“
Die Vierjährige heißt also Mia, registriert Sebastian, der ebenfalls die Halle verlassen hat. Die Kleine wird von ihrer Mutter in die andere Richtung gezogen. Bereits nach einigen Metern bleiben sie vor „Schmorl & von Seefeld“ stehen. Die Buchhandlung hat draußen mehrere Stände mit preiswerten Büchern aufgebaut.
„Guck mal, Mama. Ein Buch mit kleinen Hunden.“
Bevor die Mutter reagieren kann, hat Mia schon ein Buch mit Fotos von Hundewelpen in den Händen.
„Nun fass nicht alles an“, ermahnt die Mutter.
Sebastian ist ihnen unauffällig gefolgt. Neben den Büchern stehen Ständer mit originellen Postkarten. Sebastian tut so, als würde er sich die Postkarten ansehen. Die Mutter guckt jetzt zusammen mit Mia das Welpen-Bilderbuch durch.
„Aber nur angucken. Du hast ja schon so ein Buch. Kaufen tun wir das nicht“, erklärt sie ihrer Tochter.
Die Mutter scheint sich damit durchsetzen zu können, dass nur geguckt, aber nicht gekauft wird. Das ist für Sebastian eine günstige Konstellation. Während sich Mia und ihre Mutter intensiv mit dem Bilderbuch beschäftigen, schiebt sich Sebastian seitlich von hinten an die Mutter heran, so als ob er ihr über die Schulter zuschauen würde. Dabei berührt er sanft ihren Rucksack. Mit einem unmerklichen Ruck hat er den Reißverschluss der Rucksacktasche geöffnet. Er hält einen Moment inne. Die Frau hat davon offenbar nichts bemerkt. Der Griff in die Rucksacktasche nach dem Portemonnaie wirkt geradezu routiniert. Mit einer kurzen schnellen Bewegung hat er das Portemonnaie aus dem Rucksack geholt und in seine eigene Umhängetasche gesteckt. Wieder verharrt er für einige Sekunden. Dann schlendert er langsam weiter zum Kröpcke in Richtung des hohen Bauzauns, der noch das mehrstöckige Gebäude von „Peek & Cloppenburg“ umgrenzt, das seit einigen Jahren aufwendig umgebaut wird. Aus sicherer Entfernung sieht er, wie die Mutter Mia das Bilderbuch aus der Hand nimmt und sich mit ihr samt Kinderwagen auf den Weg macht. Damit sind sie für ihn nicht mehr von Interesse.
Wer so unvorsichtig so viel Geld abhebt, muss davon genug haben, geht es ihm durch den Kopf. Und er muss grinsen: Manchmal können Kinder für ihre Mütter zum Unglück werden.
Heute ist anscheinend sein Glückstag. Sebastian beschließt, seine Glückssträhne an diesem Vormittag vollständig auszuschöpfen.
Er geht die Bahnhofstraße zurück an „Schmorl & von Seefeld“ vorbei zur „Galeria Kaufhof“. Im Erdgeschoss des Kaufhauses sind links vom Eingang die Schreibwaren, rechts die Handtaschen für Frauen. Etwas unschlüssig nähert er sich der Rolltreppe nach oben, bleibt stehen und schaut auf die Infotafel. Ein Ehepaar Mitte fünfzig geht an ihm vorbei und stellt sich nebeneinander auf die Rolltreppe. Intuitiv entschließt sich Sebastian, ihnen zu folgen. Er steht direkt hinter dem Paar, als die Frau zu ihrem Mann sagt:
„Ich geh noch mal in die Damenabteilung und suche nach einem passenden Blazer für das Kleid. Ich hol dich dann in der Herrenabteilung ab.“
„Ist gut“, antwortet der Mann knapp.
„Kannst du den Anzug denn überhaupt bezahlen? Deine EC-Karte ist doch kaputt“, will seine Frau wissen.
Der Mann deutet ein Lächeln an: „Ja, ja, ich hab genug Bargeld dabei.“
Sebastian fühlt sich bestätigt, er hat wieder den richtigen Riecher gehabt. Der Mann trägt eine leichte Sommerjacke, in der sich sein Portemonnaie befinden könnte.
In der 1. Etage ist die Damenabteilung. Die Frau verabschiedet sich hier von ihrem Mann für „eine Viertelstunde“. Der Mann fährt die Rolltreppe weiter in die 2. Etage. Hier, in der Herrenabteilung, ist Freitagvormittag noch nicht viel los. Oftmals stellt sich dadurch ein Effekt ein, den Sebastian zu schätzen weiß. Kunden fühlen sich in leeren Kleiderabteilungen manchmal wie zu Hause und lassen die Achtsamkeit vermissen, die sie sonst angesichts einer größeren Ansammlung fremder Menschen selbstverständlich an den Tag legen würden.
In der Herrenabteilung gibt es eine große Auswahl von Anzügen bekannter Herstellermarken, wie „Roy Robsen“, „Bugatti“ oder „C. Comberti“. Ein Verkäufer im hellgrünen Hemd mit Krawatte und Pullunder hat sich sofort des Mannes angenommen und fragt ihn freundlich nach seinen Wünschen. Fachmännisch ermittelt der Verkäufer die Konfektionsgröße des Kunden und zeigt ihm dann mehrere Anzüge, deren Qualitäten er in wohlgesetzten Worten zu vermitteln weiß. Der Kunde hat seine Jacke über einen Kleiderständer gelegt. Seine Gesäßtaschen sind nicht ausgebeult, sodass das Portemonnaie wahrscheinlich wirklich in der Jackentasche ist. Je länger sich der Kunde mit den Jacketts der Anzüge beschäftigt, desto weniger hat er seine eigene Jacke im Auge. Sobald er eine engere Wahl getroffen hat und in eine der Umkleidekabinen geht, um die dazugehörigen Hosen anzuprobieren, wird er die Jacke mitnehmen. Sebastian muss jetzt rechtzeitig den richtigen Moment abpassen. Er schlendert wie zufällig zum Kleiderständer mit der Sommerjacke des Kunden. Vorsichtig sieht er die beiden Männer an, die jedoch durch das intensive Beratungsgespräch abgelenkt sind. Jetzt oder nie! Er lehnt sich an den Kleiderständer und scheint mit Interesse die Anzüge durchzugucken. Sein Herz schlägt spürbar schneller und er merkt, wie ihm der Schweiß den Rücken herunterläuft. Mit viel Geschick haben seine Finger das Portemonnaie in der Jackeninnentasche ertastet. Schnell hat er das Objekt der Begierde ergriffen und in seiner Umhängetasche verschwinden lassen. Langsam klingt seine innere Aufregung ab. Kunde und Verkäufer haben nichts bemerkt. Jetzt kann er in aller Ruhe den Rückweg antreten.
Plötzlich spürt er, wie sich eine Hand fest auf seine rechte Schulter legt.
„Würden Sie bitte mitkommen!“, sagt eine kräftige Stimme mit einer Entschlossenheit, die einen Widerspruch nicht einplant.
Verdammt!, schießt es Sebastian durch den Kopf. Ohne sich umgucken zu müssen, weiß er sofort, wer hinter ihm steht. Er hat den Kaufhausdetektiv übersehen. Was tun? Ein Adrenalinstoß durchflutet seinen Körper und innerhalb einer Sekunde kommt es zu einer Entscheidung. Mit einer Drehung befreit er sich aus dem Griff des Detektivs und rennt zur Rolltreppe. Er muss hier raus! Vor der Rolltreppe stößt er mit einem Kunden zusammen, der ihn zunächst erschrocken anstarrt und ihn im nächsten Moment verärgert zur Rede stellen will. Sebastian lässt den Mann einfach stehen und erreicht die Rolltreppe nach unten. Er hat wertvolle Sekunden verloren. An den Schritten hinter sich hört er, dass ihm der Verfolger ganz nah auf den Fersen ist. Auf der Rolltreppe zwischen 1. Etage und Parterre ist es bereits merklich voller. Sebastian schiebt eine Frau mittleren Alters unsanft zur Seite, hastet an ihr vorbei und erreicht das Erdgeschoss. Da sieht er einen Anzugträger gezielt auf sich zukommen. Ein zweiter Detektiv! Sebastian stoppt seinen Lauf und erwägt, zur Seite zu flüchten. Zu spät, der Verfolger von hinten umklammert ihn. Sebastian versucht sich gewaltsam zu befreien, schlägt mit der Faust nach dem Mann. Da ist schon der zweite Detektiv zur Stelle und packt ebenfalls zu. Sebastians gewaltsamen Widerstand beantworten die Detektive mit energischer Gegenwehr. Als er merkt, dass er gegen die beiden durchtrainierten Detektive nicht ankommen kann, gibt er seinen körperlichen Abwehrkampf auf. Eine Ansammlung von Kunden hat das Geschehen aufmerksam verfolgt, wobei sich einige Verkäuferinnen darum bemühen, die Normalität des Geschäftsalltags schnell wiederherzustellen.
Sebastian lässt sich von den Detektiven in ein Büro führen. Seine Umhängetasche ist von einem der Männer sichergestellt worden. Der bestohlene Kunde wird ebenfalls hinzugebeten. Ihm wird angeraten, Anzeige gegen den Dieb zu erstatten.
Sebastian sitzt auf einem Stuhl und schaut wütend in die Runde.
„Iru al infero! Mi malamegas vin!“, stößt er mit gepresster Stimme hervor.
„Was ist …?“, äußert einer der Detektive.
„Mi fekas sur vin, malsaĝuloj!“
„Nun seien Sie mal vernünftig und beantworten uns ein paar Fragen zu Ihren Personalien“, fordert der andere Detektiv.
„Neniam mi elbabilos pri miaj personaĵoj al vi“, ist Sebastians Antwort. „Mi ne lasas timigi min.“
„Bitte nennen Sie uns Ihren Vor- und Familiennamen“, versucht es einer der Detektive erneut.
„Flaremulojn mi malamegas!“
Die Kaufhausdetektive informieren die Geschäftsleitung und ziehen die Polizei hinzu.
Sebastian befindet sich in einem der hinteren Büroräume der Polizeiinspektion Mitte in der Herschelstraße. Er sitzt an einem Schreibtisch zwei Polizisten gegenüber: Gudrun Schäfer und Rainer König. Die Aufgabe der Polizei besteht in diesem Fall darin, die Personalien des Täters festzustellen und die Anzeige des Geschädigten entgegenzunehmen. Aber es ist das merkwürdige Verhalten des Täters, das die Polizeibeamten dazu bewogen hat, sich näher mit ihm zu beschäftigen. Durch Personal- und Schülerausweis wissen die Polizisten, mit wem sie es zu tun haben.
„Pass mal auf, Sebastian. Nun lass uns mal vernünftig ein Wort von Mann zu Mann reden“, sagt König und versucht zum wiederholten Mal, ein Gespräch in aller Ruhe mit Sebastian zu führen.
Ohne Vorankündigung braust dieser auf: „Mi estas libera burĝo! Lasu min trankvila, fipolicanoj!“
„Nun mach mal halblang, Junge“, entgegnet König und macht eine beschwichtigende Handbewegung.
Sebastian fängt an zu schreien: „Ĉiujn vin mi mortigos aŭ mi memmortigos min!“
Gudrun, ihren eigenen Sohn vor Augen, hat nicht so viel Geduld: „Jetzt hör auf, hier auf verrückt zu machen!“
Sebastian schaut die Beamtin einen Moment schweigend an, dann fängt er leise an zu wimmern:
„Mi memmortigos min, mi memmortigos min, mi memmortigos min …“
König schüttelt den Kopf: „Also mir ist die ganze Sache nicht geheuer.“
Tri / Drei
Ich bin froh, dass bald Wochenende ist. Aber noch habe ich bis 13 Uhr Notfallbereitschaft. Lustlos diktiere ich den Bericht meines letzten Einsatzes ins Diktafon.
„It’s been a hard day’s night …”
Mit diesem Song der Beatles als Klingelton meldet sich lautstark mein Handy. Das wird der nächste Notfalleinsatz sein. Ich greife mir das kleine Gerät, das ich stets mit einem Clip am Hosengürtel trage, und nehme das Gespräch an. Bereits an der Nummer habe ich vorab die Polizei als Anrufer erkannt.
„Sozialpsychiatrischer Dienst, Seifert“, melde ich mich.
„König, Polizeiinspektion Mitte“, kommt die Antwort. „Bin ich mit der psychiatrischen Notfallbereitschaft verbunden?“
„Ja. Was kann ich für Sie tun?“
„Es geht um einen 18-jährigen Schüler, der heute in der ‚Galeria Kaufhof’ an der Bahnhofstraße von einem Detektiv beim Stehlen der Geldbörse eines Kunden erwischt worden ist. Dabei hat sich der Schüler massiv gewehrt, die Überprüfung seiner Personalien durch die Kaufhausdetektive nicht zugelassen und stattdessen nur noch in einer unbekannten Sprache geredet. In seiner Umhängetasche befand sich eine weitere gestohlene Geldbörse.“
„Das klingt alles noch nicht sehr psychiatrisch“, werfe ich etwas ungeduldig ein, obwohl mir klar ist, dass der Anrufer sicher gleich zum Punkt kommen wird.
„Da haben Sie recht.“ Der Anrufer nimmt meine Zwischenbemerkung gelassen. „Wir haben den jungen Mann mit zur PI Mitte genommen. Wie bereits im Kaufhaus verhält sich der junge Mann bei uns psychisch sehr auffällig. Seine Stimmung schwankt zwischen Wut und Traurigkeit. Und obwohl er eindeutig der deutschen Sprache mächtig sein muss, redet er fortwährend in einer Sprache, die hier keiner kennt. Wir glauben aber, dass er möglicherweise von Selbstmord gesprochen hat. Ich möchte Sie bitten, ihn sich einmal anzuschauen. Denn ohne ärztliche Überprüfung würden wir ihn in diesem unklaren Zustand ungern gehen lassen.“
Es interessiert mich, ob ich den Patienten möglicherweise schon kenne: „Wie heißt denn der junge Mann?“
Der Name „Sebastian Rokahr“ sagt mir nichts.
„In Ordnung, Herr König“, sage ich, „in ungefähr einer Viertelstunde bin ich mit einer Mitarbeiterin bei Ihnen.“
Wir beenden unser Telefonat. Meine Recherche in unserer elektronischen Patientendatei ergibt keinen Treffer. Sebastian Rokahr ist noch nie mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover in Kontakt gekommen.
Über mein Festnetztelefon rufe ich Rita Wienert an. Sie ist Krankenschwester mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung und sitzt in einem Büro in der Etage über mir. Heute ist sie eingeteilt, mit mir zusammen Notdienst zu machen.
Ich informiere sie darüber, dass wir zum nächsten Einsatz fahren müssen. Im Auto auf dem Weg zur Polizeiinspektion Mitte werde ich ihr die weiteren Einzelheiten mitteilen, die ich bereits kenne.
Rita verspricht, dass sie in zwei Minuten bei mir ist. Eine erfahrene zuverlässige Kraft Ende dreißig, die sich ansonsten hier im Haus darum kümmert, den Bedarf an Eingliederungshilfe für chronisch psychisch Kranke zu ermitteln. Vom Schreibtisch gehe ich zu meinem großen runden Besprechungstisch, auf dem ich meinen Notfallkoffer abgestellt habe.
Ich schnappe mir den Koffer und die volldiktierte Kassette aus dem Diktafon und gehe aus meinem Büro ins Vorzimmer, wo Sonja Mock, meine Sekretärin, ihre Schreibarbeiten am PC unterbricht und mich erwartungsvoll anschaut.
„Ich muss jetzt zum Einsatz. Können Sie das heute noch für mich schreiben, Mockie?“, frage ich sie mit süßem Lächeln und lege gleich die Kassette vor sie hin.
„Wenn Sie mich so nett darum bitten, Chef, kann ich Ihnen einfach nichts abschlagen“, entgegnet sie und strahlt mich dabei freundlich wie immer an. Warum ist eigentlich dieses zuvorkommende Wesen ihre gesamten vierzig Lebensjahre immer noch nicht verheiratet?, frage ich mich beim Verlassen des Vorzimmers und treffe im Flur auf Rita.
„Hallo, Mark“, begrüßt sie mich. Rita wiederum ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist nicht mehr zu haben. Schade eigentlich.
„Wir nehmen meinen Wagen“, sage ich. Mir fällt plötzlich auf, dass ich mich in letzter Zeit wieder sehr für die Frauen meiner Umgebung interessiere. Mit Katharina kann das eigentlich nichts zu tun haben. Obwohl ich daran zu knabbern habe, dass sie jetzt nach London entschwunden ist.
„Wo parkst du?“, fragt Rita.
Mein Büro befindet sich im Erdgeschoss des Gesundheitsamtes der Region Hannover in der Weinstraße 2, also im nördlichen Teil der Südstadt in der Nähe des „Aegi“, dem Aegidientorplatz, und damit ungefähr drei Kilometer von unserem nächsten Einsatzort entfernt.
„Mein Wagen steht auf dem Parkplatz hinter dem Haus.“
Wir verlassen das Gebäude, ein dreistöckiges gelbfarbenes Haus, welches alt, nach pragmatischen Gesichtspunkten gebaut und dringend sanierungsbedürftig ist. Auf dem Parkplatz steht mein blauer VW Golf, mit dem wir zusammen in die Innenstadt von Hannover fahren. Rita lässt sich während der Fahrt von mir auf den genauen Informationsstand bringen.
Nach zehn Minuten haben wir die Herschelstraße erreicht, wobei ich meinen Wagen auf einem der Parkplätze der Polizei abstelle. Den Notfallkoffer in der Hand, betrete ich mit Rita zusammen die Polizeiwache. In dem großen Raum grenzt eine lange Theke vier mit Telefon und PC ausgestattete Arbeitsplätze ab, an denen einige weibliche und männliche Polizisten ihren Dienst tun. Eine Polizistin spricht gerade an der Theke mit einem aufgeregten Bürger, der offensichtlich eine Sachbeschädigung zur Anzeige bringen will. Auf der rechten Seite ist eine besonders gesicherte Glastür, hinter der sich ein gut einsehbarer Raum befindet, in dem Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen werden können. Ich sehe darin zwei Männer sitzen, von denen einer wohl an die vierzig, der andere ungefähr zwanzig ist.
Ein Polizist steht von seinem Arbeitsplatz auf und kommt zu mir an die Theke.
„Mein Name ist Seifert“, stelle ich mich vor. „Ich bin Psychiater und komme vom Sozialpsychiatrischen Dienst wegen Herrn Rokahr.“ Dabei drücke ich dem Polizisten meine Visitenkarte mit dem Logo der Region Hannover in die Hand. „Und das ist Frau Wienert, Krankenschwester.“
Mein Gegenüber begrüßt uns mit Handschlag: „Mein Name ist König, wir haben miteinander telefoniert.“
Als er auf meine Visitenkarte schaut, nimmt sein Gesicht einen verwunderten Ausdruck an:
„Hätte gar nicht gedacht, dass der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes noch selbst zu solchen Einsätzen zu uns kommt.“
„Für die Freitage habe ich mich immer selbst zur Notfallbereitschaft eingeteilt, damit ich den praktischen Bezug nicht verliere“, erkläre ich wahrheitsgemäß.
König deutet auf den Raum gegenüber: „Das ist er übrigens.“
Ich drehe mich um. Der junge Mann sitzt momentan regungslos mit gesenktem Kopf in dem kleinen Raum.
„Gibt es Hinweise auf Alkoholisierung?“, geht mir spontan durch den Kopf.
„Nein“, sagt König, „auch nicht, dass er aktuell unter Drogeneinfluss steht.“
„Und in welche Schule geht er?“, möchte Rita wissen.
„Hermann-Hesse-Gymnasium.“
„Haben Sie auch Kontakt zu seinen Eltern aufgenommen?“, lautet Ritas nächste Frage.
„Nein. Der junge Mann ist volljährig und wir müssten auch erst einmal ermitteln, wer überhaupt seine Eltern sind.“
Na gut, dann will ich jetzt zur Sache kommen: „Wo können wir uns mit Herrn Rokahr in Ruhe unterhalten?“
König erklärt, dass wir einen der Büroräume im hinteren Teil der Wache benutzen können. Er öffnet den Raum, in dem Sebastian sitzt. Dieser blickt uns überrascht an.
„Das hier sind Herr Dr. Seifert und seine Mitarbeiterin Frau Wienert vom Sozialpsychiatrischen Dienst, die sich gerne mit dir unterhalten würden“, erläutert ihm König die Situation.
„Mi estas la potenculo de Lernantolando“, verkündet Sebastian mit kräftiger Stimme.
Ich verstehe leider nichts und auch Rita schüttelt den Kopf.
König führt Sebastian problemlos in eines der hinteren Büros.
„Wenn Sie mich brauchen, Herr Doktor, ich bin im Nebenraum“, sagt König und verlässt den Raum.
„Keine Sorge“, murmel ich, „ich kann Taekwondo.“
Wir sitzen uns zu dritt im Kreis gegenüber. Sebastian macht ein betont böses Gesicht und starrt mich an.
„Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und möchte gerne durch dieses Gespräch klären, was mit Ihnen los ist und ob ich Ihnen helfen kann.“
Mit einem Grunzen äußert Sebastian: „Mi treege ruzas. Mi estas pli ruza ol vi.“
„Aha“, fällt mir dazu nur ein.
„Kuracistoj estas la plej grandaj stultuloj en la tuta mondo.“
In meinem Kopf rotiert es. Sebastian geht zum Hermann-Hesse-Gymnasium, an dem auch mein Freund Bernd Lehrer ist. Bernd hat mehrfach von einer Kollegin gesprochen, die an der Schule eine Esperanto-AG anbietet. Eine Sozialarbeiterin beim Sozialpsychiatrischen Dienst spricht ebenfalls Esperanto. Von ihr weiß ich, dass alle Hauptwörter auf –o oder im Plural auf -oj enden. Langsam entwickelt sich bei mir ein Verdacht.
„Psikiatroj estas la plej spiritmalfortaj uloj en la tuta medicino“, legt mein junger Patient mit kräftiger Stimme noch einen drauf. „Kaj vi estas ekzemplero kun testiketoj.“
Das letzte Wort ähnelt einem Begriff aus der Medizinersprache mit der Bedeutung „Hoden“, wahrscheinlich als Beleidigung gemeint.
Ich gehe zum Angriff über:
„Ihr Zustand ist ernster als ich dachte. Betrüblich, aber wahr … Ihr Gehirn ist offenbar völlig ‚out of order’ und absolut nicht mehr in der Lage, regulierend auf Ihr zentrales Schaltzentrum für normatives Verhalten und deutsche Sprachartikulation einzuwirken.“
„Se vi ne liberigos min, mi memmortigos min“, ist die Antwort, etwas weniger laut als eben.
Ich wende mich an Rita:
„Das nennt man hirnorganisches Psychosyndrom. Sein psychischer Zustand hat dazu geführt, dass er sogar fremde Leute im Kaufhaus angegriffen hat. Gehirnbeeinträchtigung mit einer Auswirkung, die klar den Tatbestand der akuten Fremdgefährdung erfüllt.“
Ritas Augen fangen an zu leuchten: „Das heißt Klinikeinweisung.“
Ich stimme ihr zu: „Wegen unkalkulierbarer Verhaltensweisen bei fehlender Absprachefähigkeit wird er um eine geschlossene Station nicht herumkommen.“
Sebastian lächelt: „Vi blufas, fiuloj.“
Ich notiere mir einige der Worte, wie ich sie heraushöre und werde meine Sozialarbeiterin am Montag befragen, welche freundlichen Infos uns Sebastian mitteilen wollte.
„Wären Sie mit der Aufnahme in der für Sie zuständigen psychiatrischen Klinik einverstanden, Herr Rokahr?“, frage ich mit deutlicher Stimme und sehe ihn dabei durchdringend an.
„Ne diru al mi tian merdon, kuracisteto.“
Ich notiere „merdon“ und „kuracisteto“.
„Dann werde ich jetzt eine Zwangseinweisung veranlassen“, erkläre ich Sebastian und stehe auf.
Sebastian bleibt sitzen und lächelt weiterhin: „Kuracisteto.“
Rita erhebt sich ebenfalls. Wir streben auf die Tür zu und ich bitte König herein.
Verdammt, geht es mir durch den Kopf, reagiert Sebastian endlich?
„Kann ich Ihren PC benutzen, um ein ärztliches Zeugnis für eine Zwangseinweisung zu tippen?“, erkundige ich mich höflich.
„Ach, muss er doch in die Psychiatrie?“, entgegnet der Polizist.
„Ja, und wenn er Glück hat, kann er dort noch seinen Mitpatienten die Schulkenntnisse aus seiner Esperanto-AG weitervermitteln.“
Rita und ich haben gerade das Büro verlassen, als ich ein geräuspertes „Atendu, sinjoro Doktoro“ höre. Ich drehe mich um und bleibe im Türrahmen stehen. Dabei versuche ich meine eigene Nervosität komplett zu verbergen.
„Mi komprenas al vi, also ich, … dank’ al Dio, … mir geht es plötzlich besser. Mi sanas, … ich weiß gar nicht, was mit mir los war.“
Mir fällt ein Stein vom Herzen.
„Mi ne bezonas …“ – ein erneutes Räuspern und dann die klare Aussage von Sebastian: „Ich brauche in keine psychiatrische Klinik.“
Nachdem sich Sebastian mittels seiner wiedererlangten deutschen Sprachkenntnisse eindeutig von Selbsttötungsabsichten distanziert hat, gestaltet sich der weitere Verlauf unseres Einsatzes erfreulich zügig. Ich gebe zu Protokoll, dass ich aus ärztlicher Sicht keinen Anhalt für das Vorliegen akuter Suizidalität oder einer psychischen Erkrankung habe. Anschließend fahren Rita und ich zurück zu unserer Dienststelle. Sebastian wird nach Erledigung aller Formalien die Polizeiwache verlassen dürfen.
Kvar / Vier
I don’t like Mondays – ich mag keine Montage –, hat 1979 die irische Gruppe „Boomtown Rats“ gesungen. Dem kann ich auch heute noch zustimmen. An diesem 5. September 2011, natürlich einem Montag, geht es mir morgens absolut miserabel. Zu Hause bin ich angesichts eines flauen Magens zu keiner Nahrungsaufnahme in der Lage gewesen. In meinem Kopf scheint eine Truppe von Schmieden um die Wette zu hämmern. Und dann kein Aspirin im Haus. Wenn ich nicht mittags diesen Termin beim Fernsehen hätte, wäre ich auf jeden Fall zu Hause geblieben.
So fahre ich pflichtbewusst zur Arbeit im Gesundheitsamt. Als ich meine Dienststelle in der Weinstraße betrete, werde ich von zwei Arztkollegen vom Team Begutachtung begrüßt, freundlich gemeint, aber viel zu laut. Mit letzter Willenskraft rette ich mich in mein Vorzimmer.
Sonja Mock strahlt mich an, dann bekommt ihr Gesichtsausdruck eine besorgte Note.
„Morgen, Mockie, bitte zwei Aspirin“, bringe ich gerade noch hervor.
„Guten Morgen. So schlimm, Chef?“ Mockies Stimme drückt echte Anteilnahme aus.
Ich durchquere das Vorzimmer, öffne die Doppeltür zu meinem Büro und lasse mich dort in meinen Schreibtischstuhl fallen.
Ich bin jetzt 43, aber so schlecht habe ich mich am Arbeitsplatz noch nie gefühlt. Oder zumindest nicht oft. In diesem Zusammenhang von wehleidig zu sprechen, finde ich aus der Luft gegriffen. Meine Sekretärin reagiert auf mein Leiden auf jeden Fall mit angemessener Hilfeleistung.
Ich höre, wie im Vorzimmer das Telefon klingelt und Mockie daran hindert, mein Aspirin zu besorgen. Die Nummer auf dem Display scheint sie als wichtig einzuschätzen.
Mockie hört sich das Anliegen des Anrufers kurz an, dann sagt sie: „Tut mir leid, Herr Dr. Seifert ist gerade bei einer wichtigen Besprechung. Kann er Sie heute Nachmittag zurückrufen? … Danke.“
Mockie ist ein Engel, was wäre ich ohne sie.
Nach Einnahme des Aspirins und einem kleinen Mixgetränk, dessen Rezeptur das Geheimnis meiner Sekretärin ist, kehren meine Lebensgeister nach und nach wieder zurück. Das Wochenende ist doch etwas heftig verlaufen, wenn ich da an die nette Dame, deren Name mir momentan nicht einfällt, und die zahlreichen gemeinsamen Cocktails denke. Ich glaube, ich leide momentan unter „Feminomanie“, der intensiven Suche des einsamen Mannes nach der weiblichen Gesellschaft. Was erstaunlich ist, wenn man bereits eine Scheidung erfolgreich hinter sich gebracht hat.
Nachdem ich am PC meine diversen E-Mails gecheckt habe, schweift mein Blick durchs Büro. Vom Schreibtisch aus kann ich durch mehrere Fenster auf den Parkplatz hinter dem Gesundheitsamt schauen. Mein Büro ist nicht gerade elegant eingerichtet, aber praktisch mit mehreren Holzschränken und einer riesigen Regalwand, in der ich meine medizinischen Fachbücher und -zeitschriften untergebracht habe. An den Wänden hängen mehrere gerahmte Schwarzweißposter mit Fotos von Filmlegenden wie Charlie Chaplin, Laurel & Hardy oder Marilyn Monroe, aber auch ein von Linda McCartney 1967 fotografiertes Bild von den vier Beatles.
Ich schnappe mir meinen Notizzettel vom Einsatz letzten Freitag in der Polizeiwache Herschelstraße und rufe Martina Wittke an. Sie ist langjährige Sozialarbeiterin in der für Hannover-Linden zuständigen Sozialpsychiatrischen Beratungsstelle im sogenannten Ahrbergviertel, einem zwei Hektar großen Arbeits- und Wohnbezirk, welcher den kulturellen Mittelpunkt der spanischstämmigen Einwohner Hannovers darstellt. Martina Wittke ist die einzige Mitarbeiterin im Sozialpsychiatrischen Dienst, von der ich weiß, dass sie Esperanto spricht.
Ich lese ihr die mitgeschriebenen Worte vor, wie ich sie verstanden habe, mit denen uns Sebastian bedacht hat. Martina kann mit einigen Begriffen sofort etwas anfangen. „Mi treege ruzas“ heißt „Ich bin sehr gerissen“. „Testiketoj“ ist eine Beleidigung und bedeutet „Hödchen“. Außerdem hat er Ärzte und Psychiater als Dummköpfe tituliert und mich als „kuracisteto“ bezeichnet, was soviel wie „Ärztchen“ bedeutet. Insofern wird aber noch einmal deutlich, dass er sehr wohl alles verstanden und auf eine intelligente Art mit seiner Umgebung gespielt hat. Ich bedanke mich bei Martina für ihre fachkundige Unterstützung. Was hat Sebastian dazu bewogen, sich letzten Freitag derart verrückt zu verhalten? Ich bewerte sein Verhalten jetzt endgültig als Versuch, sich als nicht zurechnungsfähig darzustellen.
Mockie ruft mich an: „Denken Sie an Ihren Termin bei h1, Chef?“
„Ja, danke.“
Ich verlasse mein Büro durchs Vorzimmer. Sonja Mock, so geht es mir durch den Kopf, ist ein von Verhalten und Kleidung her durch und durch konservativer Mensch – und damit genau das, was ich hier als Chef brauche. Sie ist loyal und hat alles im Griff.
Vom Eingang des Gesundheitsamtes ist man mit ein paar Schritten an der Hildesheimer Straße, an der sich das Haus der Region befindet, daneben die Stadtbibliothek und das Theater am Aegi. Bei strahlendem Sonnenschein ist es sommerlich warm. Auf den Gehwegen kommen mir luftig gekleidete Menschen mit Eis in der Hand entgegen. Ich gehe Richtung „Aegi“ an der Hildesheimer Straße unter den Arkaden entlang. Die Tische draußen vor dem Steakrestaurant „Blockhouse“ sind alle besetzt. Über den „Aegi“ fahren jeden Tag riesige Mengen an Autos. Mit der Rolltreppe gelange ich hinunter in die große Fußgängerhalle, die den „Aegi“ unterquert und von der es weiter nach unten zur U-Bahnstation geht. Als ich den unterirdischen Bereich über die Rolltreppe nach oben wieder verlasse, bin ich fast am Ziel. Das Sandwich-Schnellrestaurant „SUBWAY“ ist gerammelt voll mit Jugendlichen. Dahin will ich nicht. Ich gehe um „SUBWAY“ und das „Café am Aegi“ herum und stehe vor dem Gebäude Georgsplatz 11. Hier hat der Hannoversche Fernsehsender h1 seinen Sitz. Ich betrete das etwas düstern wirkende Gebäude und fahre mit dem Fahrstuhl in den 2. Stock, wo sich die Aufnahmestudios befinden.
Ich werde bereits erwartet und von einigen jungen Mitarbeiterinnen freundlich begrüßt. Heute bin ich Talk-Gast des täglichen Nachrichtenmagazins „0511/tv.lokal“. Während ich mit einem kleinen Mikrofon verkabelt werde, erklärt mir der sympathische Moderator, wie das Interview zwischen uns ablaufen wird. Das Gespräch soll ungefähr fünf Minuten dauern und wird für die heutige Ausgabe des Nachrichtenmagazins aufgezeichnet.
Nach kurzer Vorbesprechung geht es gleich los und zwei Kameras halten unser Gespräch fest.
Der Moderator gibt mir mit gezielten Fragen die notwendigen Stichworte, damit ich in meiner Funktion als Chef des Sozialpsychiatrischen Dienstes dem Zuschauer die Angebote meiner Abteilung anschaulich erläutern kann. Was ich dann sage, habe ich mir bereits vor einigen Tagen gedanklich zurechtgelegt.
Der Sozialpsychiatrische Dienst wird betrieben von der Gebietskörperschaft Region Hannover und verfügt über eine Zentrale in der Weinstraße und 12 Beratungsstellen, die über das ganze Regionsgebiet verteilt sind, wobei zwei Beratungsstellen zum Kooperationspartner Medizinische Hochschule gehören. In den Beratungsstellen arbeiten unter anderem Fachärzte für Psychiatrie, Sozialarbeiter, Krankenpfleger und Arzthelferinnen, insgesamt an die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ambulante Hilfsangebot richtet sich an psychisch Kranke von 3 Jahren bis ins hohe Alter, die nicht oder nicht ausreichend durch das kassenärztliche System erreicht werden: Menschen mit schizophrenen Psychosen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeitserkrankungen, hirnorganischen Psychosyndromen und psychischen Störungen des Kinder- und Jugendlichenalters. Für die Beratung und Entlastung der Angehörigen psychisch Kranker sind wir ebenso zuständig. Angeboten werden von uns Beratung, Behandlung und Krisenintervention in Form von Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppengesprächen. Zu den üblichen Praxisöffnungszeiten beteiligen wir uns auf dem Gebiet der Landeshauptstadt an der kassenärztlichen Versorgung von Notfällen. Außerdem ist die langfristige Versorgungsplanung für psychisch Kranke durch koordinierende Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Hilfsanbietern unsere Aufgabe. In meiner Funktion als Leiter beschäftige ich mich viel mit der Koordination von Versorgungsstrategien, führe aber auch persönlich Info-Veranstaltungen über psychische Störungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten durch.
Die Aufzeichnung des Interviews mit Vor- und Nachbereitung dauert keine halbe Stunde. Alles läuft routiniert zügig ab. Ich werde entkabelt und schließlich freundlich verabschiedet.
Als ich wieder das Zimmer meiner Sekretärin betrete, hat Mockie gleich eine Nachricht für mich:
„Ihr Handy ist noch ausgeschaltet. Ein Herr Kramer vom Hermann-Hesse-Gymnasium hat deshalb hier für Sie angerufen, um den nächsten gemeinsamen Trainingstermin abzusagen.“
Ich bin schon fast in meinem Büro, als Sonja sich erkundigt: „Darf ich fragen, was er mit Ihnen gemeinsam trainiert?“
„Klar“, sage ich, „Taekwondo.“
Kvin / Fünf
Als Carsten Sonnenberg an diesem Morgen aufwacht, stellt er fest, dass die andere Hälfte seines Doppelbetts schon verwaist ist. Er dreht sich im Bett um zum Nachttisch und schaut auf seinen Digitalwecker: Es ist Dienstag, der 6. September, genau 6:05 Uhr. Carsten hört, dass Anna im Bad ist und duscht. Jetzt hat er noch knapp fünfzehn Minuten bis zum Aufstehen. Gedanken kreisen in seinem Kopf. Sein Leben in den letzten Monaten hatte er sich ganz anders vorgestellt. Er verzweifelt und weiß nicht mehr, was er noch tun kann, um das Steuer herumzureißen. Ein Problem ist seine Ehe, das andere die Schule.
Anna ist eine wunderbare Frau. Wenn er genau nachdenkt, liebt er immer noch alles an ihr – ihre Schönheit, ihre positive Ausstrahlung, ihre Begeisterungsfähigkeit. Wo Anna auftaucht, ist sie stets der von allen begehrte Mittelpunkt. Wie am Hermann-Hesse-Gymnasium, an dem sie seit ihrer Referendarzeit zehn Jahre als Lehrerin Englisch und Französisch unterrichtet. Dass Anna ausgerechnet ihn, den als langweilig geltenden Lehrerkollegen, vor drei Jahren geheiratet hat, ist das Beste, was ihm in seinem 35-jährigen Leben passiert ist. Ihr erstes Ehejahr ist die tollste Zeit seines Lebens gewesen. Da hatten sie sich gemeinsam für den Kauf dieses Einfamilienhauses in Arnum entschlossen und viel Zeit damit verbracht, das Haus so herzurichten, dass es ihren Erwartungen entsprach – mit Arbeitsbereich, Fitnessraum und zukünftigem Kinderzimmer. In diesem ersten Jahr ist Anna offenbar noch davon ausgegangen, dass Carsten ihre Bedürfnisse erfüllen wird. Gemeinsame Kinder, spontane Aktionen mit Freunden, Reisen in entfernte Länder mit Besuchen gleichgesinnter Esperantisten. Nach und nach hat sie gemerkt, dass Carsten nicht mithalten kann. Es fällt ihm schwer, sich auf spontane unkalkulierbare Unternehmungen einzulassen. Seine Begeisterung für die Esperanto-Idee hält sich trotz gewisser Sprachkenntnisse in Grenzen. Und angeblich ist es seine Schuld, dass Anna und er keine Kinder bekommen können. Im letzten Jahr ist ihre Beziehung bereits merklich abgekühlt. Seit einigen Monaten leben sie nur noch ohne einen Hauch von Wärme nebeneinander her.
Er liebt alte Westernfilme, eine Liebe, die sich schon in der ganzen Schule herumgesprochen und ihm nicht nur Pluspunkte eingebracht hat. Vor einigen Wochen hat er gehört, wie ein Schüler hinter seinem Rücken äußert, dass Carsten daran als „Typ von gestern“ zu erkennen wäre. Der gestrige Abend ist ein typisches Abbild ihrer Beziehung gewesen. Carsten hat sich im Wohnzimmer eine DVD mit dem Western-Klassiker „Rio Bravo“ angesehen, während Anna im Arbeitszimmer auf ihrem PC den französischen Film „Bienvenue chez les Ch’tis“ in der Originalversion geguckt hat. Anna teilt nicht Carstens Bücher- und Filmgeschmack, sie begeistert sich für fantastische Geschichten wie Tolkiens „Herr der Ringe“, den sie am liebsten auf Esperanto liest. Und sie sammelt fantasievolle Masken aus verschiedenen Kontinenten, Mitbringsel von Reisen zu ihren Esperanto sprechenden Bekannten. Carsten kann damit wenig anfangen, es ist nicht seine Welt.
Wenn er Anna verliert, hat er gar keinen Rückhalt mehr in der Schule. Und der Druck in der Schule wird immer größer.
Carsten hört, dass Anna im Bad ihre langen naturblonden Haare fönt. Gleich heißt es Aufstehen für ihn.
Anna betritt frisch geduscht, lediglich in ein Badehandtuch gehüllt, das Schlafzimmer. Sie riecht angenehm nach Duschgel. Ihr Körper ist in jeder Beziehung perfekt. Das ist das Bild, das er liebt. Diese schöne 33-jährige Frau, die er auf keinen Fall verlieren will.
„Guten Morgen, Carsten“, begrüßt sie ihn in sachlichem Tonfall.
„Guten Morgen, mein Schatz“, antwortet er, wobei das Wort „Schatz“ bei ihr lediglich zu einem Verziehen des Mundwinkels führt.
Zu Hause ist Annas quirliger Redefluss weitgehend verstummt.
Während sie aus dem Schrank ihre Unterwäsche holen will, tritt er hinter sie und umgreift vorsichtig mit beiden Händen ihren Oberkörper.
Schüttelnd windet sie ihren Körper aus seiner Umarmung, wobei er sich abgewehrt fühlt wie ein unangenehmes Insekt. „Lass das, Carsten!“, sagt sie mit klarer Stimme, „du weißt, das ist vorbei.“
Er tritt einen Schritt zurück und sie zieht dabei zügig ihre Unterwäsche an.
„Wir sollten es noch mal miteinander probieren. Einfach von vorne anfangen.“ Fast beschwörend kommen seine Worte hervor.
„Es gibt keine gemeinsame Zukunft mehr für uns, Carsten. Nimm das endlich zur Kenntnis! Sobald ich etwas Passendes gefunden habe, werde ich hier ausziehen.“
„Anna, bitte …“ Carsten guckt sie mitleiderhaschend an.
Aber Anna reagiert nicht darauf. Sie zieht sich ihr buntes Sommerkleid an und verlässt das Schlafzimmer. Carsten hört sie die Treppe zum Erdgeschoss heruntergehen und anschließend in der Küche werkeln.