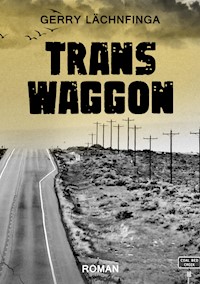
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Transwaggon handelt von der Sehnsucht der Menschen, ihr Leben verändern zu können und dem Scheitern dabei. Es scheitern nicht alle. Manchen gelingt es tatsächlich, zu reflektieren und die schmerzhaften Veränderungen zu verantworten. Veränderungsprozesse, sofern sie nicht vollständig durchlebt werden, befördern Zuschreibungen, wie Widersprüchlichkeit, Heuchelei, Bigotterie … bis hin zu kriminellem Verhalten. Ich habe versucht darzustellen, dass das Verdrängen der eigenen Widersprüche bei den Protagonisten nicht vollständig funktionieren mag. Manche ahnen durchaus, welche Stunde geschlagen haben könnte. Doch sie schaffen es auch dann nicht, andere Entscheidungen zu treffen. Auch als Therapeut glaube ich nicht daran, dass Menschen ihr Handeln so sehr verdrängen können, dass darüber keinerlei Bewusstheit besteht. Denn dazu wird der jeweilige Gewinn, der die von mir unterstellte Bauernschläue bringt, zu gern und motiviert angenommen. Den Ort Transwaggon habe ich, um die Tragik zu steigern, auf eine alte Grabstätte der amerikanischen Ureinwohner "gebaut". Dies meinte ich als Hinweis darauf, welche Verletzungen – bis zum Auslöschen von Leben – der industrialisierte Teil der Menschheit im Sinne von Fortschritt, Reichtum und Macht bereit ist/war, anderen zuzumuten. Letztlich hat Transwaggon etwas Dystopisches sowie Utopisches. Vielleicht stellt dies aber auch die Bandbreite unserer existenziellen Sehnsüchte dar…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Transwaggon
von
Gerry Lächnfinga
Cover: Perry Payne
Bildlizenz. Gerry Lächnfinga
Korrektorat & Lektorat: Christine Lagerbauer, Julia Niewel, L.T. Ayren
Verantwortlich für den Inhalt des Textes
ist der Autor Gerry Lächnfinga
© 2022 Gerry Lächnfinga
Herausgegeben von: L.T. Ayren
ISBN Softcover: 978-3-347-74514-8
ISBN E-Book: 978-3-347-74515-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Autors darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie zum Beispiel manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
Schlau zu sein bedeutet nicht unbedingt, man selbst zu sein.
Inhalt
Handy Cuffs
Trench Coat
Flash Tunnel
Joss Tisse
Miss Jeux
Transwaggon
Father Morgana
Testo Steronn
Hoss Tyle
Joe Caire
Gus Pacho
Shy Neese
Mill House
Handy Cuffs
Trommeln. Den ganzen Tag schon. Sie erinnerte sich nicht mehr an den Moment, als sie die Trommeln das erste Mal bewusst hörte. Das Gewummere kam irgendwo her aus den Bergen. Handy war genervt. Niemals würde sie sich als Rassistin bezeichnen, doch sie war definitiv kein Fan davon, wenn sich Minderheiten im Alltag der Mehrheit bemerkbar machten.
»Welchen Geist beten sie jetzt wieder an? Haben die Natives noch nicht kapiert, dass ihre Geister sie nicht mehr hören?« Handy konnte sich mit keiner Zelle ihrer selbst vorstellen, dass heute Nacht sehr wohl einer zuhörte.
Als Deputy Sheriff suchte Handy instinktiv nach der plausibelsten Erklärung für diese Art der Belästigung. So, wie sie Transwaggon und ihre Bewohner kennengelernt hatte, kam sie schnell auf die Idee, dass Flash Tunnel, der örtliche Piercer und Tätowierer mal wieder auf Friedensmission war. Dieses Mal schien er sich wohl einzubilden, mit den Ureinwohnern Zeit verbringen zu müssen. Am besten bei einem gemeinsamen Ritual. Bei Flash hieß das aus Handys Sicht, Drogen verkaufen, einschmeißen, feiern. Heute lautete die Überschrift des Ganzen eben „Ritual mit Natives“.
Wenn Handy abschätzig über jemanden dachte, zog sie ihre Mundwinkel nach unten und lächelte fies. Dabei konnte sie sich selbst ganz gut leiden.
Sie fuhr genervt in ihrem Polizeiauto durch die kleine Stadt im Nordosten New Mexicos und steigerte sich in ihr Misstrauen den Menschen gegenüber hinein. Sie hoffte fast schon, irgendjemanden wegen irgendeiner Kleinigkeit belangen zu können.
»Scheiß Trommeln!«, schrie sie in ihrem Auto.
Plötzlich hörten die Trommeln abrupt auf. Die Sonne setzte in diesem Moment genau auf den Titty Peak nordwestlich von Transwaggon. So genervt sie von dem Rhythmus war, der die Stadt seit Stunden so organisch bewegte, als sei er so normal, wie der ständige Westwind in der Gegend, so erschrocken – fast schockiert – war sie von der sie attackierenden Stille. Ohne es zu merken, blieb die Polizistin mitten auf der Hauptstraße stehen. Handy spürte ihren Herzschlag, als ob ihr Herz Wucht der Trommelschläge in ihr fortsetzte. Handy selbst blieb innerlich laut. Jedoch wollte sie sich nicht hören. Nicht jetzt.
Der ganze Ort schien auf einmal still zu sein. Handy atmete schwer. Sie beruhigte sich, indem sie ihre eigene Wahrnehmung als Spinnerei, als Zufall abtat. Sie dachte an ihren Therapeuten, der ihr einfühlsam und ebenso dringend geraten hätte, auf ihre Wahrnehmungen zu vertrauen. Nicht jetzt.
Immer, wenn sie unter Stress geriet oder keine Lust auf Ermittlungen hatte, begann sie damit, diszipliniert abzuarbeiten, was sie ihre „Basics“ nannte. »Denke an die Basics, tu´ es einfach.« Das sagte sie sich schon damals, als sie noch versuchte als Speerwerferin ins Olympiateam aufgenommen zu werden. Ganz besonders berief sie sich auf die Basics, wenn sie schon sah, dass ihre Konkurrentinnen eher sie besiegen, gar vernichten, würden, als dass Handy eine Chance auf eine Medaille gehabt hätte. Mit dieser Taktik lenkte sie gezielt ihre Konzentration, um nicht zu emotional in den Wettkampf zu gehen und von ihrer Aufregung überwältigt zu werden. Das hieß, sie führte jede einzelne Aufwärmübung konzentriert sowie in der gebotenen Intensität durch. Ihre Versagensangst, ihr innerer Druckmacher wollte sie stets dazu verleiten, schon beim Aufwärmen ihre ganze Kraft und Energie einzubringen. Allerdings erkannte sie in ihrer Karriere schnell, dass es keine Medaillen gibt, wenn man beim Aufwärmen gewinnt. Zu viele ihrer talentierten Mitkonkurrentinnen verstanden das nicht. Sie verstanden nicht, was es wirklich heißt „alles zu geben“. Handy verstand das schnell. Für sie bedeutete „gib alles“, sich auch im richtigen Moment zu disziplinieren und zurückzuhalten. Dadurch lernte sie, das richtige Maß an Energie im richtigen Moment abzurufen.
Also, egal wie arrogant, wie selbstsicher – ja, wie erfolgreich – Handys Gegnerinnen wirklich waren, sie begann sich auf ihre Basics zu konzentrieren. Zwanzig Minuten lockeres Joggen, um den Kreislauf anzuregen. Dabei achtete sie durch Zählübungen streng auf ihre Atmung. Ihr Therapeut griff ihre Fähigkeit der Atemkontrolle schnell auf und nutzt diese noch heute, um Handy einen sicheren Boden zur Beruhigung anzubieten, bevor ihr Gedankenchaos zu emotionaler Lähmung führt. Körper und Geist sind bei Handy noch heute positiv mit kontrolliertem Atmen verknüpft.
Dehnübungen zwangen sie förmlich dazu, ruhig zu bleiben und zu entschleunigen und im besten Fall auch wirklich herunterzukommen. Handy atmete gezielt in ihr Stretching hinein. Linke Wade, rechte Wade, linker Oberschenkel, rechter Oberschenkel, linke Hüfte, rechte Hüfte, linke Schulter, rechte Schulter, linker Arm, rechter Arm. Dabei zählte sie jedes Mal bis 15. Danach begann sie von vorne und variierte ihr Stretching.
Handy lernte dadurch für ihr Leben, unangenehme Situationen ruhig und diszipliniert anzugehen.
Was ihre Karriere als Speerwerferin betraf, sie wurde nie ins Olympiateam berufen. Handy galt als eigenbrötlerisch und verbissen. Noch heute schläft sie schlecht, weil sie sich verkannt fühlt. Sie war die Einzige, die ihren Weg eigenverantwortlich ging und nicht ständig gemanagt werden musste. Handy schleimte sich nie bei Trainern oder Funktionären ein. Sie war fast schon so weit, ihren Speer in den Medaillenbereich zu werfen. In ihrer sportlichen Entwicklung war sie zwar auf dem Weg zum Erfolg, jedoch vollzog Handy diese Entwicklung zu langsam. Und, das wühlt sie am meisten auf, denn sie weiß es heute, sie war naiv.
Sie dachte, es ging nur um das Sportliche. Ging es nicht. Handy wollte nicht sexy sein, sie wollte nicht bei jedem Training, bei jedem Wettbewerb mit dem neuesten Sportoutfit ankommen und sich dadurch ins Rampenlicht stürzen. Handy wollte nicht dopen und sie wollte sich auch nicht halbnackt, lediglich mit einem Handtuch bekleidet mit den Männern des Verbands unterhalten. An diesem Wettbewerb abseits des Feldes nahm Handy nicht teil. Das waren die Business-Medaillen, die sie verpasste.
Noch heute fühlt sie sich verkannt und ihr Therapeut leistet immer wieder Schwerstarbeit, ihr ins Bewusstsein zu rufen, dass sie sich treu geblieben sei.
Ja, sie bezahlte dafür einen hohen Preis. Dennoch könne ihr niemand nehmen, dass Handys Basics eine Eigenschaft seien, welche ihr halfen, selbstwirksam zu bleiben und welche sie als Person einzigartig und liebenswert machten.
Heute sahen Handys Basics so aus, dass sie für jede Fallbearbeitung zu Beginn eine To-Do-Liste erstellte und hoffte ihre Fälle klären zu können. Der Papierkram zu Beginn war ihr stets das Lästigste. Auch diese Phasen atmete sie diszipliniert weg, bis sie sich ein wenig freier fühlte. Dann konnte sie auch seelisch aufatmen und sich selbst lebendig und motiviert genug fühlen, um zu ermitteln.
In der Therapie lernte sie, genau diesen Moment als ihre eigene Stärke anzuerkennen und vielleicht gelänge es ihr irgendwann, sich in diesem sogar selbst zu mögen, statt die erlebte Verkennung anderer als einzige Wahrheit ihrer Existenz zu akzeptieren.
Handy staunte häufig darüber, wie sinnstiftend es für ihre Selbstwahrnehmung war, Verletzungen durch andere selbst immer wieder zu erneuern, indem sie nach Gründen suchte, welche die Anderen rechtfertigten. Sie erschrak über sich selbst, dass auch sie sich lieber in den noch immer offenen Wunden auf der Müllhalde ihrer Existenz suhlte, statt den Mut aufzubringen, neue Erfahrungen zu suchen.
Mittlerweile wollte Handy unbedingt an die schöneren Orte ihres Selbst gelangen. Doch diese waren ihr unbekannt und das „Tropical Spa“ ihrer Seele hieß sie selbst nicht bedingungslos willkommen. Dass sie sich unbewusst selbst so ablehnte, schmerzte sie sehr. Gleichzeitig machte sie dies zu einer echteren Polizistin, denn sie konnte nun besser verstehen, was viele Menschen neben aller Rationalität, neben all dem guten Zureden der Helfenden dazu bewog, ihren Sumpf aus Kriminalität, Gewalt, Leid, Armut, Opfer, Täter und vieles mehr, nicht zu verlassen. Selbstsabotage schien ein mächtiger Teil der eigenen Persönlichkeit zu sein.
Manchmal verstand Handy all das. Manchmal taten ihr alle leid. Manchmal schämte sie sich dafür, dass es ihr selbst besser ging. Manchmal fragte sie sich, warum gerade sie die Zusammenhänge erkannte. Manchmal war sie dankbar. Manchmal sogar Gott. Manchmal war sie wütend. Manchmal total unberührbar. Manchmal war sie hilfsbereit. Manchmal war sie professionell desinteressiert. Und manchmal war sie so wütend auf all die ungerechte Scheiße, die sie durch andere erfuhr, dass sie in diesem Moment wusste, sie würde nicht nochmal den Schwanz einziehen und auf ihre Karriere verzichten. Sie würde töten. Diesen Teil von sich konnte sie sehr gut akzeptieren. Handy lächelte. Jedoch nur kurz, denn die Trommeln setzten wieder ein und rissen sie aus ihren Gedanken.
WUMM WUMM WUMM
Ihr Instinkt sagte ihr, dass in dieser Nacht noch ein Verbrechen stattfinden wird. Vielleicht auch mehrere. Gänsehaut war ihr körperliches Orakel, wenn Unangenehmes im Anmarsch war. In diesem Moment fror sie fast vor lauter Gänsehaut.
So instinktsicher entschloss sie sich, heute Abend und die ganze Nacht lang die Straßen in Transwaggon abzufahren. Sie spürte ihren Willen, bereit sein zu wollen. Zähneknirschend gestand sie sich ein, einerseits zu wissen, jetzt schon das Richtige zu tun. Andererseits gab es außer den nervtötenden Trommeln keinerlei verwertbaren Hinweis auf irgendwelche Verbrechen. Ihrem Instinkt so zu folgen, entsprach nicht dem, was sie sich unter guter Polizeiarbeit vorstellte.
Wenn sie sich die Alternativen ausmalte, kam sie schnell zu dem Schluss, dass auf Streife zu sein ihr die größte Sicherheit gab. Sie hatte überhaupt keine Lust, ihrem Boss, Sheriff Hoss Tyle zu begegnen. Zu Hause würde sie auch nicht zur Ruhe kommen und sich irgendwelchen Nippes im Internet bestellen.
Als Handy nach Transwaggon kam, hatte sie einen guten Start in der Stadt. Ihre Sportkarriere hatte sie, irgendwie logisch, aufgeben müssen und sie wollte, fern ihrer akademischen Familie, einer echten Arbeit nachgehen. So entschied sie sich, den Nebel und den Winter von New Hampshire gegen den Staub von New Mexico einzutauschen, um irgendeine andere schlechte Version von Wahrheit zu finden. Immerhin: diese schlechte Version hatte sie sich selbst ausgesucht. Handy betrachtete sich bereits nach kurzer Zeit als „eine aus dem Süden“ und lehnte die tägliche absichtlich herbeigeführte intellektuelle Unzufriedenheit schlicht als Yankeescheiße ab.
Die Polizeiarbeit machte sie auch zu einem „Dirtmover“, von denen Bürgermeister Mill House bei jeder Gelegenheit sprach. Zu ihrem Boss, Hoss Tyle, schaute sie zu Beginn ihrer Tätigkeit bewundernd auf. Die Denkweise des Ermittelns, die Frage, wer welches Motiv hatte sowie die Überlegung, ob jemand log oder nicht, öffneten für Handy eine neue Welt. Verzweifelt versuchte sie in den ersten Monaten ihrer Familie zu erklären, dass dies philosophisch nicht mit Pessimismus oder gar Misanthropie gleichzusetzen sei, jedoch … Yankeescheiße.
Hoss zeigte ihr, wie man freundlich ermittelte und sich innerlich die Möglichkeit erhielt, jederzeit einen Gang hochzuschalten. Im Zweifel sogar die etwas zu öffentlich trauernde Witwe in Handschellen abzuführen, wenn sich der Lebensstil in zu kurzer Zeit nach dem völlig unerwarteten Ableben des Ehegatten deutlich verteuerte. Ob ein Besuch beim Juwelier, obwohl die Asche noch nicht kalt war, oder eine Reisebuchung mit einer neuen Frau. Ein neues Auto vor dem Trailer, welches einen solchen Kontrast ergab, dass sich an so eine Darstellung noch nicht einmal die Werbebranche rantraute. Hoss brachte ihr bei, in solchen Fällen geduldig zu sein. „Kleine“ nannte er sie von Anfang an. „Kleine, gute Polizeiarbeit“ bedeutet auch, jemanden, von dem man weiß, dass er der Täter ist, eine Zeit lang tatsächlich damit durchkommen zu lassen. „Wer sich vor der Polizei sicher fühlt, macht Fehler.“
Ja, diese Fehler zeigten ihr viel über die Menschen, die sie zu schützen gelobte. Hoss zeigte ihr all dies auf ruhige, erfahrene und kalte Art. Er war ihr Mentor. Fast drei Jahre lang war er das. Handy saugte sein Wissen auf wie ein Schwamm. Sie schrieb sich seine markigen Sprüche zu Hause nach Dienstschluss auf, in der Hoffnung, Ermittlungs-Regeln daraus ableiten zu können. Sie wandte den Hoss-Way in ihrer täglichen Arbeit immer selbstständiger an und wurde damit erfolgreich.
Eines Tages kam sie noch spät am Abend ins Sheriffs Office zurück. Zu diesem Zeitpunkt emanzipierte sie sich bereits ein wenig von ihm. Handy dachte immer, er würde stolz auf sie sein. Sie wäre beruflich zwar nicht sein Ziehsohn gewesen, aber vielleicht seine Ziehtochter. Ihr ging es darum, mit Hoss in Transwaggon Polizeiarbeit aus einer Hand auszuführen. Sie war reinen Herzens, ohne Hintergedanken. Handy war zufrieden mit sich und der Welt. Umso überraschter war sie, als sie Hoss im Office so was von sturzbetrunken antraf. Er schaute sie regungslos an. Die Pupillen klein. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die Tür zur Asservatenkammer offenstand und sein rechter Hemdärmel am Handgelenk ein wenig „staubig“ war. Hoss´ Blick erinnerte sie an einen brünstigen Eber, der – leicht schielend – nur noch das Signal „Angriff“ in seinem Hirn hatte.
»Schaust du immer so blöd, wenn Du jemanden erwischt hast?«
Handy sagte nichts.
»Aha, sehe schon. Ganz die moralisch Integre. Kommst jetzt bei mir mit genau der Yankeescheiße, über die du mich immer voll heulst, wenn deine Eltern nicht stolz auf dich sind.«
» Es ist alles okay, Hoss.« Noch versuchte Handy die Situation zu beruhigen und sie war tatsächlich nicht sauer auf ihn. Polizisten sind auch nur Menschen. Scheiß drauf, dann hat er sich mal ein wenig Koks aus der Asservatenkammer besorgt. Alles wäre okay gewesen, wenn Hoss an dieser Stelle aufgehört hätte.
» Lüg´ mich nicht an, du Fotze.« Er lief rot an.
»Ich weiß genau, was du hier willst!«
»Was soll ich wollen?«
»Yankeescheiße!«
»Was heißt das, Hoss? Du kannst mich ankacken, wenn ich Mist gebaut habe, nur bitte mach´ kein abgefucktes Rätsel daraus!« Ihre Stimme wurde lauter. Aus Wut und Angst.
»Du kleines Miststück willst hier Sheriff sein. Du willst mich abservieren. Meinst du, ich merke nicht, wie du mir seit Jahren auf die Finger schaust und nur wartest, bis ich einen Fehler mache? So, und jetzt hast du mich erwischt.«
»Hoss. Schau´ mich an. Bullshit! Ja, ich habe dir auf die Finger geschaut, aber doch nur, weil ich alles von dir lernen konnte.«
Hoss Tyle stand auf und ging Richtung Toilette. Enttäuscht und wütend zugleich musste sie ihrem Mentor zusehen, wie er leicht schwankend aufstand und seinen strammen Bauch mit falschem erigiertem Stolz vor sich herschob. Handy war nicht klar, inwieweit ihre Antwort ihn beruhigen konnte. Oder kam er gleich mit einer Schrotflinte zurück? Handy schaute auf seinen Schreibtisch. Was sie dort sah, machte sie sehr wütend. Handy entschloss sich, Hoss Recht zu geben. Ja, sie würde ihn abservieren. Allerdings nicht für das bisschen Koks. Schnell fotografierte sie Hoss´ Schreibtisch ab, damit alles an der gleichen Stelle lag, wenn er vom Pissen kam. Sie konnte sich Zeit lassen, gegen ihn zu ermitteln. Zeit – das hatte sie von ihm gelernt. Aus dem Klo kam ein Geräusch, wie wenn sich jemand rückwärts die Nase putzte…
Als Hoss von der Toilette kam, saß Handy an ihrem Schreibtisch und schien in den Bürokram vertieft, weswegen sie ursprünglich nochmal ins Office kam. Er kam erstaunlich aufgeräumt auf sie zu.
»Hey Kleine, hör´ mal. Das gerade war nicht so gemeint. Du verstehst schon. Weißt du, Sheriff sein bedeutet auch Politik und da kann man schon mal verzweifeln. Also, nichts für ungut.«
Handy sah Hoss freundlich an. »Hoss, ich will mir gar nicht vorstellen, was für Scheiße in der Politik läuft. Ich frage mich sowieso, wie du das alles schaffst. Wenn ich dir mit – egal, was – helfen kann. Du weißt, wo du mich finden kannst. Alles gut.«
»Das ist meine Kleine.«, sagte Hoss vom Koks ein wenig zu überschwänglich und überprüfte dabei mit der rechten Hand, ob sein Hosenstall zu war. Mit diebischem Blick und etwas unbeholfen schob Hoss die Fotos und Dokumente auf seinem Schreibtisch zusammen zu einem Haufen und drückte diesen in seine Aktentasche. Dicht und blöd grinsend, jedoch wortlos verließ er das Office.
Diese Situation hatte sie bis heute nicht vergessen und auch nicht verziehen. Dass Hoss gekokst hatte, war mit Sicherheit keine Glanzleistung. Dass Hoss nach diesem Abend nie auf sie zukam und sich wenigstens für sein Verhalten ihr gegenüber entschuldigte, verletzte sie auf ihr bekannte Weise. Hoss selbst würde so etwas niemandem durchgehen lassen.
Handy gab ihm die Zeit, sich was einfallen zu lassen. Seit einigen Wochen jedoch hatte sie verstärkt den Eindruck, Hoss machte sein eigenes Ding. Nun, es war mehr als ein Eindruck. Die gefälschten Beweismittel auf seinem Schreibtisch sprachen ganz klar die Sprache, dass Hoss einen Unschuldigen pressewirksam ins Gefängnis brachte, um kurz vor den erneuten Wahlen zum Sheriff mit einem großen Fall dazustehen. Besonders ekelhaft an der Sache war, dass dieser 26-jährige vorher nie auffällig war und dass „die Lösung“ dieses Falles genau die Geldmittel benötigte, welche Hoss im Wahlkampf für die Ausführung des Sheriffamtes wiederholt lautstark nannte. Die Sache stank gewaltig. Denn nach Hoss´ erneuter Wiederwahl änderte sich nichts an der Personalstärke, nichts an der Ausrüstung. Wo ging das Geld also hin, für welches Hoss ein junges Leben zerstörte?
Ebenfalls auffällig war, dass Hoss sich im Wahlkampf so theatralisch mit Mill House, dem Bürgermeister von Transwaggon in die Haare kriegte. Ausgerechnet die größten Buddys! Ernsthaft? Zwischen diese beiden passte doch kein Blatt Papier. Und plötzlich spielten die beiden öffentlichen Schlagabtausch, um dem Wahlvolk vorzugaukeln, es werde ernsthafte Politik betrieben. Und ja, im Sinne des Volkes müsse man streiten und Lösungen finden. Man musste keine Polizistin, wie Handy sein, um den gemeinsamen Nenner zu finden. Hoss und Mill mussten niemals streiten, denn was Hoss lauthals forderte, musste der Bürgermeister nur beim Staat New Mexico als Finanzzuschuss zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit beantragen.
Aus diesem Topf hatte Transwaggon seit der Einführung desselben noch nie gegriffen und somit gegenüber anderen Countys ein Erstzugriffsrecht.
Hoss stand mal für das Gesetz von Transwaggon. Heute war Hoss so eine eigene Figur, wie ein Bösewicht in einem Comic. Wenn man ihm aus dem Weg ging, hatte man keinen Ärger. Alles war seit einiger Zeit „persönlich“. Dieses „Ich nehme das persönlich“ hatte er sich wahrscheinlich von Michael Jordan abgeschaut. Handy musste laut hinter ihrem Lenkrad lachen, denn die Vorstellung, dass sich Hoss Tyle für den Micheal Jordan der County Sheriffs hielt, war schon ziemlich geil daneben!
BUMM DA DA DA
BUMM DA DA DA
Handy wurde sauer. Nicht mehr auf die Trommeln und die Natives. Vielmehr schienen die Trommeln sie zu leiten, einen Zugang zu einer lang und tief vergrabenen Wut zu finden. Sie fuhr erneut rechts ran, griff nach dem Rückspiegel und sah sich an.
»Alle, mit denen Du bisher was zu tun hattest, haben was drauf. Die Coaches haben dich besser gemacht. Sie wussten, an welche Punkte Du im Training gehen musstest, um besser zu werden. Scheiße ja! Es tat weh, es war unangenehm, aber die Medizin verfehlte ihre Wirkung nie!«
Sie hielt sich am Lenkrad fest. Während ihre Knöchel weiß wurden knarzte der Kunststoff unter ihrem Griff.
»Dann hast du dich herabgelassen, diesem Landei-Trampel von Sheriff den Respekt zu zollen, dass er dir was beibringen kann. Auch unangenehm, aber die richtige Entscheidung. Hoss hat dir die Instinkte geschärft. Ja, auch das tat weh. Wie oft bist du dir dumm vorgekommen? Wie oft hat Dad in Gedanken gesagt, dass alles, was du anfasst Yankeescheiße ist? Zu oft! Aber Hoss hat dafür gesorgt, dass du dich selbst schützt. Vor Jahren hättest du nie gedacht, jemals so stark sein zu können!«
BUMM DA DA DA
BUMM DA DA DA
»Aber …« jetzt zeigte sie mit dem Finger auf ihr eigenes Spiegelbild.
»… aber diese Kerle, bei allem, was sie können, haben eines nie fertiggebracht: An dem Punkt, wo sie selbst nicht mehr weiterwussten, haben sie alle daraufgesetzt, dass ich es einfach schlucken würde. Dass ich einfach so tue, als hätten sie mich nicht wie ein Objekt behandelt, damit sie sich selbst weiter einreden können, die Krönung der Schöpfung zu sein. Immer dann, wenn sie sich in ihrem eigenen Scheiß verrannten, haben sie mich leichtfertig geopfert, damit rechtzeitig ein Kopf rollt und nach Außen das Bild stimmt. Und Hoss ist drauf und dran dich zu opfern! Er und Mill werden es als den großen Skandal verkaufen. In den Medien werden sie wie begossene Pudel einräumen müssen, lange nichts von deinen Machenschaften gewusst zu haben und um Vergebung bitten. Schließlich werden sie die Trumpfkarte spielen und sagen, man habe dich immerhin überführt. Leider hast du dich selbst deiner irdischen Strafe entzogen.«
WUMM WUMM WUMM
»FUCK! FUCK! FUCK!«
Handy schlug wie wild auf ihr Lenkrad ein. Sie weinte, sie schrie. Sie bekam einen Heulkrampf, ergoss sich in Selbstmitleid. Sie war wütend. Auf sich. Auf alle anderen. Wie konnte sie nur so mit sich umgehen lassen? Wem wollte sie denn was beweisen? All diese Gedanken fielen über ihr zusammen, wie ein Haus, dass in Flammen steht. Gleichzeitig lautete jede bittere Antwort auf ihre Fragen simpel und nüchtern: Sie hätte für sich einstehen und sich nicht nur an den Launen der anderen orientieren sollen. Immer wieder wurde sie von ihrer neuen Erkenntnis gepackt, geschüttelt und getröstet. Ihre Tränen und ihr Weinen wurde von den Trommeln begleitet.
Handy weinte sich in den Schlaf, wie ein Kind, das etwas Schlimmes erfuhr und sich an einen tröstenden Gedanken klammern musste. Ihr heilender Gedanke war, dass sie sich ändern wollte. Zwischen Wachheit und Schlaf träumte sie davon, dass sie das Leben als ein Übungsfeld verstehen wollte. Die Dinge sollten nicht mehr so schwer auf ihr lasten. Auch sie dürfe „Versuch und Irrtum“ praktizieren und darüber eine neue Offenheit entwickeln. Tränenüberströmt schlief die Polizistin ein. Zum Glück parkte sie neben einer stillgelegten Fabrik. Ein sicherer Ort für die Dauer ihres Schlafes.
Als sie langsam erwachte, waren als Erstes die Trommeln präsent, bevor sie ihre Augen öffnete. Sie war innerlich klar und gefasst, fühlte sich gut und befreit nach all ihren zahlreichen Tränen. Handy empfand für sich ein Frische, wie die Luft nach einem reinigenden Gewitter. Erst jetzt öffnete sie die Augen. Zu ihrem Erstaunen war es bereits dunkel.
»Bleib´ruhig.«, sprach sie ruhig zu sich.
»Fang´ jetzt nicht mit diesem Stress an. Das Funkgerät hätte dich schon geweckt und Dein Mobiltelefon (jetzt „Handy“ zu schreiben wäre auch zu doof) genauso. Nimm einfach mal an, dass Dir diese Ruhe geschenkt wurde.« Handy entspannte sich und atmete tief durch.
Kaum konnte sie für sich akzeptieren, heute eben mal einen „seichteren Dienst“ vollführt zu haben, durchblitzte sie ein Gedanke.
»Die Sache mit Hoss ist deshalb noch nicht durch.«
BUMM DA DA DAM
BUMM DA DA DAM
»Sei selbst das reinigende Gewitter. Bereinige ihn… be… seitige ihn.« Handy war immer noch klar. So klar, wie nie zuvor.
»Scheiß auf die Geduld. Hoss ist heute Nacht dran.«, sagte sie zu sich selbst.
Noch einmal sah sie sich die Beweisfotos von Hoss´ Schreibtisch an. Der Drecksack jubelte dem armen Pausenbrotverkäufer damals alles unter, damit Hoss die Wahl zum Sheriff wieder gewann. Er brauchte einfach nur einen Fall. Sie erschrak über die Erkenntnis, dass ihr Chef damals gemeinsame Sache mit dem Kartell machte. Wo treibt sich dieses Schwein nur rum? fragte sie sich.
Kurz bevor sie ihr Mobiltelefon mit den Fotos weglegte, fiel ihr ein kleiner Zettel auf einem Bild von Hoss´ Schreibtisch auf. War das ein Hinweis?
†♠heute
Was sollte das bedeuten? Handy dachte angestrengt nach. Sie spürte, an dieser Notiz war was dran. Vielleicht wünschte sie sich auch nur zu sehr, Hoss heute zu überführen. Um ein wenig auf andere Gedanken zu kommen fuhr sie los und nahm sich vor, kreuz und queer durch Transwaggon zu fahren. Mit etwas Glück entdeckte sie einen weiteren Hinweis.
»Kreuz. Pik. Heute.«, sagte sie monoton vor sich her.
Sie fuhr sinnsuchend durch die Straßen. Im Copper Coin Saloon spielte an diesem Abend eine Band und die ganze Stadt schien dort zu sein. Irgend so eine Truppe von fünf Jungs mittleren Alters, die ihren eigenen Stil „Barrel Bottom Rock“ nannten. Das, was Handy im Vorbeifahren hörte, war ganz klar Stoner Rock. Warum muss sich jede Kapelle mit einem selbsterfundenen Stil wichtigmachen? Egal. Den Leuten schien es zu gefallen. Es war mächtig was los, in the Coin. Dort würden die Trommeln aus den Bergen auf jeden Fall nicht stören.
Eigentlich befand sie sich doch schon auf dem Heimweg, da wendete sie doch nochmal spontan den Wagen, um die Hauptstraße abzusuchen. So langsam kam sie sich blöd vor. Sie wendete nochmal, weil sie nicht nach Hause wollte. Zum Sheriff´s Office schon gar nicht. Vor allem, weil sie Hoss dort ausgeliefert wäre. Ein Heimvorteil für ihn.
Moment! Sie hielt den Wagen an und setzte ein wenig zurück. Leuchteten beim Wenden hinten bei der Kirche nicht gerade Fahrradrückstrahler auf? Es gab in Transwaggon nur einen Radfahrer. Flash Tunnel. Kirchgänger war er definitiv nicht, das war ihr klar. Und selbst wenn, nicht um diese Uhrzeit.
Handy bog in die Straße zur Kirche ein. Geübt schaltete sie die Scheinwerfer aus. Circa 100 Meter von der Kirche entfernt machte sie den Motor aus und ließ ihr Auto noch ein wenig rollen. Das hatte sie von Hoss gelernt.
Nach gefühlt unendlich langen Minuten schaffte sie es, aus ihrem dunklen Auto auszusteigen.
Sie zog ihre Waffe.
Langsam näherte sie sich der Kirche. An der großen Tür des Haupteingangs wollte sie nicht einfach durchspazieren. Die Kirche war im Bretterstil des Wilden Westens gebaut und sie musste damit rechnen, das Portal nicht leise prüfen zu können. Ein verräterisches Holzknirschen galt es zu vermeiden. Sie ging weiter außen herum und kam an einem abgestellten Fahrzeug vorbei. Handy erkannte aber vor Aufregung nicht, dass es Hoss` Wagen war.
Die Kirche war stockfinster. Als sie das Ende des eigentlichen Gotteshauses erreichte fiel ihr wieder ein, dass es ja einen Rückraum gab – von der Straße abgewandt. Sie sah den Anbau von der Straße aus nicht, da er nicht so breit gebaut war, wie das Hauptgebäude. Aus einem Fenster schien schummriges Licht auf den Weg. Sie schlich unter dem Fenster weiter bis hin zur Ecke und lauschte. Sie hörte langsame Schritte von drinnen. Die Tür war geschlossen, etwas versetzt vom Türgriff klaffte jedoch ein Loch mit circa zehn Zentimetern Durchmesser in der Holzwand. Schmauchspuren am Rand. Das muss ganz klar eine Schrotflinte gewesen sein.
Geistesgegenwärtig nahm sie ihre Waffe in Anschlag, richtete sie vor sich und trat energisch in den Anbau.
»Polizei! Keine Bewegung!«
Das Bild, welches sich ihr dort bot, drang nur teilweise zu ihr durch. Ihr Herz pumpte, Adrenalin schoss durch ihren Körper. Handy spulte innerlich in einer konsumierenden kalten Logik ab, dass sie sechs Leichen in Blutlachen zählte. Hoss stand in Mitten der Toten mit dem Rücken zu ihr, die schallgedämpfte Schrotflinte in der rechten Hand gesenkt.
»Waffe fallenlassen!« Sie spannte hörbar den Hahn ihrer Glock, um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen.
»Umdrehen!«, schrie sie.
Hoss hob beschwichtigend seine linke Hand, drehte sich langsam um und legte die Schrotflinte auf den Pokertisch.
Sie vertraute seiner Friedensgeste nicht. Nicht mehr. Wut mischte sich mit Traurigkeit. Langsam setzten sich die Eindrücke dieser Horrorszene auch auf anderen Ebenen durch.
Sie sah sich die Leichen an. Hinten in der Ecke zu Hoss´ Füßen lag Shy Neese. An der Längsseite zur Außenwand lagen unnatürlich verkrümmt und mit panisch weit aufgerissenen Augen Father Morgana und Flash Tunnel. Zu ihren Füßen befand sich in embryonaler Haltung der Sozialarbeiter Joss Tisse. Sie verstand nicht, welche Rolle er in dieser Gruppe spielte. Aber eigentlich kannte sie ihn nicht. Der nächste Tote auf der anderen Längsseite des Tisches war eindeutig Gus Pacho. Der auch? Stellte sie verzweifelt fest. Von ihm hielt sie immer viel. Neben Gus lag einer mit Schlangenlederstiefeln, schwarze Anzughose, schwarzes Hemd, schwarzes Jackett. Wo war sein Kopf?
Sie musste einmal tief durchatmen. Hoss verhielt sich still. Sie riskierte einen Blick an die gegenüberliegende Wand, an welcher Father Morgana und Flash Tunnel lagen. Überall rote Teilchen. Deutlich größer, als bloße Blutspritzer.
Dort, wo Hoss seine Schrotflinte ablegte sah sie ein sechstes Glas und Zigarettenkippen im Aschenbecher. Hinter Hoss sah sie außerdem auf dem kleinen, als Bar verwendeten Schränkchen ein Schneidebrett mit angeschnittenen Limonen sowie einen Eimer mit Eiswürfeln. Bei dieser Pokerrunde, schloss sie, haben die Beteiligten bestimmt nicht wie 16-jährige ihre Cocktails selbst gemischt oder gar „Getränkepausen“ eingelegt. Handy war sich sicher, dass Shy hier heute Abend die Saftschubse mimte. Also, wenn Shy Neese nicht mitspielte, muss hier noch jemand gewesen sein. Eines wusste Handy sicher. Shy rauchte nicht und Hoss spielte kein Poker. Zumindest nicht mit diesen Menschen hier. Da war sie sicher. Jetzt sah sie auch, dass neben Shy ein Glas lag. Bei dem Kopflosen am Platz fehlte das Glas.
»Wer ist der Kopflose?«
Hoss antwortete nicht.
»Hoss, wer ist das?«
Sie entschied sich zu bluffen – das passte schließlich zur Szenerie.
»Du kannst gerne den Bockigen spielen. Ich finde es sowieso raus.«
»Ha! Wie denn? Sind doch alle tot.“ raunzte Hoss.
»Hör´ zu Arschloch! Neben deiner Schrotflinte steht ein Glas. Ich schätze, die waren zu sechst. Unsere Ortsmasseuse hat hier nur bedient und was weiß ich noch alles.
Also gibt es da draußen jemanden, der sagen kann, wer heute Abend hier war.«, sie machte eine kurze Pause.
»Spuck´s aus und zeig´ wenigstens ein bisschen Würde.«
Trench Coat
»Verdammt noch mal, Trench! Was soll ich nur mit Ihnen machen?« Sein Vorgesetzter motzte wieder einmal mit ihm. Das Problem? Ziemlich einfach, denn Trench war wieder einmal auf der richtigen Spur wegen eines Drogendeals. Im kalten und windigen Detroit wühlte er sich wie ein Maulwurf durch die Beziehungen und Seilschaften der Hafenarbeiter.
»Sechs Monate. Sechs verdammte Monate.«, brüllte sein Boss.
»Für nichts, Trench. Sie haben, wie immer sehr gut ermittelt, aber sie brauchen einfach zu lange. Das Beschissenste dabei ist, dass der Deal wieder einmal über die Bühne ging und wir wieder einmal mit runtergelassen Hosen dastehen. Was rede ich? Sie, Trench, stehen mit runtergelassenen Hosen da! Und? Was meinen Sie, was meine Vorgesetzten davon halten werden verdammt?«
Trench stand militärisch stramm, dennoch bequem, mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor seinem Chef. Wenn ich nur jedes Mal ´n Scheiß Dollar bekommen würde, wenn er „verdammt“ sagt…. Auf die Frage seines Vorgesetzten zuckte er nur leicht mit seinen Schultern.
»Ich sage Ihnen, was die davon halten. Sie werden sagen „Carl, wenn Ihre Abteilung nicht endlich Fleisch an den Knochen bringt, gibt´s weniger Budget für Ihre Ermittlungen“. Das werden Sie sagen. Und? Ich? Was soll ich denen jetzt verdammt nochmal sagen?«
Katsching $. Trench hörte innerlich seinen Geldbeutel füllen.
»Mister Ender, Sir, ich weiß es nicht. Wir waren an den Hurensöhnen dran.« Was hätte er auch sonst sagen sollen? Trench hatte, mal wieder, eine sauber geführte Fallakte. Die Spur war klar und das Beschaffen von Beweisen kostete seine Zeit. Er wusste selbst, dass er der King der Abteilung sein könnte. Wenn er nur die Hälfte seiner Fälle mit Verhaftungen und Anklagen zum Abschluss gebracht hätte, wäre er das Aushängeschild der Abteilung. Trench wollte zu sehr auf „Nummer sicher“ gehen. Alle seine geplanten Verhaftungen hätten saftige, wasserdichte Anklagen zur Folge gehabt. Aber was bringt es, wenn die Würfe eines Quarterback gut aussehen, aber nicht ankommen?
»Verdammt! Verdammte Scheiße!« Katsching, Katsching, zwei Dollar auf einmal $$.
»Wissen Sie, ich hätte Ihnen diesen Erfolg wirklich gegönnt. Klar, ich hätte diesen Erfolg auch gebraucht. Sie fragen sich gerade, wie es jetzt weiter geht. Zumindest frage ich mich das.«
Es entstand eine kleine Pause. Trench sah Carl Ender, seinen Chef, an und er verstand, dass er dieses Mal nicht mehr beschützt werden konnte. Die DEA war auf Ermittlungserfolge angewiesen. Er als Agent hatte bisher zu wenig dazu beigetragen. Die Behörde war sowieso schon so unbeliebt wie die CIA. In den 1980ern geriet der „War on Drugs“ von Ronald Reagan mit ihrer Hilfe so richtig ins Kreuzfeuer der Medien. Die Interventionen in Mittelamerika waren auf politischer und diplomatischer Ebene ein einziges Fiasko. Die USA galten seit Vietnam schon nicht mehr als die Nation, die Demokratie und Frieden brachte. Und dann kam dieser Scheiß in Nicaragua. Im Nachhinein betrachtet, war das Eingreifen dort so arrogant und überheblich, man hätte meinen können, die Aktion wäre beim Koks-Buffet geplant worden. Als ob die Entscheidungsträger die Nase voll Stoff gehabt hätten und so wildes Zeugs von sich gaben, wie
„Fuck, ist das geil. Viel zu geil. Den Scheiß müssen wir unterbinden, also verhindern, wenn ihr wisst, was ich meine, weil… zu geil. Whoooo! So geil! Also im Ernst. Wenn der heiße Scheiß in Massen unser gelobtes Land flutet, dann… Whoooo! Blutet mein Auge? Also, den Indios können wir auf keinen Fall… auf gar keinen Fall… Du musst es mit der Klinge erst klein hacken… die Indios, die Mexis, wenn die… stellt Euch vor, was die Kirchen sagen würden. SCHNIIIIIIEEEEEEEFFFFF!!! Das ist der Kreuzzug unserer Zeit! Wie geil. SCHEIßE GEIL! GEIL! Scheiß´ auf Kommunismus, scheiß´ auf Wettrüsten, scheiß´ auf… auf die Ölkrise… Das geile unschuldige, wattige, geile Scheißzeug dürfen wir auf keinen Fall in unser großartiges Land lassen, denn… meine Hand zuckt! Geil! Ich meine lasst uns den scheiß Urwald in Nicaragua einfach niederbrennen. Also Hanoi in erfolgreich… Wisst ihr was ich meine?“
So stellte sich Trench zumindest vor, wie es zu der verhängnisvollen Entscheidung kam, den Weltpolizisten in Mittelamerika mit freier Hand Sheriff spielen zu lassen. Carl ergriff das Wort.
»Trench, Sie wissen, ich kann Sie nicht entlassen. Allerdings sind Sie jetzt Ihr eigenes Strafbatallion.«
»Was soll das heißen? Ein Büro hier in der Zentrale im Keller?«
»Nein, Trench. Sie gehen nach Transwaggon. Alleine. Dieses kleine Dreckskaff ist irgend so ein Eisenbahnknotenpunkt in… New Mexico oder war es doch Texas? Egal, Sie werden dieses Scheißnest auf der Landkarte finden, Ihren Arsch unverzüglich dort hinbewegen und sehen, was sich dort tut. Verdammt!« Katsching $.
Trench war sich nicht sicher, was dieser Auftrag bedeuten sollte. Klar wurde er in die Pampa geschickt. Aber wo waren die Angaben, die ersten Hinweise? Welche Spuren gab es bereits? Was soll überhaupt die Tat sein?
»Wo soll ich anfangen? Gibt es eine Kontaktperson?«
»Scheiße nein! Verdammt ($), Trench!«, platzte es aus Carl heraus.
»Sie gehen dorthin und schauen sich um. Stellen Sie sich darauf ein, ein Bürger dieser Stadt zu werden, denn Sie werden dort so lange Ihre Arbeit gut aussehen lassen, bis ich begründen kann, warum ich Sie für echte Polizeiarbeit woanders brauchen kann. Verstanden? Sie bleiben unauffällig, suchen sich eine Arbeit, hören sich um, finden falsche Freunde… der ganz normale Undercover-Scheiß eben.«
Trench verstand.
»Dieses verdammte ($) Scheißnest liegt so abgelegen und durch Zufall fiel es einem unserer Fotoanalysten auf. Verdammt ($) Trench, das begann alles als ein Witz. Stellen Sie sich das mal vor. Bei einer Zigarettenpause sagte dieser Analyst seinem Chef, dass dieses Kaff sämtliche Eigenschaften aller Überprüfungsraster erfüllt. Und sofort rennen die mir die Tür ein und behaupten, wenn sich linksradikale Hippies, rechtsradikale Rednecks, Drogendealer, Falschspieler und Finanzbetrüger ein Nest bauen würden, würde genau dieses verdammte ($)





























