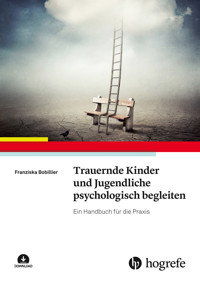
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Thema Tod und Trauer ist besonders im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ein großes Tabuthema. Franziska Bobillier liefert mit diesem Handbuch eine theoretisch fundierte, praxisnahe und anwendungsorientierte Unterstützung für Psycholog*innen, die Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Kontext von Tod und Trauer begleiten. Die Autorin fokussiert auf folgende Themen: •Pathologisierung der Trauer (Diskussion der Diagnose "anhaltende Trauerstörung" u.v.m.) •entwicklungspsychologische Aspekte (Entwicklung des Todeskonzepts, mögliche Trauerreaktionen u.v.m.) •Entwicklung der Trauermodelle •Konkrete Implementierung des Dualen Prozessmodells (DPM) nach Stroebe und Schut in die kinder- und jugendpsychologische Trauerbegleitung •Empfehlungen für unterschiedliche Auftragsarten in der Praxis (Kurz-Coaching von erwachsenen Bezugspersonen: Dos and Donts im Umgang mit trauernden Kindern und Jugendlichen; Empfehlungen für den konkreten Ablauf eines Erstgesprächs u.v.m.) •Umgang mit Suizid und Suizidalität (Todeskontext Suizid; Suizidalitätsmanagement: (trauernde) Kinder und Jugendliche coachen) •Selbstfürsorge als psychologische Fachperson (u.a. Mindful Self Compassion (MSC) und Acceptance & Commitment Therapy (ACT)) • Im Anhang befindet sich eine ausführliche Zusammenstellung von Interventionen, Materialien, Checklisten, Musterbriefen, Literaturempfehlungen und Hinweisen auf alternative Angebote, fachliche Weiterbildung und Netzwerkarbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Franziska Bobillier
Trauernde Kinder und Jugendliche psychologisch begleiten
Ein Handbuch für die Praxis
Trauernde Kinder und Jugendliche psychologisch begleiten
Franziska Bobillier
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br., Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Franziska Bobillier
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Mihrican Özdem, Landau
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Sarolta Bán, Budapest
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96174-3)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76174-9)
ISBN 978-3-456-86174-6
https://doi.org/10.1024/86174-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Für Stève, Antoine und Raphaël, in Liebe.
Wie sag ich’s meinem Kinde?
Jüngst sah mein kleiner Sohn
Den ersten Totenwagen.
– Er gab nicht einen Ton
Und stellte keine Fragen.
Doch dann, nach ein paar Tagen,
Begann er zögernd-leis,
– Was konnte ich schon sagen,
Wo man doch selbst nichts weiß.
Das Schulrezept: Botanik,
„Vom Werden und Verderben“,
Erzielte nichts als Panik:
„Mama, auch du kannst sterben?“
Es war nicht pädagogisch,
Vom Fortbestand der Seelen,
Und viel zu theologisch,
Vom Himmel zu erzählen.
Doch mangels akkuraten
Berichts aus jenen Sphären,
Erschien es mir geraten,
Zu trösten statt zu lehren.
Im Kreis der „Aufgeklärten“
Bin ich darob verfemt.
– Verzeiht, ihr Herrn Gelehrten,
Wenn mich das nicht sehr grämt.
Die Bücherweisheit ist bankrott,
Der Blinde führt den Blinden.
– Und wahrlich, gäb es keinen Gott,
Man müsste ihn erfinden.
Mascha Kaléko (2018, S. 51), mit freundlicher Genehmigung.
Ab welchem Alter spreche ich mit Kindern über den Tod?
„Ab welchem Alter sage ich meinem Kind, dass es die Farbe Gelb gibt?“ Diese Frage stellt niemand. Obwohl wir wissen, dass einige Kinder lange die Farben nicht unterscheiden können, sagen wir dennoch schon den Kleinsten: „Schau mal da, die schöne gelbe Blume.“ Wir lassen Kinder in eine Farbenwelt hineinwachsen und irgendwann können sie diese Farbe selbst benennen. Genau so können wir es halten, wenn es um fröhliche oder um traurige Dinge geht. Trauern, lachen, wütend sein, lieben … all das und vieles mehr gehört zum Menschsein dazu und wir können […] Kindern helfen, in diese Gefühlswelt hineinzuwachsen, wie wir es bei der Farbenwelt ganz selbstverständlich tun.
Mechthild Schroeter-Rupieper (2009, S. 9), Familientrauerbegleiterin und Autorin
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Dank
Geleitwort
Vorwort: Warum dieses Fachbuch?
Einleitung: Pathologisierung der Trauer?
1 Entwicklungspsychologische Aspekte der Trauerreaktionen
1.1 Säuglinge und Kleinkinder (± 0–2 Jahre)
1.2 Junge Kinder (± 2–4 Jahre)
1.3 Kindergarten-/Vorschulkinder (±4–7 Jahre)
1.4 Junge Schulkinder (± 7–12 Jahre)
1.5 Ältere Schulkinder/Pubertät (± 12–14 Jahre)
1.6 Jugendliche (ab ± 14 Jahre)
2 Das duale Prozessmodell (DPM) der Trauerbewältigung in der kinder- und jugendpsychologischen Trauerbegleitung
2.1 Entwicklung der Trauermodelle
2.2 Anwendbarkeit, Möglichkeiten und Grenzen des dualen Prozessmodells
2.2.1 Das duale Prozessmodell in der kinder- und jugendpsychologischen Trauerbegleitung
2.2.2 Ergänzung 1: Erinnerungsarbeit und Stabilisierung
2.2.3 Ergänzung 2: Belastende Beziehung zur verstorbenen Person zu deren Lebzeiten
2.2.4 Fazit
2.3 Implementierung des dualen Prozessmodells in die kinder- und jugendpsychologische Trauerbegleitung
2.3.1 Zum Einstieg in die Trauerbegleitung mit Kindern und Jugendlichen
2.3.2 Umgang mit belastender Beziehung des Kindes zum Verstorbenen
2.3.3 Die Realität des Verlusts und die Realität einer veränderten Welt akzeptieren
2.3.4 Den Trauerschmerz erfahren und sich Pausen vom Trauerschmerz erlauben
2.3.5 Sich an die Welt anpassen, in der die verstorbene Person fehlt, und die veränderte (subjektive) Welt bewältigen
2.3.6 Eine dauerhafte neue Verbindung zu der verstorbenen Person finden und neue Rollen, Funktionen, Identitäten und Beziehungen entwickeln
3 Vorschläge für unterschiedliche Auftragsarten in der Praxis
3.1 Allgemeine Informationen für psychologische Fachpersonen
3.2 Anmeldung/Erstkontakt
3.2.1 Klient*in mit starkem Leidensdruck: Die ELSE-Technik nach Servan-Schreiber
3.2.2 Vergütung ansprechen und klären
3.2.3 Das weitere Auftragssetting besprechen
3.3 Alternative Unterstützungsformen
3.4 Kurzcoaching von erwachsenen Bezugspersonen: Dos and Don’ts im Umgang mit trauernden Kindern und Jugendlichen
3.4.1 Wissen um die Kindertrauer: Bedürfnis nach Trauer und nach Normalität
3.4.2 Kindgerechte Wortwahl und Erklärungen zum Sterben, zum Tod und zur Trauer
3.4.3 Praktische Unterstützung von trauernden Kindern und Jugendlichen
3.4.4 Erwachsene Bezugspersonen: Modellfunktion und Umgang mit eigenen Emotionen
3.4.5 Vorbeugung von Ängsten bei Kindern und Jugendlichen
3.4.6 Umgang mit unterschiedlichen Reaktionen und Bewältigungsstrategien
3.4.7 Umgang mit Mobbing: Die Neue Autorität nach Haim Omer
3.4.8 Hilfreiche und entlastende Unterstützung durch soziales Netz
3.5 Anregungen für den Ablauf des (Erst-)Gesprächs
4 Umgang mit Suizid und Suizidalität
4.1 Besondere Aspekte der psychologischen Trauerbegleitung bei der Todesursache Suizid
4.1.1 Grundsätzliches
4.1.2 Kommunikation
4.1.3 Psychoedukation
4.1.4 Verabschieden vom Leichnam ermöglichen
4.1.5 Gefühle zulassen
4.1.6 Psychoedukation über den „suizidalen Modus“
4.1.7 Den ständigen Fokus vom Suizid auch einmal wegnehmen
4.1.8 Auf den Umgang mit unangebrachten Reaktionen des Umfeldes vorbereiten
4.1.9 Mögliche unrealistische Erwartungen an trauernde Kinder und Jugendliche
4.2 Suizidalität bei trauernden Kindern und Jugendlichen
4.2.1 Anzeichen
4.2.2 Warnzeichen
4.2.3 Alarmzeichen
4.2.4 Trauernde Kinder und Jugendliche auf ihre Suizidalität ansprechen
4.3 Suizidalitätsmanagement: Kinder und Jugendliche coachen
4.3.1 Grundsätzliches
4.3.2 PRISM™-S (Pictoral Representation of Illness Self Measure – Suicidality)
4.4 Wenn psychologische Begleitung nicht ausreicht
4.4.1 Risikofaktoren für eine Entwicklung einer anhaltenden Trauerstörung
4.4.2 Kurzausblick: Psychotherapieverfahren
5 Selbstfürsorge für psychologische Fachpersonen in der Trauerbegleitung
5.1 Die Rolle von Selbstfürsorge bei der psychologischen Trauerbegleitung
5.2 Selbsterfahrung und Selbstreflexion
5.3 Grundlagen zur Selbstfürsorge
5.4 Achtsamkeit
5.5 Akzeptanz des Leids: die Akzeptanz-und-Commitment-Therapie (ACT)
5.6 Achtsames Selbstmitgefühl (Mindful Self-Compassion, MSC)
5.7 Mitgefühl mit Gleichmut und Umgang mit Fürsorgemüdigkeit
Schluss
Anhang
Hinweise zu Zusatzmaterialien
Anhang A: Interventionen
A1 Interventionen für die kinder- und jugendpsychologische Trauerbegleitung
A2 Techniken und Übungen für die Selbstfürsorge für psychologische Fachpersonen in der Trauerbegleitung
Anhang B: Materialien
B1 Zum (Nach-)Spielen/Psychoedukation
B2 Spiele
B3 Andere Materialien
Anhang C: Checklisten und Musterbriefe
C1 Merkblatt „Telefonischer Erstkontakt mit Familie“
C2 Ausführlicheres Anamneseblatt (ergänzend zu C1)
C3 Weitere vertiefende Fragen
C4 Musterbrief „Unfall“
C5 Musterbrief „Tod eines Schülers/Suizid“
C6 Musterbrief „Familiendrama“ (z. B. Geiselnahme, Gewalttaten, Totschlag, etc.)
C7 Möglicher Ablauf einer psychologischen Intervention in einer Klasse
C8 Checkliste für telefonische Anfragen in der Psychologischen Ersten Hilfe (PEH)
Anhang D: Bücherempfehlungen
Anhang E: Netzwerkarbeit/Angebote für Betroffene und fachliche Weiterbildungen
Professionelle Trauerbegleitung, Fachstellen und Vereine
Andere allgemeine Angebote
Fachliche Information, Weiterbildungen in Trauerbegleitung und Therapie
Literatur
Die Autorin
|11|Dank
Ich danke ganz herzlich …
Frau Dr. phil. Susanne Lauri, Programmleiterin Psychologie (Buch) beim Hogrefe Verlag in Bern für ihr gründliches und konstruktives Lektorat und die phantastische Betreuung;
Herrn Professor Dr. Hansjörg Znoj, Professor für klinische Psychologie an der Universität Bern, für sein Geleitwort;
Frau Mihrican Özdem, Diplompsychologin und Fachlektorin für Psychologie, und Frau Lisa Maria Pilhofer, Juniorlektorin für Psychologie und Medizin bei Hogrefe für ihr gründliches und hilfreiches Lektorat;
Frau lic. phil. Swantje Brüschweiler-Burger, Psychotherapeutin und Transaktionsanalytikerin CTA-P, für ihr gründliches Lektorat und ihre richtungsweisenden Anmerkungen aus hypnotherapeutischer Perspektive;
Herrn Gregor Harbauer, Psychotherapeut, leitender Psychologe an der Klinik Hohenegg, Meilen, für sein hilfreiches Lektorat des Kapitels „Suizidalität bei trauernden Kindern und Jugendlichen“ und seine konstruktiven Anmerkungen;
meiner Mutter Beate Herrmann und meiner Schwiegermutter Sylvia Bobillier für ihre liebe Unterstützung.
Außerdem danke ich meinem Mann Stève und meinen Kindern Antoine und Raphaël, die mich bei allen Projekten bedingungslos unterstützen und aus deren Liebe ich meine Kraft und Inspiration schöpfe.
Dank gebührt insbesondere auch den folgenden Fachpersonen für den Einblick in ihre Praxis, denn ohne ihre Mithilfe wäre dieses Fachbuch nicht entstanden:
Frau Christine Leicht, Familientrauerbegleiterin für Kinder und Familien und Kleinkinderzieherin, Bern;
Frau Mechthild Schroeter-Rupieper, Familientrauerbegleiterin und Autorin;
Herrn Roland Kachler, evangelischer Theologe, Psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis und Autor zahlreicher Bücher in der Trauerthematik, für die freundliche Transkriptionsgenehmigung seines Seminars „Und wo ist Mama jetzt“ und die Erlaubnis, Übungen aus diesem Seminar für dieses Fachbuch zu verwenden;
Frau Mareike Jentzsch, Psychotherapeutin beim Zentrum für Begabungsförderung, Zürich;
Frau Marie-Noëlle Ruffieux, Psychotherapeutin, AGAPA Suisse-Romande, Freiburg im Üechtland;
Frau Andrea Kurzo, Psychoonkologin und Psychotherapeutin im Inselspital Bern;
Frau Rosanna Abbruzzese, Psychoonkologin und Psychotherapeutin im Kinderspital Zürich;
Frau Eva Antonak, Kinder- und Jugendpsychologin, Schulpsychologin-Erziehungsberaterin, Kantonale Erziehungsberatung Thun;
Frau Christine Krummen-Kläy, Psychotherapeutin und Schulpsychologin-Erziehungsberaterin, Kantonale Erziehungsberatung Bern.
Unterstützung erhielt ich auch von folgenden Personen, auch ihnen sei herzlich gedankt:
|12|Herrn Florian Huggler, Schulpsychologe-Erziehungsberater, Kantonale Erziehungsberatung Thun, für die freundliche Bereitstellung von Unterlagen aus dem Ordner „Psychologische Erste Hilfe“ (PEH) der kantonalen Erziehungsberatung des Kantons Bern;
Herrn Tomas Renken, Lehrer für Englisch und Chemie am Hermann-Tast-Gymnasium in Husum (D), für sein hilfreiches Lektorat und seine sehr wertvollen Anmerkungen aus pädagogischer und persönlicher Perspektive;
Frau Nadine Chaignat, die 2020 auf ihrem Blog „Mamas Unplugged“ ein Interview mit Frau Christine Leicht veröffentlichte und mir freundlicherweise gestattete, die Inhalte dieses Interviews für dieses Buch zu verwenden;
Herrn Fabian Grolimund, Psychologe, für seine Unterstützung und Beratung als erfahrener Autor;
Frau Johanna Jutzet, Cofilialleiterin der Lüthy Kanisius Buchhandlung in Freiburg im Üechtland für ihre fachliche Beratung und Anmerkungen aus der Perspektive des Buchhandels.
|13|Geleitwort
Auf dieses Buch hat man lange gewartet. Viel wurde schon über Trauer und die Verlustreaktion geschrieben, doch wie man Kindern und Jugendlichen in Trauer begegnet, welche Reaktionen zu erwarten sind in Abhängigkeit von ihrer Entwicklung, wie Kinder und Jugendliche den Verlust eines Elternteils, eines Geschwisters oder einer anderen wichtigen Person in ihrem Leben verarbeiten, was dieser Verlust mit ihnen macht – dazu fehlte bislang eine fundierte fachliche Auseinandersetzung. Zwar existieren Ratgeber oder Hilfsangebote, diesen mangelt jedoch oft eine wissenschaftliche Perspektive. Franziska Bobillier gelingt es in diesem wertvollen Werk, die Praxis mit der Wissenschaft zu verbinden, ohne sich in akademischen Fragen zu verlieren.
Sie bezieht sich auf das duale Prozessmodell der Trauer, wie es von der Arbeitsgruppe um Margaret Stroebe entwickelt wurde. Dieses Modell betrachtet den Prozess der Verlustverarbeitung von zwei Polen her. Einerseits aus der Perspektive der emotionalen Auseinandersetzung, die zur Voraussetzung hat, dass der Verlust als endgültig verstanden wird und in der Folge eine innere Leere bewirkt, die mit Schmerz und Verwirrung verbunden ist. Andererseits verändert sich die Lebenssituation, es stellen sich ganz konkrete Fragen, wie es weitergeht, wie diese Situation bewältigt werden kann ohne die Unterstützung des Elternteils, ohne die Auseinandersetzung mit dem Bruder oder der Schwester. Zudem sind in einem familiären System auch weitere Personen involviert. Diese wollen unterstützen und sind gleichzeitig ebenfalls betroffen vom Verlust, was nicht selten Lebenskrisen auslöst oder zumindest die Fähigkeit reduziert, auf andere einzugehen oder sie stehen der Situation selbst hilflos gegenüber. Zur Verarbeitung eines Verlustes werden Ressourcen gebraucht, die vielleicht gerade in dieser Situation nicht zur Verfügung stehen.
Wie begegnet man als Erwachsener einem Kind, das sich in einer Lebenssituation befindet, der man selbst kaum gewachsen ist? Was versteht das Kind, wie verhält man sich einer Jugendlichen gegenüber, die alle Hilfe ablehnt oder sich in der Schule nicht mehr konzentrieren kann, weil sie gerade keine Kapazität für Vokabeln aufbringt? Und soll man Kinder „beschützen“ vor der Konfrontation mit dem Tod, soll man die Endgültigkeit des Verlustes beschönigen, indem man Metaphern braucht, die darüber hinwegtäuschen, dass die Mutter, der Vater aus dem Leben geschieden sind? Wie spreche ich mit dem Kind? Versteht es das Konzept des Todes und ab welchem Alter ist dies der Fall? Fragen über Fragen, die Eltern, Großeltern oder auch Lehrpersonen oft überfordern und deshalb nicht thematisiert werden.
Abhängig vom Alter entwickelt sich das Verständnis der Welt und das impliziert, dass Erwachsene in unterschiedlicher Position, etwa als Eltern oder Fachperson sich darüber bewusst werden müssen, ehe sie intervenieren. Die Autorin zeigt auf, dass Kinder über Ressourcen verfügen, die oftmals unterschätzt werden und dass Kinder und Jugendliche schnell realisieren, wenn man ihnen etwas vormachen will. Sie plädiert deshalb, offen mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Verlust altersgerecht auseinanderzusetzen.
|14|Was das Buch so wertvoll macht, sind die kurzen, prägnanten Beispiele, die vielen Vignetten, die immer wieder verdeutlichen, wie unterschiedlich die Erfahrungswelten sind und wie man sich entsprechend dieser Möglichkeiten richtig verhält. Dos and Don’ts als Hinweise für Erwachsene sind noch keine Intervention, aber sie helfen zu verstehen, was das Kind, die jugendliche Person braucht und was gar nicht geht. Selbstverständlich kommen diagnostische Hinweise nicht zu kurz, aber es wird klar, dass sich dieses Buch nicht nur an psychologische Fachkräfte richtet, sondern auch für Großeltern, Lehrpersonen oder seelsorgerisch Tätige eine reiche Quelle an Wissen und Hinweisen birgt.
Franziska Bobillier nimmt eine kritische Haltung bezüglich der „Pathologisierung“ der Trauerreaktion ein und zeigt die Kriterien auf, die für eine Diagnose einer Störung erfüllt sein müssen. Der endgültige Verlust verletzt zentrale Bedürfnisse, viele Symptome und Reaktionen werden aus dieser Perspektive verständlich. Die Reaktionen zu kennen ist für Angehörige aber auch professionelle Begleiter wichtig, denn es kommt vor allem darauf an, die Verletzung nicht noch zusätzlich zu verstärken. Daraus folgt, jedem Kind, jeder Jugendlichen Freiheit im Verhalten zuzugestehen und sich um eine empathische, wertschätzende Haltung zu bemühen, aber auch „Normalität“ zuzulassen. Den therapeutischen Verfahren ist ein eigenes Kapitel gewidmet, das sich dadurch auszeichnet, dass nicht eine ausschließliche Herangehensweise demonstriert wird, sondern eine Auswahl an möglichen und teilweise auch empirisch gestützten Verfahren charakterisiert werden. Das lässt Fachpersonen die Wahl, dasjenige Verfahren zu vertiefen, das sie bereits kennen oder sich leicht aneignen können. Zentral ist dieser Punkt deswegen, weil klar ist, dass es nicht darum geht, spezifische „Techniken“ anzuwenden, sondern das Wesen der Verlustreaktion zu verstehen und aus dem Katalog möglicher Herangehensweisen das Verfahren zu wählen, das besonders für die jeweilige Situation geeignet erscheint. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist der ausführliche Anhang, der in herausragender Weise Interventionen beschreibt und durchaus „handfeste“ Anleitungen bietet, die für Fachpersonen für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen von großem Nutzen sind, aber durchaus allgemein für alle anregend sein können. Diese Anleitungen zeigen einen hohen Praxisbezug, wobei auch die Quellen der Verfahren genannt sind, damit Interessierte sich in die Verfahren weiter vertiefen können. Sie sind so beschrieben, dass sich nicht nur praktisch tätige Fachpersonen Ideen und Anregungen holen können. Selbstfürsorge ist ein weiteres Anliegen der Autorin, Selbstfürsorge im Sinne von zu sich Sorge tragen, sich nicht zu viel zuzumuten und die eigenen Grenzen aber auch Möglichkeiten zu kennen. Die ermutigende Aufforderung, sich dem Thema Trauer mit Interesse und Hoffnung zu nähern, ist in allen Aspekten dieses wirklich wunderbaren Buches zu spüren, und so möchte ich dieses Geleitwort damit schließen, dass ich allen, die sich mit dem Thema notgedrungen befassen müssen, dieselbe vorurteilsfreie und hoffnungsfrohe Haltung wünsche, die Franziska Bobillier dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Franziska Bobillier hat mit diesem Buch nicht nur eine Lücke geschlossen, sondern sie hat zahlreiche Wege und Möglichkeiten gezeigt, wie man Kinder und Jugendliche unterstützen kann, mit einer der schrecklichsten Erfahrungen umzugehen, die das Leben beinhaltet: dem Verlust eines vielgeliebten Menschen, eines Elternteils, eines nahen Verwandten oder eines Freundes, einer Freundin. Diesen Verlust akzeptieren zu lernen und das eigene Leben fortzusetzen ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist traurig, aber es setzt auch Möglichkeiten und Ressourcen frei, die vielleicht sonst brach geblieben wären. Dieses Buch gehört in jede Bibliothek, in jede Schule, in jede Praxis!
Bern, September 2021
Professor Dr. Hansjörg Znoj
|15|Vorwort: Warum dieses Fachbuch?
Mascha Kaléko zeigt uns: Bei keinem anderen Thema fehlen uns so oft die Worte wie beim Tod, insbesondere, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen sollen.
Es gibt bisher kein Fachbuch, das spezifisch kinder- und jugendpsychologische Begleitung im Kontext von Tod und Trauer behandelt und ein etabliertes theoretisches Modell anhand eines konkreten Interventionsrasters in die Praxis überträgt. Deshalb habe ich beschlossen, die Lücke zu schließen und selbst ein Fachbuch zu verfassen. Dabei habe ich das etablierte duale Prozessmodell der Trauerbewältigung von Stroebe und Schut (1999) anhand eines konkreten Interventionsrasters in die Praxis übersetzt. Das Ziel dieser Publikation ist, ein Handbuch für Kinder- und Jugendpsycholog*innen bereitzustellen.
Als ich mit verschiedenen Personen über die Idee dieses Fachbuchs sprach, teilten sich die Reaktionen in zwei Lager: Die einen waren begeistert, die anderen sagten: „Der Tod ist etwas Normales und gehört zum Leben. Auch die Trauer ist etwas Normales und vor allem keine Störung. Und überhaupt, warum dann psychologische Begleitung?“ Wozu braucht es also dieses Fachbuch für die psychologische Begleitung von trauernden Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern und für die Beratung von anderen erwachsenen Bezugspersonen (Erzieher*innen, Lehrpersonen, Angehörige, Freund*innen und sonstige Bekannte)?
Stellen Sie sich folgende Szenarien vor:
Frau H.s Mann ist gerade bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie soll sie das ihrem 3-jährigen Kind erklären?
Herr N. fragt: „Meine jugendliche Nichte hat sich umgebracht. Sie hat wohl nicht einmal einen Abschiedsbrief geschrieben, was man doch sonst macht. Was sage ich denn jetzt meinem Bruder? Ich will ihn trösten und ihm etwas Hilfreiches sagen, aber was wäre das denn?“
Der 5-jährige Muhammed fragt: „Guck mal, die Mama schläft doch nur. Morgen wacht sie wieder auf.“ Wie erklären Sie den Unterschied zwischen Tod und Schlaf?
Lisas Vater hat sich suizidiert. Für Lisa hat ihr Leben nun keinen Sinn mehr, sie hat sich einen Suizidplan erstellt und erzählt in der psychologischen Begleitung davon.
Eines der Kinder in der Klasse von Herrn W. ist auf dem Weg zur Schule tödlich verunglückt. Wie soll er das den anderen Klassenkamerad*innen erklären? Was soll er den Eltern sagen? Oder soll er sie lieber in Ruhe lassen, um sie nicht zusätzlich zu belasten?
Die 6 Monate alte Lilli schreit nach ihrer Mutter, die letzte Nacht gestorben ist. Was macht man nun mit so einem Säugling? Kann Lilli schon verstehen, was los ist?
Carla, 15, versteht nicht, warum ihr Bruder, 18, feiern gehen kann, obwohl der Vater erst kürzlich verstorben ist.
Es ist Zeit, für den Muttertag zu basteln. Frau B., Primarlehrerin, will das ihrem Schüler Gabriel, dessen Mutter verstorben ist, nicht zumuten. Was soll sie tun?
Die Ehefrau von Herrn V. hat einen Altarschrein für das verstorbene Kind im Wohnzimmer aufgebaut. Das ist Herrn V. zu viel, |16|aber er will seine Frau auch nicht kritisieren. Was soll er tun?
Die 8-jährige Lisa fragt am Tag der Beerdigung ihrer Schwester, ob sie jetzt ihr Zimmer haben kann. Ihre Eltern sind bestürzt und empfinden Lisas Frage als unangemessen.
Wie soll Herr C. den Suizid seiner Schülerin in der Klasse thematisieren? Er fragt: „Es gibt doch diesen Nachahmungseffekt. Was, wenn dann noch jemand den Freitod1 wählt?“
Der 6-jährige Paul will nach der Beerdigung seines Vaters Fußball spielen. Die Mutter findet: „Also ist er doch noch zu klein, er versteht das alles nicht. Er sollte jetzt doch traurig sein. Verdrängt mein Sohn seine Trauer?“
Frau I. erzählt, dass ihr Mann sich suizidiert hat. Soll sie ihren Kindern wirklich die Wahrheit sagen, oder soll sie das nicht besser zu einem späteren Zeitpunkt tun, wenn die Kinder älter sind?
Was antworten Sie in diesen Fällen als Kinder- und Jugendpsycholog*in?
Der erste Grund für diese Publikation ist, betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Familien in ihrer Trauer zu unterstützen. Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern werden es in keinem Fall als „normal“ empfinden, wenn ein oder mehrere Mitglieder ihrer Kernfamilie (d. h. Kinder, Geschwister, Eltern) durch Unfall, Krankheit, Fehl- oder Frühgeburt, Suizid oder andere Todeskontexte stirbt bzw. sterben. Bei Abschieden – sei es durch Tod, Trennung oder Scheidung – gerät die ganze Welt des betroffenen Kindes, der Eltern, der ganzen Familie aus den Fugen. Laut Bergstraesser et al. (2015) betreffen die negativen Auswirkungen von Krankheit, Tod und Trauer bei 40 % der Eltern die eigene Gesundheit, bei 35 % die Familie als Ganzes, bei 32 % die Partnerschaft der Eltern und bei 20 % die finanziellen Ressourcen der Familie, was ein wichtiger Hinweis auf notwendige psychologische Unterstützung sein kann.
Hinzu kommt, dass sich die Eltern in einer Doppelrolle befinden: Zum einen sind sie selbst Trauernde, zum anderen betreuen sie ihre trauernden Kinder, und umgekehrt befinden sich auch Kinder in einer solchen Doppelrolle: Sie erleben die eigene Trauer und übernehmen auch die Trauer der anderen (Kachler, 2009). Es kommt vor, dass Eltern so stark mit sich selbst und ihrer eigenen Trauer und den dazugehörigen Emotionen beschäftigt sind, dass sie nicht in der Lage sind oder sich (zeitweise) nicht in der Lage fühlen, sich ihren überlebenden Kindern angemessen zuzuwenden. Andere Eltern sind so sehr verunsichert, dass sie nicht wissen, wie sie nun mit ihren Kindern über den Tod sprechen sollen. Eine weitere Belastung für viele trauernde Kinder und Jugendliche infolge eines Todesfalls in ihrer Kernfamilie stellen Aussagen dar, die von der Umwelt an sie herangetragen werden, wie: „Jetzt musst du aber ganz besonders lieb zu Mama sein“. Sie werden selbst mit ihrer eigenen Trauer meist wenig bis gar nicht wahrgenommen. Oft spricht man daher bei trauernden Kindern bzw. Geschwistern auch von den vergessenen Trauernden. Der Tod in der Kernfamilie ist eine einschneidende Erfahrung und kann ihrerseits Krisen bei trauernden Kindern und Jugendlichen auslösen. Deren eigene Suizidalität muss in jedem Fall abgeklärt werden, damit die Kinder und Jugendlichen „fit gemacht“ werden können im Umgang mit ihrer eigenen Suizidalität.
Der Tod in der Kernfamilie gilt heute als unnatürlich, vor allem wenn Kinder (zeitlich vor ihren Eltern) sterben. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft nach Gesundheit und Jugend strebt, womit das Sterben heute zu einem immensen Tabu geworden ist. Daraus können viele Ängste entstehen, die sich negativ auf die |17|Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie auf das Beziehungsgefüge innerhalb der Familie auswirken können. Früher war der Tod viel allgegenwärtiger im Alltag, viele Kinder starben, die Lebenserwartung war allgemein geringer, Tote wurden zu Hause aufgebahrt, innerhalb der Gemeinschaften wurden Trauernde mehr unterstützt. Durch den medizinischen Fortschritt ist die Lebenserwartung stark gestiegen, der Tod ist heute weniger präsent, gleichzeitig ist der familiäre Zusammenhalt in den letzten Jahrzehnten tendenziell gesunken. Wenn dann der Tod in der Kernfamilie eintritt, sind viele Familien mit ihrer Trauer überfordert, weil sie kaum mehr Gelegenheiten haben, den Umgang mit Tod und Trauer zu erlernen. Eltern wollen ihre Kinder am liebsten vor allem Leid bewahren und sie beschützen, was ein normales elterliches Bedürfnis ist. Damit nehmen sie ihren Kindern aber die Gelegenheit, Tod und Trauer zu „er-leben“ und den Umgang mit diesen Situationen zu erlernen.
Wenn Eltern heute bereits beim Tod der Großmutter stark verunsichert sind, wie sie dies ihren Kindern erklären sollen, wie sieht dies erst aus, wenn ein Kind oder ein Elternteil aufgrund von Krankheit, durch Suizid oder durch andere gewaltsame Todesarten stirbt? Vor allem Suizid ist eine nicht zu ignorierende Todesursache in der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2017): Die Todesursache Suizid spielt gewissermaßen eine Sonderrolle aufgrund der Gewaltsamkeit, auch geschieht er für viele Familien meist plötzlich oder oft infolge psychischer Erkrankungen, wie z. B. Depressionen, jedoch sind Tod und Trauer im Allgemeinen und Suizid im Spezifischen noch immer ein großes Tabuthema.
Dieses Buch soll Kinder- und Jugendpsycholog*innen helfen, die Betroffenen zu begleiten, und sie dabei unterstützen, dem Unaussprechlichen eine Sprache zu schenken.
Der zweite Grund für diese Publikation ist, Information für Kinder- und Jugendpsycholog*innen bereitzustellen, die Betroffene im Kontext von Tod und Trauer unterstützen. Leider ist psychologische bzw. psychotherapeutische Trauerbegleitung heute kaum in Curricula von schulpsychologisch-erziehungsberaterischen, kinder- und jugendpsychologischen oder psychotherapeutischen Weiterbildungen im deutschsprachigen Raum verankert. Auch wenn man als Psycholog*in Betroffene mit vielen allgemeinen Methoden unterstützen kann, herrscht bei vielen Psycholog*innen, die nicht hin und wieder mit der Todes- und Trauerthematik konfrontiert sind, fachliche Unsicherheit und der Wunsch nach aktuellem theoretischem Hintergrund und konkretem Interventionsmaterial. Darüber hinaus sind mangelndes Wissen, fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten und Richtlinien für die Betreuung unheilbarer kranker und sterbender Kinder für die Fachpersonen eine starke Belastung, wie Bergstraesser et al. (2015) in ihrer Pelicanstudie gezeigt haben.
Zielpublikum. Dieses Fachbuch richtet sich vorwiegend an Kinder- und Jugendpsycholog*innen, die z. B. an Erziehungsberatungsstellen, schulpsychologischen Diensten, anderen Beratungsstellen und Kliniken beschäftigt sind. Auch für Kinder- und Jugendpsychotherapeut*innen und -psychiater*innen, die sich in das Thema einarbeiten oder sich auch nur einen thematischen Überblick verschaffen möchten, kann dieses Fachbuch nützlich sein. Für angrenzende Berufsgruppen, wie z. B. Sozialarbeiter*innen, Seelsorger*innen, Erzieher*innen, Lehrpersonen sowie für Betroffene und Angehörige kann dieses Buch ebenso von Interesse sein.
Begriffliche Einordnung. Im Folgenden wird auf die verwendeten Begriffe „psychologische Begleitung“ sowie „Psychotherapie“ und „psychologische Beratung“ im Kontext von Tod und Trauer eingegangen.
Bei der Psychotherapie geht es um eine umfassendere und oft langfristigere Behandlung mithilfe von Therapieverfahren, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die primär auf die Bearbeitung von Proble|18|men mit Störungscharakter abzielen. In der Einleitung werden diesbezüglich die Fachdiskussion um die Pathologisierung der Trauer und die Kriterien für die anhaltende Trauerstörung vorgestellt. In Kapitel 4.4.1 werden Risikofaktoren für die Entwicklung einer solchen aufgeführt. Zu diesen zählen unter anderem der Tod eines Kindes, Tod eines Geschwisters und eine ganz besonders enge Beziehung (wie z. B. Eltern-Kind-Beziehung). Das heißt, dass Kinder, Jugendliche und Familien, die einen Todesfall in ihrer Kernfamilie erlebt haben, schon per se zur Risikogruppe für die Entwicklung einer anhaltenden Trauerstörung zählen, aber nicht alle entwickeln deshalb eine solche.
Auch die subjektive Wahrnehmung, die das überlebende Kind hinsichtlich seiner Beziehung zur verstorbenen Person zu Lebzeiten hatte, ist hier zentral. Viele Kinder haben eine normale Beziehung zum verstorbenen Familienmitglied, mit positiven und negativen Anteilen. Stand jedoch eine Belastung auf Bindungs- und/oder Beziehungsebene eher im Vordergrund (z. B. wenn das Kind sich nie persönlich akzeptiert fühlte oder stets das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein) oder war diese sogar traumatisch (z. B. Missbrauch durch verstorbenes Familienmitglied), stellt sich die Frage, was hier noch psychologisch behandelt und was in den Bereich der Psychotherapie gehört. Das hängt auch stark davon ab, was für Ausbildungen und wie viel Berufserfahrung die psychologischen Fachperson hat und welche Art von Behandlung sie anbieten kann und welche nicht. Zum Vorliegen eines Traumas schreiben Cohen, Mannarino, Greenberg, Padlo und Shipley (2002, S. 311): „Traumatische Trauer in der Kindheit ist beschrieben worden als der ‚Übergriff von Traumasymptomen auf die Fähigkeit des Kindes zu trauern‘.“
Prinzipiell gilt: Liegt ein Trauma vor, sei es in Bezug auf eine belastete Beziehung, auf die Todesumstände oder andere Aspekte, muss zuerst das Trauma behandelt werden, bevor man an der Trauer arbeiten kann. David Trickey (2014), Klinischer Psychologe und Kodirektor des United Kingdom Trauma Council am Anna Freud Centre in London, drückt dies folgendermaßen aus:
An die normale Stelle einer normalen Reaktion auf den Verlust tritt das Trauma, das einen normalen Verlauf der Trauer blockiert oder behindert. […] zunächst muss jedoch gemeinsam das Trauma der Erinnerung aufgearbeitet werden, damit es dem hilfreichen Prozess des Gedenkens nicht im Wege stehen kann. (S. 448)
Anregungen dazu, wie Kinder- und Jugendpsycholog*innen diese Thematik mit Kindern und Jugendlichen aufnehmen können, finden sich in Kapitel 2.2.3, Ergänzung 2, sowie in Kapitel 2.3.2 und entsprechende Unterkapitel.
Psychologische Beratung bedeutet in der Regel eine punktuelle Begleitung bei einem spezifischen aktuellen Thema des Klienten oder der Klientin. Bei der Bearbeitung der betreffenden Fragestellung erlangen die Klient*innen ein vertiefteres Verständnis für das aktuelle Anliegen, entwickeln passende, möglichst ressourcenorientierte Bewältigungsstrategien und setzen diese anschließend um. Die psychologischen Berater*innen unterstützen die Klient*innen bei diesem Prozess. Eine Beratung ist in der Regel nach Abschluss dieses Prozesses beendet.
Einordnung dieses Buchs in den Bereich der psychologischen Beratung. Trauer ist grundsätzlich ein normaler und gesunder Prozess (und keine Störung per se), der den Betroffenen jedoch starke Anpassungsleistungen abverlangt. In diesem Buch geht es um die beratende psychologische Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Bezugspersonen bei normalen Trauerreaktionen und bei der Bewältigung von normalen Alltagserfahrungen nach einem außergewöhnlichen Ereignis in Form eines Todesfalls in der Kernfamilie. Zwar wurden auch psychotherapeutische Interventionen aufgeführt (wie z. B. hypnotherapeutische Imaginationen, Arbeit mit Ego-States), aber das Ziel der beraterischen |19|Behandlung ist nicht eine tiefgehende Veränderung aufseiten der Klient*innen auf individueller und/oder familiärer Ebene.
Der Arbeitskontext bleibt aufgrund des punktuellen spezifischen Trauerkontextes sowie aufgrund der meist kürzeren Behandlungsdauer, der Unterstützung bei einer normalen Anpassung infolge eines herausfordernden und einschneidenden Lebensereignisses in der Regel auf Beratungsebene. Oft ist es auch schlicht nicht voraussehbar, ob sich ein ursprünglicher Beratungskontext im Laufe des Prozesses zu einem eher therapeutischen Kontext entwickelt, da noch weitere persönliche und/oder familiäre Themen und Anliegen hinzukommen können. Es liegt in der Verantwortung der betreuenden psychologischen Fachperson, abzuschätzen, worum es im spezifischen Fall geht, ob sie den Fall übernehmen bzw. weiterführen kann oder ob sie den Fall weitervermitteln muss (siehe auch Kapitel 4.4).
In Bezug auf die Begrifflichkeit wurde in dieser Publikation anstelle des Begriffs der psychologischen Beratung jedoch der Begriff der „psychologischen (Trauer-)Begleitung“ gewählt: Die traditionelle Trauerbegleitung grenzt sich davon ab, Trauernde „beraten“ zu wollen, „wie man trauert“, vielmehr will sie sie in ihrer Trauer begleiten. Zwar beinhaltet dieses Buch auch beratende Anteile, wie z. B. bei den Dos and Don’ts in Kapitel 3.4, aber insgesamt geht es darum, die Kinder, Jugendlichen, Familien und deren Bezugspersonen bestmöglich zu begleiten, und daher lehnt sich der in diesem Buch verwendete Ausdruck an den klassischen Begriff der Trauerbegleitung an.
Theoretische Grundlage des Interventionsrasters. Stroebe und Schut (1999) gehen davon aus, dass Trauernde in ihrem Alltag verlustorientierte und wiederherstellungsorientierte Stressoren erleben und zwischen diesen beiden Polen oszillieren. Verlustorientierte Stressoren sind z. B. das Vermissen der verstorbenen Person, wiederherstellungsorientierte Stressoren z. B. der Aufbau von neuen Beziehungen. Stroebe und Schut haben vier solcher Paare an verlust- und wiederherstellungsorientierten Stressoren aufgestellt (siehe Kapitel 2.3, Abbildung 3). Einige der Interventionen passen auch zu mehreren der Paare oder können in Abwandlung auch breiter verwendet werden. Es ging bei der Zusammenstellung um den Versuch, für jede Thematik passende Interventionen bereitzustellen. Jedoch ist es auch hier der psychologischen Fachperson überlassen, die Interventionen flexibel an den ihr vorliegenden Begleitungskontext anzupassen.
Laut Kachler (2009), Theologe und Psychologischer Psychotherapeut, kommt in der Trauerbegleitung mit Kindern und Jugendlichen die Stabilisierung dieser oft viel zu kurz. Auch rät er zu Erinnerungsarbeit als Einstieg in die Trauerbegleitung, da diese die Kinder und Jugendlichen nicht direkt mit den massiven Gefühlen der Trauer, Wut oder auch Ohnmacht konfrontiert, sondern sich der Trauer indirekt über handlungsorientierte Impulse behutsam annähert. Daher wird dem Interventionsraster, das sich an das duale Prozessmodell nach Stroebe und Schut (1999) anlehnt, ein Interventionsblock auf Grundlage von Kachlers Gedanken vorangestellt, der in Kapitel 2.3.1 genauer beschrieben ist.
Das hier vorgestellte Handbuch erweist sich in der Anwendung als sehr flexibel und seine Struktur ist überschaubar. Dies ist jedoch auch der Dynamik des gewählten Trauermodells, dem dualen Prozessmodell nach Stroebe und Schut (1999), geschuldet: Man ist in der Trauermodellforschung in den letzten Jahren davon abgekommen, Trauer nach zeitlich festgelegten Phasen und Aufgaben zu unterteilen. Stattdessen gehen Stroebe und Schut sowie Ennulat (2003) davon aus, dass Trauernde unabhängig ihres Alters zwischen verlust- und wiederherstellungsorientierten Alltagserfahrungen oszillieren. Damit ist gemeint, dass es Zeiten gibt, in denen sich Trauernde zu einem bestimmten Zeitpunkt X vordergründig mit ihrem Verlust auseinandersetzen (z. B. „Den Weihnachtsbaum hat immer meine Mutter ge|20|schmückt, jetzt ist sie tot und kann den Baum nie wieder schmücken“) oder vordergründig mit der Wiederherstellung ihres Alltags (z. B. „Wer schmückt den Baum denn jetzt? Können wir eine neue Tradition einführen?“). In Abhängigkeit der aktuellen Verfassung der Klient*innen muss auch die psychologische Fachperson flexibel auf diese eingehen können. Daher wird das vorliegende Handbuch, das großen Handlungsspielraum für seine Anwendung lässt und ausgeprägte Flexibilität aufweist, der psychologischen Realität der Klient*innen eher gerecht als ein hochstrukturiertes Manual, das durchgearbeitet wird.
Einige Inhalte wiederholen sich verschiedentlich, jedoch in unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel werden in Kapitel 1 entwicklungsspezifische Empfehlungen für die Psychoedukation gegeben, teilweise wiederholen sich diese in Kapitel 4.4 oder auch in den Interventionen. Jedes Mal ist der Blickwinkel jedoch ein anderer. Hier wird es der psychologischen Fachperson überlassen, sich die jeweils relevanten Informationen aus den Kapiteln für den individuellen Begleitungskontext auszuwählen.
Todesursachen nach Alter in der Schweiz (2017). Neben Eltern und Angehörigen stellen auch weitere Bezugspersonen wie Erzieher*innen oder Lehrer*innen Beratungsanfragen, um sich darüber zu informieren, wie sie als „Familienexterne“ das betroffene Kind bzw. die betroffene Familie unterstützen können. Dabei ist es für Psycholog*innen wichtig zu wissen, in welchem Alter und aufgrund welcher Todesursachen die Menschen in der Schweiz aktuell am Häufigsten sterben. Die untersuchten Zahlen stammen aus der Todesursachenstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) der Schweiz aus dem Jahr 2017 und wurden mit den Daten der vorangehenden Jahre abgeglichen. Es gibt geringfügige Schwankungen, aber die Zahlen sind relativ konstant.
Im Erwachsenenalter wurde die Altersspanne bis 64 Jahren analysiert, weil angenommen wird, dass bis zum Alter von 64 Jahren in der Regel eigene Kinder volljährig sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bevölkerungsgesundheit und die gesundheitliche Versorgung in Deutschland, Österreich und Schweiz weitgehend ähnliche Bedingungen aufweisen. Zur Erklärung der häufigsten Todesursachen werden einige Beispiele angeführt. Die Kodierungen entsprechen der ICD-10 der WHO, Version von 2016 (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), 2015):
Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode, z. B. Unreife, Schädigung des Fötus’ durch mütterliche Faktoren
Unfälle: Eingeschlossene Unfallarten: Verkehrsunfälle, Stürze, Ertrinken, elektrischer Strom, Rauch/Feuer/Flammen, unfallmäßige Vergiftung ohne psychotrope Substanzen
Angeborene Missbildung, z. B. Anenzephalus (teilweises oder vollständiges Fehlen des Großhirns und der Schädelkalotte), Hydrozephalus („Wasserkopf“), Spina Bifida (Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks), Missbildungen des Kreislaufsystems, des Nervensystems etc.
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, vor allem unbekannte Todesursache
Abbildung 1 zeigt, dass die größte Anzahl von Kindern unter der Geburt bis zum ersten Geburtstag infolge von perinatalen Todesursachen oder an den Folgen von angeborenen Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien stirbt. Das bedeutet für Kinder- und Jugendpsycholog*innen, dass Eltern und überlebende Geschwister weitaus häufiger mit Säuglingstodesfällen konfrontiert sind als mit dem Tod von älteren Kindern.
Krebs und Unfälle stellen im Verlauf der Kindheit die häufigsten Todesursachen dar. Die jüngsten Kinder, die sich selbst töteten, waren im Alter von 10 bis 14 Jahren (im Jahr 2017 ausschließlich Mädchen). Ab dem Alter |21|von 15 Jahren starben in der Schweiz die meisten Jugendlichen aufgrund von Suizid, dicht gefolgt von Unfällen. Das Bundesamt für Statistik (2017) gibt noch folgende Zahlen an:
Jedes Jahr begehen in der Schweiz etwa 1000 Menschen Suizid, etwa 30 davon fallen in die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre. Das bedeutet, dass sich etwa alle 12 Tage ein Kind oder ein Jugendlicher in der Schweiz selbst tötet. Diese Zahlen sind seit einigen Jahren stabil. (o. S.)
Abbildung 1: Anzahl Todesfälle in der Schweiz bei Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Alter (0 bis 24 Jahre) und die häufigsten Todesursachen im Jahr 2017. Quelle: Bundesamt für Statistik, 2017.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Fachbuchs gibt es noch keine veröffentlichten wissenschaftlichen Studien, die den Einfluss der Coronakrise auf die Anzahl von Kinder- und Jugendsuiziden belegen. Jedoch geht Landolt (2021), leitender Psychologe am Zürcher Universitäts-Kinderspital, davon aus, dass sich die Anzahl der Einweisungen in seinem Spital von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Suizidversuchen im Jahr 2020 gegenüber 2019 mehr als verdoppelt hat. In den Monaten Januar bis April 2021 wurden etwa gleich viele Suizidversuche verzeichnet wie im ganzen Jahr 2019 (2019: 22 Suizidversuche; 2020: 49 Suizidversuche; Januar bis Mitte April 2021: 21 Suizidversuche). Es seien überwiegend junge Mädchen, die infolge von Suizidversuchen vorstellig würden. Landholt (2021), leitender Psychologe am Zürcher Universitäts-Kinderspital, sagt in einem Interview:
Die Gründe für Suizidversuche haben sich gegenüber früher nicht verändert. Doch die Pandemie hat die Faktoren, die zum Selbstmord führen, verstärkt: Zum Beispiel die Einsamkeit, die Traurigkeit und die Ängste vor der Zukunft. Zudem ist es so, dass diese Suizidversuche bloß die Spitze des Eisberges darstellen. Darunter liegen weitverbreitete Depressionen und Ängste. (o. S.)
Di Gallo (2021), Chefarzt der kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes in Basel, beobachtet ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Anzahl von Patient*innen um ca. 40 % seit September 2020, die Lage an allen anderen Schweizer Universitätsspitälern (Bern, Lausanne, Zürich und Genf) sei vergleichbar. Der Verein für Angehörige um Suizid (AGUS e. V., o. J.) schreibt auf seiner Internetseite:
|22|Die Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) geht davon aus, dass jeder Suizidtote 5–7 Angehörige hinterlässt. […]
Unberücksichtigt bleiben dabei Personen mit mehr Distanz zum Verstorbenen, wie z. B. Schulklassen, Arbeitskollegen, Vereinsfreunde, Nachbarn und andere Gruppen. Auch sie sind fassungslos, hilflos und trauern. […]
Bei der (geschätzten) Zahl von 60 – 80 000 Suizidbetroffenen jährlich in Deutschland ist zu berücksichtigen, dass sich diese Zahl nur auf EIN Jahr bezieht. Die Trauer nach der Selbsttötung eines nahestehenden Menschen ist aber oft über viele Jahre hinweg ein lebensbestimmendes Thema. (o. S.)
In der Schweiz war 2017 der Suizid bis zum Alter von 34 Jahren die häufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Suizid bleibt eine über alle Altersstufen des Erwachsenenalters konstant präsente Todesursache, wobei die höchste Anzahl von Suizident*innen im Alter von 50 bis 59 Jahren zu verzeichnen war (Bundesamt für Statistik, 2017).
Im Alter von 15 bis 29 Jahren starben die Menschen nach der häufigsten Todesursache Suizid am zweithäufigsten aufgrund von Unfällen. Der Anteil der Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen steigt mit zunehmendem Alter kontinuierlich an, ab dem Alter von 35 Jahren bis zum untersuchten Alter von 64 Jahren war Krebs die Haupttodesursache. Die Anzahl der Todesfälle infolge von Erkrankungen des Kreislaufsystems nahm im jungen Erwachsenenalter kontinuierlich zu, diese bildeten ab dem Alter von 40 Jahren nach Krebs die zweithäufigste Todesursache (Bundesamt für Statistik, 2017).
Suizid und Suizidalität werden in dieser Publikation ebenfalls behandelt. Zum einen werden in Kapitel 4 Anregungen für die Begleitung von trauernden Kindern und Jugendlichen nach einem Suizid in der Kernfamilie gegeben. Zum anderen kann Suizidalität auch bei trauernden Kindern und Jugendlichen ein Thema sein. Ziel des betreffenden Unterkapitels ist, das nötige Grundwissen und geeignete Methoden für das Coachen von trauernden Kindern und Jugendlichen in ihrem Suizidalitätsmanagement zu vermitteln.
In diesem Buch gehe ich nicht auf weitere gewaltsame Todeskontexte wie Mord ein, da diese meines Erachtens in den Kompetenzbereich der Psychologischen Ersten Hilfe (PEH) und bei der späteren Verarbeitung in den Kompetenzbereich der Psychotherapie fällt und nicht in den der psychologischen Begleitung (bzw. Beratung).
Kinder- und jugendpsychologische Anwendungskontexte. Der explizite Anwendungskontext dieses Fachbuchs ist die psychologische Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Einzel- und im Familiensetting. Die Interventionen eignen sich in der Regel für die Einzel- und Familienbegleitung, können aber für verwandte Kontexte abgewandelt angewendet werden. Ein weiterer wichtiger Teil ist das Kurzcoaching von erwachsenen Bezugspersonen (z. B. Eltern, Erzieher*innen/Lehrpersonen, Pat*innen, Großeltern, Nachbar*innen), die oft Beratungsbedarf in Bezug auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben. Dies ist meist umso häufiger der Fall, je jünger die Kinder sind. In Kapitel 3.4 werden verschiedene Hilfestellungen angegeben, damit auch die Bezugspersonen hilfreich unterstützen können und gleichzeitig darüber im Bilde sind, welche oft gut gemeinten Aussagen oder Handlungen sich kontraproduktiv auswirken können. Auf entsprechende Literatur wird im Anhang D hingewiesen. Es wird nicht auf die Konzeption und Durchführung von Trauergruppen eingegangen, da es hierfür bereits geeignete Literatur auf dem Markt gibt (siehe ebenfalls Anhang D).
Aufträgen im schulpsychologischen Setting ist kein explizites Kapitel gewidmet, jedoch können viele der Interventionen auch im schulpsychologischen Kontext, gegebenenfalls in abgewandelter Form, angewandt werden (z. B. für die Psychoedukation von Kindern). Da die Bildungseinrichtungen in der Regel bei ei|23|nem Todesfall in der Kernfamilie von dieser informiert werden und diese mit den betroffenen Kindern/Familien einerseits und den anderen Kindern mit ihren Eltern andererseits kommunizieren, ist eine Abstimmung zwischen der Familie und der Bildungseinrichtung sinnvoll. Ist eine schul- oder kinder-/jugendpsychologische Fachperson involviert, kann sie bei der Auftragsklärung die Koordination zwischen Bildungseinrichtung und Familie ansprechen und gegebenenfalls übernehmen, siehe dazu Anhang C1: Merkblatt „Telefonischer Erstkontakt mit Familie“ und C2: „Ausführlicheres Anamneseblatt (ergänzend zu C1)“. Da auch Erzieher*innen/Lehrpersonen oft viele Fragen zum Umgang mit den betroffenen Familien bzw. dem betroffenen Kind in der eigenen Klasse hinsichtlich der Kommunikation haben, bietet sich, wie oben bereits gesagt, ein Kurzcoaching von Erzieher*innen/Lehrpersonen an (siehe Kapitel 3.4). Hinweise zum Umgang mit Mobbing werden in Kapitel 3.4.7 gegeben. Weiterhin befinden sich im Anhang C Muster-Elternbriefe (C4: Musterbrief „Unfall“, C5: Musterbrief „Tod eines Schülers/Suizid“, C6: Musterbrief „Familiendrama“), ein möglicher Ablauf einer schulpsychologischen Intervention nach einem Todesfall eines Schülers oder einer Lehrperson (C7) und eine Checkliste für telefonische Anfragen in der Psychologischen Ersten Hilfe (PEH) (C8). An dieser Stelle sei auch auf die Publikationen von Witt-Loers (2012, 2014, 2016) hingewiesen. Sie hat einige sehr hilfreiche Bücher, auch für den schulischen Kontext verfasst, mit vielen Materialien und Vorschlägen. Im Buch „Trauernde Jugendliche in der Schule“ befinden sich auch sehr gute Musterbriefe, die über den rein informativen Inhalt hinausgehen und sehr einfühlsam verfasst sind. Außerdem möchte ich auf die kostenlose Broschüre „Suizidalität im Jugendalter – Leitfaden für Schulen“ (Niklaus, 2020) hinweisen, die von der Suizidprävention Zürich herausgegeben wurde.
Eine Anwendung im klinischen Kontext ist ebenfalls denkbar. Die (pädiatrische) Psychoonkologie sollte zunächst ein expliziter Teil dieses Fachbuchs werden. Jedoch habe ich mich aus Gründen des Textumfangs dagegen entschieden. Außerdem ist die Quintessenz aus zwei Interviews mit erfahrenen Psychoonkologinnen, dass die wichtigsten Punkte in der Begleitung die Flexibilität, das einfache „Da-Sein“ sowie die Unterstützung bei organisatorischen Aspekten im Alltag sind. Da dieses Handbuch diese Aspekte berücksichtigt, kann es auch in der Psychoonkologie seine Anwendung finden.
Inhaltliche Grundlage. Dieses Fachbuch basiert auf Interviews und fachlichem Austausch mit Kinderpsychoonkolog*innen, Erziehungsberater*innen-Schulpsycholog*innen, Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen sowie mit professionellen Trauerbegleiter*innen. Es gründet des Weiteren auf ausführlicher Recherche in Literatur und Statistiken des Bundesamts für Statistik (BFS) der Schweiz mit den aktuellsten Zahlen aus dem Jahre 2017 und auf Inhalten von besuchten fachspezifischen Weiterbildungen.
Geschlechtsneutrale Formulierung. Ich habe mich bemüht, dieses Buch geschlechtsneutral zu verfassen. Wo die Lesbarkeit stark beeinträchtigt würde, habe ich die männliche Form gewählt. In diesem Fall sind beide Geschlechter gemeint.
Der Begriff „Freitod“ sollte von Fachpersonen nicht mehr verwendet werden, da er einem Suizid einen glorifizierenden Charakter angedeihen lassen kann. Siehe auch Kapitel 4.1.3 unter „Hinweise“.
|25|Einleitung: Pathologisierung der Trauer?
Begriffsklärung. Seit einigen Jahren besteht neben der Uneinigkeit über die Definition einer Trauerstörung auch eine große Uneinigkeit darüber, wann eine Trauerreaktion als pathologisch eingestuft werden soll. Folgende Begriffe tauchten im bisherigen Fachdiskurs auf:
pathologische Trauer (Horowitz, Bonanno & Holen, 1993)
komplizierte Trauer (Prigerson et al., 1995)
traumatische Trauer (Prigerson et al., 1997)
prolongierte Trauer (z. B. Jordan & Litz, 2014)
anhaltende Trauerstörung (aktuellster Begriff im deutschsprachigen Raum, angelehnt an den gleichnamigen Diagnosebegriff im ICD-11)
Infolge der Weiterentwicklungen diagnostischer Manuale wie dem DSM und dem ICD wurde eine Pathologisierung von Trauer in Fachkreisen stark diskutiert. Insbesondere stellt sich die Frage, ab welcher Dauer eine Trauerreaktion als pathologisch eingeordnet werden kann oder soll. Eine Übersicht über den Forschungsstand zum Thema Trauer als psychische Erkrankung in Abgrenzung zu normalen Trauerreaktionen gibt Wagner (2016). Im Folgenden werden die für dieses Kapitel als die am relevantesten erachteten Punkte aus der genannten Publikation kurz skizziert.
Einordnung von Trauerreaktionen im DSM und ICD. Im DSM-III war Trauer Ausschlusskriterium bei der Depression; eine Diagnose „Depression“ konnte nicht gegeben werden, wenn die Symptome durch Trauer erklärt werden konnten. In den Revisionen DSM-III-R und DSM-IV wurde das Ausschlusskriterium ausgeweitet: Die Depression konnte auch dann diagnostiziert werden, wenn die Trauersymptomatik länger als 2 Monate vorlag. Im DSM-5 wurde das Ausschlusskriterium der Trauer aufgehoben, aber anstelle einer eigenen Diagnose für Trauer, wurde das Zeitkriterium bei der Vergabe einer depressiven Episode angepasst: Waren es im DSM-IV noch 2 Monate, kann Trauernden bereits nach 2 Wochen die Diagnose einer depressiven Episode gegeben werden.
Weiter wurde die Forschungsdiagnose „Störung durch eine anhaltende komplexe Trauerreaktion“ in das Kapitel „Klinische Erscheinungsbilder mit weiterem Forschungsbedarf“ des Appendizes des DSM-5 aufgenommen. Auffällig ist, dass das Zeitkriterium für Erwachsene mindestens 12 Monate umfasst, während dies bei Kindern mindestens 6 Monate sind (Tabelle 1).
|26|Tabelle 1: Diagnose im DSM-5
Diagnosekriterien der Störung durch eine anhaltende komplexe Trauerreaktion
A
Die Person ist vom Tod eines Menschen, zu dem eine enge Beziehung bestanden hat, betroffen.
B
Seit dem Todesfall tritt an mehr als der Hälfte der Tage mindestens eines der folgenden Symptome in klinisch bedeutsamer Ausprägung auf. Es besteht bei hinterbliebenen Erwachsenen für mindestens 12 Monate und bei hinterbliebenen Kindern für mindestens 6 Monate fort:
1)Fortbestehende Sehnsucht/Verlangen nach dem Verstorbenen. Bei jüngeren Kindern kann die Sehnsucht durch Spiel und Verhaltensweisen ausgedrückt werden, die das Getrennt- und Wiedervereintsein mit einer Betreuungs- oder Bezugsperson widerspiegeln.
2)Intensive Sorge und emotionaler Schmerz als Reaktion auf den Todesfall.
3)Gedankliches Verhaftetsein mit dem/der Verstorbenen.
4)Übermäßige Beschäftigung mit den Umständen des Todesfalles. Bei Kindern kann die übermäßige Beschäftigung mit dem Verstorbenen durch Themen im Spiel und im Verhalten ausgedrückt werden und sich auf einen möglichen Tod anderer Personen aus dem nahen Umfeld ausweiten.
C
Seit dem Todesfall treten an mehr als der Hälfte der Tage mindestens sechs der folgenden Symptome in klinisch bedeutsamem Ausmaß auf und besteht bei hinterbliebenen Erwachsenen für mindestens 12 Monate und bei hinterbliebenen Kindern für mindestens 6 Monate fort:
Durch einen Todesfall hervorgerufene Belastung
1)Beträchtliche Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren. Bei Kindern ist dies abhängig von ihrem kognitiven Vermögen, die Bedeutung und Endgültigkeit des Todes zu verstehen.
2)Unglaube oder emotionale Taubheit über den Verlust.
3)Schwierigkeiten, positive Erinnerungen an den Verstorbenen zuzulassen.
4)Bitterkeit oder Ärger über den Verlust.
5)Dysfunktionale Bewertungen der eigenen Person in Bezug auf den Verstorbenen oder seinen Tod (z. B. Selbstvorwürfe).
6)Übermäßiges Vermeiden von Erinnerungen an den Verlust (z. B. Vermeidung von Personen, Plätzen oder Situationen, die mit dem Verstorbenen verbunden werden; bei Kindern kann dies beinhalten, dass sie Gedanken und Gefühle in Bezug auf den Verstorbenen vermeiden).
Soziale und Identitätsprobleme
7)Der Wunsch zu sterben, um bei dem Verstorbenen zu sein.
8)Schwierigkeiten, anderen Personen seit dem Todesfall zu vertrauen.
9)Sich seit dem Todesfall einsam oder von anderen Personen abgetrennt fühlen.
10)Das Gefühl, dass das Leben ohne den Verstorbenen sinnlos und leer ist, oder der Glaube, dass man nicht mehr ohne den Verstorbenen funktionieren kann.
11)Verunsicherung über die eigene Rolle im Leben oder eine verminderte Wahrnehmung der eigenen Identität (z. B. das Gefühl, dass ein Teil von einem selbst mit dem Verstorbenen gestorben ist).
12)Schwierigkeiten oder Widerwillen, seit dem Verlust Interessen zu verfolgen oder Zukunftspläne zu entwickeln (z. B. Freundschaften, Aktivitäten).
|27|D
Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
E
Die Trauerreaktion ist unverhältnismäßig oder nicht kongruent mit kulturellen, religiösen oder altersentsprechenden Normen.
Bestimme ob: Mit traumatischer Trauerreaktion:
Die Trauerreaktion folgt auf einen Mord oder Suizid und umfasst ein andauerndes und belastendes gedankliches Verhaftetsein mit den traumatischen Umständen des Todesfalls; dazu gehören die letzten Momente des Verstorbenen, der Leidensgrad, verstümmelnde Verletzungen oder die mutwilligen oder vorsätzlichen Umstände des Todesfalls. Das gedankliche Verhaftetsein wird häufig durch Erinnerungsreize hervorgerufen.
Quelle: American Psychiatric Association (APA). (2018). Abdruck erfolgt mit Genehmigung vom Hogrefe Verlag Göttingen aus dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).© 2013 American Psychiatric Association, dt. Version © 2015 und 2018 Hogrefe Verlag.
Weitere wichtige Punkte der Forschungsdiagnose in Bezug auf Kinder und Jugendliche (American Psychiatric Association, 2018) sind:
Die Diagnose kann ab dem Alter von 12 Monaten gegeben werden.
Junge Kinder können den Verlust einer primären Bezugsperson durch die desorganisierenden Effekte, die die Abwesenheit der Bezugsperson auf die Bewältigungsstrategien hat, als traumatisch erfahren.
Bei Kindern kann das Leiden im Spiel und durch Verhalten ausgedrückt werden und zu Entwicklungsverzögerungen, Ängstlichkeit oder protestierenden Verhaltensweisen zu Zeitpunkten von Trennung oder Wiedervereinigung führen.
Eine Trennungsangst kann insbesondere bei jüngeren Kindern auftreten, eine soziale und Identitätsbeeinträchtigung und das Risiko einer komorbiden Depression können sich besonders bei älteren Kindern und Jugendlichen manifestieren.
Es besteht ein erhöhtes Risiko für eine Störungsentwicklung bei starker Abhängigkeit von der verstorbenen Person vor dem Tod oder bei dem Tod eines Kindes.
Schwierigkeiten bei der folgenden Unterstützung durch Betreuungspersonen erhöhen das Risiko einer Störungsentwicklung bei trauernden Kindern und Jugendlichen.
Trauerreaktionen als Störung im ICD. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Publikation war noch das ICD-10 in Kraft. Nachfolgend wird kurz skizziert, wie bisher anhand dessen kodiert wurde, anschliessend werden die Kriterien im ICD-11 (Status quo zum Zeitpunkt der Manuskriptabgabe) beschrieben. Nach Wagner (2016) werden im ICD-10 als pathologisch eingeordnete Trauerreaktionen meist unter Anpassungsstörungen (F43.28) kodiert. In diese Kategorie werden Trauerfälle implizit miteingeschlossen. Wagner erklärt weiter, dass mit der Z-Kodierung (d. h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen [Z00–Z99]. Z-Kodierungen stellen keine spezifischen Diagnosen dar. „Z“ steht für „Zustand nach“.) diejenigen Fälle berücksichtigt werden, in denen Probleme und Schwierigkeiten des Patienten gegeben sind (z. B. durch Trauerfälle) und den Gesundheitszustand negativ beeinflussen. Ferner habe die ICD-10 mit der Kodierung „Z63.4 Verschwinden oder Tod eines Familienangehörigen, vermuteter Tod eines Familienangehörigen“ eine Möglichkeit der Klassifizierung geschaffen, die allerdings keinen Krankheitswert im Sinne einer psychischen Störung darstelle. Im Vergleich zur Forschungsdiagnose im DSM-5 kann die Diagnose „anhaltende Trauerstörung“ bei Erwachsenen laut ICD-11 nach 6 Monaten gegeben werden, während im DSM das Zeitkriterium mindestens 12 Monate bei Erwachsenen und mindestens 6 Monate bei Kindern umfasst. Nachfolgend werden in Tabelle 2 die Diagnosekriterien der anhaltenden Trauerstörung im ICD-11 beschrieben (Stand 24.6.2021).
Kritik am Störungsbegriff bei Trauerreaktionen. Die Problematik der Diagnose von trauerspezifischen Störungen zeigt sich in der Pathologisierung einer normalen Reaktion nach dem Tod von Nahestehenden, im Zeitaspekt wie auch in der Methode, mit der die Trauerstörung erfasst wurde.
|28|Tabelle 2: Diagnose im ICD-11
Diagnosekriterien der anhaltenden Trauerstörung bzw. prolonged grief disorder 6B42
A
Ereignis: Trauerfall (Verlust eines Partners, Elternteils, Kindes oder einer anderen nahestehenden Person)
B
Anhaltende und durchdringende Trauerreaktion charakterisiert durch: Sehnsucht nach dem Verstorbenen oder anhaltende Beschäftigung mit dem Verstorbenen
C
Symptome aus B werden begleitet von intensivem emotionalem Schmerz, z. B.:
Traurigkeit
Schuldgefühle
Ärger
Verleugnung
Schuldzuweisung
Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren
Das Gefühl, einen Teil des eigenen Selbst verloren zu haben
Unfähigkeit positive Stimmung zu erleben
Emotionale Taubheit
Schwierigkeiten, sich auf soziale oder andere Aktivitäten einzulassen
D
Die Trauerreaktion persistiert für eine atypisch langanhaltende Periode (mindestens 6 Monate) und übersteigt die erwartbaren sozialen, kulturellen oder religiösen Normen der Kultur und des Kontextes des Individuums deutlich. Langanhaltende Trauerreaktionen, die in Anbetracht des kulturellen und religiösen Kontextes der Person einer normativen Trauerperiode entsprechen, werden als normale Trauerreaktionen betrachtet und erhalten keine Diagnose
E
Die Einschränkungen verursachen signifikante Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsbezogenen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
Killikelly, C. & Maercker, A. (2017), Übersetzung von Treml, J. & Kersting, A. (2018)
Alle Punkte, die in der Diagnose „anhaltende Trauerstörung“ (ICD-11) bzw. in der Forschungsdiagnose „Anhaltenden komplexe Trauerreaktion“ (DSM-5) als Symptome aufgeführt werden, sind Trauerreaktionen, die als normale Reaktionen angesehen werden können. Der Psychiater Allen Frances (2013) äußerte sich bereits vor einigen Jahren kritisch gegenüber der Verwendung eines Störungsbegriffs im Zusammenhang mit Trauer:
Wenn wir die Trauer pathologisieren, dann nehmen wir dem Schmerz die Würde, kürzen den Trauerprozess ab, der notwendig zur menschlichen Existenz gehört und nehmen den vielfältigen kulturellen Trostritualen ihren Wert und ihre Verlässlichkeit […]. Von einem einheitlichen Trauerprozess kann keine Rede sein, nirgends steht geschrieben, wie man „richtig“ trauert. (S. 267 f.)
Verschiedene Vereine und Berufsgruppen schließen sich seiner Position an: Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband e. V. (DHPV) schlägt anstelle der oben genannten Diagnoseformulierungen den Begriff „Belastungsstörung nach Verlust“ (post-loss stress disorder) vor. Diese Formulierung trage zum einen der Tatsache Rechnung, dass es auch Verlusterfahrungen gibt, die therapeutische Hilfe notwen|29|dig machen. Vor allem aber berücksichtige er die Bemühungen und Erfolge der letzten Jahrzehnte, eine neue Kultur der Trauer zu etablieren (Deutscher Hospiz- und Palliativverband e. V., 2018). Einen detaillierten Überblick über die Skepsis der beteiligten Fachpersonengruppen (Psychotherapie, Psychologie, Begleitung, Medizin und Palliative Care) im deutschsprachigen Raum geben Dietl, Wagner und Fydrich (2018).
Was die Trauer laut der Diagnosen im eigentlichen Sinne pathologisch macht, ist laut der Störungsdefinition vor allem das Zeitkriterium von 6 Monaten (ICD-11) bzw. 12 Monaten für Erwachsene und 6 Monaten für Kinder (Forschungsdiagnose DSM-5). Hinzu kommt, dass das Ausschlusskriterium der Trauerreaktion bei der Depression im DSM-5 aufgehoben wurde, was verschiedene Probleme aufwirft, allen voran jedoch besteht das erhöhte Risiko der Fehldiagnose einer Depression im frühen Trauerverlauf ab 2 Wochen nach dem Todesfall (Fox & Jones, 2013).
Auch H. Znoj (persönl. Mitteilung, 23.06.2017), Professor für klinische Psychologie an der Universität Bern, äußert sich kritisch gegenüber einer Normierung der Trauer im Hinblick auf das Zeitkriterium:
Trauer ist keine normative Angelegenheit. Die Dauer einer Trauerreaktion ist allein genommen kein Kriterium einer komplizierten Trauerreaktion und komplizierte oder anhaltende Trauerreaktionen kommen vor, nicht nur bei Tod, sondern auch bei endgültigen Trennungen. (o. S.)
Wagner (2016) kritisiert weiter, dass die Validierungsstudie, die zeigt, dass nach 6 Monaten die Trauerreaktionen in der Regel abnehmen (Prigerson et al., 2009), viele wichtige Faktoren außer Acht lässt. So umfasste die Population zu 84 % ältere, verwitwete Menschen im Alter von durchschnittlich 62 Jahren. Nach Wagner (2016) wurden in dieser Studie traumatische Todesfälle, jüngere Altersgruppen, der Verlust eines Elternteils oder Geschwisters in der Kindheit oder der Tod eines Kindes nicht berücksichtigt. Laut zahlreicher Studien sind jedoch gerade bei diesen letztgenannten Populationen oder Todesumständen die Trauerreaktionen und -verläufe oft von bedeutend längerer Dauer und Schwere, wie die Auflistung der folgenden Tabelle 3 zeigt.
Birgit Wagner (2016), Professorin an der Medical School in Berlin, fasst die sich daraus erschließende Frage zusammen:
Dies wirft generell die Frage auf, inwieweit eine Diagnose einer anhaltenden Trauerstörung unter Berücksichtigung des Zeitkriteriums zu rechtfertigen ist, wenn die Mehrheit der Betroffenen eine solche Diagnose erhalten würde.
Oder wäre es nicht eher ein Beleg dafür, dass für bestimmte Trauergruppen ein normaler langfristiger Trauerprozess zu erwarten ist, ohne dass dieser pathologisiert werden sollte?
Bei dem derzeitigen Diagnosevorschlag besteht die Gefahr, dass zu viele falsch positive Diagnosen vergeben werden. Dies betrifft insbesondere spezifische Trauergruppen – wie beispielsweise trauernde Eltern, trauernde Geschwister und Trauernde, die traumatische Todesfälle erlebt haben. (S. 254)
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (2017) nimmt zur Einführung der Diagnose einer anhaltenden Trauerstörung in der ICD-11 differenziert Stellung, unter anderem auch in Bezug auf das Zeitkriterium von 6 Monaten und wie dies in der Praxis zu verstehen ist:
Das Zeitkriterium von mindestens sechs Monaten bedeutet nicht, dass jede Trauer, die länger als sechs Monate andauert, als pathologisch einzustufen sei. Sondern, dass diejenigen, die nach 1–2 Jahren eine sehr hohe Belastung aufweisen, frühestens sechs Monate nach dem Tod durch Tests zur Risikoeinschätzung zur Entwicklung einer komplizierten Trauer „herausgefiltert“ werden können. In den ersten sechs Monaten nach einem Todesfall kann also anhand der ge|30|schilderten Symptome nicht differenziert werden, wer langfristig mit einem hohen Risiko für komplizierte Trauer behaftet ist. (S. 2)
Jedoch schließt sich die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin an Wagners (2016) Standpunkt insofern an, als dass es unter anderem intensivere Forschung mit verwaisten Eltern und trauernden Kindern/Geschwistern braucht, um das Zeitkriterium in Hinblick auf seine Allgemeingültigkeit zu überprüfen.
Tabelle 3: Zeitkriterium nach spezifischen Trauerfällen nach Wagner (2016)
Autoren
Trauergruppe
Zeit seit Verlust
Trauerverarbeitung
Lannen, Wolfe, Prigerson, Onelov und Kreicbergs (2008)
Trauernde Eltern
4–9 Jahre
26 % Tod nicht verarbeitet
23 % ein wenig verarbeitet
Dyregrov, Nordanger und Dyregrov (2003)
Trauernde Eltern nach Verlust durch gewaltsame und unerwartete Todesfälle
18 Monate
57–78 % traumatische Trauer
Dijkstra (2000)
Trauernde Eltern
20 Monate
Komplizierte Trauer:
50 % Väter
75 % Mütter
Lin und Lasker (1996)
Trauernde Eltern nach pränatalem Verlust
2 Jahre
59 % chronische Trauer
Melhem, Porta, Shamseddeen, Walker, Payne & Brent (2011)
Trauernde Jugendliche nach Verlust eines Elternteils
12 Monate
3 Jahre
3 % langsame Abnahme der Trauersymptomatik
10 % anhaltende Trauersymptomatik
Bylund-Grenklo, Fürst, Nyberg, Steineck und Kreicbergs (2016)
Trauernde Jugendliche nach Verlust eines Elternteils
6–9 Jahre
49 % unverarbeitete Trauer
Herberman Mash, Fullerton und Ursano (2013)
Trauernde Geschwister
3 Jahre
57 % komplizierte Trauer
Dyregrov, Dyregrov und Kristensen (2014)
Trauernde Geschwister
18 Monate
75 % komplizierte Trauer
Weiter kritisiert Wagner (2016), dass gewisse methodische Aspekte nur begrenzt berücksichtigt wurden. So wurden die diagnostischen Kriterien für die anhaltende Trauerstörung insbesondere durch das Inventory of Complicated grief (Prigerson et al., 1995) erfasst. Shear et al. (2011) weisen jedoch darauf hin, dass die limitierte Zusammenstellung von Symptomen möglicherweise wichtige andere Bereiche nicht miteinbezogen hat (z. B. Todesumstände oder Beziehung zur verstorbenen Person).
Vorteile einer Diagnose „anhaltende Trauerstörung“.Wagner (2019) fasst die Vorteile einer Diagnose „anhaltende Trauerstörung“ wie folgt zusammen:
Frühe Identifizierung von Risikogruppen





























