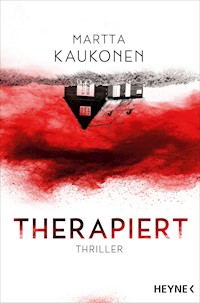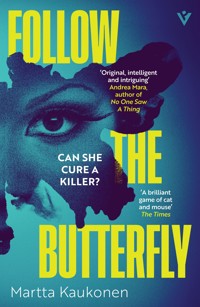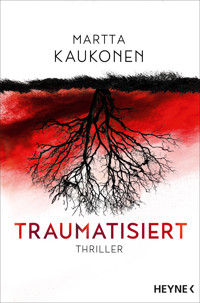
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ira-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller wie ein Kaleidoskop. Mit jeder Wendung ergibt sich ein neues Bild.
Vier Jahre ist es her, dass Ira eine Therapie gemacht hat, um die Dämonen ihrer Jugend hinter sich zu lassen. Inzwischen lebt sie bei ihrem Vater und arbeitet als Reporterin bei einer Zeitung. Kerttu, die Leiterin des Helsinkier Morddezernats steht derweil kurz vor ihrer Pensionierung, als man ihr das Tagebuch eines Mörders übergibt. Es stammt von einem Tatort, an dem ein Mann mit einer Axt erschlagen wurde. Sie muss sich beeilen, denn der Killer plant schon seinen nächsten Mord. Immer wieder sterben in den folgenden Wochen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen: Obdachlose, Drogenabhängige. Niemand hegt einen Verdacht. Außer Kerttu und Ira. Doch weiß Ira womöglich mehr, als sie zugeben will?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
»An jenem Abend war ich nicht ich selbst gewesen. Es waren genau vierzehn Jahre vergangen, seit der Scheißkerl mich entführt hatte. An dem Abend hatte ich an nichts anderes denken können. Nein, ich war an dem Abend wirklich nicht ich selbst gewesen. Und eben deshalb hatte ich etwas getan, was ich andernfalls nie getan hätte. Oder doch? Vielleicht griff ich nur zu Ausreden, um mich ertragen zu können? Ich durfte nicht anfangen, an Blut zu denken. Oder an eine Axt. Schon gar nicht an eine blutige Axt.«
»Tiilihella hatte mir soeben meine Pensionierung verweigert, obwohl sie bereits vor einem Jahr schriftlich vereinbart worden war. Die Polizei hatte es gerade mit einem komplizierten Fall zu tun, den seiner Meinung nach nur ich aufklären konnte, Kerttu Leppänen, Kriminalhauptkommissarin der Mordeinheit, Leiterin des Gewaltdezernats bei der Helsinkier Polizei. Auf der Haut spürte ich das vertraute Prickeln. Ich wollte diesen Fall lösen. Ich konnte ja noch nicht wissen, was mich das kosten würde.«
Zur Autorin
Martta Kaukonen wurde 1976 geboren und lebt in Helsinki, wo sie als Filmkritikerin arbeitet. Ihr Debüt Therapiert schaffte es auf Anhieb auf die SPIEGEL-Bestsellerliste und war für den von Sebastian Fitzek gestifteten Viktor Crime Award nominiert. Die Faszination des Bösen begleitet sie auch im Alltag. Sie liebt Psychothriller, Film noir und verlassene Häuser.
Lieferbare Titel
Therapiert
Traumatsiert
MARTTA
KAUKONEN
TRAUMATISIERT
THRILLER
AUSDEMFINNISCHENVONGABRIELESCHREY-VASARA
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Hengissä erschien erstmals 2023 bei Werner Söderström Ltd. (WSOY), Helsinki.
Das Zitat, das dem Text vorangestellt ist, stammt aus Every Breath You Take von The Police. Musik & Text: Gordon Matthew Sumner. Mit freundlicher Genehmigung © Songs Of Universal, Inc. / Universal/MCA Music Publishing GmbH.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Diese Übersetzung wurde gefördert von
Deutsche Erstausgabe 03/2025
Copyright © 2023 by Martta Kaukonen
German edition published by agreement with Martta Kaukonen and Elina Ahlbäck Literary Agency, Helsinki, Finland.
© 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Frauke Meier
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von Shutterstock.com (Kathie Nichols, Latte Art)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29356-7V001
www.heyne.de
Für J., endlich! Es tut mir leid, wieder kein Spionageroman.
»Every move you make. Every step you take.
I’ll be watching you.«
THEPOLICE
HELSINKI 2023
IRA
Die Klinge der Axt war in die Stirn meines Opfers eingedrungen, als hätte sie endlich ihren Platz in der Welt gefunden. Der hölzerne Griff ragte hoch wie eine überzählige Gliedmaße.
Wie sehr ich diesen Anblick liebte!
Und wie kunstvoll ich ihn geschaffen hatte! Die Axt hatte sich in einem anmutigen Bogen bewegt. Nur ein Schlag, und das Opfer war tot.
Präzise, überlegt, genau!
Meine Morde waren Kunst! Und ich war ihr selbstbewusster Auteur. Mit Kompromissen gab ich mich nicht zufrieden.
Hättet ihr den göttlichen Augenblick doch selbst erleben können! Aber da ihr nicht dabei wart, müsst ihr euch mit meiner Beschreibung begnügen.
Ich hatte im Lauf der Jahre eine unglaublich große Schar von Anzugträgern ins Jenseits befördert. Wenn die Leute erfahren hätten, wie zahlreich meine Opfer waren, hätte es niemand geglaubt. Wie hatte ich so viele Menschen ermorden können, ohne geschnappt zu werden?
Die Männer waren ins Grab gefallen wie Dominosteine. Als wäre es ihr einziger Lebenszweck gewesen, von mir ermordet zu werden.
Vielleicht war es ja so.
Warum werden Mörder nie für ihre Leistungen ausgezeichnet?
Ich stellte mir vor, ich stünde auf dem Siegespodest, natürlich ganz oben. Dort verneigte ich mich vor der jubelnden Menge. Sobald die Fanfaren verstummten, hielte ich eine Rede, dankte mir selbst und nähme die Ovationen entgegen.
Als ich aus dieser Vision in das Schlafzimmer meines Opfers zurückkehrte, merkte ich, dass ich die Designerlampe vom Nachttisch genommen hatte und sie in der Hand hielt wie ein Mikrofon.
Ich stellte die Lampe wieder auf den Nachttisch. Dann hob ich die Hände vor die Augen und spähte zwischen den Fingern hindurch. Wenn man die Axt mit den Fingern verdeckte, bot sich ein friedliches Bild. Das Opfer lag ruhig im Bett. Als hätte ich es von langem Leiden erlöst.
Hätte mein Opfer doch gewusst, welch würdevoller Tod es erwartete. Ich selbst würde wahrscheinlich alt und verwelkt sterben. Es sei denn, ich engagierte einen Auftragskiller, mich zu erledigen.
Wenn ich wenigstens ein Selfie neben meinem Kunstwerk hätte machen können. Ich hätte die Leiche und die Axt so gern verewigt. Aber ich durfte kein Beweismaterial produzieren.
Ich hätte Lust gehabt, meine blutigen Finger auf die erkaltende Stirn zu drücken. Meine Fingerabdrücke zu hinterlassen als Beweis dafür, dass ich den Mord begangen hatte, niemand sonst. Damit keiner den Mord auf seine Kappe nehmen, ihn mir stehlen konnte.
Aber Trödelei konnte ich mir nicht leisten. Ich holte eine Packung Desinfektionstücher aus dem Rucksack, mit denen ich den Fuß der Lampe und die Klinke der Schlafzimmertür abwischte. Sonst hatte ich nichts berührt, und auch diese beiden nur mit Nitrilhandschuhen. Aber man konnte nie sorgfältig genug sein. Indem ich mich an dieses Prinzip hielt, war ich bei meinen Verbrechen nie gefasst worden. Und auch diesmal würde man mich nicht erwischen.
Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Aus dem Dorfbrunnen an der anderen Straßenseite wankte ein betrunkener Mann. Ich hätte in der Kneipe mit Leichtigkeit noch ein zweites Opfer aufgabeln können, wenn ich es gewollt hätte.
Ich eilte in die Diele.
Erst da merkte ich es.
Auf dem Schuhständer, zwischen schmutzigen Stiefeln und ausgelatschten Turnschuhen, lag ein Paar Stöckelschuhe aus rosa Wildleder.
Ich tötete nur allein lebende Männer, aus gutem Grund. Ich wollte nicht beim Schlachten überrascht werden.
War mein Opfer verheiratet gewesen, oder hatte es eine Lebensgefährtin gehabt? Egal, ob Freundin oder Ehefrau – die brennende Frage lautete: Wo versteckte sich das Schätzchen?
Meine ausgelassene Stimmung war auf und davon.
Was, wenn die Partnerin gesehen hatte, wie ich mit dem Opfer in die Wohnung gekommen war? Wenn sie gesehen hatte, dass ich die Axt zur Hand nahm, sich erschreckt und versteckt hatte?
Mir trat der Schweiß auf die Stirn.
Ich hatte noch nie eine Frau getötet.
Und das wollte ich auch jetzt nicht tun.
Aber vielleicht würde ich es nicht vermeiden können.
Versteckte sie sich in der Diele? Hatte sie eine Waffe? Ein Gewehr? Irgendeinen schweren Gegenstand? Einen Kerzenständer aus Messing, ein Erbstück? Eine zehn Kilo schwere Kugelhantel, mit der sie mir die Kniescheiben zertrümmern konnte?
Ich musste sie finden. Vorher konnte ich nicht weggehen. Aber wenn sie doch nicht zu Hause war? Dann musste ich schnellstens verschwinden, bevor sie zurückkam.
In aller Eile holte ich die Axt wieder aus dem Rucksack. Ich hatte die Mordwaffe nicht zurücklassen wollen, damit die Polizei sie nicht untersuchen konnte. Obwohl die Axt so hübsch in die Stirn meines Opfers gepasst hatte.
Ich sah mich um. Mein Blick fiel auf einen antiken Nussbaumschrank, einen von der Sorte, durch die man nach Narnia gelangt.
Ich riss die Schranktür auf. Sie war leichter, als ich dachte, mein kraftvoller Zug warf mich nach hinten. In letzter Sekunde bekam ich den Türrahmen zu fassen und konnte mich auf den Beinen halten.
Ich schob die Ulster und Popelinemäntel beiseite.
Im Schrank war niemand.
Ich ging ins Wohnzimmer.
Ein Chippendale-Sofa mit luxuriösem schwarzem Samtpolster beherrschte den Raum. Es war zu niedrig, um sich darunter zu verstecken. Die pfirsichfarbenen Vorhänge an den Fenstern waren transparent. Das Bücherregal war an der Wand festgedübelt, man konnte sich nicht dahinterzwängen. In diesem Zimmer war niemand.
Als Nächstes war die Küche an der Reihe.
Die Wachstuchdecke mit dem Rosenmuster war so kurz, dass ich nicht unter den Tisch zu spähen brauchte. Im ganzen Raum gab es nur ein einziges mögliches Versteck: die Besenkammer. Dort fand ich jedoch nur einen Staubsauger, einen Mopp und einen Eimer.
Blieb nur noch das Schlafzimmer. Ich umklammerte die Axt mit schweißnasser Hand und schlich über die Schwelle.
Die Frau konnte nicht im Schlafzimmer sein. Hätte sie den Mord an ihrem Mann beobachten können, ohne einen Laut von sich zu geben? Mein Opfer hatte entsetzt aufgeschrien, als es die Axt über seinem Kopf sah.
Trotzdem musste ich das Zimmer durchsuchen.
Vorsichtig griff ich nach der Tagesdecke.
Unter dem Bett war niemand.
Die Gefahr war vorüber. Aber die Frau des Opfers konnte jederzeit auftauchen. Ich holte die Putztücher wieder aus dem Rucksack. In aller Eile trat ich den Rückweg zur Wohnungstür an und wischte dabei hektisch alle Flächen ab, die ich bei der Suche berührt hatte.
Ich lief aus der Wohnung ins Treppenhaus, die Treppe hinunter und zur Haustür hinaus. Dann rannte ich weiter zur Bushaltestelle. Ich musste schleunigst raus aus dem Stadtteil Vallila. Ich stieg in den erstbesten Bus und setzte mich ganz hinten hin. Erst jetzt merkte ich, dass meine Hände zitterten.
Noch nie war ich so nah daran gewesen, erwischt zu werden.
Ich blickte mich um. Der Bus war fast leer. Hinten saß außer mir niemand.
Ich holte ein dickes Heft und einen Kugelschreiber aus der Tasche und begann zu schreiben.
Die Klinge der Axt war in die Stirn meines Opfers eingedrungen, als hätte sie endlich ihren Platz in der Welt gefunden.
ARTO
Ich hatte mich sorgfältig wie ein Berufsverbrecher auf meine Aufgabe vorbereitet. Ich trug eine schwarze Garnitur, damit Ira mich im Dunkeln nicht sofort bemerkte, und Wollsocken, mit denen ich mich so lautlos bewegen konnte wie ein Kaninchen. Die Socken waren ein Weihnachtsgeschenk von meiner alten Tante, die sie im Pflegeheim für mich gestrickt hatte, aber die Garnitur hatte ich eigens für diesen Zweck gekauft.
Ich versuchte, möglichst leise durch den dunklen Flur zu Iras Zimmertür zu schleichen.
Ich gebe zu, dass mein Verhalten sogar mich selbst schaudern ließ.
Wieder einmal – wie schon so oft – musste ich mir versichern, dass mein Tun gerechtfertigt war, dass ich keine andere Möglichkeit hatte. Ich versuchte doch nur, Ira zu schützen, auch wenn ich dabei ihre Privatsphäre verletzte.
An der Flurwand hing ein Spiegel. Ich wich ihm automatisch aus. Ich wollte meine heruntergekommene Erscheinung nicht sehen, geschweige denn an meinen Augen das Gefühl ablesen, das meinen Verfall verursacht hatte. Ich versuchte stets, dieses Gefühl von meinem Bewusstsein fernzuhalten, aber es überrollte mich immer wieder wie die Brandung bei stürmischem Wetter.
Schuld, Schuld, Schuld.
Außer dem Spiegel hing an der Wand nur Marjas und mein Hochzeitsbild. In einem einfachen Holzrahmen. Warum hatte ich es nicht abgenommen?
Unsere Ehe wäre unausweichlich auf die Scheidung zugesteuert, wenn Marja nicht vorher gestorben wäre. Aber das Porträt hatte ich nie angerührt, denn ich dachte, dass Ira vielleicht auch einige gute Erinnerungen an ihre Mutter hatte und sich eventuell wünschte, dass Marja in ihrem Leben weiterhin präsent war, wenigstens auf einem Foto.
Mein Blick fiel auf den verblichenen Farbfleck auf dem Boden.
Marja war an Krebs gestorben, als Ira noch ein Kind war, aber unmittelbar vor ihrem Tod hätte sie beinahe eine wundersame Heilung erlebt, das hatte der Arzt jedenfalls prophezeit. Die Strahlenbehandlung schien zu wirken, und Marja war in so guter Verfassung, dass der Arzt sie aus dem Krankenhaus entlassen wollte.
Ich hatte damals eine Dose Farbe gekauft und stand mit dem Pinsel in der Hand im Flur, um die Wände in Marjas Lieblingsfarbe zu streichen, damit sie sich willkommen fühlte, wenn sie auf das Schlachtfeld unserer Ehezwistigkeiten zurückkehrte.
Da hatte mein Telefon geklingelt.
Marjas Zustand hatte sich dramatisch verschlechtert, und der Arzt sprach nicht mehr davon, dass sie nach Hause käme. Stattdessen sagte er, wenn ich meine Frau noch einmal sehen wolle, müsse ich schnellstens ins Krankenhaus kommen.
Ich rannte zur Garderobe und trat aus Versehen gegen die Farbdose, die ich gerade geöffnet hatte. Die Farbe lief über die Schwelle in Iras Zimmer. Der Fleck erinnerte mich immer an Marjas Tod, aber ich hatte es trotzdem nicht über mich gebracht, ihn zu übermalen. Er sah aus wie ein Veilchenstrauß, und er erinnerte mich nicht nur an Marjas Tod, sondern auch an die Hoffnung, die zwar enttäuscht worden war, aber doch eine Hoffnung.
Der eilige Aufbruch zur Klinik erwies sich als unnötig. Marja siechte noch lange vor sich hin, doch das hatte ich natürlich nicht vorhersehen können.
Vorsichtig griff ich nach der Klinke. Die Tür maunzte wie eine hungrige Katze. Ich hatte die Angeln seit einer Ewigkeit nicht mehr geölt. Mein Leben bestand aus Dingen, die ich hätte erledigen müssen, auf die ich aber keinen Gedanken verschwendete.
Ich lebte in all dem Chaos. Und damit meine ich jetzt nicht das Chaos, das meinen Kopf erobert hatte, sondern die konkreten Aufgaben, um die ich mich hätte kümmern müssen, die ich aber nicht auf die Reihe brachte. Nicht mehr, seit Marja gestorben war.
Ich erstarrte an der Tür. Hatte Ira das Quietschen der Angeln gehört? Da das gleichmäßige Rauschen der Dusche im Bad nicht abbrach, wagte ich es, in das Zimmer zu schlüpfen. Dabei hielt ich den Atem an, als könnte Ira hören, wie die Luft durch meine Lunge strömte.
Nun stand ich in Iras Zimmer, und ihr könnt euch denken, dass ich nicht stolz auf mich war. Aber wie ich schon sagte, ich hatte nur Iras Bestes im Sinn, auch wenn es nicht ganz danach aussah.
Ira lebte wie ein Vampir. Sie hatte die Angewohnheit, die Vorhänge auch tagsüber geschlossen zu halten. Die Sonne stand hoch am Himmel, aber die schwarzen Verdunklungsvorhänge wehrten selbst die hellsten Strahlen ab. Am liebsten hätte ich die Vorhänge zurückgezogen, damit wenigstens ein bisschen Tageslicht hereinfiel, doch das konnte ich natürlich nicht tun, denn es hätte mich verraten.
Das Zimmer war asketisch wie eine Gefängniszelle. Schreibtisch, Stuhl und Bücherregal, die angeschlagenen Möbelstücke aus der engen Einzimmerwohnung, in der Ira gewohnt hatte, bevor wir zusammengezogen waren. Als Nachttisch diente ein schmuddeliger Pappkarton, auf dem die Teetasse Abdrücke hinterlassen hatte. Nicht einmal ein Bett, nur eine Matratze auf dem Boden. Keine Poster, Bilder oder Schmuckgegenstände, die etwas über die Persönlichkeit der Bewohnerin ausgesagt hätten.
Mit einer Ausnahme.
Über der Matratze hing ein Dekobild an der Wand.
Live Love Laugh.
Ich hatte Ira nicht gefragt, wieso sie ausgerechnet auf dieses Bild verfallen war. Aber ich kannte meine Tochter gut genug, um zu wissen, dass ihre Einstellung zu dem Spruch ironisch war.
Live Love Laugh.
An diese Prinzipien hielt Ira sich eher nicht.
In aller Eile führte ich meine Mission durch.
Rasierklingen. Scheren. Messer.
Jeden Morgen, wenn Ira aufstand und unter die Dusche ging, überprüfte ich ihr Zimmer. Ich hatte die Zeit gestoppt und festgestellt, dass sie durchschnittlich sechs bis sieben Minuten lang duschte. Also schaltete ich den Klingelton der Eieruhr leise und stellte sie auf fünf Minuten ein. Während auf der Uhr die Minuten abliefen, durchsuchte ich das Zimmer. Ich schob die Hand unter den dünnen Futon und tastete, ob etwas darunterlag. Ich untersuchte die Schreibtischschubladen, die Ira und ich türkis lackiert hatten, als sie klein war. Ich stieg auf den Stuhl und fuhr mit der Hand über das Bücherregal.
Nichts.
Keine Rasierklingen. Keine Scheren. Keine Messer.
Trotzdem glaubte ich nicht, dass Ira mit dem Ritzen aufgehört hatte.
Oder dass sie ihre Selbstmordgedanken aufgegeben hatte.
Ira und ich hatten vor vier Jahren beschlossen, zusammenzuziehen. Iras ehemalige Therapeutin Clarissa Virtanen und deren Mann Pekka – oder, wie Ira ihn nannte: der Scheißkerl – waren damals verurteilt worden. Der Scheißkerl hatte Ira mit Clarissas Hilfe zum ersten Mal entführt, als sie zehn war, und zum zweiten Mal zehn Jahre später.
Nach alldem hatten Ira und ich uns überlegt, dass wir uns umeinander kümmern sollten. Ich war in die AA-Gruppe gegangen und hatte mit dem Trinken aufgehört, Ira versuchte, mit ihren Traumata fertigzuwerden. Unsere Wohngemeinschaft mochte verwunderlich erscheinen, Ira war ja schon 24, doch das war mir egal.
Die Eieruhr piepste. Ich hörte, wie Ira das Bad verließ und zur Toilette ging. Leise schlich ich zur Klotür und lauschte. Erbrach sie sich etwa? Meine Tochter hatte allmählich begonnen, ihre Essstörung zu überwinden, aber ich glaubte immer noch nicht vorbehaltlos an ihre Genesung.
Während ich das Ohr an die Klotür presste, packten mich wieder entsetzliche Schuldgefühle. Warum konnte ich meiner Tochter nicht vertrauen, obwohl sie doch ihr Bestes tat, um gesund zu werden? Aber noch mehr bedrückte mich der Gedanke, dass ich keineswegs der Einzige war, der an Vertrauensmangel litt.
Ira vertraute mir noch weniger als ich ihr.
Meine Tochter wusste es sicher nicht, aber ich hatte gemerkt, dass sie die Angewohnheit hatte, mein Zimmer zu überprüfen, wenn ich nicht da war. Die Matratze. Den Schreibtisch. Das Bücherregal. Sie suchte an den gleichen Stellen wie ich, wenn ich in ihrem Zimmer schnüffelte. Der Schluss lag nahe, dass Ira wusste, dass ich in ihrem Zimmer das Gleiche tat.
Statt nach Rasierklingen, Scheren und Messern suchte Ira in meinem Zimmer nach Flaschen.
Als Ira die Spülung betätigte, eilte ich in die Küche.
Misstrauisch beäugte sie den Frühstücksbrei, den ich gekocht hatte. Sie löffelte nur ein wenig vom Tellerrand und ließ die Butterflöckchen in der Mitte unberührt. Ich hatte es nicht anders erwartet.
Wir frühstückten schweigend. Unser Arbeitgeber, die Helsinkier Nachrichten – unter Freunden Hena – übernahm die Unterhaltung. Das Papier raschelte, wenn ich umblätterte. In der nächsten Woche würden wir unsere Arbeit bei der Zeitung antreten: ich als Urlaubsvertretung, als »Sommerreporter«, und Ira als Praktikantin. Ich war bestimmt der einzige Sommerreporter in der Geschichte der Zeitung, der eine jahrzehntelange Laufbahn hinter sich hatte.
Wieder einmal überlegte ich, wie es möglich war, einem Menschen so nahe zu sein, ohne irgendeine Verbindung zu ihm zu bekommen. Es kam mir vor, als wären wir zwei Astronauten im Weltall, die von der Existenz des anderen nichts wissen. Ich hätte Ira gern auf die Schulter geklopft und ihr gesagt, wie viel sie mir bedeutete, aber von der Art war unsere Beziehung nicht, nicht mehr, nicht nachdem der Scheißkerl alles verdorben hatte.
Wäre ich fähig gewesen, mich mit den Momenten zu begnügen, die ich mit Ira verbringen durfte – oder sogar glücklich darüber zu sein –, wenn ich gewusst hätte, was wir bald gemeinsam würden durchmachen müssen?
Aber an all das will ich noch nicht denken.
Lasst mich noch bei diesem Moment verweilen: Ira und ich saßen schweigend am Küchentisch, und ich sehnte mich nach ihr.
Und wir ahnten beide nicht, dass das Schicksal unser Leben noch einmal in Stücke reißen sollte.
KERTTU
Der Polizeichef Tiilihella hatte eine strenge Miene aufgesetzt. Daneben starrten mich noch fünf weitere ebenso ernste Gesichter an. Die Farbskala der Porträts von Tiilihellas Vorgängern war trostlos grau und der Stil saftlos realistisch, als hätten die Künstler betonen wollen, dass die Polizeiarbeit freudlose Maloche ist. Die Porträtierten schienen darum zu wetteifern, wer am säuerlichsten dreinblickte. Aber keiner von ihnen wirkte so abweisend wie Tiilihella, der mir gegenübersaß.
Nicht einmal mein Vater auf seinem Gemälde.
Meinen Vater und mich verbanden nur zwei Dinge: der Nachname und der Beruf. Meine Eltern hatten es für selbstverständlich gehalten, dass auch ich Polizistin würde. Nur um sie zu ärgern, hatte ich in meiner Jugend eine Ausbildung zur Friseurin angefangen. Erst nachdem ich einer Übungskundin beinahe ein Ohr abgeschnitten hätte, hatte ich mir eingestanden, dass mir nichts anderes übrig blieb, als in die Fußstapfen meines Vaters zu treten.
Tiilihellas Miene schloss jeden Zweifel aus. Ich erwartete beinahe, dass er sagte: »Entweder du nimmst es hin, oder du weinst erst und nimmst es dann hin.« Aber das hatte er nicht nötig. Tiilihellas »Nein« bedeutete Nein, und damit musste ich mich abfinden. Ich wusste, dass es aussichtslos war, mit ihm zu verhandeln.
Trotzdem versuchte ich es.
Das heißt, eigentlich bettelte ich. So hörte sich mein Erguss sogar in meinen Ohren an.
Tiilihella unterstrich seine Aussage, indem er mit der Faust auf den Tisch schlug. Für mich sah es so aus, als hätten die Schläge auf der Tischplatte seines Kommandozentrums – eines antiken Eichenholztisches – eine Vertiefung in Form seiner Faust hinterlassen. Ich war ganz offensichtlich nicht die Einzige, die sein Nein nicht auf Anhieb akzeptiert hatte. Wir Polizeikräfte pflegen dickköpfig zu sein.
Tiilihellas Blick suchte auf dem Tisch nach etwas und fand es schließlich. Er hielt mir die Zigarettenschachtel hin. Anscheinend hatte er vergessen, dass ich das Rauchen vorläufig aufgegeben hatte. Als ich den Kopf schüttelte, nahm er sich eine Zigarette, zündete sie an und saugte hingebungsvoll daran. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, griff nach der Schachtel, die er achtlos auf den Tisch gelegt hatte, holte eine Zigarette heraus und bat Tiilihella um Feuer.
Ich suchte beim Fenster Zuflucht. Die Wolken kreuzten frei am hellblauen Himmel. Ich malte mir aus, wie ich auf das Dach des Polizeigebäudes in Pasila klettern und auf eine Wolke steigen würde. Ich würde Pasila hinter mir lassen, würde alle ungeklärten Fälle hinter mir lassen. Tiilihella würde mich vom Fenster aus sehen und hilflos hinter mir herrufen. Ich würde ihm zuwinken, ein Stück von der Wolke abreißen und mir den nach Zuckerwatte schmeckenden Flaum auf der Zunge zergehen lassen.
Tiilihella hatte mich vor einer Viertelstunde in der kargen Kantine aufgestöbert, wo es an diesem Vormittag Brühwurstsuppe gab. Ich hatte in stolzer Einsamkeit – wie es meine Art war – am Tisch gesessen, Suppe gelöffelt und ein Kreuzworträtsel ausgefüllt.
Ich war gerade dabei, eine Fünf-Buchstaben-Aufgabe zu lösen: Nobel-Pasternak. Literatur war nicht meine stärkste Seite, aber Boris ist ein geläufiger Name in Kreuzworträtseln. Man behauptet, das Ausfüllen von Kreuzworträtseln würde Demenzerkrankungen verhindern, aber ich bin anderer Meinung. Wieso soll es hilfreich sein, wieder und wieder dieselben Wörter in die Felder zu schreiben?
Tiilihella war an meinen Tisch geeilt und hatte mich gebeten, nach dem Essen in sein Dienstzimmer zu kommen, und hier litt ich nun. Ich dachte wieder einmal, dass mein Vorgesetzter ein hervorragendes psychologisches Gespür hatte. Der Sessel, auf dem ich saß, verwies jeden Besucher sofort auf seinen Platz, denn er war erheblich niedriger als Tiilihellas Stuhl. Ich fühlte mich wie eine kleine Göre im Büro des Rektors. Ich hatte schon gesehen, wie Männer, die größer waren als ich, auf diesem Sessel hockten, die Knie in Ohrenhöhe, während Tiilihella sie von oben herab musterte, den Mund zu einem harten Strich zusammengepresst. Er hatte wahrhaftig seine Tricks.
Aber ich würde nicht klein beigeben.
Neben Tiilihellas Schreibtisch stand eine Kommode, auf der sich gerahmte Fotos reihten. Außer seiner Frau posierten darauf Kinder und Enkelkinder. Sein Nachwuchs war so zahlreich, dass man hätte glauben können, Tiilihella wäre Mitglied einer Sekte, in der Verhütung verboten war.
Auf meiner Kommode gab es kein einziges Bild. Ich war allen dankbar, die sich mehrten und die Erde füllten, denn ich hatte meine staatsbürgerliche Pflicht im unter Bevölkerungsschwund leidenden Finnland nicht erfüllt.
Tiilihella fing an, in sein Notizbuch zu schreiben, als Zeichen, dass das Thema erledigt war und ich gehen sollte.
Dennoch rührte ich mich nicht vom Fleck.
Ich wandte nur den Kopf, um das Bild über der Kommode zu bewundern, das ich für Tiilihella zu seinem fünfzigsten Geburtstag gemalt hatte. Es zeigte das Sommerhaus meines Chefs, in das er und seine Frau Arja mich jedes Jahr zum Mittsommerfest einluden. Auf dem Bild lag Tiilihella selig lächelnd in der Hängematte und las einen Krimi. Es war das erste Gemälde, das ich verschenkt hatte. Ich war immer noch stolz auf mein Werk, obwohl ich inzwischen so viel dazugelernt hatte, dass ich Tiilihellas Knopfaugen heute einen noch helleren Glanz geben könnte.
Tiilihella blickte von seinem Notizbuch auf und schien überrascht, weil ich immer noch vor ihm saß. Als er begriff, dass ich nicht die Absicht hatte, aufzugeben, seufzte er.
»Leppänen, es bleibt bei der Entscheidung.«
Sein Telefon klingelte. Ich musste an den alten Trick bei einem Blind Date denken. Bitte eine Freundin, dich eine halbe Stunde nach dem Beginn des Treffens anzurufen. Wenn das Treffen sich bis dahin als katastrophal erwiesen hat, behauptest du, die Anruferin stecke in Schwierigkeiten, und du müsstest sofort los, um ihr zu helfen. Tiilihella sah so erleichtert aus, als er zum Telefon griff, dass ich vermutete, er hatte genau diesen Kniff angewandt.
Er tat, als hätte er nicht gemerkt, wie wütend ich über seine Entscheidung war.
Um meine Wut zu zügeln, nahm ich Zuflucht zu meiner Fantasieübung. Ich lag an meinem Schutzort im weißen Sand und lauschte den Wellen des türkisfarbenen Meeres, die ans Ufer plätscherten. Das Landschaftsklischee aus der Tourismuswerbung erfüllte seine Aufgabe, und ich beruhigte mich ein wenig.
Aber nur ein wenig.
Während ich aufsprang, rief ich:
»Du machst einen Fehler!«
Hätte ich doch da schon gewusst, wer für diesen Fehler würde büßen müssen.
Nicht Tiilihella.
Sondern ich selbst.
IRA
Als ich hörte, dass mein Vater die Wohnungstür schloss, stürmte ich in sein Zimmer.
Ich griff nach dem Deckel der alten Reisetruhe meines Großvaters. Darauf war mit einem dünnen Pinsel kunstvoll eine Meerjungfrau gemalt. Der seetanggrüne Schwanz der Kreatur schien zu zucken, als hätte ihn ein Stromschlag getroffen. Im Garten vor Clarissas Praxis hatte eine hölzerne Nachbildung der Statue der Kleinen Meerjungfrau gestanden, die so ähnlich aussah.
Ich hatte unzählige Male das Gleiche geträumt. Im Traum war ich mit der Meerjungfrau auf den Grund eines schlammigen Teiches getaucht und nie mehr an die Oberfläche gelangt.
Später hatte ich gehört, dass der jetzige Besitzer des Hauses, das Clarissa und dem Scheißkerl gehört hatte, die Statue zu Brennholz zerhackt hatte.
Was war wohl aus dem Outfit geworden, das Clarissa beim Prozess getragen hatte? Es hatte eine gespenstische Ähnlichkeit mit dem ikonischen Chanel-Kostüm gehabt, das Jackie trug, als John F. Kennedy erschossen wurde. Nur der rosa Pillbox-Hut und die weißen Handschuhe fehlten. Clarissa hatte ihre Kleidung nicht zufällig gewählt. Sie wollte den Gerichtsreportern signalisieren, dass ihr Ehemann ein unschuldiges Opfer und sie selbst die leidende Ehefrau war.
Aber als Clarissa glaubte, niemand würde es merken, hatte sie meinem Vater zugezwinkert, kokettierend wie Betty Boop.
Dieses Augenzwinkern ließ mir immer noch keine Ruhe.
Unzählige Male hatte ich auf dem Sofa in Clarissas Praxis gesessen und mir eingebildet, sie wolle mir helfen. Stattdessen hatte sie mit dem Scheißkerl meine Entführung geplant.
Ich konnte es immer noch nicht glauben.
Der Deckel der Truhe war schwer wie die Sünde.
Oder eher die Sünden, die, so fürchtete ich, in der Truhe verborgen lagen.
Schon in meiner Kindheit hatte mein Vater alle seine Geheimnisse in der Truhe versteckt.
Mit beiden Händen hob ich den Deckel an. Er schlug gegen die Wand.
Ich warf die zerlöcherten Socken und die verschlissenen Unterhosen auf den Boden. Mein Vater hatte sie schon vor Jahren obenauf gelegt. Er hatte gehofft, bei ihrem Anblick würde ich das Interesse verlieren, falls es mir gelang, den Deckel zu öffnen. Darin hatte er sich getäuscht. Ich hatte die Truhe zum ersten Mal durchwühlt, noch bevor ich im Schulalter war. Dabei hatte ich allerdings eine Enttäuschung erlebt: In der Truhe lagen keine Edelsteine und keine Goldstücke. Damals hatte ich noch nicht begriffen, dass sie viel wertvollere Schätze enthielt.
Ich holte die Porzellankatze aus der Truhe. Mein Großvater hatte sie meiner Großmutter als Andenken an seine Seereise aus Deutschland mitgebracht. Ich hatte mit der Katze gespielt und dabei ihre Oberfläche zerkratzt. Jetzt wäre sie mir beinahe aus den schweißnassen Händen gerutscht. Ich bekam sie im letzten Moment zu fassen.
Unter der Katze lag ein Stapel Briefe, die mit einem roten Samtband zusammengebunden waren. Die Briefe hatte ich schon als Teenager gelesen. Ich war schockiert gewesen, als mir aufging, dass meine Eltern sich irgendwann einmal geliebt hatten.
Ich glaube nicht, dass mein Vater sich noch an diese innigen Gefühle erinnerte. Oder dass er sich überhaupt daran erinnern wollte. Ich hatte aus seinem Mund nie etwas Gutes über meine Mutter gehört.
Vielleicht hatte zwischen ihnen keine Liebe, sondern nur Begierde geherrscht. Woher sollte ich das wissen? Ich hatte immer schon Schwierigkeiten, Gefühle voneinander zu unterscheiden.
Plötzlich umklammerte ich eine Axt.
Ihre Klinge war rot von Blut.
Jemand lachte.
Ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ich selbst es war.
Niemand war vor mir sicher.
Nicht einmal mein Vater.
Früher hatte ich befürchtet, ich hätte Dinge getan, mit denen ich tatsächlich gar nichts zu tun hatte.
Jetzt fürchtete ich, nicht aufhören zu können.
Meine Hand fuhr wie von selbst in den Halsausschnitt. Ich streichelte den Schlüssel, der an einer dünnen Silberkette um meinen Hals hing.
Ich schüttelte mich wie ein nasser Hund. So gelang es mir, mich wieder im Hier und Jetzt zu verankern.
Im Zimmer wurde es still, und die Axt verschwand aus meiner Hand.
Ich holte das alte Fotoalbum aus der Truhe. Die Fotos kannte ich längst. Sie zeigten meinen Vater in jungen Jahren. Die Freundinnen in seinen Armen wechselten, und in seiner Studentenbude glaubte man das Klappern der Schreibmaschine zu hören.
Aus dem Album schwebte ein Foto auf den Boden. Ich hob es auf und steckte es wieder zwischen die Seiten. Vater und Mutter mit Kinderwagen im Park.
Ich wollte etwas finden, das mir sagte, dass Vater es wusste.
Dass er es früher erfahren hatte als ich.
Und gleichzeitig schwor ich bei Gott, beim Schicksal, bei was auch immer. Ich schwor, dass ich alles tun würde, damit mein Vater es nicht erfuhr.
Unter dem Album befand sich ein Paket, in weißes Seidenpapier gewickelt. Es enthielt ein Kleid aus grüner Seide. Daneben lag ein Paar stahlblaue Lederstiefel, deren Absätze so hoch waren, dass man bis zur nächsten Stadt hätte sehen können, wenn man die Stiefel trug.
Ich war meinem Vater dankbar dafür, dass er eine Erinnerung an meine Mutter aufbewahrt hatte. Ein Kleid, das meine Mutter gemocht und vielleicht bei ihrem ersten Date getragen hatte oder an dem Tag, an dem sie sich verlobt hatten.
Ich wickelte das Kleid wieder in das Seidenpapier.
Als Nächstes war ein Stapel Schulhefte mit blauem Einband an der Reihe. Die Hefte fielen mir aus der Hand und breiteten sich wie ein Fächer auf dem Boden aus.
Mein Vater hatte alle seine Aufsätze aufbewahrt. Die Geschichten lasen sich wie Kopien aus den Jungenbüchern seiner Kindheit. Verwegene Abenteuer zu Land, auf dem Meer und in den Lüften. Vielleicht hatte er schon als Schüler davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Meine Mutter war ihm jedoch zuvorgekommen. Und als sie ihr erstes Buch veröffentlichte, geriet mein Vater in eine Sackgasse. Er war nicht mehr fähig, mehr als einen oder zwei Sätze zu schreiben.
Nun war die Truhe leer. Es war nichts Neues aufgetaucht.
Die Erleichterung überrollte mich wie eine Sturzwelle, doch das Gefühl hielt nicht lange vor.
Ich erteilte mir die Erlaubnis, tief Luft zu holen. Mein Körper gehorchte nicht. Mein Atem blieb flach.
Ich ging daran, die Sachen wieder in die Truhe zu packen.
Dabei spürte ich das vertraute Gewimmel. In meinem Inneren kollidierten wütende Wespen miteinander. Sie warteten ungeduldig darauf, stechen zu dürfen. Ich hatte vergeblich versucht, sie zu zähmen. Sie hatten sich meinem Kommando nicht unterworfen.
Ich würde sie nicht aufhalten können, wenn sie sich auf jemanden stürzen wollten.
Vier Jahre waren eine lange Zeit.
In vier Jahren können Befürchtungen Wahrheit werden.
In vier Jahren kann eine Maus zur Katze werden.
Ich erkannte mein zwanzigjähriges Ich nicht mehr wieder. Wie hatte so ein schreckhafter Feigling den Scheißkerl in Schwierigkeiten bringen können?
Jetzt hätte mir das nicht mehr genügt.
Jetzt hätte ich ihn nicht am Leben gelassen.
ARTO
Die Ketten der Schaukeln schepperten, als die beiden kleinen Mädchen Schwung nahmen. Sie lachten hellauf. Die Laken auf der Leine schaukelten im Wind.
Die Sonne streichelte mein Gesicht. Hätte ich doch ein T-Shirt angezogen statt des dicken Polohemds.
Ich stand in dem kleinen Park vor dem mehrstöckigen Haus im Stadtteil Töölö, lehnte mich an eine Bank und starrte möglichst unauffällig zu einem Fenster in der obersten Etage hinauf.