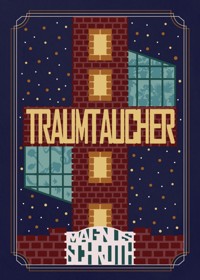
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Außenseiter Charlie will sich an den Jungen rächen, die ihn in der Schule quälen. Als der geheimnisvolle Traumtaucher und seine Magie in die Stadt einziehen, hält er seine Chance für gekommen. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sich nach etwas anderem sehnt – und dass Zauberei ihm nicht helfen kann … Diese Geschichte handelt von Erinnerungen, die sich in die Gegenwart schleichen. Von einem Jungen, der sich verloren hat, sowie einem alten Verbrechen, für das bezahlt werden muss. Und vom Traumtaucher. Seit Langem kennt er den Weg in die Fantasien der Menschen, wo er sie von ihren Ängsten befreit. Er weiß, dass Charlie nicht Magie, sondern Freundschaft und Anerkennung braucht. Als der Junge in seinen Turm eindringt, ist dieser voller Geheimnisse, zauberhafter Wesen und Hoffnung. – Bis der Traumtaucher mit dem Tod bedroht wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traumtaucher
Magnus Schroth
2024
Text: © Copyright by Magnus Schroth
Umschlaggestaltung: © Copyright by Magnus Schroth
Grafik: © Copyright by Magnus Schroth
Verlag:
Magnus Schroth
Lange Hecke 11
37130 Gleichen
Vertrieb: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-759800-20-6
Ledger, der Koffer
Inhalt
1 Die vielen Stimmen des Charlie Méliès
2 Gelächter, Verrat und ein böses Ende
3 Fliegende Spinnen und tanzende Gießkannen
4 Von Geisterwachen und dem Klang der Elfen
5 Über hinterhältige Koffer, Albträume und Rache
6 Böse Omen
7 Ivy, ein Zwerg und jede Menge Fotos
8 Ein Traum, ein Oraz und die Tränen der Nacht
9 Von der Nacht, den Quallen und woher sie kamen
10 Seelenspiegel und viel zu viele Scherben
11 Wo Kirchen-Grim wohnt und Mylinge schreien
12 Skirab, der den Wind liebte
13 Fragen ist Silber, Schweigen ist Gold
14 Angst und Zorn und Blut
15 Hinter Dornenzweigen
16 Charlie, Moja und etwas namens Hoffnung
17 Ein dunkles Haus, ein dunkler Flur und dahinter ein Geheimnis
18 Vom Spiegel und von der Vergangenheit
19 Grüne Laternen
20 Ein mutiger Feigling
21 Besuch am Tor
22 Angeln in der Finsternis
23 Die Tochter
24 Blütenduft liegt in der Luft
25 Die Straße hinab, nach Lower Meadow
26 Der missratene Zauber
27 Narben und Erinnerungen
Epilog
1 Vraé
2 Der Schrank
Danksagung
Magnus Schroth
Für dich, für Morten und deshalb auch für mich.
»Charlie? Eigentlich ist da noch alles. Du hast nur deine Hoffnung verloren. – Aber wir werden sie wiederfinden. Du wirst schon sehen.«
• Moja •
1Die vielen Stimmen des Charlie Méliès
Am Rande der kleinen Stadt Upper Meadow erhob sich ein Hügel aus dem sonst flachen Land, rund und wie ein Kissen, so sagten es zumindest die meisten. Mr. Rown sprach lieber von einem Thron, welcher die Villen der »unteren Oberschicht« hoch über den Reihenhäusern aufragen ließ, sodass man nicht vom Pöbel gestört werden und in Ruhe wichtigeren Dingen nachgehen konnte. Es gab nur zwei Villen auf dem »Misty Hill« und sie gehörten beide ihm. Mächtige Gebäude aus rotem Stein, die etwas Pompöses hatten mit ihren weißen Löwenstatuen vor den Eingängen, sowie den Drachenköpfen, die aus dem Tor ragten. Doch Mr. Rown nannte es bloß den gesunden Stolz, wie ihn jeder Mann an den Tag zu legen habe.
Aber das hörten die meisten Einwohner Upper Meadows nicht, denn es war selten, dass er persönlich nach unten in die Stadt kam. Vielleicht war das auch besser so, weil ihn niemand lange ertragen hätte, und überhaupt sprach er mit den Leuten, als wäre Armut eine Krankheit, die auf ihn überspringen würde, sobald er jemandem die Hand schüttelte.
Im Schatten seines Stolzes lebten die Menschen jedoch genauso, wie bevor er dort gewohnt hatte, mochte Mr. Rown sich auch gerne einreden, seine Anwesenheit verändere die Dinge grundlegend.
Tatsächlich war gerade die noch das Interessanteste an ihm, schließlich hätte niemals jemand einen so reichen Mann an einem solchen Ort vermutet. Denn Upper Meadow war eine der Städte, die niemand kannte und erst recht niemand suchte. Wo man nach dem Fortschritt vergeblich Ausschau hielt, da keine schwarzen Fabrikwolken die Sonne verdunkelten, wie es in anderen Teilen der Welt längst der Fall war und wo von Motorkutschen gerade einmal das Gerücht durch die Straßen geisterte.
Warum es also ausgerechnet einen Mann wie Mr. Rown hierher verschlagen hatte, war ein Rätsel, dessen Antwort an den Stammtischen immer dieselbe war. Eine gehörige Menge an dunklen Geheimnissen, Vermutungen und Ideen, vermischt mit dem jeweiligen Alkoholpegel.
Aber selbst für solche Gesprächsrunden bot er auf lange Sicht zu wenig Stoff, sodass er meist gerade mal Teil eines gelangweilten Spruchs wurde. »Seht mal, der macht sich zum Rown«, sagten sie beispielsweise, wenn jemand besonders angab.
Das erste Mal so richtig zum Thema wurde er erst an einem sonnigen Dienstagnachmittag, denn ein Gerücht zog durch die Stadt, schneller als ein Feuer hätte sein können. Von Tür zu Tür, Fenster zu Fenster, Haus zu Haus. Überall wurde gemunkelt und geschrien, gefaselt und erörtert, und worum es auch ging, es versetzte alle in Aufruhr.
Schon nach kurzer Zeit erreichte es sogar jemanden, dem Mr. Rown bisher so egal gewesen war wie das Unkraut am Wegesrand.
»Charlie …«
Und selbst ihn würde es interessieren.
»Hey …«
Viel mehr als er gedacht hätte.
»Hey, Charlie!«
Der Ruf riss ihn so plötzlich aus der Geschichte, dass er wie vom Blitz getroffen auffuhr. Jemand pochte lautstark gegen die Scheibe der Ladentür. Es war ein leicht verschwitzter Junge mit Pausbacken, die in der Schule einem Todesurteil gleichkamen. Charlie seufzte innerlich, bevor er nach dem Lesezeichen griff. Er wollte nicht mit Toby reden. Er wollte zurück in seine Geschichte, wo ihn niemand störte und alles egal war. Genervt sank er zurück in den Sessel, sodass sein Kopf hinter der Kasse verschwand, und lauschte, wie der Junge gegen die Scheibe hämmerte. Einmal, zweimal, dreimal. Dann kam die Erkenntnis. Endlich. – Oder besser: Leider. Die Tür war offen.
Schon stürmte er in den warmen Raum, dessen Behaglichkeit von Hunderten dicken Büchern stammte, die sich in Regalen quetschten, Türme bis unter die Decke bildeten und auf Tischen pyramidenförmig in die Höhe wuchsen. Wie immer standen sie sehr eng, und weil der Junge genauso dick wie begeistert war, riss er gleich mehrere zu Boden.
»Entschuldigung …« Mühsam bückte er sich, und während er sie wieder aufhob, lief sein Gesicht rot an. »Charlie? Bist du hier?«
Keine Antwort.
Vielleicht würde Toby dann gehen und er könnte sich wieder in sein Buch vertiefen, um erneut alles zu vergessen. Stattdessen verspürte Charlie schlechtes Gewissen. Du bist mies gelaunt, stellte etwas in ihm fest. Mal wieder! Noch immer gab er kein Lebenszeichen von sich. Du solltest es nicht an ihm auslassen. Irgendwo tickte eine Uhr, das Klackern der Zahnrädchen, ganz leise und doch gut vernehmlich.
Tick, tack.
Stille.
In der Ferne schlug ein Fensterladen im Wind.
Tick, tack.
Der Geruch nach Papier, Tinte und Leim hatte sich über den Buchladen gelegt wie Staub über die obersten Regalböden. Kleine Figuren standen dort und an den wenigen freien Stellen hingen fremdartige Masken, die Löwen und Panther zeigten. Ein wenig verloren stand Toby da, in den Händen zwei Bücher, und Enttäuschung trat auf sein Gesicht.
»Charlie?«, fragte er wieder, diesmal deutlich leiser.
Was solls. Auf einmal tat ihm der Junge leid. »Hier drüben«, antwortete er flüsternd, und gab sich Mühe, so zu klingen wie sonst, wenn man ihn aus seinen Fantasien holte. Weit fern, als würden die Worte aus einer anderen Welt herüberwehen, nur ein Hauch, wie eine Erinnerung, die verblasste.
»Wo?«
»Toby, hier.« Jetzt wurde der Ton eine Spur lebendiger – und gereizter – aber weil Charlie immer so reagierte, machte sich der dicke Junge nichts daraus. Mühsam suchte er sich einen Weg zwischen den Büchern hindurch, blickte über die Kasse und entdeckte ihn. »Ah, da bist du, beim Träumen – hätte ich mir denken können.«
Er meinte es gut, Charlie wusste das – und trotzdem stieg eine gefährliche Hitze in ihm auf. Ich bin kein Träumer!
»Wie sagst du immer?«, fuhr Toby fort, der nicht zu bemerken schien, was in ihm vorging. »Die längsten Reisen unternimmt man mit der Fantasie?«
»Ja.«
Plötzlich schien ihm wieder einzufallen, weshalb er gekommen war, und seine Begeisterung kehrte augenblicklich zurück. »Ich muss dir was erzählen! Alle reden darüber!«
»Was?«, fragte Charlie griesgrämig. »Hat Edward sich totgesoffen?«
»Unsinn. Außerdem soll ich dir von ihm ausrichten, er werde dich so fertig machen, dass dir die Straße wie ein Himmelbett vorkommen wird. – Halt dich lieber von ihm fern.«
»Soso.« Es war nur ein Wort, als fürchtete Charlie, seine Stimme könnte die Angst in ihm verraten, wenn er mehr sagte. Ganz kurz huschte ein Lächeln über sein Gesicht, aber es erreichte die Augen nicht und verschwand sofort. »Vielleicht sollte Edward aufpassen«, versuchte er den Moment zu überspielen. »Bald ist selbst seine Faust schlauer als er – sie könnte zu dem Entschluss kommen, ihm eine reinzuhauen!«
Eine Woge des Hasses kam in ihm hoch. Er wünschte sich, den Jungen anzuschreien, ihn zu demütigen. Zu sehen, wie Edward jegliche Größe vor seinen Freunden verlor, für deren Anerkennung er immer umher brüllte – und für die der Mädchen, welche ihm Aufmerksamkeit schenkten und dafür hasste Charlie auch sie.
»Solche Vollidioten, rennen ihm hinterher wie Schafe, machen mit, weil sie sich dann super finden, aber in Wirklichkeit sind sie so bescheuert, dass nicht einmal…«
»Charlie«, sagte Toby. »Es geht nicht um Edward. Der Traumtaucher kommt nach Upper Meadow, Mr. Rown hat nach ihm rufen lassen.«
»Was?!«
»Ja, und es heißt, er bringe einen Vogel aus dem Traum einer Katze mit, Hühner mit Fledermausflügeln und…«
»Warte …«
»Imb Quorin hat es mir erzählt.«
»Der Bettler?«, Charlie lachte schallend auf.
»Ja, aber er weiß es von George und der von Lisa, und sie arbeitet bei Mr. Rown.«
»Und hat Quorin auch die Sache mit dem Vogel behauptet?«, spottete Charlie.
Tobys Wangen nahmen einen Hauch rosa an. »Na ja«, erwiderte er. »Die Leute meinen doch auch, er sei ein Hexer, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat.«
»Und Imb Quorin trinkt jeden Tag eine Flasche Wein, weil er glaubt, auf dem Grund einer Glücksfee zu begegnen.«
»Der Traumtaucher soll ein Dämon sein. Wenn du ihn in deinen Kopf lässt, verdreht er ihn, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.«
Das war keine Geschichte des Bettlers. Die Leute redeten eine Menge über den Traumtaucher, obwohl sie ihn nie zuvor gesehen hatten. Er war ein Mythos, eine Sagengestalt, und die Erzählungen, die sich um ihn rankten, waren so unterschiedlich und teils so seltsam, dass keiner mehr zu sagen vermochte, was stimmte und was nicht. Von brutalen Heilmethoden bis hin zu der Vorstellung, er sei ein Vampir und labe sich an der Fantasie der Menschen, war alles dabei. Charlie wusste nicht, was er mit solchen Behauptungen anfangen sollte, schließlich redeten die Leute auch sonst von Werwölfen und Wichteln, die sich in den Socken unartiger Kinder versteckten, um ihnen die Zehen abzubeißen.
Allerdings war da so ein Gefühl in ihm, jedes Mal, wenn das Wort »Traumtaucher« ausgesprochen wurde. Eine Sehnsucht nach ein bisschen wahrer Magie, wie er sie sonst bloß aus Büchern kannte, und gleichzeitig ein Schauer, der ihm den Rücken hinab rann, vermischt mit der wunderbaren Vorstellung, durch Träume reisen zu können.
In Gedanken sah er sich schon durch Wolken laufen, schwebte in einem Heißluftballon über Silberschlössern, dichten Urwäldern und glitzernden Meeren. Dort wäre er glücklich. Fern von seiner Einsamkeit, fern von seinen Erinnerungen, die er verdrängte, wann immer er konnte, obwohl sie jedes Mal zurückkehrten. Was musste eine Traumreise nicht schön sein? Einmal so frei zu sein … frei von allem … frei von seinen Gedanken. Bereits jetzt roch er die leuchtenden Wälder, beobachtete die blauen Tiger, hörte ihr Brüllen in seinen Ohren …
»Charlie, ich rede mit dir«, klang Tobys Stimme aus weiter Ferne, und plötzlich war er wieder in einem Buchladen, in der kalten Welt, die er jedes Mal hasste, wenn er aus seinen Fantasien zurückkehrte.
»Hm?«, fragte er verwirrt und ihm fiel auf, dass er Toby angestarrt hatte, ohne ihn wirklich zu sehen. »Was hast du gesagt?«
Toby wandte sich beleidigt ab und ging zwischen den Regalen entlang. »Wie kann man sein Leben nur an einem so staubigen Ort verbringen?«
»Ich finde es recht gemütlich.«
»Hier passiert doch nichts.«
»Wenn du die Bücher einmal aufschlagen würdest, statt sie nur zu betrachten, dann würdest du auch etwas erleben. Dadrinnen passiert nämlich ganz schön viel.«
Toby zuckte bloß mit den Schultern. »Du bist nie draußen und …«
»Warum auch?«, fuhr er dazwischen. »Edward wartet nur darauf, mich in den Schlamm zu stoßen.« Charlie hasste Edward, aber mindestens genauso sehr hasste er es, wenn jemand seine Lebensweise infrage stellte, denn das taten seine Eltern oft genug. Ich bin kein armseliger Träumer!
»Und dich verstehe ich schon mal gar nicht. In den Welten der Bücher wärst du besser aufgehoben. Dort kannst du sein, wer du willst, statt dass du dich lächerlich machst bei dem Versuch, dazu zugehören.«
»Lächerlich?«
Er war über das Ziel hinausgeschossen. Daran war sein aufkommender Zorn schuld. Doch entschuldigen wollte er sich deshalb nicht. »Als ob es Edward oder sonst irgendwen von denen interessiert, was du tust. Sie lachen nur über dich, wenn du beim Laufen keuchst wie eine Dampflok beim Anfahren.« Und wie immer, wenn er etwas Falsches gesagt hatte, machte er alles noch schlimmer, fast, als suchte er den Streit. Wahrscheinlich tat er das sogar.
Das volle Gesicht des Jungen zitterte leicht, und Charlie wusste nicht, ob vor Verzweiflung oder Wut. Er zuckte bloß mit den Schultern. »Stimmt doch.«
Eine merkwürdige Stille trat ein, in der Toby den Kopf senkte, als interessiere er sich für die Titel auf den Büchern. Das Schweigen schien sie ersticken zu wollen, lag wie ein schweres Tuch über ihnen.
Tick, tack.
Die Uhr tickte immer noch, sie tickte immer, nur jetzt war sie wieder zu hören. Auf einmal war Charlie unbehaglich zu Mute. »Also … wenn Mr. Rown den Traumtaucher hat rufen lassen, ist er dann wahnsinnig geworden, oder wozu braucht er dessen Hilfe?« Sein Versuch, das Gespräch zu retten, wurde nicht erwidert.
Schließlich sagte Toby leise, aber bestimmt. »Ich möchte mich mit meiner Antwort nicht lächerlich machen. Weißt du, Edward lacht vielleicht über mich, aber wenigstens sagt er mir nicht, was für eine Witzfigur ich bin.« Seine Finger lösten sich von den Einbänden, er blickte auf. »Viel Spaß noch Charlie, mit deinen Welten, den Farben und Stiften und Geschichten. Vielleicht brauchst du sie ja, um dir einreden zu können, dass du etwas Besseres bist als ich.«
Wütend wandte er sich ab, marschierte zur Tür, wobei er wieder zahlreiche Bücher umwarf, doch diesmal bückte er sich nicht, um sie aufzuheben. Die Tür schwang auf, die Geräusche der Straße drangen herein, verstummten, als sie sich erneut schloss. Toby war fort.
Für einen Moment hatte Charlie ihn aufhalten, ein Wort der Entschuldigung vorbringen wollen, aber dann hatte er geschwiegen. Er wusste nicht warum, vielleicht, weil er sich selbst nicht verstand … Noch immer tickte die Uhr. … und weil es einfacher war, den Vorfall zu vergessen.
Tick, tack.
Schade nur, dass Toby das nicht tat.
Tick, tack.
Er könnte sich entschuldigen, das war gemein von ihm gewesen. Aber dann müsste er sich beeilen und die Sekunden verstrichen bereits. – Stattdessen senkte er den Kopf und las weiter. Zumindest versuchte Charlie das. In Wirklichkeit starrte er lediglich auf die Wörter, ohne dass sie einen Sinn für ihn ergaben, und dachte an das, was gerade geschehen war. Plötzlich wünschte er sich, geschwiegen zu haben. Es war gut, mit Toby zu reden. Immerhin hatte er ein Interesse daran gehabt, dass Charlie mal wieder auf die Straße kam.
Tick, tack.
Die Stille konnte einen rasend machen.
Tick, tack.
Manchmal wünschte Charlie sich, einfach laut zu schreien. So laut …
Stattdessen erklang das Geräusch umfallender Bücher aus der Kiste, die sein Vater soeben auf den Tisch krachen ließ. »Immer noch am Lesen …?« Er warf den Deckel hinter die Kasse, zog drei schwere Wälzer hervor und begann sie in die Regale einzuräumen.
»Toby war vorhin hier«, meinte Charlie bloß, ohne den Blick zu heben.
»Der Dicke? Ein netter Junge.«
»Wer denn sonst?«
»Hast recht, sonst kommt ja eher selten Besuch.«
Eine seltsame Spannung ergriff Charlie, seine Hände verkrampften sich merklich, und obwohl er noch immer den Zeilen seines Buches folgte, verstand er nur noch ein Wort. Selten. Nicht selten. Nie.
Charlie sah auf. »Warum interessiert es dich?«
»Weil du mir wichtig bist.« Die Haare seines Vaters waren schwarz wie seine, doch längst von Grau durchzogen. Er runzelte die Stirn. »Aber du hast natürlich recht. Es ist deine Sache.«
»Gut, dann frag nicht mehr, denn es ist scheißegal. Ich lese und dazu brauche ich keine Freunde.« Etwas in seiner Stimme ließ den Mann zögern, erschreckte Charlie selbst. Diese unterschwellige Wut, die sich hinter dem scheinbar gelassenen Ton verbarg, in seinen Ohren aber lauter widerhallte als jeder Schrei. Keine Freunde, keine Freunde, keine Freunde … Warum ärgerte ihn das? Was war so schlimm daran, es auszusprechen? Du bist allein, allein, allein … Wer auch immer es war, der in seinen Gedanken sprach, Charlie mochte ihn nicht.
»Aber Toby…«, sagte sein Vater verwirrt.
»…ist nur ein dummer Junge, mit dem ich manchmal rede. Er ist ein Heuchler, immer tut er alles, um von den anderen gemocht zu werden. Sogar vor Edward ist er am Kriechen.«
»Hat er Freunde?«
Vor einem Jahr hatte auf dem Schulhof eine Weinflasche gelegen, mit einem zerbrochenen Hals sowie einem kleinen Rest am Grund, der widerlich hin und hergeschwappt war, weil Edward sie aufgehoben hatte. Ein Glücksspiel. Wer verlor, würde die Flasche leer trinken. Charlie hatte sich sofort geweigert, was ihm eine ganze Woche Spott eingebracht hatte, doch Toby war leichenblass eingestiegen. – Natürlich hatte er verloren. Immerhin war er deshalb nicht krank geworden – vielleicht weil ihm am Grund Imb Quorins Glücksfee begegnet war. Hey,
»Keine wahren, wenn du mich fragst.«
Sein Vater wandte sich um, eine große Gestalt mit starken Armen, obwohl sie lange keinen Sport mehr betrieben hatten. »Du solltest öfter mit ihm rausgehen«, sagte er, ein Buch zwischen den Beinen, weitere einsortierend. »Hier drinnen wirst du keine Gesellschaft finden.«
»Ich bin gerne allein.«
Für eine Sekunde steckte er wieder in dem Schrank, gefangen in der Dunkelheit, wo Morten ihn einst eingesperrt hatte.
Verteidigung!
Jetzt sofort!
Dann stand Charlie plötzlich, so als müsste er gegen jemanden kämpfen. Erinnerungen prasselten auf ihn ein. Gefühle, mit denen er nicht wusste, wohin. Irgendetwas sagte sein Vater, er hörte die Worte, ohne ihren Sinn zu verstehen, ging hinaus, ohne eine Entschuldigung. Auf der Treppe quoll die Hitze bereits aus seinen Augen, während er hinauf polterte, das Badezimmer betrat und sich vor das Waschbecken stellte. Längst rann sie über seine Wangen.
Heute war ein schlechter Tag. Es hatte schon so viele von ihnen gegeben. Etwas Salziges lief über seine Lippen. Wütend wischte er die Tränen fort, nur kamen sofort neue nach und er spürte Zorn über seine mangelnde Beherrschung, über all die Widersprüche in ihm, die er nicht verstand.
Charlie wollte keine Freunde mehr, alle Freunde, die er je gehabt hatte, waren irgendwann zu seinen Feinden geworden. Das hatte er nicht vergessen. Zu oft steckte er in seinen Träumen noch in dem Schrank. Morten hatte ihn dort eingesperrt, als er sich zwischen dem Jubel eines anderen und ihm hatte entscheiden müssen. Warum also hatten die Worte ihn getroffen?
Du bist langweilig, schrie es in seinem Kopf, so laut, dass er taub zu werden glaubte. In all seinen Vorstellungen war er anders, das Gegenteil seines jetzigen Selbst. Mit der Faust schlug Charlie nach einem unsichtbaren Gegner, eine Witzfigur!, kämpfte verzweifelt gegen sich selbst, gegen die vielen Stimmen und wünschte sich, jemand anderes zu sein. Das Spiegelbild formte mit den Lippen einen lautlosen Schrei.
»Ich hasse dich.«
»Charlie«, drang der Ruf seiner Mutter aus dem Flur. »Das Abendessen ist fertig.«
Erschrocken bemerkte er, wie viel Zeit vergangen war. Noch immer stand er vor dem Spiegel, auf das Waschbecken gestützt, und die Tränen hatten klebrige Spuren auf seinen Wangen hinterlassen. Wenn er bloß ein paar magische Gegenstände gehabt hätte. So wie in den Geschichten. Vielleicht einen Umhang, der unsichtbar machte, oder einen Boxhandschuh, mit dem er jeden besiegte. Dann wäre er losgezogen und hätte sich für all das gerächt, was er nicht vergessen konnte, obwohl es schon so lange her war.
Schrank.
Dunkelheit.
»Eines Tages…«, schwor er sich.
»Charlie? Ich rufe nicht noch einmal.«
Es war ihm egal. Das Gespräch musste nicht fortgeführt werden und zweifellos würden sie das wollen. Wie zur Bestätigung flackerte die alte Badezimmerlampe. Sein Vater mochte glauben, dass draußen auf der Straße die Lösung wartete. Doch Charlie Méliès hätte alles gegeben, um in die Welten aus Zauberern, Schneesoldaten und Dreibeinpilzen verschwinden zu können.
Aus der Küche drang das Klappern von Besteck.
Auch egal, fand er. Morgen würde Edward ihn umbringen. Wieder flackerte die Lampe, ihr warmes Licht leuchtete grell auf, dann umhüllte ihn plötzlich Dunkelheit.
2Gelächter, Verrat und ein böses Ende
Am nächsten Tag erwachte Charlie mit einem flauen Gefühl im Magen, verbunden mit der Befürchtung, dass ihm heute nichts Gutes bevorstände. Sein Hals kratzte – wie immer, wenn er gestresst war, denn dann wurde er krank. Nicht gespielt, sondern mit Husten, Schnupfen und jeder Menge schlechter Laune. Am Frühstückstisch sprach er kein Wort, der Tee half gegen die Halsschmerzen, den Schal aber lehnte er ab. – Den Gedanken an Edwards spöttischen Blick ertrug er nicht.
Zur Schule ging Charlie langsam. Nicht halb so schnell, wie er sonst immer zurücklief, und sein Blick suchte die Tauben und Häusereingänge, als hoffte er, eine Ausrede zu entdecken, nicht weitergehen zu müssen.
Eine Leiche vielleicht.
Amseln flogen umher, ein paar Raben stolzierten über die Dächer aus rotem Zinn und einer hüpfte auf der Straße vor ihm davon. Die Häuser waren alt, aus hohem Fachwerk, das zierliche Giebel aufwies. Kleine Schornsteine ragten in den Himmel, Rauch stieg daraus empor. In Schaufenstern standen lederne Schuhe, Regenschirme und Mäntel. Charlie ging an der Apotheke vorbei, wobei er sich sehr krank fühlte. Er hustete. Die Strahlen der Sommersonne wärmten bereits das Pflaster, und der Tau glitzerte hell auf dem Efeu, das an einigen Straßenlaternen hinauf rankte. Wie Perlen, dachte Charlie.
Doch wie langsam er auch ging, selbst wenn er seine Füße bewegte, als habe er sich einen gebrochen, die Schule rückte näher. Schon kam er an einem großen Turm vorbei, aus rotem, dickem Stein, weißem Mörtel und mit spitzem, schwarzem Dach. »Stargate« nannten die Einwohner Upper Meadows ihn, denn einst hatte ein Astronom diesen gebaut und ihn stets als den Pfad zu den Sternen bezeichnet. In Wirklichkeit hatte darin nur ein Teleskop gestanden. Jetzt war der Mann fort, zusammen mit der Magie, die er ausgestrahlt hatte, und der Turm gehörte Mr. Rown, der ihn nie auch nur betrat.
»Für die Sterne sind wir nur winzige Winzigkeiten«, hatte der Astronom stets gesagt, und sich dann durchs Haar gestrichen, wobei ihm jedes Mal wieder aufgefallen war, dass er schon lange keines mehr besaß.
Als auch der Turm hinter ihm lag, tauchte die Schule auf, und bei jedem Schritt schien Charlie zu schrumpfen, als wolle er aus seiner Winzigkeit eine Unfindbarkeit machen.
Das Gebäude hatte zwei Säulen am Eingang, groß und düster, hinter dem hohen Zaun, der verdächtig an ein Gefängnis erinnerte. Trotzdem lachten hier Kinder, Freunde begrüßten sich. Charlie ging in sein Klassenzimmer, ohne mit jemandem zu reden, setzte sich an seinen Platz und wartete. Mit den Minuten füllte sich der Raum, füllte sich mit Fröhlichkeit und Geräuschen, und alles überdeckte Charlie, der stumm auf seinem Platz saß.
»Du hast ja eine schöne Kette.« Als Grace an ihm vorbeilief, hob er leicht den Kopf, fast als hoffte er, sie würde ihn ansprechen.
Dass irgendjemand ihn ansprach.
Irgendjemand, der nicht Edward hieß.
Aber natürlich tat sie es nicht, sondern lief eilig zu den anderen Mädchen. »Ethan hat sie mir geschenkt.«
»Der mit den roten Haaren?« Kichern drang aus der Ecke, augenblicklich übertönt von Edward, der gerade prahlte, in den Blumenkübel der Nachbarin gekotzt zu haben. – Zweimal, weil er zu viel getrunken hatte.
»Das glaubst du doch selbst nicht«, rief Austin beeindruckt. »Musste deine Schwester dich nach Hause tragen?«
»Red keinen Scheiß. Das hat Ivy getan«, erwiderte Edward, und sein Beifall heischender Blick suchte den Klassenraum ab. »Aber dableiben wollte sie nicht mehr«, fügte er hinzu, worauf seine Freunde anerkennend grölten.
Charlie starrte auf seine Finger und lauschte. Die Worte faszinierten und widerten ihn zugleich an. Wie konnte jemand nur so reden? Warum fanden das alle so toll – warum fand er das so … Seine Hände ballten sich zu Fäusten, zornig, weil alle diesen Jungen ansahen.
Du bist langweilig und schwach. Kein Wunder, dass niemand mit dir reden will. Die Stimmen flüsterten immer. Früher war das anders gewesen. Früher hatten sie Menschen gehört. Menschen, zu denen er aufgeblickt und Menschen, denen er vertraut hatte. Minderwertig. Jetzt waren es seine Eigenen. Und all die fröhlichen Schüler um ihn herum machten ihn nur noch kleiner.
Verstohlen sah er zu den Mädchen, die jetzt ebenfalls dem Gespräch lauschten.
»Na, was ist? Willst du wieder mitkommen?«, wandte sich Edward an eines, das sein goldenes Haar in den Rücken warf und ihm einen spielend mitleidigen Blick schenkte, bevor es lachte. Ivys Art, ihn zurückzuweisen, brachte noch lauteres Gejohle hervor. Gordon setzte zu einem Spruch an, da …
»Hallo, Charlie.« Eine riesige Hand schoss in sein Blickfeld, winkte direkt vor seinem Gesicht umher, und als sie sich endlich zurückzog, sah er in die riesigen Glubschaugen Abbys. »Wusstest du, dass man schlechte Laune hauptsächlich durch das Essen von Kohl aufnimmt?«, fragte sie.
Charlie überhörte den Satz, sah zu Ivy und Edward. Ein Bild entstand in seinem Kopf, doch er verdrängte es sofort wieder.
Das Schlimmste an der Schule war, dass ihm hier am deutlichsten wurde, wie allein er, und wie glücklich die anderen waren. Mit ihm hätte sich keines der Mädchen gezankt, das wäre er ihnen gar nicht wert gewesen. Charlie senkte den Blick wieder.
»Hast du gestern viel Kohl gegessen?«, drang Abbys Stimme zu ihm durch, während sie ihn anstarrte, als sei er ihr Patient, den Mund geöffnet wie ein Karpfen.
»Halt die Klappe«, antwortete Charlie gereizt. Wie wirkte es, wenn er hier mit Abby redete? Keiner redete mit ihr.
»Wirklich nicht?« Ihr Mund öffnete sich noch ein Stück weiter.
»Nein!« Er stand auf, um zu Toby zu gehen, aber dann fiel ihm erneut ihr Streit ein und schlechtes Gewissen stieg in ihm auf. – Sollte er sich entschuldigen?
Wahrscheinlich.
Der dicke Junge lachte mit den anderen, versuchte, dazu zugehören. Charlie fragte sich, ob er die mitleidigen Blicke bemerkte, bemerkte, dass keiner seinen Witzen lauschte und niemand ihm zuhören wollte.
»Vielleicht ja auch Kohlrabi«, überlegte Abby.
Irgendetwas in Charlie explodierte.
»Nein!« Er wandte sich ihr wieder zu. »Nein, nein, nein! Lass mich in Ruhe, du …«
Abby fiel vom Stuhl, vor Schreck schloss sie ihren Mund. Edward hielt mitten in seiner Rede inne, Ivy runzelte missbilligend die Stirn. Keiner sagte etwas, keuchend wandte sich Charlie um. Die Stille schien ihn anzugreifen und er drehte sich im Kreis wie ein Reh, das von Wölfen umzingelt wurde.
»Und?«, fragte Edward spöttisch, »was hast du gestern gegessen, Charlie? – Keinen Kohl, Abby. Wahrscheinlich eines seiner langweiligen Bücher und dazu ein Glas Tinte.« Er schrie förmlich, damit auch ja niemand seinen Auftritt verpasste. Alle lachten.
Na ja. Fast alle. In Tobys Gesicht war weder Freude noch Mitleid zu sehen – höchstens Angst. Charlie fragte sich, ob er ihm helfen würde.
»Deshalb ist er auch so klein«, verkündete Austin strahlend. »Vom vielen Lesen hat sich sein Rücken verkrümmt.«
»Was willst du?«, fauchte er. Wieder lachten sie, doch in seiner Panik merkte Charlie zu spät, dass er sich lächerlich machte. »Haltet die Fresse!« Schamesröte stieg in sein Gesicht.
»Jetzt reiß mal nicht gleich dein Maul so auf«, stöhnte Austin theatralisch, blickte Anerkennung suchend zu Edward und fuhr fort. »Von dir will niemand etwas, Kleiner. – Oder?« Er blickte fragend zu den Mädchen. »Wollt ihr etwas von so einem Langweiler?« Spöttisches Kopfschütteln, irgendwo kicherte jemand. »Also sei leise. Sonst müssen wir dir zeigen, wo du hingehörst.«
Verzweifelt trieb Charlie die Tränen zurück. Schnell, schrie es in seinem Kopf. So darfst du ihn nicht gewinnen lassen! Die abschätzigen Blicke der Umstehenden brannten wie frische Schürfwunden. Doch Austins Worte enthielten eine entwaffnende Wahrheit, die ihm die Sprache verschlug.
»Wenigstens kotz ich nicht in Blumentöpfe, um mich groß zu fühlen«, schrie er.
»Weil du ein Feigling bist«, lachte Sebastian ihn aus.
Mit vor Wut zitternden Händen wandte Charlie sich dem Jungen zu und wollte ihn schlagen. Aus irgendeinem Grund wollte er zeigen, wie mutig er war, auch wenn sie ihn verprügeln würden – obwohl Ivy doch genauso lachte wie die anderen.
Auch Toby grinste inzwischen. Noch eine Woge der Wut, nein, des Hasses. Er wünschte sich, sie zu bestrafen, ihnen die Schadenfreude aus den Gesichtern zu treten, bis sie um Gnade flehten.
»Da fällt mir ein …«, übertönte Edward die anderen so gelangweilt, als erinnerte er Charlie an die Hausaufgaben. »Eigentlich wollte ich das ja nach der Schule regeln. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, vielleicht lieber sofort.«
»Bist du eigentlich bescheuert?« Das Gefühl, seinen Körper mit der Stimme wettmachen zu müssen, hallte durch den Klassenraum. »Ich habe dir gestern schon gesagt, ich war es nicht!«
»Wer denn sonst? Alle wissen, dass du ein korrekter Streber bist, der nur zu blöd ist, gute Noten zu schreiben.«
»Verdammt, ihr müsst mir glauben!« Niemand antwortete. Toby und zwei, drei andere blickten zu Boden, Grace gackerte schadenfroh. »Dann halt nicht.« Charlie zuckte mit den Schultern, »auch egal.«
»Nein«, widersprach Edward und sein Ton nahm etwas dümmlich Gefährliches an. »Kein bisschen.«
»Komm doch«, zischte Charlie und versuchte zu verbergen, wie eingeschüchtert er war, auch wenn er nicht wusste, wie er aus dieser Situation jetzt noch heil herauskommen sollte. »Wenn ich den erwische, der sich hinter mir versteckt…«
»Boah, Charlie«, sagte Ivy. »Wir wissen alle, dass du ein mieser Verräter bist.«
Da war kein Sauerstoff mehr. Er hatte Worte im Kopf, Dinge, die er sagen, erklären wollte, doch nichts drang nach draußen und stattdessen blieb ihm die Luft weg. Für einen Moment brachen all die Erinnerungen über ihn herein und lösten ein Gefühl tiefer Verzweiflung aus. Bestimmt bot er den Anblick eines Verlierers, wie er so dastand, den Schweiß auf der Stirn.
Noch während er nach einer Antwort suchte, baute sich Edward vor ihm auf, die Hand schon unterwegs zu seinem Kragen …
»Hinsetzen!« Ms. Morrison kam als Erlöserin in Gestalt einer strengen Frau mit Hasenscharte hereinmarschiert, wobei sich Charlie nie mehr gefreut hatte, sie zu sehen.
»Dich kriegen wir noch«, zischte Sebastian.
Charlie gab keine Antwort. Der Junge hatte recht. Zweifellos würden sie ihn in einem anderen Moment erwischen, um ihn dann nur noch härter zu bestrafen. Denn der Grund, weshalb Charlie erneut Ärger mit Edward hatte, lag nicht wie sonst darin, dass dieser ein Opfer für seine Witze brauchte, sondern schlicht und ergreifend in der Sache mit …
»Sie drei …« Ms. Morrison deutete auf Edward, Austin und Sebastian. »… können morgen beginnen, die Wände im Westflügel zu streichen, und ich hoffe, dass solcherlei Vorfälle nie wieder geschehen. Beim nächsten Mal fliegt ihr schneller von der Schule, als ihr ›ungerecht‹ schreien könnt!«
»Genau«, sagte Abby. »Ihr müsst auf eure Ernährung achten. Gefühle leiten uns, und wir nehmen sie über die Nahrung auf.«
»Wir hätten dich anstelle deiner Zeugnismappe verbrennen sollen«, zischte Austin ihr zu.
»Dann hätte ich wenigstens noch eine. Aber wie gut, dass Charlie zugesehen und es Ms. Morrison berichtet hat, sonst würde der Flur keinen neuen Anstrich bekommen.«
»Ich habe es ihr nicht erzählt«, knirschte Charlie, der sie mittlerweile ebenso gerne verprügelt hätte wie Austin.
»Die jetzige Farbe ist nicht gut für die freie Entfaltung der Fantasie«, plapperte Abby munter weiter.
»Warum«, fragte er wütend, »glauben hier eigentlich alle, ich sei der Verräter gewesen?«
»Weil du es oft genug bewiesen hast«, erwiderte Edward und versuchte, ihm einen tödlichen Blick zuzuwerfen, bei dem Charlie gelacht hätte, wenn es ihm später keine Schläge eingebracht hätte.
»Stimmt nicht«, antwortete er hitzig.
Nur ein einziges Mal war Charlie zur Lehrerin gegangen, und das vor drei Jahren, als Edward ihn jeden Tag verprügelt hatte. Seitdem besaß er den Ruf eines Verräters, und irgendjemand, irgendjemand versteckte sich dahinter. Misstrauisch sah er sich im Raum um und fragte sich, wer der Feigling war, der ihn in diese Situation gebracht hatte.
»Das reicht jetzt.« Wütend warf Ms. Morrison Edward einen Blick zu. »Wir haben noch weitere Wände. Der Hausmeister freut sich.«
Augenblicklich herrschte Stille.
Der Unterricht begann in seinem langweiligen Trott, zog an Charlie vorbei wie die Landschaft hinter einem Zugfenster. Er wünschte sich weit fort. Noch immer durchlebte er das eben Geschehene, das Gefühl, allein zu stehen.
Allein gegen alle.
Wenn Charlie doch bloß in einer anderen Welt gewesen wäre, in einer aus seinen Büchern. Dann hätte er jetzt ein Elixier getrunken, unglaubliche Kräfte entwickelt und alle niedergeschlagen, bis sich keiner mehr traute, ein Wort gegen ihn zu sagen. – Und Ivy hätte ihn angeblickt.
Irgendwann stand er auf, lief in die Pause. Abseits beobachtete er die anderen, bis der Unterricht weiter ging.
Oder fliegen … Fliegen zu können müsste auch schön sein. Er meinte einen Luftzug zu spüren, den Wind, wie er an seinen Kleidern zerrte, durch seine Haare fuhr und mit rauschender Stimme rief, »höher, Charlie, höher.« Unter ihm wurde die Schule kleiner, Edward, der mit offenem Mund dastand, Toby, die Mädchen, und mitten in einer Gasse auch ein blonder Junge.
Morten erglühte vor Neid.
Schon war er zwischen den Wolken, drehte Saltos in der Luft und flog schneller als die Vögel, die ihn aufgeregt umkreisten. Schließlich lehnte er sich nach vorne, zischte wieder ein Stück in die Tiefe, bis er über der Schule schwebte. Die Schüler begannen zu jubeln, viel zu laut für die Entfernung. »Charlie. Charlie!«
Sogar Ms. Morrison rief. »Mr. Méliès? Charlie Méliès, könnte ich bitte einen Augenblick mit Ihnen sprechen?«
Er schreckte hoch, die Klasse starrte ihn an, manche neugierig, die meisten höhnisch. »Ja… na klar.« Er stolperte von seiner Bank und eilte nach vorne.
»Sebastian? Austeilen! Danach können Sie nach Hause gehen«, sagte Ms. Morrison noch, bevor sie Charlie in einen Nebenraum winkte. »Setzen Sie sich.«
Angespannt knetete er seine Finger. Eine ziemlich genaue Ahnung, worum es hier ging, hatte ihn ergriffen.
»Ich unterrichte Sie jetzt seit drei Jahren«, sagte Ms. Morrison. »Und in Physik scheinen Sie sich offensichtlich zu langweilen. Deshalb fragte ich mich, warum Sie nicht mitdenken, so wie Sie es in Englisch tun? Was ist los mit Ihnen, Méliès?«
Charlie senkte den Kopf und schwieg. Er fühlte sich schuldig.
»Ich muss Ihnen die Arbeit wiedergeben.«
Ohne aufzublicken, nahm er das Papier entgegen und warf einen kurzen Blick darauf. Durchgefallen. Es überraschte Charlie nicht, denn er hatte nichts hingeschrieben.
»Ich wünsche mehr Disziplin! Ich halte Sie nicht für einen Idioten, aber zunehmend verleihen Sie mir das Gefühl, meine Meinung überdenken zu müssen.«
Charlie schwieg weiterhin – was sollte er darauf erwidern? Die Pausenglocke schrillte zum Schulende.
»Sie haben mir einmal erzählt, Sie wollten Illustrator werden?«
»Ja.«
»Ich gehe mal davon aus, Sie waren zu beschäftigt, um zu lernen? Eines will ich Ihnen sagen. Sie spielen ein riskantes Spiel. Setzen Sie nicht ihren Abschluss für den Traum eines Vierzehnjährigen in den Sand. Ich mag Ihre Zeichnungen, Méliès, aber ein Buch zu veröffentlichen wird Sie nicht weiterbringen. Erst die Schule, dann Ihre … erst dann sollten Sie versuchen, Ihren Vorstellungen Leben einzuhauchen.«
»Ja.«
Stille. Ms. Morrison erwartete eine Antwort, aber Charlie nickte bloß. Die Augenblicke zogen sich dahin, länger als eine Physikstunde. Nervös starrte er auf seine Schuhe. Eine Schleife war offen.
»Und? Wie geht es Ihnen sonst so?«
»Gut.«
»Nun… Sie sollten dringend erwachsen werden. Das war dann alles.«
Ms. Morrison geleitete ihn zurück in die Klasse, die sich inzwischen geleert hatte. Einzig Abby saß noch an ihrem Platz.
»Möchtest du eine Apfelsine«, fragte sie. »Davon bekommt man gute Laune.«
Charlie schüttelte bloß den Kopf, verließ das Gebäude und trat zum Tor hinaus. Die Jungen waren fort. Nach Schulende hatten sie nicht mehr auf ihn warten wollen.
So ein Glück.
Charlie fand, dass er schon lange keines mehr gehabt hatte. Etwas in ihm rebellierte, fast, als erwartete er eine Falle. Aber auch am Donnerstag entkam er den Jungen, weil der Hausmeister sie zum Wändestreichen dabehielt – und Charlie überkam das merkwürdige Gefühl, jemand würde ihm einen Streich spielen. Wahrscheinlich brauchte Edward lediglich Zeit, um sich einen furchtbaren Racheplan auszudenken. Doch am Freitag hatten sie ihre Strafarbeit noch immer nicht beendet, weshalb er die Schule erneut unbeschadet verließ.
Vielleicht hatte er ja tatsächlich Glück.
Dies war zu viel des Guten und im Nachhinein fand er, dass er es besser hätte wissen müssen. Denn schon am Montagmittag holte ihn das Pech wieder ein …
Gerade wollte er sich auf den Heimweg machen, als eine Stimme hinter ihm rief. »Na, kleiner Charlie?«
Ihm wurde schlecht. Langsam drehte er sich um und sah zum Schultor zurück. Dort hatten sich fünf Jungen aufgebaut. Edward, Austin und Sebastian vorne, Tom und Richard im Hintergrund, mit Gesichtern, als hätte man sie her geschleift.
»Hast du uns etwa vergessen? Wir haben noch eine kleine Rechnung offen.« Austin grinste spöttisch. Offenbar kam er sich ziemlich stark vor. »Hoffentlich passt dir der Zeitpunkt. Wir haben beschlossen, nicht zu warten, bis du freiwillig kommst.«
»Du wirst noch lernen, was es heißt, sich mit uns anzulegen«, brüllte Sebastian.
Edward stand rachsüchtig in der Mitte der Jungen und war sich offenbar zu gut, sich heiser zu schreien. Doch als Charlie sich umdrehte und losrannte, war er der Erste, der ihm folgte.
Tauben flogen auf, als sie zwischen ihnen hindurch stoben. Bereits nach wenigen Metern wurde klar, dass es ein knappes Rennen werden würde. Ihre Schritte hallten auf dem unebenen Pflaster wider, genauso wie man ihre Aussetzer hörte, wenn sie beinahe stolperten.
Charlie war nie besonders sportlich gewesen, aber sein Herz raste und er lief, so schnell er konnte, während die Rufe seiner Verfolger ihn jagten. Keuchend schnappte er nach Luft, seine Brust pochte schmerzhaft. Er hatte das Gefühl, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, und seine Schritte fühlten sich gefährlich wacklig an. Edward war schneller als er, das wusste Charlie, doch wenn er es bis in seinen Teil der Straße schaffte, würde er ihnen vielleicht entkommen. Mach schon. So weit ist es nicht!
Er kannte den Schmerz, wenn sie ihn schlugen. Panik floss in Wogen durch ihn hindurch, sie durften ihn nicht einholen!
Sie durften nicht!
Schweiß rann ihm über die Stirn. Lange konnte er seine Geschwindigkeit nicht mehr halten und Edward kam näher. Charlie meinte bereits, seinen Atem im Nacken zu spüren, wich in eine Seitengasse aus, wo er zwischen alten Häusern weiter die Stufen hinab hetzte. Der Haken hatte ihm ein paar Meter Vorsprung eingebracht, aber jetzt war der Weg noch viel weiter.
Komm schon, komm schon!
Das Seitenstechen wurde so stark, dass er sich zu jedem Schritt zwingen musste. Tränen stiegen ihm in die Augen, nahmen ihm die Sicht.
Helft mir! Er wollte schreien, doch besaß den Atem nicht. Ein Hund kläffte, schnappte nach ihm.Knapp entging er Zähnen und Spazierstock, hörte den wütenden Fluch des Besitzers, gefolgt von dem Jaulen des Tieres, weil Sebastian vermutlich hineingerannt war. Inzwischen holte Edward wieder auf. Der Klang seiner Schritte auf dem Pflaster wurde lauter, näher und näher, Chaaaarlieeeee! In seinem Kopf schrie alles durcheinander, während er wieder in eine andere Gasse bog, zurück auf die Straße – bald wäre er zu Hause!
Mit jedem Schritt schien die Schultasche auf seinem Rücken schwerer zu werden. Schweiß rann ihm in die Augen, wo er brannte, und unter seiner Kleidung kochte es vor Hitze. Charlie spürte eine Hand, wie sie seinen Arm streifte und wusste, dass Edward jetzt ganz, ganz nah war. Verzweifelt holte er all seine verbliebene Kraft aus sich heraus, nur reichte die nicht sehr lang.
Sie würden ihn kriegen, er hatte verloren.
Noch einmal wurde er schneller, aber seine Beine drohten einzuknicken und er konnte das Tempo nicht halten. Eine Hand stieß in seinen Rücken, Charlie flog, flog durch die Luft. Für einen kurzen, wirren Augenblick fragte er sich, ob seine Träume wahr geworden waren. Dann knallte er mit solcher Wucht auf die Steine, dass er meinte, sein Kopf würde explodieren.
Einen Moment lang war ihm so schwindlig, dass er nicht wusste, wo er sich befand. Hastig rappelte er sich auf. Seine Hände bluteten und die Schürfwunden brannten schlimmer als seine Augen, die gegen seinen Willen voller Tränen waren.
»Lasst mich in Ruhe«, brüllte er.
»Du denkst wohl, du kannst uns Wände streichen lassen!« Edward packte und schubste ihn einige Meter von sich, irgendwo gingen Fensterläden auf.
»Scheiße, ich war es nicht, das habe ich euch doch gesagt!«
Inzwischen waren auch Austin und Sebastian angekommen, die um ihn herumliefen, sodass es keinen Fluchtweg mehr gab.
»Ich habe euch nichts getan!« Er schrie mehr, um das Gefühl der Hilflosigkeit zu verdrängen als vor Angst. »Ich…«
»Merk dir eines, du mieser Verräter.« Austin gab ihm von hinten eine Ohrfeige. »Keiner mag dich, und wenn du in Zukunft nicht deine Zunge hütest, verlierst du vielleicht ein paar Zentimeter davon.«
Charlie drehte sich im Kreis, versuchte, sich auf den nächsten Schlag vorzubereiten. Sebastian spuckte nach ihm, Tom und Richard kamen hinzu. Er hörte ihr Atmen, das Lachen von Austin, in der Ferne erklang Hufgetrappel. Charlie wollte sich so klein wie möglich machen, da kam Trotz in ihm hoch. So einfach würde er sich ihnen nicht ausliefern, mochte er schwach sein, aber das… Nein. Niemals würde er sich hinknien wie ein feiger Hund, der auf Bestrafung wartet.
Rasender Zorn verdrängte die Angst, das Hufgetrappel war jetzt ganz nah. Charlie richtete sich auf, in einer einzigen fließenden Bewegung sprang er nach vorne, den Arm weit zum Schlag ausgeholt… Edward war schneller, seine Faust traf ihn mitten ins Gesicht. Es knackte, sein Kopf flog nach hinten, rückwärts krachte Charlie erneut auf die Straße – etwas Heißes strömte über Mund und Nase, über die Wangen, bis zu seiner Kleidung. Vor Schmerz verschwand die Welt vor seinen Augen. Irgendwo schrie Toby.
Toby?
Ein Pferd wieherte, plötzlich ertönte ein Schuss. Vögel flogen kreischend auf, er sah sie im Blau über ihm Flügel schlagen. Für eine Sekunde herrschte Stille, Schreckensstarre.
Dann knallte es ein zweites Mal.
3Fliegende Spinnen und tanzende Gießkannen
Der Schuss verhallte in der Mittagsluft, Geruch von Rauch und Blei, Türen flogen auf, jemand schrie.
»Was steht ihr hier so herum? Verschwindet, macht, dass ihr fortkommt!«, donnerte eine barsche Stimme. Charlie setzte sich auf, die Finger gegen seine Nase gepresst, zwischen denen es rot auf sein Hemd tropfte. Ihm wurde schwindlig. Für einen Moment verschwamm die Welt vor seinen Augen, sein Arm begann zu zittern und beinahe wäre er zurück aufs Pflaster gefallen.
»Leg den Kopf nicht in den Nacken, Junge«, sagte die Stimme, irgendwo schräg über ihm. »Du musst dich nach vorne lehnen. Die Leute denken immer, sie würden dann verbluten – aber die Leute sind ja eh dumm.« Langsam kehrte Charlies Sicht wieder zurück. Am Ende der Straße rannten drei Jungen davon. Ein tröstlicher Anblick. »Willst du verbluten?«
»Nein.«
»Wirst du nicht. Kopf nach vorn.« Jemand reichte ihm ein Tuch. Seine Nase schmerzte so stark, dass die Tränen sofort alles wieder verschwimmen ließen. Charlie fühlte sich merkwürdig schlaff und kraftlos, sein Schädel wummerte, als hätte ihn jemand gegen einen Stein gerammt.
Man hatte ihn gegen einen Stein gerammt.
Gegen einen Pflasterstein.
»Drück das Blut ab. Deine Nase ist gebrochen.«
Neben ihm stand ein Pferd. Charlie hörte leises Schnauben, den warmen Atem, während es ihn beschnupperte, und den Klang der Hufe, mit jedem Schritt, den es zurückwich. Der Geruch des Blutes machte das Tier nervös, ließ es auf der Stelle tänzeln und den Kopf in den Nacken werfen.
Aus dem Sattel schwang sich ein Mann. Charlie hatte noch nie jemanden gesehen, der sich so geschmeidig bewegte. Es erinnerte ihn an die Prinzen, die in den Märchen gegen Hexen und Drachen kämpften, um am Ende ihr Bauernmädchen zu retten. Doch seine Anmut wurde von seinem Gesicht überschattet, das weder jung noch schön war, sondern ausgemergelt und vernarbt.
»Komm mit mir.« Er reichte Charlie einen Arm als Stütze, der ihn zögernd ergriff.
»Sie haben niemanden …«, setzte er zur Frage an und verschluckte sich. Das Blut ließ ihn würgen.
»Ich sagte, Kopf nach vorne – dann läuft es dir nicht in den Rachen.«
»… niemanden …«
»Nur in die Luft. Es hat ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt.«
Charlie rieb sich die Tränen aus den Augen und Blut ins Gesicht. Er musste aussehen, als käme er aus dem Krieg. Noch immer fuhr der Schmerz wie Stromschläge durch ihn hindurch, doch kaum dass er wieder richtig sehen konnte, vergaß er ihn genau wie seine Nase. – Zumindest soweit das denn möglich war.
Der Mann trug enge Lederkleidung und Mantel, zwei glänzende Pistolen an seinem Gürtel und ein Messer am Bein. Hinter seiner Stute warteten vier Kutschen. »Setz dich auf die vorderste.«
Charlie rührte sich nicht, sondern blickte wie gebannt auf die morschen Holzgefährte. »Wo sind die …?«
Das Gespann fehlte. Keine Pferde, keine Esel, nicht einmal Rentiere oder Hasen. Für einen Augenblick wollte Charlie zum Himmel sehen, ob dort nicht eine Schar Einhörner auf sie wartete – aber das war dumm.
»Sie fahren allein«, erklärte der Mann und drängte ihn auf die Erste zu. Charlie wusste, dass es mittlerweile Motorkutschen gab, doch waren sie laut und stanken, und viel zu teuer für einen solchen Mann. Seine fuhren hingegen wie von Zauberhand, rollten auf der Stelle hin und her, als wären sie von ungeduldigen Helfergeistern besessen, die nur darauf warteten, ihre Fracht abzuliefern.
Und sie transportierten eine Menge. Auf jeder der Kutschen stapelte sich ein Berg aus Koffern und allerlei merkwürdigen Geräten, schlecht mit Planen abgedeckt, sodass Charlie sich nicht erklären konnte, warum keine zusammenbrach. Große Uhren drückten sich an die Bäuche geheimnisvoller Flaschen, gefährlich zu einem Haufen zusammengeworfen, den sie sich mit Harpunen, Kisten und Pfauenfedern teilten. Schillernde Pflanzen, Terrarien voller leuchtender Schnecken, neben Schmetterlingen und Gartenwerkzeug. Irgendwo rumpelte es. Charlie entdeckte einen Käfig, mit … Er musste noch Tränen in den Augen haben. Ein Huhn gackerte. Es schien ihn auszulachen.
»Setz dich«, wiederholte der Mann und half ihm, sich auf einem Koffer niederzulassen, der mit schweren Ketten an die Kutsche gefesselt war.
Gezeter.
Geflatter.
Das Huhn beschwerte sich in einer Lautstärke, die Charlie nicht für möglich gehalten hätte, wobei es, die Federn nach allen Seiten abspreizend, beunruhigend gefährlich wirkte. Zornig schlug es mit den Flügeln – Fledermausflügeln.
Charlie blinzelte und begann sich zu fragen, ob der Schmerz seiner Nase ihn fantasieren ließ. Vorsichtig legte er eine Hand an das Gitter des Käfigs und bereute es sofort. Mit einem kampflustigen Schrei schoss das Huhn vor, den Schnabel an der Spitze wie ein Pfeil.
»Du blödes Vieh!«
Es hatte ihm in den Daumen geschnitten, Blut perlte aus der Wunde.
»Hände weg von meinen Sachen«, befahl der Mann, mittlerweile wieder im Sattel thronend. »Das ist kein Spielzeug.« Kaum tat die weiße Stute ein paar Schritte, ruckelten die Kutschen los, als wären sie Entenküken, die ihrer Mutter folgten. »Und fass die Fesseln nicht an. Der Koffer ist gefährlich.«
Hastig zog Charlie seine Finger zurück und blickte beklommen auf das Leder zwischen seinen Beinen. Es bebte. »Was ist da drin?«
»Das glaubst du mir sowieso niemals, Junge«, antwortete der Mann. Dann lachte er wild und bellend.
»Wer sind Sie?«, fragte Charlie, obwohl er bereits eine Ahnung hatte. Neugierig blickte er von ihm zum Huhn und wieder zurück.
»Weißt du das wirklich nicht?« Mit hochgezogenen Augenbrauen drehte sich der Mann im Sattel um. »Ich bin enttäuscht.«
»Sind Sie … der Traumtaucher?«
Da war es wieder, dieses magische Wort, das ihm einen Schauer den Rücken hinunterrollen ließ. Hier draußen im Sonnenschein klang es unwirklich und falsch wie ein Traum, der nur im Schatten Gestalt annahm. Charlie erinnerte sich an die Märchen und Legenden, welche die Menschen im Feuerschein erzählten und deren Ursprung dieses vernarbte Gesicht sein sollte. – Sehr wahrscheinlich kam ihm das nicht vor.
Der Vater ein Mörder, die Mutter eine Harpyie, und die Geister der Nacht haben ihn das Ängstigen gelehrt.
Andererseits … Mit seinen Pistolen, dem Messer am Gürtel, seinem Koffer und besonders durch die vielen Narben, wirkte der Mann abgebrüht, hart, und wie jemand, der zu allem im Stande war.
Einst ist er in den Kopf einer wunderschönen Prinzessin gestiegen, pflanzte dort Liebe und verbrachte sieben Stunden mit ihr. In der achten jedoch erlösten die Sonnenstrahlen das Mädchen. Es wehrte sich und schließlich warf der Traumtaucher es den Nymphen zum Fraß vor. Charlie beschloss, sich lieber ein eigenes Bild zu machen. Nymphen gab es nicht, genauso wenig – wie es Hühner mit Fledermausflügeln gibt?
Tückisch.
»Ich …«, sagte der Mann und grinste. »… bin Mr. Ethnicas.«
»Also sind Sie nicht …?«
»Doch.« Er lachte über Charlies verwirrten Gesichtsausdruck, kramte in seinem Mantel, zog eine Zigarre hervor und zündete sie an. Sofort begann sich ihr Duft auszubreiten, schnell, leicht, vom Wind getragen, nach Äpfeln, Zimt und Träumen.
Ja, eindeutig. Ein Geruch nach Träumen lag in der Luft. Er zog durch die Straße wie eine Erinnerung oder eine unsichtbare Fahne, getragen von jenen Geistern, die auch die Kutschen lenkten. Charlie atmete tief ein, spürte, wie sich seine Lungen füllten, und fühlte sich betäubt. Die Anspannungen ließen nach, seine Schmerzen schwanden. Für eine Sekunde schloss er die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass sich kleine Feuermotten wie Funken von der Zigarre lösten und quer durch die Luft tanzten. Fröhlich flatterten sie umher, zick, zack, die kleinen Flügel so unglaublich zart und ihre Körper … verpufften zu Rauch, ehe Charlie sie näher betrachten konnte.
Äpfel, Zimt und Träume.
Charlie blinzelte heftig und schüttelte den Kopf, sodass ein stechender Schmerz durch seine Nase hindurchzuckte. Die Motten waren verschwunden, einzig die Zigarre glühte und auf einmal kam ihm der Geruch verdorben vor.
Erneut blinzelte er, sah sich um.
Keine Motten.
Keine Nymphen.
Inzwischen standen einige Leute auf der Straße, allesamt von den Schüssen aus den Häusern gelockt. Mit neugierigen, misstrauischen Blicken beäugten sie Mr. Ethnicas und seine vier Holzgefährte. Charlie beobachtete, wie sie ihre Augenbrauen finster zusammenzogen und die Arme vor der Brust verschränkten, um einander wissende Blicke zuzuwerfen. Der Traumtaucher war hier genauso wenig gewollt wie sein stolzer Einzug in die Stadt.
Empörtes Gemurmel setzte ein, jemand spuckte auf den Boden, und irgendwo hinter ihnen splitterte Glas. Mr. Ethnicas ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Er ritt so entspannt weiter, als sei die Straße ein einsamer Feldweg und die tuschelnden Einwohner Baumkronen im Wind.
»Sie sind überall gleich«, sagte er schulterzuckend, weil er Charlies Blick bemerkte. »Aber es sind nie alle – und manche brauchen einen.«
»Bleiben Sie lange?« Noch eine Flasche knallte auf das Pflaster, wo sie zu einem Haufen glitzernder Scherben zerbarst.
»Ich bin für einen alten Kunden hier. Quasi ein Freundschaftsdienst. – Merkwürdig, wenn ich darüber nachdenke, dass ich ihm nur einmal begegnet bin. Es sollte nicht lange dauern, allerdings …« Er nickte in Richtung der Leute. »… dauern die Dinge immer länger, als man denkt. Bestimmt wird mich der ein oder andere besuchen kommen.«
»Meinen Sie?« Zweifelnd sah Charlie zu der wütenden Meute. Ein Teil von ihm hoffte, Edward und die anderen Jungen zu entdecken. Dann hätte er gewunken, bis sie ihn bemerkten – auf der Kutsche des Traumtauchers, vor dem sich alle fürchteten. Wie sich die Überraschung über ihre Gesichter ausbreiten würde, gefolgt von dem Entsetzen, weil Charlie mutiger war als sie.
Denn er war mutiger.
Er war nicht davongerannt.
Er war kein Feigling.
Aber weder sie noch Toby standen am Straßenrand, und inzwischen konnte Charlie nicht einmal mehr sagen, ob er wirklich seine Stimme gehört hatte. Stattdessen erblickte er den alten Imb Quorin, der aus einem Hauseingang heraus mit seiner Weinflasche winkte – keiner wusste, woher er jeden Tag eine neue bekam – und grinste, sodass die gelben Zähne blitzten. Als sie vorbeifuhren, hickste er grüßend. Charlie hatte bisher keinen Tag erlebt, an dem der Bettler keinen Schluckauf besaß.
»Selbstverständlich«, antwortete Mr. Ethnicas. »Heimlich und mit hängendem Kopf, vielleicht bei Nacht, vielleicht mit viel Schminke im Gesicht – aber sie werden kommen. Sie kommen immer.«
Gezeter.
Geflatter.
Erneut begann das Huhn zu kreischen, schlug mit dem Schnabel gegen die Stäbe des Käfigs, nach wie vor nicht einverstanden mit dessen Größe. Der Anblick erinnerte Charlie an das Pulsieren in seinem Daumen, wo es ihn geschnitten hatte. Rachsüchtig zog er die Plane über das Gitter, sodass der Vogel im Dunkeln saß. Selbst schuld, dachte er zufrieden.
»Junge«, rief jemand. »Das ist ein Hexer!«
Noch immer wusste Charlie nicht, worin eigentlich Mr. Ethnicas’ Beruf bestand – abgesehen vom Kinderschänden, wie es die Märchen behaupteten. Er musste eine Art Heiler oder Wunschverwirklicher sein – zumindest schien das am naheliegendsten. Nur sah er überhaupt nicht aus wie die Ärzte aus der Stadt, sondern glich vielmehr einem Kriegsveteranen.
Eine Frau rannte aus der Menge hervor, mitten auf die Straße und schrie. »Hey Junge, komm da runter. Er ist böse …« Knapp entging sie den Hufen der Stute, erreichte schnaufend die Kutsche. »…, er wird dir die Fantasie aussaugen!« Ihre keifende Stimme verstummte für einen Moment als sie röchelnd nach Atem rang. »Böse …«
Aber Charlie schüttelte bloß den Kopf, denn eine plötzliche Sicherheit hatte von ihm Besitz ergriffen. Vielleicht lag es daran, dass der Traumtaucher ihm seinen Namen verraten hatte – oder daran, dass er keine rauchige Stimme hatte – oder einfach, weil alle gegen ihn waren, denn der Traumtaucher erschien ihm menschlicher. Charlie hatte keine Angst vor dem Mann.
»Junge …« Mit der Hand langte sie nach ihm und versuchte, ihn vom Koffer zu zerren, während sie neben der Kutsche her hetzte. »Ich flehe dich an …« Ihre Augen waren weit aufgerissen, das Gesicht dunkelrot, wobei sie beim Reden spuckte und ihre Nägel in seinen Arm bohrte.
Damit hatte sie eine Grenze überschritten.
Die Stimme des Traumtauchers übertönte den Lärm mit einer solchen Kraft, dass die Umstehenden vor Schreck verstummten. »Genug! Wenn es auch nur einer wagt, mir in den Weg zu treten, werde ich …« Ein Fingerschnipsen, ein überraschtes Taumeln. Die Frau rang um ihr Gleichgewicht, stürzte auf die Straße, ohne dass jemand gesehen hatte, was passiert war.
Sofort sprang sie wieder auf, richtete den Rock, derweil ihr die Haare ins Gesicht fielen wie einer wilden Kräuterhexe. Und ausnahmsweise einmal schwieg sie.
»Ich bin eben kein böser Mensch«, sagte Mr. Ethnicas. »Aber ich lasse weder mich noch meine Begleiter angreifen. Habt ihr das verstanden?«
Niemand antwortete ihm und das schien er auch gar nicht erwartet zu haben. Stattdessen trieb er seine Stute an, die Kutschen wurden schneller und fuhren weiter die Straße hinauf. Allerdings nicht sehr weit, denn noch während Charlie sich zu fragen begann, wohin sie eigentlich wollten, hielten sie an.
»Hier sind wir, drück dir das Tuch auf die Nase.« Der Traumtaucher sprang aus dem Sattel, zog einen Schlüssel hervor und öffnete das Tor zum Stargate. Weinranken rissen und fielen zur Seite, als es aufschwang, und zum ersten Mal seit Langem betrat jemand das Grundstück. Der rote Turm ragte mitten zwischen den Häusern auf, die sich aufgrund des runden Hofes nicht gegen seine Fassade schmiegen konnten und den Kutschen Platz zum Parken ließen. Charlie rutschte vom Koffer, blickte sich um.
Unkraut wucherte wild unter den Wagenrädern hervor, gelber Löwenzahn, der so kräftig zwischen seinen Blättern strahlte, dass er der Sonne Konkurrenz machte. Auch an der Turmfassade klomm Wein hinauf. Grüne Stängel, mit unreifen Trauben, die sich an den Regenrinnen verknotet hatten und jedes Jahr weitere Zentimeter auf dem Weg zum schwarzen Dach gewannen.
Ob das Teleskop noch dort drinnen steht? Charlie hatte den Turm nie selbst betreten und sich stattdessen immer mit den Geschichten des alten Imb Quorin zufriedengeben müssen. Zu gerne hätte er deshalb einmal einen Blick auf das riesige Teleskop und den Nachthimmel dahinter geworfen, auf dem die Sterne wie Tau in einem Spinnennetz glitzerten.
Etwas stieß ihn unsanft in die Knie, sodass er einknickte. Kurz fragte er sich, ob die Legenden vom Traumtaucher stimmten und er ihn jetzt ermorden würde.
»Mr. Ethnicas?« Erschrocken drehte er sich um, nur stand dort niemand. Eine Sekunde lang starrte er durch das Nichts hindurch, hinüber auf die andere Straßenseite hinter dem Zaun. Dann wanderte sein Blick zu seinen Füßen. Ein Koffer wackelte über die Steine davon und hinein in den Turm.
Es war nicht der Einzige.
Rings um Charlie herum floppten plötzlich Beine aus den Lederwänden, sprangen hinab auf den Boden und dackelten in Richtung Tür, wobei sie sich gegenseitig traten und schubsten, oder gefährliche Überholmanöver starteten. Irgendwo schrie das Huhn, Charlie meinte, es mit den Fledermausflügeln flattern zu hören. Wie angewurzelt stand er da, blickte auf die Koffer, blickte zu den pferdelosen Kutschen. Ein Gefühl unbändiger, berauschender Freude machte sich in ihm breit, denn einer seiner sehnlichsten Wünsche hatte sich erfüllt. Das hier war Magie. Magie. – Magie!
Es gab keine Worte, um zu beschreiben, wie er sich fühlte. Charlie musste lachen, während er langsam zu realisieren begann, was das bedeutete. »Magie«, sagte er, lachte noch lauter, bis er wieder Blut schmeckte. Ein stechender Schmerz fuhr durch ihn hindurch und er bemerkte, wie rot sein Hemd inzwischen geworden war.
»Mr. Ethnicas?«
»Junge, Kopf nach vorn.« Der Mann erschien so plötzlich neben ihm, dass Charlie zusammenzuckte. Einen Moment lang sahen sie sich an, dann sagte der Traumtaucher, als könnte er Gedanken lesen. »Jetzt zu deiner Nase.« Er öffnete eine Kiste, kramte darin herum, bis er einen kleinen Beutel hervorzog, dessen linke Seite lediglich aus herabhängenden Fetzen bestand. Etwas bewegte sich darin. »Was zum …« Mit zusammengekniffenen Augen sah Mr. Ethnicas zu, wie sich eine winzige Schere, unterstützt von Messer und Säge durch den Stoff arbeitete. »Was machst du da drin?«, fragte er und öffnete den Beutel im selben Moment, in dem Charlie den Hirschkäfer bemerkte. Den Hirschkäfer, der anstelle eines Geweihs mit den Werkzeugen eines Taschenmessers ausgestattet war. »Träume«, sagte Mr. Ethnicas entschuldigend, befreite das Tier und legte es in eine Dose. Dann wandte er sich erneut dem Beutel zu, zog etwas hervor, seufzte und drehte sich zu Charlie um.
»Sagen Sie, woher ist all die … diese Zauberei?«, fragte der begeistert.
»Kannst du dir das nicht denken? Aus unseren Träumen natürlich. Na ja. Eigentlich aus dem Oraz, aber davon hast du noch nie gehört.«
»Habe ich auch nicht.«
»Haben die wenigsten.«
Eine Gießkanne tanzte so fröhlich über die Steine, dass mit jeder Pirouette rosa Flüssigkeit durch die Luft flog.
»Und was ist das Oraz?«
»Stell es dir wie eine Galaxie vor. Ein Ort, so endlos groß wie die Fantasie eines Menschen. Vielleicht erzähle ich dir einmal mehr davon – irgendwann.«
Charlie öffnete den Mund, aber Mr. Ethnicas lächelte bloß. »Nicht jetzt, Junge. Eine lange Reise liegt hinter mir. Ich kümmere mich um deine Nase, dann gehst du nach Hause.« Er hielt eine Wäscheklammer in die Luft. »Träume sind manchmal recht willkürlich, genauso wie das Oraz. Nach einer gewissen Zeit sollte man aufhören, sich zu wundern.« Damit warf er sie Charlie zu, der sie fing, zu verwirrt, um irgendetwas zu fragen, außer »was soll ich damit?«
»Steck sie dir auf die Nase.«
Einen Moment lang glaubte er, sich verhört zu haben. Das Ganze war so seltsam, dass kein Einwand für mehr Klarheit gesorgt hätte. Charlie zögerte, Mr. Ethnicas hob eine Augenbraue, und … Als Charlie die Klammer aufsetzte, geschah etwas Merkwürdiges. Zuerst war da der stechende Schmerz, wie es ihn nur geben konnte, wenn man auf die bescheuerte Idee kam, sich eine Wäscheklammer auf die gebrochene Nase zu heften. Dann jedoch breitete sich ein warmes Gefühl aus, über die Nasenflügel, das Nasenbein hinauf bis zur Stirn und irgendetwas rückte sich gerade. Es knackste und plötzlich …. Ungläubig fuhr er sich über das Gesicht. Alles war heil und gesund.
»Danke«, stammelte er, zu erstaunt, um mehr hervorzubringen. Charlie starrte ihn an, als wäre ihm ein Engel erschienen, was dem Traumtaucher von Sekunde zu Sekunde unangenehmer wurde.
»Nun«, er schnappte ihm die Wäscheklammer vom Gesicht, »das wäre auch schon alles gewesen. Empfiehl mich in der Nachbarschaft.« Er machte eine ausladende Handbewegung nach draußen. Die Straße hinter dem Tor erschien Charlie wie eine andere Welt, langweilig. Sie hatte ihm nichts zu bieten und es schmerzte, gleich wieder gehen zu müssen, wo es doch noch so viel zu entdecken gab.
»Das kommt also alles aus Träumen?«
»Ja, und nein.«
Ein Ahornsamen sauste kreiselnd durch die Luft, daran ein Seidenfaden, und Charlie entdeckte eine winzige Spinne. Sie war mit dem Propeller verwachsen, drehte ihn blitzschnell, und er wischte die Silberschnur beiseite, ehe sie sich in seinen Haaren verfing.
»Und Sie reisen in Träume hinein?«
»Ja, und nein.«
»Aber …«
»Es gibt einen Ort in jedem Menschen, der das Oraz genannt wird. Nur die wenigsten haben je nach ihm gesucht und kaum einer hat ihn gefunden, denn man kommt nur hinein, wenn man den Eingang kennt.«
»Eingang? Eingang zu was?«
»Das Tor, Junge. Es sind Träume. Wenn wir schlafen, öffnen sie den Weg hinein in eine andere Dimension, wo alle unsere Fantasien und Vorstellungen Wirklichkeit werden.«
Instinktiv fasste Charlie sich an den Kopf. Haare, darunter Haut und darunter sein Schädel. Links und rechts die Ohren, unten der Hals. Platz für Drachen gab es dort nicht. »Ich habe, glaube ich, keines …«, setzte er an, wobei ihm noch im selben Moment bewusst wurde, wie dumm das klang.





























