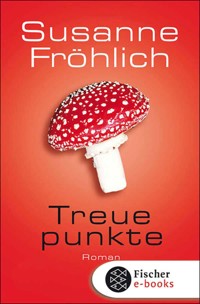
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Andrea Schnidt Roman
- Sprache: Deutsch
Noch bis eben schien Andrea Schnidts Leben – mit kleinen Abstrichen – perfekt zu sein: mein Haus, mein Auto, meine Kinder, mein Mann. Doch Christoph verbringt angeblich ganze Tage und Nächte in der Kanzlei, weil es momentan so viel zu tun gebe und er nun mal keine andere Wahl habe. Merkwürdig nur, dass er dabei so erstaunlich gut gelaunt ist und jetzt auch noch diese gestreifte Krawatte trägt, die sie in ihrem Leben vorher noch nie gesehen hat. Da läuft doch was! »Was der kann, kann ich schon lange«, schnaubt Andrea und tritt die Flucht nach vorne an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Susanne Fröhlich
Treuepunkte
Roman
Roman
Über dieses Buch
Noch bis eben schien Andrea Schnidts Leben – mit kleinen Abstrichen – perfekt zu sein: mein Haus, mein Auto, meine Kinder, mein Mann. Doch Christoph verbringt angeblich ganze Tage und Nächte in der Kanzlei, weil es momentan so viel zu tun gebe und er nun mal keine andere Wahl habe. Merkwürdig nur, dass er dabei so erstaunlich gut gelaunt ist und jetzt auch noch diese gestreifte Krawatte trägt, die sie in ihrem Leben vorher noch nie gesehen hat. Da läuft doch was! »Was der kann, kann ich schon lange«, schnaubt Andrea und tritt die Flucht nach vorne an.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2007
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400115-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für alle Frauen in [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Tausend Dank an Constanze. [...]
Für alle Frauen in meiner Familie: Meine Mama Meine Oma Und natürlich für meine Schwestern, Kathrin und Julia, die beide sehr genau wissen, dass Familie etwas Schönes, aber auch verdammt Anstrengendes ist. Und wie immer natürlich auch für meine Kinder – Charlotte und Robert Ich liebe euch alle
1
Die Karte ist voll. Lauter kleine blau-weiße Klebepünktchen. Ein erhebendes Gefühl. Und welch ein Anblick. Endlich! Nach monatelangem emsigem Sammeln und eifrigem Einkleben kommt jetzt der lang ersehnte Moment. Mit der vollgeklebten Karte in der Hand fühle ich mich wie die Klassenbeste vor der Lieblingslehrerin. Ja, auf mich ist Verlass! Ich bin ein treuer Mensch, eine treue Kundin. Fast schon verwunderlich, dass die Tankstelle kein Feuerwerk veranstaltet oder nicht zumindest einen Tusch spielt.
Jetzt wird sie, die Frau an der Tankstellenkasse, mir gleich den wohlverdienten Preis für mein vorbildliches Verhalten überreichen. Von wegen.
Ich wollte die Pulsuhr und bekomme den Picknickrucksack. Ein Picknickrucksack. Etwas, was der Mensch nun wahrlich nicht braucht. Und das auch noch in Schwarz-Gelb. Was denken sich diese Tankstellenbonusprogrammerfinder eigentlich? Bin ich vielleicht Biene Majas Cousine oder Fanclubmitglied bei Borussia Dortmund? Aber Treuepunkte kann man eben nur da einlösen, wo man sie her hat. Das ist das Grunddilemma. Wie herrlich wäre es, mit den Tankstellentreuepunkten zu Dior zu schlendern und sich mal richtig gehen zu lassen. Oder zu Hermes. Oder wenigstens zu Hennes und Mauritz. Aber so geht es nun mal nicht.
Eine Ehe ist ein bisschen wie eine Tankstelle. Erst ist man überwältigt vom grandiosen Angebot und der permanenten Öffnungszeit. Doch je häufiger man hingeht und je besser man sich auskennt, umso ernüchterter wird man. Viel ist eben nicht alles. Und irgendwann ist auch das größte Angebot überschaubar und genau das, was man will, ist nicht zu haben. Will man es vielleicht gerade deswegen, weil man weiß, dass man es hier nicht bekommen kann? Ist das vielleicht die deutlichste Parallele zur Ehe? Will man auch hier genau das, was man nicht bekommen kann, weil der Partner es sozusagen nicht im Sortiment hat und es im schlimmsten Fall auch nie hatte?
Es gibt verschiedene Tankstellen. So wie es auch verschiedene Ehemänner gibt. Große, mit Ausmaßen wie die von Mega-Supermärkten. Kleine, friemelige, die immer noch so aussehen wie früher – an schlecht beleuchteten Landstraßen gelegen ohne frische Brötchen und schnieke Cappuccinomaschinen, dafür aber mit Truckerkost wie »Pralle Möpse« und Zigaretten. Im Endeffekt spielt das aber keine Rolle. Wenn ich mich nach prallen Möpsen sehne, nutzt mir auch der tollste Cappuccino nichts. Denn wer sich nach prallen Möpsen verzehrt, lässt sich kaum durch einen Cappuccino ruhigstellen. Jedes Angebot ist begrenzt, egal, wie vielfältig es zu Beginn scheint. Was heißt das übertragen auf die Ehe? Gibt es keine Ausnahme, keine Überraschung? Wahrscheinlich nicht. Denn letztlich ist eine Tankstelle eine Tankstelle und ein Ehemann ein Ehemann. Da helfen auch kein Bonusprogramm und keine Treuepunktesammelkarte – was nützt einem ein Picknickrucksack, wenn man keinen braucht?
Muss man sich damit abfinden, dass man eben nicht alles haben kann, was man will? Und was ist eigentlich mit meiner ganz persönlichen Tankstelle? Meinem Mann?
Er ist wie er ist. Das ist gut und schlecht. Gut, weil es angenehm ist zu wissen, wie jemand ist. Wie er reagiert, was er in den nächsten zehn Sekunden tun wird. Berechenbar eben. Schlecht, weil damit alles, was mit Überraschung zu tun hat, wegfällt. Und wo keine Überraschung ist, kommt ganz schnell die große lähmende Langeweile angekrochen, unaufhaltsam wie Lava, und je mehr Langeweile da ist, umso mehr sucht man nach Abwechslung und der tollen Überraschung.
Aber – weder ein Mann noch eine Tankstelle sind Wunschkonzerte. Das Leben ist ja auch keins. Den Spruch konnte ich nie leiden, aber, das muss man ihm lassen, an ihm ist was dran. Die Amis sagen: »What you see is what you get«, und so ist es auch. Was will uns dieser Satz sagen: Augen auf beim Männerkauf?
»Sie könne aach die Bademantel habe, wenn se noch dreizehn neuneneunzich druffzahle«, bietet mir die Verkäuferin an. Ich glaube, sie hat gesehen, wie enttäuscht ich bin. Aber ich habe schon einen Bademantel, den ich nicht anziehe. Mein Bademantelbedarf ist somit absolut ausreichend gedeckt. Bademäntel gehören zu den Klamotten, die sich wenig zum Objekt der Begierde eignen. Bei Schuhen, Hosen oder Schmuck kann ich maßlos werden. Bademäntel gehören nicht in diese Kategorie. Da bleibt meine Kreditkarte völlig ruhig. Wem soll man so einen Frottémantel auch schon vorführen? Ich könnte ihn natürlich für meinen Mann Christoph mitnehmen. Da besteht akuter Bedarf. Sein Bademantel sieht echt Mitleid erregend aus. Ich glaube, er hat ihn zum Abitur bekommen. Oder war es sogar schon zur Kommunion? Ursprünglich weiß, hat er jetzt eine eher gräuliche Farbe und wenn man ihn anhat, sieht man aus wie bei einer schlimmen Magen-Darm-Grippe. Außerdem ist er ihm auch ein wenig knapp. Christoph streitet allerdings vehement ab, sich seit dem Abitur figürlich verändert zu haben, und deshalb kann es natürlich nur an meiner Unfähigkeit liegen, das gute Stück richtig zu waschen. Dabei habe ich mittlerweile schon Angst, den Bademantel nur anzufassen, geschweige denn zu waschen, weil der Stoff so mürbe geworden ist, dass er jederzeit reißen kann.
Ich könnte also nett sein und die 13,99 Euro zuzahlen. Könnte. Andererseits sammle ich seit Monaten diese Punkte und habe mir eine Treueprämie mehr als redlich verdient. Bin ich etwa die Mutter Teresa der Bonuspunktesammlerinnen? Bekomme ich für diesen Anfall von Güte und Selbstlosigkeit Zusatztreuepunkte? Komme ich in den Charity-Klub der Tankstelle? Nein. Definitiv nicht. Und vor allem hat Christoph sich diese Prämie zurzeit wahrlich nicht verdient. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Kein besonders erfreuliches, um genau zu sein. Soll der doch ruhig weiter in seinem gammeligen Kinderbademäntelchen durch die Gegend laufen.
Ich nehme den schwarz-gelben Picknickrucksack. Willi, hier kommt deine flotte kleine Biene! Ich sammle doch nicht, um dann mit leeren Händen dazustehen. Die Jagd kann wahrlich erquicklicher sein als die Beute. Das immerhin lerne ich jetzt hier an der Kasse. Philosophischer Erkenntnisgewinn an der Tanke. Trotzdem: Ich habe mir diesen Rucksack verdient. Oder besser gesagt ertankt.
Ich werde den Rucksack im Auto lassen, dann kann ich bei einer akuten Drive-in-Hamburger-Attacke wenigstens stilgerecht auf Plastikgeschirr essen oder im Stau die Superhausfrau rauskehren. Dem Wartenden im Wagen vor mir ein Gäbelchen reichen. Und wenn die Kinder demnächst irgendwas im Auto knabbern wollen, dann aber bitte mit Teller! Eine gute Hausfrau ist schließlich auf jede Situation vorbereitet.
Christoph ruft an. Das erste Mal für heute übrigens. Früher, als wir uns gerade kennen gelernt hatten, hat er sich fast stündlich gemeldet. Manchmal nur um mir zu sagen, wie wahnsinnig verliebt er ist. In mich! Oder wie sehr er sich nach mir sehnt. Die Zeiten sind vorbei. Wenn er heutzutage anruft, dann geht es normalerweise um logistische Fragen. Wer, wann, wo wen abholt oder Ähnliches. Was will er also jetzt? Mich spontan zum romantischen Essen einladen oder mir sagen, dass ich die tollste Frau überhaupt bin? Nein.
»Es wird ein wenig später, die Michels und ich müssen noch was durchsprechen«, sagt mein Mann. Schon wieder die doofe Michels. Die Frau gehört ja bald zur Familie, so oft wie ihr Name fällt. Was durchsprechen mit Frau Michels! Aha! Mit Miss Sexbombe aus der Kanzlei. Der neuen Allzweckwaffe, hochintelligent, Prädikatsexamen und dazu noch irre hübsch. Ich habe sie noch nie gesehen, aber als ich mal gefragt habe, wie die Michels denn so aussieht, hat mein Mann gesagt: »So wie diese Angelina Jolie, die vom Brad Pitt.« Frau Michels, oder Michelle, wie sie mein Mann mittlerweile nennt, kommt aus Kanada. Sie spricht fließend Französisch, Englisch, natürlich auch Deutsch, und kommt aus wohlhabender Familie. Ich kenne sie nicht, habe aber auch kein wirkliches Interesse daran, sie kennen zu lernen. Die nervt mich schon so. Ohne dass ich sie je gesprochen habe. Ich finde, es gibt einen Grad an Perfektion, der keinen Raum mehr für Bewunderung lässt. Alles sollte doch bitte im Bereich des Menschlichen bleiben. Hätte sie wenigstens einen fiesen Sprachfehler oder einen kleinen Silberblick oder zumindest O-Beine oder eine Zahnspange, dann könnte ich ein Auge zudrücken. Eine Hasenscharte wäre mir ehrlich gesagt noch lieber. So kann ich sie leider nur hassen. Ich bewahre trotzdem oder gerade deshalb Haltung beim Telefonat und wünsche ganz gelassen ein gutes Gespräch. Man darf eifersüchtig sein, es aber möglichst nicht zeigen. »Eifersucht zeugt von einem schwachen Selbstwertgefühl«, meint mein Mann und auf diese Blöße kann ich sehr gut verzichten. Diese Frau Michels deprimiert mich. »Vielleicht gehen wir noch eine Kleinigkeit essen. Du musst also nicht auf mich warten«, raunt mein Mann noch und verabschiedet sich schnell. Schade. Ich hätte ihm gerne noch den Picknickrucksack angeboten, denn dann könnte er mit Frau Michels ab sofort immer lauschig in der Kanzlei essen – mit Belle Michelle, wie Michelle liebevoll hinter ihrem Rücken von den männlichen Kollegen genannt wird. Solche Frauen gehören wirklich verboten. Sie schwächen die Moral der Basis. Also der Frauen, die wie ich die Fronarbeit leisten: Kinder, Küche und Co.
Gut, dass ich nicht in einem Anfall von Großmut den Bademantel für meinen Mann genommen habe. Obwohl, sollte er mal mit Belle Michelle in die Sauna wollen (zum Was-Durchsprechen oder so), kann er ja schlecht sein nahezu verwestes Teil anziehen.
Mein Picknickrucksack und ich fahren nach Hause. Wird sicherlich ein toller Abend! Christoph mit Belle Michelle beim lauschigen Abendessen im Restaurant und ich mit zwei Kindern, die Nahrung haben wollen, in die Wanne müssen und garantiert rumzanken.
Ich sammle die Kinder bei den diversen Freunden ein und freue mich auf übermorgen.
Übermorgen gehe ich zum Arbeitsamt, vielmehr zur Agentur für Arbeit. Ich will endlich wieder einen Job. Die Kinder sind, wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus und ich möchte auch die Chance haben, zu einer Belle Michelle mutieren zu können. Obwohl Belle Andrea schon wesentlich weniger attraktiv und irgendwie auch verdammt affig klingt. Aber mit einem Kollegen (der ganz zufällig haargenau so aussieht wie Brad Pitt!!) abends nochmal was durchsprechen zu müssen, klingt ziemlich reizvoll. Nicht dass ich extrem rachsüchtig wäre, doch allein der Anruf bei Christoph, »du warte nicht, ich muss mit dem schönen Brad noch das eine oder andere klären!« – herrlich.
Bin gespannt, was die Fuzzis von der Agentur für Arbeit mir vorschlagen. Viel erhoffe ich mir nicht. Ich meine, man kennt ja die Berichte aus dem Fernsehen. Die vollen Gänge, die Nummernschalter und die bleichen deprimierten Gesichter der Wartenden. Aber man soll ja nicht verzagen, ohne es überhaupt probiert zu haben. Die Chancen, eine Anstellung zu finden, sind in meinem Fall sicherlich begrenzt. Ich bin nun mal nur sehr eingeschränkt flexibel. Eingeschränkt flexibel. Gibt’s das überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ein Ausschlusskriterium? Aber mit zwei Kindern kann ich nun mal nicht heute in Cottbus und morgen in München sein. Und auch nächtelanges Durcharbeiten scheint nicht kompatibel. Der Hort macht irgendwann zu und die Geduld der Erzieherinnen, was verspätetes Abholen angeht, hält sich in Grenzen. Auf meinen ehemaligen Arbeitgeber, den Sender Rhein-Main-Radio-und-TV, kann ich nicht bauen. Die Fernsehsendung, für die ich gearbeitet habe, »Raten mit Promis«, ist mittlerweile abgesetzt. Die Einschaltquoten waren fast nur noch unter dem Mikroskop sichtbar. Quotenspurenelemente sozusagen. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hatte, dass ich im Team gefehlt habe, aber der Gedanke, dass mein Weggang die Sendung ins Aus katapultiert haben könnte, ist einfach herrlich. Die freiberuflichen Redaktionsmitarbeiter sind entlassen und die wenigen Festangestellten in andere Abteilungen verschoben. Der Moderator, der unsägliche Will Heim, moderiert mittlerweile bei einem Homeshopping-Kanal. Welche Demütigung! Obwohl ich ihn nie mochte, tut er mir doch ein wenig Leid. Ich hätte aus lauter Mitleid fast schon mal ein Sushi-Messerset bei ihm gekauft, konnte mich aber in letzter Minute dann doch noch beherrschen. Vor allem, weil ich zugegebenermaßen eher selten Sushi selbst mache. Ehrlich gesagt nie. Christoph hasst Fisch, und die Kinder zucken schon bei Fischstäbchen zusammen. Von rohem Fisch gar nicht erst zu reden.
Zurück in meine ganz alte Firma will ich einfach nicht und ich glaube, ich hätte auch nicht wirklich eine Chance. Ich habe einige Jahre in meinem erlernten Beruf als Speditionskauffrau gearbeitet. Nur – die Speditionsbranche kränkelt und von der alten Mannschaft sind schon vier geschasst worden. Es sieht also nicht so aus, als würden die auf mich warten. Andererseits – irgendwo da draußen in der Welt der Arbeitenden muss es doch auch eine Aufgabe für mich geben. Ich versuche, optimistisch zu sein. Nicht grämen, bevor es nicht auch einen Anlass dazu gibt. Vorbeugend pessimistisch zu sein, mag helfen, die spätere Enttäuschung zu mildern, allerdings ist man dann auch vorher schon geknickt und das ist im Großen und Ganzen doch eher furchtbar. Also – vielleicht bin ich ja ab übermorgen wieder eine berufstätige Frau. Wenigstens jetzt will ich mich im Rausch dieser wunderbaren Vorstellung suhlen.
Viel Zeit bleibt mir dafür nicht. Claudia, meine neunjährige Tochter, mittlerweile in der vierten Klasse, und Mark mein Sohn, fast sechs Jahre alt, verlangen mal wieder volle Aufmerksamkeit. Sie streiten sich so dermaßen, dass ich kurz davor bin, das Jugendamt anzurufen, um die beiden abholen zu lassen. Ich schaffe es ohne Jugendamt. Eine Stunde später liegen sie abgefüttert und einigermaßen sauber im Bett. Und nun? Ein weiterer aufregender Abend liegt vor mir!
Ich werde auf Christoph warten. Mal hören, wie es mit Belle Michelle war. Außerdem kann ich ihn durch meine Anwesenheit vielleicht auch sanft daran erinnern, dass er schon eine Frau hat. Sicher ist sicher. Es ist nicht so, dass ich rasend eifersüchtig bin, aber seit Christoph zum Juniorpartner in der Anwaltskanzlei Langner aufgestiegen ist, lebt er praktisch in der Kanzlei. Bald werde ich den Kindern Bilder zeigen müssen, damit sie sich wieder erinnern, wie ihr Vater aussieht. Nicht dass sie irgendwann auf der Straße einen wildfremden Kerl anspringen und ekstatisch »Papa« schreien. Christoph ist ein ehrgeiziger Mann – tut all das aber selbstverständlich nur für uns, seine Familie.
Ich gucke die »Supernanny« und bin erstaunt, was es für Kinder gibt. Wo haben die wohl diese Zwergmonster aufgegabelt? Dagegen sind meine ja geradezu wohlerzogen. Immerhin hat mich noch keins angespuckt oder alte Schlampe genannt. Man wird dankbar für kleine Dinge. Ich genehmige mir eine Flasche Wein. Für mich eher ungewöhnlich. So allein vor mich hin zu picheln, macht mir eigentlich keinen Spaß. Aber heute Abend verlangt mein Körper nach Alkohol. Bin gespannt, wann mein Mann sich nach Hause bequemt.
Nach dem dritten Glas Rotwein ist es Viertel nach zehn und kein Christoph weit und breit. Ob ich mal anrufe? Ich meine, er könnte ja einen Unfall gehabt haben oder eine fiese Panne. Vielleicht braucht er Hilfe? Ich wähle seine Handynummer und komme mir schon beim Wählen doof vor. Wie so eine Kontrolltante, typisch eifersüchtige hysterische Ehefrau. Es antwortet seine Mailbox. Ich lege auf. Wie ich das hasse. Nie geht mein Mann an sein Telefon. Wozu hat der überhaupt ein Handy? Wie oft habe ich ihm erklärt, dass ein Handy an sein muss, um seine Funktion zu erfüllen. Ich habe wortreich Horrorszenarien entwickelt: »Stell dir mal vor, ich wäre mit Claudia oder Mark in der Notaufnahme und müsste entscheiden, ob das Bein abgenommen werden soll oder so was Ähnliches. Da wäre es doch sinnvoll, wenn du auch was dazu sagen würdest. Dazu musst du dein Handy aber anmachen.« Er ist durch solche Schilderungen nicht zu erschüttern.
Aber warum hat er jetzt sein Handy aus? Eine Stimme tief in mir drin sagt, dass er an Michelle rumbaggert. Belle Michelle. Versucht gerade, sie in ein Hotelzimmer zu locken, und will dabei selbstverständlich nicht durch häusliche Kontrollanrufe gestört werden. Um diese unsinnige Idee zu vertreiben, trinke ich schnell noch ein Glas Rotwein. Wer weiß, wie die gerade rumfingern? Ich kippe das Zeug runter wie Wasser und hoffe, es ist einer von Christophs guten Weinen. Eine der Flaschen, die erst in drei bis vier Jahren ihr wahres Aroma entwickeln und als Investition für die Zukunft angeschafft wurden. Eine der Flaschen, die ich nicht mal berühren darf. Mein Mann liebt Rotwein. Seine Schätze liegen unten im Keller fein säuberlich in einem eigens dafür angeschafften Weinregal. Christophs Traum ist ein extra Weinkeller. Am besten mit so einem Weinschrank, in dem konstant eine bestimmte Temperatur herrscht. Schnickschnack, meiner Meinung nach. Es gäbe wahrlich Dinge, die wir dringender brauchen könnten. Aber welche Anschaffung wie wichtig ist, darüber waren wir schon immer unterschiedlicher Ansicht.
Noch ein Glas Rotwein später ist es halb zwölf. Ich glaube, der tickt nicht richtig. Wie lange dauert »eben mal was durchsprechen«? Ich könnte ihm ein paar knallen. Der macht sich einen flotten Abend mit Belle Michelle und ich hänge zu Hause rum und schütte mich mit Rotwein zu. Je mehr ich darüber nachdenke, umso saurer werde ich. Meine rationale Seite meldet sich. Ich sollte ins Bett gehen. Die Warterei macht einen ja komplett mürbe. Andererseits – jetzt habe ich so lange ausgeharrt, da möchte ich schon noch sehen, in welchem Zustand mein Ehemann hier einläuft. Und vor allem wann! Einen Telefonversuch mache ich noch. Ich meine, kann ja sein, dass er sich bei meinem letzten Anruf in einem gigantischen Funkloch befunden hat. Die Technik weist durchaus Lücken auf. So sind wir Frauen – suchen immer brav Entschuldigungen für männliches Fehlverhalten. Was sind wir doch für erbärmlich harmoniesüchtige Wesen! Ich wähle und wieder antwortet nur die Mailbox. Diesmal spreche ich drauf. Ich begnüge mich mit einer klaren, knappen Nachricht: »Ruf mich an. Sofort.« Das sollte reichen. Wirklich freundlich war das jetzt nicht, aber immerhin deutlich. Ich hatte eine ähnliche Tonlage wie diese Domina in der Werbung für eine Masochisten-Telefonhotline.
Mittlerweile haben wir Mitternacht. Ich zappe mich durch die Programme. Meine Güte, was läuft nachts für ein Mist. Man hat die Wahl zwischen debilen Quizshows und Werbung für Telefonsexhotlines. Die Flasche Wein ist leer. Eine verzweifelte Moderatorin mit schlechten Extensions (man sieht die Knötchen) redet sich einen Wolf, bietet mehrere Geldpakete für die Lösung einer kinderleichten Aufgabe. Selbst mit meinem rotweindusseligen Kopf springt mich die Antwort geradezu an. Ich habe ja nichts weiter zu tun und wenn ich mal eben ein paar schnelle Euros machen könnte, das wäre doch was. Ich habe noch nie bei einer solchen Quizshow angerufen, aber die Moderatorin fleht ja geradezu darum. Also gut. Ich wähle. Besetzt. Nochmal. Beim dritten Mal habe ich Erfolg. Leider ist nicht die Moderatorin dran, sondern es läuft ein Band. Und das, obwohl zeitgleich die Blondine im Fernsehen bittet und bettelt, man möge sie anrufen. Wo bleibt denn da die Logik? »Püppi, ich ruf doch an, du musst nur drangehen«, denke ich und wähle noch einmal. Auch bei der achten Wahlwiederholung erreiche ich nur das Band. Langsam geht es hier ums Prinzip. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Jeder Anruf kostet 49 Cent. Jetzt habe ich schon so viel Geld vertelefoniert, dass ich die Geldpakete auch wirklich brauchen könnte. Aber noch dringender brauche ich mehr Wein. Wenn man erst mal anfängt zu trinken, kann man sich dran gewöhnen. Ich hole mir eine weitere Flasche aus Christophs heiligem Regal. Eine, die echt teuer aussieht, so eine eingestaubte. Ich hoffe, es ist eine wahre Rarität.
Es ist fünf nach halb eins und von Christoph weit und breit keine Spur. Ich rufe ein letztes Mal an, erreiche wieder nur seine bekloppte Ansage und entschließe mich, gemein zu sein – sehr, sehr gemein: »Schatz, ich bin in der Notaufnahme und weiß nicht, ob das Bein dranbleiben soll. Wo steckst du? Was soll ich tun? Melde dich.« Hä, der wird einen schönen Schreck kriegen. Verdientermaßen. Selbst schuld, wenn er auf keinen meiner Anrufe reagiert. Immer noch quengelt die blöde Blondine im Fernsehen, dass sie keiner anrufe. Zwei Versuche gebe ich mir noch: »Danke für Ihren Anruf.« Na bravo. Scheint der Abend der Anrufbeantworter zu sein. Ich gebe auf. Sowohl bei der Quiztante als auch bei Christoph. Dann halt nicht.
Ich bin saumüde, sogar schon zu müde, um überhaupt noch aufzustehen. Ich kann ebenso gut hier unten auf dem Sofa ein Nickerchen machen, dann höre ich auch, wenn Christoph heimkommt. Ich schaffe es nicht mal mehr, den Fernseher auszumachen (vom Zähneputzen und Abschminken gar nicht zu reden) und falle abrupt in den Tiefschlaf.
Ich werde wach, weil mich ein rotgesichtiger Kerl rüttelt und schüttelt und dabei wüste Beschimpfungen ausstößt. Ich bin so verpennt, dass ich einen Moment brauche, um zu registrieren, dass es sich hier um meinen Mann handelt, der momentan aber auch eine vage Ähnlichkeit mit Rumpelstilzchen hat. Ich sehe ihn wie durch einen Nebelschleier, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich meine Kontaktlinsen zum Schlafen nicht rausgenommen habe. »Lass mich schlafen«, brumme ich ihn an. »Hör mir gefälligst zu«, schreit er auf mich ein. »Du bist doch geisteskrank«, ist der nächste Satz, der in mein Matschhirn vordringt. Geisteskrank, das geht nun aber langsam zu weit. Ich setze mich auf und starre ihn an. »Was regst du dich denn auf?«, will ich wissen. Ich meine, wer war denn bis zum frühen Morgen mit Belle Michelle unterwegs? Er oder ich? Das ist mal wieder typisch. Eine altbekannte Kerl-Strategie. Angriff ist die beste Verteidigung. Aber nicht mit mir. Auf dermaßen bekloppte Tricks falle ich in meinem Alter nun wirklich nicht mehr rein. »Reiß dich zusammen und nenne mich nie mehr geisteskrank«, sage ich so ruhig und klar wie nur möglich. »Ich soll mich zusammenreißen?«, tobt mein Mann und schüttelt mich schon wieder, »Geisteskrank wäre ja sogar noch eine Entschuldigung für dein total hysterisches Verhalten.« Hysterie finde ich fast schlimmer als Geisteskrankheit. Für das eine kann man immerhin nichts. Hysterisch ist ein Lieblingsadjektiv der Männer. Immer wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, nennen sie einen hysterisch. »Lass mich erst mal los, und unter uns – wer führt sich denn hier gerade absolut hysterisch auf?«, kontere ich, wie ich finde, extrem geschickt. »Andrea, es langt. Du bist heute wirklich zu weit gegangen.« Er wird auf einmal relativ ruhig und seine Augen sehen aus wie kleine Schlitze, aus denen böse Blitze rausschießen. Richtiggehend unheimlich.
Jetzt werde ich pampig: »Du kommst mitten in der Nacht von einer geschäftlichen Besprechung und schreist mich an? Verkehrte Welt, würde ich sagen. Da meldet sich wohl dein schlechtes Gewissen.« »Meine Liebe, jetzt rede ich«, zischt Christoph wie eine miese Schlange Sekunden vor dem finalen Angriff. »Ich werde dir jetzt mal erzählen, wie ich den Abend verbracht habe. Und dann bist du dran, obwohl ich mir schon vorstellen kann, wie dein Abend so verlaufen ist«, sagt er und schaut mit angewidertem Blick durchs Zimmer, auf den laufenden Fernseher, die leeren Flaschen und den vollgemüllten Couchtisch. Kriege ich jetzt etwa einen Rüffel, weil ich mich erdreistet habe, ein, zwei Fläschchen Wein zu trinken und dann, ohne aufzuräumen einzuschlafen? »Bitte sehr, wenn es dich stört, kannst du es ja wegräumen«, sage ich und bin schon jetzt zutiefst beleidigt und dazu noch stinksauer. »Es geht nicht um den Schweinestall hier«, rümpft Christoph die Nase und hebt demonstrativ eine der leeren Weinflaschen hoch, »darüber reden wir später.« Oh, die Alkoholkontrollpolizei ist da! »Ich bin schon ziemlich groß und kann trinken, was ich will«, fahre ich ihn an.
»Also, Andrea, jetzt hör endlich zu. Ich war mit Michelle und dem Langner im Büro. Dann haben wir uns Pizza kommen lassen, weil es doch mehr Arbeit als gedacht war, diese Mingner-Sache durchzusprechen. Dazu gab’s bei uns Mineralwasser, wir haben uns nicht zugeschüttet.« Ich stutze. Einmal wegen der Zugeschüttet-Beleidigung, nur weil ich mal ein paar Gläschen Wein getrunken habe, und dann wieso Langner? Hä? Ich dachte, Christoph und Belle Kotzkuh hätten zusammen den Abend verbracht. »Der Langner war dabei? Wieso hast du das nicht gesagt«, pflaume ich ihn an. Das hätte die Sachlage ja komplett geändert, wenn ich das gewusst hätte. »Was spielt denn das für eine Rolle, wenn ich arbeiten muss? Ist doch egal, wer noch dabeisitzt«, bemerkt mein Mann nur trocken. So eine dumme Äußerung kann wirklich nur ein Mann machen. Natürlich spielt es eine Rolle, wer wo dabei ist. Eine entscheidende Rolle. Hätte ich geahnt, dass der Langner das neue Kanzlei-Turteltäubchenpaar Belle Michelle und Christoph geradezu beaufsichtigt hat, wäre mir das Ganze doch piepegal gewesen. »Andrea, jetzt zum Rest des wirklich demütigenden Abends«, nimmt Christoph einen erneuten Anlauf, »wir haben geackert wie die Tiere und uns, statt essen zu gehen, was kommen lassen. Pizza, um genau zu sein.« »Die gute vom Giovanni?«, will ich schnell wissen. »Nee, und das ist, ehrlich gesagt, für die Geschichte auch absolut nicht relevant«, brummelt Christoph. »Hör mir jetzt zu. Als wir kurz nach Mitternacht fertig waren mit dem Plädoyer für die Mingner – eine echt vertrackte Sache übrigens –, habe ich mein Handy eingeschaltet und deine Nachrichten abgehört. Um es kurz zu machen. Um zwanzig Minuten nach zwölf stand ich in der Notaufnahme. Mit dem Langner, der mich netterweise gefahren hat. Ich war so aufgeregt, dass er meinte: ›In dem Zustand, Herr Kollege, lass ich Sie nicht ans Steuer.‹ Den ganzen Weg ins Krankenhaus war ich fast verrückt vor Sorge. Und dann in der Notaufnahme haben der Langner und ich fast unisono gebrüllt: ›Nicht das Bein abnehmen. Bitte nicht. Warten Sie.‹« Er schnauft laut und deutlich, um dann weiterzumachen: »Wie die uns angeschaut haben in der Notaufnahme. Der Notarzt wollte direkt kleine weiße Jäckchen für uns holen. ›Welches Bein?‹, hat der nur immerzu gefragt. ›Das von meiner Tochter oder meinem Sohn, ich bin mir da nicht sicher‹, habe ich geantwortet. ›Wie, nicht sicher? Welche Tochter, welcher Sohn?‹, hat der Arzt nur verwirrt gefragt. So ging das einige Minuten hin und her, bis klar war, dass überhaupt kein Kind in den letzten Stunden in der Notaufnahme gewesen war. Der Notarzt wollte dann in der Psychiatrie anrufen, um uns einen adäquaten Gesprächspartner zu besorgen. So hat er sich ausgedrückt. Einen adäquaten Gesprächspartner. Für den Langner und mich. Einen Psychiater. Einen Irrenarzt. Es hat bestimmt zehn Minuten gedauert, bis wir das abgebogen hatten. Daraufhin bin ich mit dem Langner in die Uniklinik, weil ich natürlich dachte, ich wäre in der falschen Klinik gewesen. Wir sind gerast und ich habe den ganzen Weg über versucht, dich zu erreichen, aber bei uns war ständig besetzt.« Mir schwant so einiges. Meine Dauertelefonate mit der Quizshowmoderatorin, vielmehr der Bandansage. Christoph macht weiter: »In der Uniklinik wieder kein Kind kurz vorm Beinabnehmen. Um uns zu beruhigen, haben sie dem Langner und mir das einzige Kind vorgeführt, das überhaupt infrage hätte kommen können – ein pickeliger Teenager mit einem Vollrausch, der bei unserm Anblick direkt losgekotzt hat. Ekelhaft. Und keine Spur von meinen Kindern. Ich habe dann meine Eltern angerufen, weil ich dachte, vielleicht wissen die was. Die waren total aus dem Häuschen, hatten aber keine Ahnung. Meine Mutter hätte fast einen Infarkt bekommen.« Er räuspert sich und stöhnt: »Da habe ich dann so langsam begriffen, dass das wohl ein Scherz sein sollte. Kein besonders gelungener übrigens. So was hätte ich dir nicht zugetraut. Andrea, das war der peinlichste Abend meines Lebens. Wie konntest du so was tun? Findest du das witzig? Was meinst du, was der Langner jetzt denkt? Wie der mich angeguckt hat.«
»Na ja«, beginne ich meine Verteidigungsrede, »also, du bist nicht ans Telefon gegangen und es war sehr spät. Und dass der Langner dabei war, wusste ich nicht.« Ich zögere einen Moment. Einen Moment zu lange. »Na und?«, schreit Christoph, »du wusstest doch, dass ich arbeite. Da habe ich mein Handy immer aus. Wenn ich arbeite, telefoniere ich nicht. Hast du das immer noch nicht begriffen! Wie blöd kann man denn sein? Du eifersüchtige Ziege!«
Jetzt langt es. Ich werde mich scheiden lassen. Oder etwas in der Richtung. Aber viel mehr Drohungsspielraum bleibt einem als Ehefrau ja nicht. Was fällt dem Typen eigentlich ein? Schließlich wird man doch als verheiratete Frau gegen Mitternacht mal nachfragen dürfen, wo der Herr Gemahl so steckt. Wie kommt der dazu, mich eifersüchtige Ziege zu nennen? Arroganter Blödian. Genau das sage ich auch: »Arroganter Blödian.« »Du solltest eine Therapie machen, so was muss behandelt werden. Du brauchst Hilfe. Das ist ja wohl nicht mehr normal. Das meint die Michelle übrigens auch.« Dieser Halbsatz ist jetzt das berühmte Tüpfelchen auf dem i. Das meint die Michelle auch! Ich denke, die war gar nicht mehr mit in der Klinik? Kann die neben all ihren anderen Fähigkeiten auch noch hellsehen? Oder hat er sie direkt angerufen, um zu erzählen, was seine Frau für eine Irre ist?
Ich springe von der Couch und stürme in Richtung Treppe. Unser Schlafzimmer liegt im Obergeschoss. Leider gibt’s auf dem Weg keine Tür, die ich so richtig zuknallen kann. Schade. Auf der Treppe drehe ich mich nochmal um und schreie theatralisch: »Deine Michelle, die kann mich mal. Die kann mich so dermaßen mal.« Das war sicherlich nicht das Verhalten, welches Beziehungsratgeber in solchen Situationen empfehlen würden, aber sei’s drum. Mit wahrer Größe und Nonchalance hat mein Auftreten wahrscheinlich auch wenig zu tun. Egal. Mir doch wurscht. »Von der Michelle könntest du dir die eine oder andere Scheibe abschneiden«, brüllt Christoph zurück und ich hasse beide. Michelle und meinen Mann. »Dann geh doch zu deiner Michelle«, kreische ich, und als er antwortet: »Gute Idee«, bin ich wie versteinert. Wenn er jetzt geht, dann … Ja, was dann? Renne ich hinterher? Auf keinen Fall. Soll er doch. »Geh doch«, sage ich in sehr bösem Tonfall und starre ihn vom oberen Treppenabsatz aus an. »Okay«, antwortet Christoph, »ganz wie du willst. Ruf an, wenn du wieder bei Sinnen bist.«
Das glaube ich jetzt nicht! Der geht tatsächlich und tut glatt noch so, als wäre das alles meine Idee gewesen. Ich meine, man kann doch so einen kleinen Satz wie, »Dann geh doch zu deiner Michelle«, nicht wirklich ernst nehmen. Er anscheinend schon, denn er nimmt seine Jacke, seine Aktentasche, die schöne cognacfarbene, die er von mir bekommen hat (ein sauteures und wirklich schickes Teil) und läuft Richtung Haustür. Spätestens jetzt sollte ich einlenken. Nicht dass der wirklich die Flatter macht. Andererseits – dann soll er doch. Es gibt ja den schlauen Spruch: Fahrende kann man nicht aufhalten, oder so ähnlich. Während ich noch überlege einzulenken, schlägt er die Haustür demonstrativ zu. Ich höre noch den Motor von Christophs ganzem Stolz, seinem BMW, aufheulen und dann ist Ruhe. Der wird nur zweimal um den Block fahren, beruhige ich mich selbst, der will mich nur kleinkriegen, schocken, das meint der niemals ernst.
Ich warte eine halbe Stunde. So groß sind die Blocks hier eigentlich nicht. Ich gehe zur Tür und schaue auf die nächtliche Szenerie. Kein Geräusch weit und breit. Die Reihenhaussiedlung im Tiefschlaf. Nur ich nicht. Eine verstörte Hausfrau nach einem desaströsen Abend. Nach zehn Minuten wird mir kalt und es ist klar: Er ist weg. Aber wohin bloß? Zu seiner Michelle etwa? Ich könnte mich ohrfeigen. Wieso habe ich nur dermaßen die Beherrschung verloren? Kann es sein, dass ich ihn mit meiner Äußerung direkt dorthin getrieben habe, wo er sowieso hin wollte? Bin ich vielleicht wirklich eine eifersüchtige Ziege? Und wenn ja – hab ich womöglich allen Grund dazu? Wenn die Kinder nicht wären, würde ich eben mal bei Michelle vorbeifahren. Nur um zu gucken, ob sein Auto da irgendwo geparkt ist. Aber ich kann doch schlecht die Kinder mitten in der Nacht allein lassen, oder? Ich meine, an sich haben die beiden einen sehr guten Schlaf. Ich entscheide mich trotzdem gegen den Spionagetrip, nicht zuletzt wegen meines Rotweinkonsums. Stattdessen leere ich noch den kleinen Rest aus der zweiten Flasche und gehe ins Bett. Es nutzt ja nichts, hier rumzusitzen und der Dinge zu harren. Wenn er wiederkommt, werde ich es merken, und wenn nicht, auch.
Werde ich ab morgen allein erziehend sein? Was ist dann mit meinem Job, den ich zwar noch nicht habe, aber so gern hätte? Werden die Kinder psychologische Hilfe brauchen? Was werden meine Eltern zu der Geschichte sagen? Ich könnte heulen. Allerdings mehr aus Wut als aus Verzweiflung. So schnell gibt eine Andrea Schnidt nicht auf, ermahne ich mich.
Das Telefon klingelt. Na also, er besinnt sich und will reumütig zurückkommen. Gut, dass ich nicht angerufen habe. Geduld und Zähigkeit zahlen sich doch aus. Ich stürze aus dem Bett in Richtung Telefon. Ich werde streng, aber doch freundlich sein, und wenn er sich angemessen entschuldigt, werde ich einlenken. Aber es ist nicht Christoph, es sind meine Schwiegereltern. Rudi, mein Schwiegervater ist dran: »Andrea, Herzsche, isch hab uff laut geschaltet, die Inge sitzt nebä mir, sach uns schnell, was macht des Beinsche, wie geht’s de Klaane, is alles in Ordnung, brauchst de Hilfe, mir sin komplett abfahrbereit, du musst nur en Wort sache, mer mache uns schlimme Sorsche«, rattert er los. »Werklisch, Andrea, alles is machbar, isch mein, heut gibt’s so gute Prothese un so Kinner, die gewöhne sich schnell an so was«, will er mich trösten. Was für ein Mist. Jetzt auch das noch. Meine herzensguten Schwiegereltern sitzen mitten in der Nacht abfahrbereit und klein vor Sorge zu Hause und das nur, weil ich ihren Sohn ein wenig ärgern wollte. »Also«, stammle ich los, »das ist alles irgendwie ein riesiges Missverständnis. Den Kindern geht’s gut. Sie schlafen. Mit allen dazugehörigen Beinen. Ohne Prothesen oder so. Geht schnell ins Bett. Wirklich, alles ist in bester Ordnung.« Rudi stockt: »Ja abä de Christoph hat uns doch aagerufe und – also des versteh isch jetzt net. Was is denn eischentlich passiert? Wem fehlt denn überhaupt des Bein?« Aus dem Hintergrund höre ich Inges besorgte Stimme: »Geht’s den Kinnern aach werklisch gut?« »Ja Inge«, rufe ich in den Hörer, »es geht ihnen bestens.« »Du willst uns jetzt net nur beruhische, mer vertrache die Wahrheit, aach wenn mer alt sin. Du kannst mit uns offe spreche, Andrea, geb mer ma unsern Bub«, bleibt Rudi hartnäckig. Ihren Bub, Christoph, wollen sie sprechen. Das wird ein wenig schwierig werden. Wo ihr Bub ist, wüsste ich auch zu gern. Wenn ich jetzt gestehe, dass zwar die Kinder noch ihre Beine haben, aber sich mein Mann deswegen aus dem Staub gemacht hat, dann werden die zwei verrückt. »Der schläft schon«, schwindle ich schnell, schließlich möchte ich nicht, dass sich die beiden noch mehr Sorgen machen müssen. »Er schläft, genau wie die Kinder und ich bin auch so gut wie im Bett. Ich melde mich morgen bei euch«, verspreche ich noch. So gern ich die beiden auch mag, jetzt möchte ich sie nur schleunigst loswerden. Nun ist Rudi ein bisschen beleidigt: »Erst macht uns de Christoph ganz verrückt mit seim verquere Anruf mitte in der Nacht un dann legt der sich mir nix dir nix hin un schläft. Seeleruhisch. Des is net in Ordnung. Wie kann der Bub uns des antun? Es wär doch kaa große Sach gewese, ebe mal dorschzuklingele, um Bescheid zu gebe, dess alles gut is, also des is net in Ordnung.« Ich finde auch gar nichts in Ordnung, rede aber beruhigend auf meine Schwiegereltern ein: »Ich melde mich morgen gleich bei euch, der Christoph braucht doch seinen Schlaf, ihr kennt ihn doch. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint.« Das nenne ich Altruismus. Selbstloses Handeln. Was hätte ich jetzt über den Kerl ablästern können, aber gutherzig wie ich bin, nehme ich ihn sogar bei seinen Eltern in Schutz. »Gut, ei ja, wenn werklisch alles in Ordnung is – der Bub soll ja sein Schlaf bekomme«, brummelt Rudi und ich höre Inge im Hintergrund nur, »seltsam is des alles, merkwördische Geschicht. Isch versteh des alles net«, murmeln. Dann wünschen sie mir endlich brav, »Gute Nacht«. Uff, das wäre geschafft.
Ich schlafe unruhig. Träume wirres Zeug von Christoph und Belle Michelle, der in meinem Traum kleine Teufelshörnchen aus ihrem glänzenden Wallehaar herauswachsen und die immerzu fies kichert.
2
Am nächsten Morgen erwache mit einem Wahnsinns-Kater. Auch das noch. Ich dachte, ich hätte guten Wein getrunken! Was für einen Fusel hortet Christoph denn da im Keller? Der kann mir dankbar sein, dass ich den getrunken habe. Mit Müh und Not zaubere ich den Kindern Frühstück, schütte Milch in Cornflakes, und als sie nach ihrem Vater fragen, behaupte ich, er sei schon im Büro. Man soll die Kleinen ja nicht unnötig in Ängste stürzen. Da Christoph wirklich sehr oft am Frühstückstisch fehlt, glauben sie mir sofort. Kinder haben ohnehin keinen Hang zum Argwohn. Nachdem ich beide weggebracht, Schule und Kindergarten abgeklappert habe, fahre ich auf dem schnellsten Weg nach Hause.




























