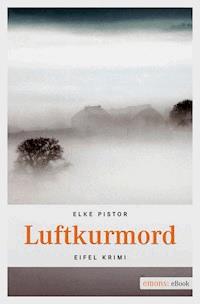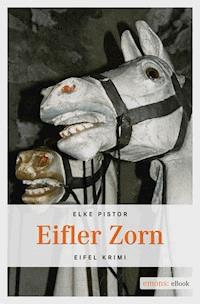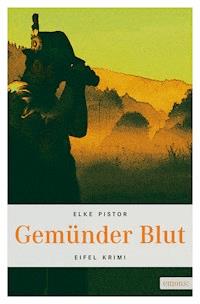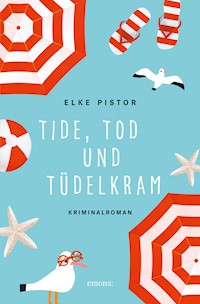8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Kommissarin Verena Irlenbusch kümmert sich um ihre an Alzheimer erkrankte Großmutter, als ihr Dokumente über die Nazivergangenheit ihres Großvaters in die Hände fallen. Sie ist geschockt und stellt sich ganz neue Fragen zu ihrer Familiengeschichte. Gleichzeitig ermittelt sie mit ihrem Kollegen Christoph Todt in drei scheinbar miteinander verbundenen Mordfällen. Die beiden stehen vor einem Rätsel, dessen Lösung sie an neue Grenzen bringt: Wer ist in diesem Spiel Opfer und wer Täter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Kommissarin Verena Irlenbusch und ihre Kollegen Christoph Todt und Leonie Ritte eilen von einem Fall zum nächsten: Ein Journalist verunglückt bei einem inszenierten Autounfall, eine Archivarin wird vergiftet aufgefunden, das nächste Opfer erschlagen. Nur was verbindet die drei scheinbar so gar nicht zusammenpassenden Fälle?
Die Spuren führen das Ermittlerteam zunächst im Kreis, und Verena Irlenbusch hat auch privat alle Hände voll zu tun. Sie kümmert sich um ihre an Alzheimer erkrankte Großmutter. Als sie aus Neugier auf ihre Familiengeschichte in Dokumenten aus der Vergangenheit stöbert, findet sie eindeutige Hinweise darauf, dass ihr Großvater überzeugter Nazi war. Verena ist bestürzt: Wie soll sie diese Erkenntnis mit dem Bild in Einklang bringen, das sie von ihrem liebevollen Großvater hatte?
Verena sieht sich mit ganz neuen Fragen konfrontiert, und vielleicht sind gerade sie es, die ihr dabei helfen können, den Fall zu lösen.
Die Autorin
Elke Pistor, Jahrgang 1967, schreibt Kriminalromane, arbeitet als Seminartrainerin und leitet Schreibworkshops. 2015 wurde sie für den Friedrich-Glauser-Preis, den höchstdotierten deutschsprachigen Krimipreis, nominiert. Sie lebt mit ihrer Familie in Köln.
Von Elke Pistor sind in unserem Hause erschienen:
Vergessen · Treuetat
ELKE PISTOR
TREUETAT
KRIMINALROMAN
ULLSTEIN
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juli 2015
© 2015 by Elke Pistor
© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: © Arcangle / Richard Nixon
ISBN 978-3-8437-1111-1
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Prolog
Das Kind muss sich anstrengen, um Schritt zu halten, schiebt seine Hand fester in die des Mannes. Laub raschelt unter seinen Füßen. Die Nacht schwärzt die Bäume und taucht den Waldboden in Zwielicht. Klamme Feuchtigkeit kriecht wie Nebel über die Kleidung, dringt in jede Faser. Sie sind weit gefahren, und das Kind ist müde und hungrig. Auf dem letzten Stück des Weges war es eingeschlafen und hatte geträumt, obwohl der Wagen so gerumpelt hatte. Es konnte sich nicht an den Traum erinnern, nur an das warme Gefühl. An die Fröhlichkeit, mit der es aufgewacht war. Jetzt ist es dunkel, und sie gehen schon seit einer ganzen Weile. Aber das Kind hat keine Angst vor dem Wald, solange der Mann bei ihm ist. Der Mann ist gut, das weiß es, weil er es ihm immer wieder versichert hat. Er hat dabei gelächelt, ihm über den Kopf gestrichen und versprochen, dass es eine große Tasse Kakao bekommen wird, wenn sie am Ziel angekommen sind. Das Kind liebt Kakao.
»Es ist nicht mehr weit«, sagt der Mann, wendet sich im Gehen zu dem Kind um und nickt. »Bald hast du’s geschafft.«
»Wohin wollen wir?«, fragt es, aber der Mann bleibt stumm. Stapft und stampft weiter und weiter. Nur sein schnaufender Atem ist zu hören. Er geht noch schneller. Das Kind stolpert, der Mann reißt es hoch und zerrt es hinter sich her. Als er sich wieder zu ihm umdreht, ist sein Gesicht verändert. Kein Lächeln mehr. Die Augen zusammengekniffen, die Lippen aufeinandergepresst, die Stirn angestrengt in Falten gelegt. Das Kind schweigt. Jetzt hat es doch Angst und sehnt sich nach seiner Mutter. Aber die ist nicht hier. Hier sind nur der Mann und der Wald und das raschelnde Laub in der Dunkelheit. Der Griff um seine Hand fühlt sich auf einmal nicht mehr sicher an, sondern kalt wie ein Eisenring.
»Wir sind da«, sagt er nach einer Weile und bleibt unvermittelt stehen. Das Kind prallt aus dem Lauf heraus mit der Stirn an die Hüfte des Mannes. Es spürt etwas Hartes, wie eine kleine Tasche, die am Gürtel befestigt ist. »Stell dich hier hin«, verlangt der Mann, löst den Griff und wendet sich dem Kind zu. Er tritt einen Schritt zurück. Sein Mantel öffnet sich, und das Kind sieht die Tasche, gegen die es gestoßen ist. Metall blitzt auf. Der Mann hat eine Pistole. Das Kind erkennt es auf den ersten Blick, weil es schon andere Waffen gesehen hat. Auf Bildern und in der Zeitung, die die Mutter ihm gezeigt hat. Mit Pistolen schießt man Leute tot, hat sie ihm erklärt. Böse Leute. Aber das Kind ist nicht böse gewesen. Es hat sich doch so angestrengt, mit dem Mann Schritt zu halten. Warum will er es jetzt bestrafen?
Das Kind schreit auf. Sofort ist der Mann bei ihm und legt ihm die Hand auf den Mund.
»Sei still!«, zischt er und schaut über die Schulter nach hinten. »Keinen Mucks.« Er drückt fester zu. »Hast du mich verstanden?« Das Kind nickt langsam. »Ja«, will es murmeln, aber wieder drückt die Hand zu. »Keinen Laut, hab ich gesagt.« Drohend richtet der Mann sich auf, schiebt mit einer einzigen Bewegung den Mantel nach hinten und zieht die Pistole hervor. Es klackt leise. Der Mann zielt auf den Waldboden. »Du bleibst hier. Egal, was passiert. Bis ich dich wieder holen komme.«
»Gehst du weg?«, flüstert das Kind und ist gleichzeitig froh und entsetzt darüber. Aber der Mann hat sich bereits umgedreht und geht mit langen Schritten weiter in den Wald hinein.
Das Kind starrt ihm hinterher, bis er nicht mehr zu sehen ist. Es friert. Ein Knacken in der Dunkelheit. Das Kind zuckt zusammen. Das Kind atmet schneller, dreht sich um sich selbst, erst langsam, dann immer schneller, bis sein Atem rasselt. Allein. Bäume. Büsche. Gras und Laub. Das Kind lässt die Arme sinken. Was ist, wenn der Mann nicht wiederkommt? Wenn er gegangen ist und es hier lassen will? So wie die Mutter, die nicht zurückgekommen ist. Das Kind friert. Es zittert. Vor klammer Kälte und vor der Angst, die es jetzt aus dem Unterholz anspringt.
»Sei still!«, hat der Mann mit ihm geschimpft. Er wollte nicht, dass es laut ist. Vielleicht kommt er zurück, wenn es nach ihm ruft. Und dann? Was geschieht dann?
Ein Geräusch von einem Tier schräg hinter ihm. Ein Grunzen oder ein Brummen. Tief und gierig. Das Kind fährt zusammen, schreit auf, dreht sich in die Richtung des Geräuschs. Nichts. Wieder ein Geräusch, diesmal aus einer anderen Richtung. Äste knacken laut. Das Kind spürt sein Herz rasen. Es will weg, egal wohin. Es rennt los, den Pfad entlang, den die langen Schritte des Mannes wie eine Schneise getreten haben. Es stolpert über Äste, verfängt sich in Zweigen, fällt und steht wieder auf, rennt weiter, bis es ein Licht entdeckt und stehen bleibt. Ein Licht aus dem Fenster eines kleinen Holzhauses. Vielleicht sind da Menschen, die ihm helfen können? Das Kind geht langsam weiter. Schritt für Schritt auf das Haus zu. Die Helligkeit verspricht ihm Wärme und Schutz. Immer wieder bleibt es stehen und schaut sich um, nähert sich im Schutz der Baumstämme. Der Wald reicht bis an die Hütte heran. Das Kind glaubt, ein anderes Kind lachen zu hören. Kurz nur, dann ist es wieder still. Gebückt schleicht es bis zur Hütte, presst sich an die Wand und späht über den unteren Rand des Fensters in die Hütte. Es muss die Augen zusammenkneifen, so hell ist das Licht mit einem Mal. Trotzdem kann es den Raum hinter der Scheibe erkennen. Er ist beinahe leer. In einer Ecke erkennt es ein ordentlich gemachtes Bett, daneben einen Schrank und eine Tür. Wieder hört das Kind das Lachen und folgt mit den Blicken dem Geräusch. Ein Mädchen steht auf der anderen Seite des Raumes. Es ist so groß wie das Kind. Strahlend hält es einen Apfel in die Höhe, will hineinbeißen, als eine andere Stimme zu hören ist, die einer Frau. Das Kind versteht die Worte nicht, aber es sieht, wie die Frau aus der Ecke des Zimmers, die das Kind nicht sehen kann, zu dem Mädchen geht, freundlich lächelt und den Apfel nimmt. Das Mädchen protestiert, aber die Frau nimmt es in den Arm, streicht ihm über den Kopf und tröstet es. Das Kind spürt Tränen in den Augen brennen. Die Frau erinnert es an seine eigene Mutter. Daran, wie es war.
Mit dem Handrücken wischt es sich die Tränen fort und drückt die Nase an die Scheibe, weil es mehr sehen will. Weil es sicher sein will, dass die Leute in der Hütte gute Leute sind, vor denen es keine Angst zu haben braucht. Jetzt sieht es auch einen Mann. Er ist groß und sehr dünn, hat dunkle Ränder unter den Augen und schmale Lippen. Aber die Augen und die Lippen lachen, als er etwas zu der Frau sagt und auf den Apfel und danach auf das Mädchen deutet. Blitzschnell ist das Mädchen beim Tisch, greift nach dem Apfel und beißt hinein. Das Kind sieht, wie der Saft nach allen Seiten spritzt. Sein Magen knurrt, und es stellt sich vor, wie der Apfel schmeckt. Diese Leute sind gute Leute. Das weiß es nun sicher. Trotzdem bleibt es stehen, ist ganz versunken in den Anblick. Erst als der Mann aufspringt, einen der beiden Stühle greift und zu der Tür läuft, schreckt es hoch. Die Tür steht offen. Das Mädchen schreit, läuft zu der Frau, flüchtet sich in ihre Arme. Ein Schatten an der Tür. Groß. Dunkel. Ein Blitz, ein lauter Knall, ein weiterer greller Schein und noch einer. Die Ohren des Kindes surren. Die Scheibe vor seinem Gesicht zerspringt in viele kleine Stücke. Es weicht zurück, duckt sich. Dann herrscht Stille. Vorsichtig schaut es wieder in die Hütte. Alles ist beinahe unverändert.
Das Mädchen liegt mit offenen Augen in den Armen seiner Mutter auf dem Boden und schaut unverwandt auf das Kind vor dem Fenster. Das Kind starrt zurück, wartet auf ein Blinzeln, ein Lächeln, eine Regung. Nichts. Nur die dunkelrote Lache neben dem Ohr des Mädchens breitet sich aus. Wird größer und größer. Der Mann und die Frau liegen so still wie das Mädchen. Das Lachen ist aus ihren Gesichtern verschwunden. Das Kind öffnet den Mund, will schreien, aber es bleibt stumm. Gebannt von dem Rot, den stillen Augen, der dunklen Flecken auf dem Holzboden, die sich immer weiter ausbreiten und ineinanderfließen.
Eine Hand legt sich auf die Schulter des Kindes.
»Komm«, sagt der Mann und steckt die Pistole in die Tasche an seinem Gürtel. »Bald sind wir da.«
1. Kapitel
Die Nacht gehörte ihm. Kai Ziegler trat das Gaspedal seines Wagens durch, ließ den Motor aufheulen und drehte die Musik lauter. Die Bässe dröhnten durch das Innere, vibrierten. Der Sänger der Prodigys brüllte seine Wut heraus. Kai Ziegler lachte laut auf, spürte eine Welle des Glücks, ein Gefühl der eigenen Größe und des kommenden Erfolgs. Er hatte es geschafft. Niemand würde ihn je wieder einen Versager nennen, ihn mitleidig belächeln. Niemand. Niemals. Er war der Firestarter.
Morgen war es so weit. Morgen würde er mit der großen Story aufwarten. Die, auf die er sein ganzes Berufsleben lang gewartet hatte. Der Hauptgewinn. Gerade hatte er die letzten Weichen gestellt, nun konnte nichts mehr diesen Zug aufhalten.
Er fädelte sich in den fließenden Verkehr ein, gab Gas und überholte den vor ihm fahrenden Wagen. Hinter ihm hupte jemand. Er ließ das Fenster herunter, streckte die geballte Faust hinaus und zeigte den Mittelfinger. Sie konnten ihn mal. Alle. Restlos.
Ihn interessierte es nicht mehr, ob diese kleine Schlampe heulte und wehklagte oder ob sie ihm drohte. Jetzt saß er am längeren Hebel. Musste nicht mehr kriechen. Nicht mehr ans Geld denken. Diese Story würde ihn nicht nur berühmt machen, sondern auch reich. Und ihm die Anerkennung verschaffen, die er verdient hatte.
Skrupel waren fehl am Platz, aber ohnehin noch nie sein Problem gewesen. Durchstarten. Ohne Rücksicht.
Das Entsetzen im Gesicht seines Gegenübers hatte ihn fasziniert. Die Wut. Die Hilflosigkeit. Hatte ihm ein Gefühl der Macht verliehen. Es gefiel ihm.
Er beschleunigte erneut, blieb auf der linken Spur, blendete auf, wenn jemand nicht schnell genug auswich. Aus dem Weg. Jetzt war er an der Reihe. Er stellte sich die Türen vor, die sich von nun an vor ihm öffnen, und die Wege, die sich ihm ebnen würden. Ab morgen hätte sein Name endlich das Gewicht, das er verdient hatte. Ihm wurde schwindelig.
Das Display seines Handys blinkte auf. Eine Kurznachricht. Mit der rechten Hand griff er danach, öffnete mit dem Daumen die Nachrichtenapp und las den Text. Leere Drohungen. Er lachte auf, warf das Telefon auf den Beifahrersitz und richtete den Blick nach vorn auf die Straße. Was wollten sie ihm schon? Er beschleunigte weiter. Der Motor brüllte. Die Umrisse der Wagen, die er überholte, vermischten sich mit dem Grün des Straßenrandes. Flogen an ihm vorbei. Seine Lider wurden schwer. Er kämpfte dagegen an. »Firestarter«, brüllte er lauter als der Sänger aus den Lautsprecherboxen gegen die Müdigkeit an. Trommelte mit den Handballen auf das Lenkrad. Es half nichts. Wie Blei kroch die Schwere durch seinen Körper, lähmte ihn und ließ ihn doch klar denken. Der Wagen holperte, begann zu schlingern, geriet aus der Spur. Er umklammerte das Lenkrad. Vor seinen Augen verschwamm der Asphalt zu einer grauen Fläche. Sein Fuß suchte die Bremse, trat ins Leere. Was war los mit ihm? Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Nicht jetzt. Morgen wäre sein Tag. Morgen. Ein Ruck ging durch den Wagen, gefolgt von einem lauten metallischen Kreischen und Funkenregen. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er klar und wusste, dass er sterben würde. Jetzt. Kein Morgen.
*
Jedes Wort, das sie über Selbstbeherrschung jemals gehört oder selbst erzählt hatte, war Unsinn. So von der Art, alles sei eine Frage des Willens, dann ginge es schon. Dabei wäre es grundsätzlich ungeheuer hilfreich, zu wissen, was genau man zu wollen hatte. Oder zu tun. Welche einfachen oder halt in ihrem Fall eben ganz und gar nicht einfachen Bewegungen sie auszuführen hatte.
Leonie konzentrierte sich darauf, die vor ewiger Zeit in Fleisch und Blut übergegangenen Abläufe von der einen auf die Muskeln der anderen Hand zu übertragen. Zielen, konzentrieren, Schuss. So war der Ablauf. So sollte er sein.
Es war kalt hier unten, die Luft klamm nach der Nacht. Die Lüftung surrte leise und kämpfte vergeblich gegen die Feuchtigkeit an. Der Schießstand bedurfte einer dringenden Renovierung, aber immer wieder fiel dieses Projekt den chronisch blanken Landeskassen zum Opfer.
Mit der rechten, für sie ungewohnten, Hand hob sie die Waffe auf. Die taube Linke tastete nach dem Magazin, versuchte es zu greifen. Langsam umschlossen die Finger das Metall. Sie stieß die Luft aus und biss sich bewusst auf die Zunge. Der Schmerz half. Schmerz war gut. Er war ein Signal ihres Körpers. Ich bin da, sagte dieses Signal. Ich bin hier. Ich spüre. Zu lange hatten große Teile dieses Körpers keine Reaktionen von sich gegeben. Waren still geblieben, wenn Nadeln in ihn gestochen, er gedreht und gewendet wurde oder fremde Hände ihn gewaschen hatten.
Schädigung des Armnervengeflechts war eine der vielen Diagnosen gewesen, die die Ärzte ihr nach ihrem Motorradunfall präsentiert hatten. Drohende Lähmung der unteren Extremitäten eine andere. Den Rollstuhl hatten sie in ihr Zimmer geschoben, damit sie sich an den Anblick gewöhnen konnte. Sie hatte in dem weißen Krankenhausbett gelegen, zugehört und Interesse geheuchelt. Und es vermieden, den Rollstuhl anzusehen. Das alles galt nicht ihr. Dieser Körper, dieser kaputte Körper war nicht ihrer. Sie war wie zweigeteilt und betrachtete ihn mit Distanz. Sprach von dem Körper, als würde ihr Verstand nicht dazugehören. Keine Einheit mehr. In ihrer Vorstellung von sich selbst waren ihre Beine stark und schnell, konnten ohne Problem zwanzig Kilometer laufen. Ihre Arme waren kräftig und ihr Griff an der Kletterwand zielsicher. Geschickte Finger. So wie es bis zu dieser einen Sekunde vor einem Jahr war.
Leonie atmete tief ein und schob das Magazin ein. Das Geräusch beim Einrasten empfand sie wie eine Belohnung. Sie umfasste mit der linken Hand den Griff, bewegte den Daumen im Zeitlupentempo zum Schlittenfanghebel und betätigte ihn. Ihre Haut prickelte. Der Schlitten glitt nach vorn, die erste Patrone befand sich im Lauf der Pistole.
»Erfreulich gute Fortschritte«, hatte der Arzt vermeldet. Das war über acht Monate her. Eine gefühlte Ewigkeit. »Es wird dauern, und nichts wird hundertprozentig so sein wie früher.« Früher bedeutete vor dem Unfall. Vor dem Koma. Vor der Lähmung. »Verlangen Sie nicht zu schnell zu viel von sich. Sie hatten ungeheures Glück. Sie können wieder gehen. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Danken Sie Ihrem Schutzengel, und gehen Sie’s langsam an.«
Langsam. Das Wort beinhaltete Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Sie, die nie Geduld gelernt hatte, die mit den Fingern trommelte und den Füßen wippte, wenn ihr Gegenüber nicht schnell genug handelte, sprach, dachte, sie musste dem Körper Zeit geben, wieder zu ihr zu gehören. Diese beiden Teile ihres Selbst wieder zusammenzufügen. Im Nachhinein der härteste Teil.
Direkt nach dem Motorradunfall und dem Erwachen war es mit jedem Tag besser geworden. Gebrochene Knochen hatten sich gefügt, Fleisch war abgeschwollen, Blutergüsse hatten sich durch die gesamte Farbpalette gearbeitet und waren schließlich verschwunden. Ihr Sport und Gesundheit gewohnter Körper wollte in seinen Ausgangszustand zurück. Wollte wieder laufen und klettern. Ihr Verstand hasste sein Versagen.
Sie suchte das Fleckziel der Scheibe, legte die Fingerkuppe des rechten Zeigefingers auf den Abzugshahn und spürte den Druckpunkt. Aber das Gefühl war fremd, obwohl es richtig aussah. Als Linkshänder mit rechts zu schießen erforderte mehr als nur Willenskraft. Sie ließ die Waffe sinken, legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Nicht aufgeben. Niemals.
»Von den fünf Wurzeln der Nerven, die Ihren Arm steuern, sind zwei am Rückenmark abgerissen. Im Moment des Unfalls haben Sie sich vermutlich aus einem Reflex heraus am Lenkrad festgekrallt. Durch die Fliehkraft und den Aufprall auf die Motorhaube des Wagens ist der komplette Arm überdehnt worden. Wenn Sie eine Chance darauf haben wollen, Ihren Arm jemals wieder zu bewegen, müssen wir jetzt etwas tun«, hatte der Arzt erklärt. »Wenn wir länger warten, ist es zu lange.«
Leonie hatte nur genickt.
Zwei Jahre konnte es dauern, bis der Nerv nach der Operation, bei der ein kleines Stück Hautnerv an anderer Stelle entnommen und neu eingesetzt wurde, sich neu gebildet hatte. Wenn er es denn tat.
Physiotherapie sollte hilfreich sein. Bewegung, damit die Muskeln nicht abschlafften.
Bis zu dem Moment, in dem sie sich zu bewegen begann, sah man ihr die körperlichen Einschränkungen nicht an. Ihre durchtrainierte, schlanke Statur ließ sie größer wirken als ihre eins fünfundsechzig. Sie hatte während ihrer Auszeit viel Energie darauf verwendet, wieder in Form zu kommen. Äußerlich war es ihr gelungen. Die inneren Verletzungen, den Schock, den sie durch den Unfall erlitten hatte, die Verzweiflung und anfängliche Perspektivlosigkeit, waren nicht sichtbar, aber noch lange nicht verheilt. Wie frische Wunden rissen sie unvermittelt auf und schmerzten. Leonie konzentrierte sich wieder. Sie blinzelte, schloss die Finger beider Hände erneut um die Waffe und hob sie an. Der gesunde Arm trug die Hauptlast, und sie spürte, wie sie zitterte. Atmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Vor ihr das Ziel auf der Leinwand. Der Druckpunkt.
Einatmen. Ausatmen. Konzentration.
Der Schuss riss ihre Arme hoch und drückte Leonie nach hinten. Sie taumelte und stolperte, schaffte es aber gerade noch, wieder Halt zu finden.
»Scheiße!«, brüllte sie gegen den dumpfen Ton unter ihrem Gehörschutz an, riss den Schutz vom Kopf und schleuderte ihn zu Boden. »Scheiße!«
»Hör auf zu fluchen und so auszurasten, Leo. Du bist Beamtin. Das gehört sich nicht.« Ihr Vorgesetzter Walter Rogmann lehnte an der Wand neben der Eingangstür, schob seinen Gehörschutz in den Nacken und kam nun auf sie zu. Sie hatte ihn bis zu diesem Moment gar nicht bemerkt. »Du schaffst das. Ich bin mir sicher.«
»Ich nicht. Das unterscheidet uns voneinander, Walter.« Leonie nahm wieder ihre Position ein, hob erneut die Waffe und zielte. Konzentrierte sich auf den Zielpunkt und versuchte, Walters Anwesenheit auszublenden. Es gab einen Grund, warum er ihr bis auf den Schießstand folgte. Sie hatte Angst vor dem, was er ihr zu sagen hatte. Trotzdem musste sie sich stellen. Drücken kam nicht infrage.
Der zweite Schuss riss sie nicht um, aber es wurde kein Treffer vermerkt.
»Ich bin mir überhaupt nicht sicher.« Laden. Konzentration. Schuss. Wieder nichts. Leonie ließ die Pistole sinken. Ihre Muskeln schmerzten. »Aber ich muss es schaffen, verstehst du? Wenn der Doc mich für den Polizeidienst unfähig schreibt, ist der Ofen aus, und ich kann nach Hause gehen.« Sie wunderte sich über die Leichtigkeit ihres Tonfalls, die Beiläufigkeit, mit der sie ihre schlimmste Befürchtung aussprach. Sie sicherte die Waffe und legte sie auf den Waffentisch. »Ich habe keinen Bock, als Sachbearbeiterin in irgendeiner Firma zu versauern.«
»Wirst du auch nicht.«
»Bisher war ich erst einmal da, um meine Verwendungsfähigkeit zu überprüfen. Der Doc hat noch nichts Endgültiges von sich gegeben.«
»Doch, hat er.« Walter Rogmann lächelte, und ein feines Netz von Fältchen zeigte sich um seine Augen.
»Wann?« Ihre Zukunft. Jetzt.
»Gestern. Sagt jedenfalls das Datum auf dem Schreiben an mich.« Walter Rogmann hielt ihr einen Umschlag hin. Leonie zögerte, bevor sie auf ihn zutrat.
»Hast du’s gelesen?«
»Ja.«
»Und?«
»Lies es selbst, Leo.« Er wedelte mit dem Brief vor ihrer Nase herum. Sie nahm den Umschlag, ohne einen Blick darauf zu werfen, und schluckte.
»Egal was drinsteht, ich will mich bei dir für deine Unterstützung bedanken, Walter. Du hast so viel …«
»… nichts hab ich, Kollegin Ritte. Gar nichts. Nur um das ein für alle Mal klarzustellen: Du musstest dein privates Motorrad nehmen, weil kein Dienstwagen zur Verfügung stand, du angefordert worden warst und Gefahr im Verzug war. Ich hatte dir die ausdrückliche Erlaubnis gegeben. Auch wenn zunächst nur mündlich. So steht es im Protokoll, und so habe ich es unterschrieben. Also war dein Unfall ein Dienstunfall. Alles klar?« Er machte eine kurze Pause, um Luft zu holen. »Denn stell dir mal vor, es wäre nicht so gewesen, und du hättest auf eigene Faust dein Motorrad für die Fahrt zum Einsatzort genommen, weil du eine Kollegin decken wolltest, die aus privaten Gründen zu spät kam.« Walter Rogmann schüttelte mit übertriebener Entrüstung den Kopf. »Nicht auszudenken, nicht wahr? Du hättest nichts als Ärger am Hals, ein Disziplinarverfahren und eine Entlassung in der Tasche. Das will doch niemand, oder?«
Leonie sah ihren Vorgesetzten an. »Nein.« Sie lächelte vorsichtig. »Nein, du hast recht. Das will niemand.« Leonie holte den Brief aus dem Umschlag und überflog ihn.
Viele der medizinischen Fachbegriffe kannte sie mittlerweile in- und auswendig, andere waren neu für sie. Trotzdem dauerte es einige Sekunden, bis sie die Kernaussage verstanden hatte.
Der Arzt hatte ihre Polizeidienstfähigkeit bestätigt. Wenn auch noch mit Einschränkung und Auflagen zur Rehabilitierung, aber mit der ganz klaren Prognose, dass es wieder werden würde. Eine Mischung aus Seufzen und Lachen machte sich in ihr breit.
»Er schlägt das Hamburger Modell für deine Wiedereinarbeitung vor. Ab sofort darfst du stundenweise wieder an den Arbeitsplatz zurück.« Walter Rogmann ging zum Waffentisch, griff nach der Pistole und hielt Leonie die Waffe hin. »Du hast noch zwanzig Minuten, dann fahren wir ins Präsidium. Dienstbesprechung. Also gib dir Mühe.« Er verschränkte die Arme. »Vor allem mach nie wieder so einen Bockmist.«
*
Der kleine Anhänger an ihrem Schlüsselbund lag glatt und weich in ihrer Hand. Heidemarie Alligs war die goldene Kugel sofort ins Auge gefallen, als sie den Laden betreten hatte. Eigentlich hatte sie nichts kaufen wollen, sich nur umsehen zwischen all den schönen Sachen, deren Glanz sie so liebte und mit denen sie sich gern umgab. Spiegel, die den bronzefarbenen Schimmer ihrer Barockrahmen vervielfältigten. Mehrarmige Kerzenleuchter, die wie Blumen aus den Wänden zu wachsen schienen. Kandelaber. Zierliche Anrichten. Geschliffene Gläser. Heidemarie Alligs liebte diese Kleinigkeiten. Sie verliehen ihrem Leben einen Hauch von Luxus, von dem sie bereits als kleines Mädchen geträumt hatte und den sie sich nur in den seltensten Fällen leisten konnte.
Die kleine Goldkugel hatte in ihr Budget gepasst, und jedes Mal, wenn sie ihren Schlüsselbund durch die Finger gleiten ließ, genoss sie das Gefühl auf ihrer Haut.
Heidemarie Alligs öffnete die Tür und betrat ihr kleines Reich im Hinterhof eines dieser größeren Mietshäuser, wie sie in diesem Viertel zahllos zu finden waren. Seelenlose Bauten gegen die Wohnungsnot. Den flachen Hinterhofbau hatte sie zu ihrem Reich gemacht. Strahlend weiße Wände und elegante Dekorationen. Die Kunden wussten es zu schätzen. Fühlten sich wohl bei ihr, begaben sich gern in ihre kundigen Hände. Stets achtete sie auf eine angemessene Kleidung. Nicht zu lässig und nicht zu edel. Professionelle Eleganz. Sauberkeit und Hygiene.
Noch brachten die Hausbesuche das meiste Einkommen, aber mehr und mehr neue Kunden fanden den Weg zu ihr, anstatt sie zu sich zu rufen. Für Heidemarie Alligs fühlte es sich wie der nächste Schritt nach oben an. Eine Art der Anerkennung, die sie sich verdient hatte. Sie war gut in dem, was sie tat, kannte die Tricks und Kniffe, wo sie ansetzen musste, wann eine Massage guttat und wann ein beherztes Zupacken den Kunden Erleichterung verschaffte.
Leise summend nahm sie die Post, überflog die Absender und legte den Stapel auf den kleinen Tisch im Eingangsbereich. Rechnungen und ein wenig Reklame. Die Rechnungen würde sie später sofort überweisen, wie sie es immer tat. Ihr war es wichtig, keine Schulden zu haben. Bei niemandem.
Anders als ihre Mutter. Die hatte sich nie gescheut, auf Pump einzukaufen, bei Versandhäusern so lange zu bestellen und nicht zu bezahlen, bis sie von niemandem mehr beliefert worden war. Die alles in der Wohnung gehortet hatte. Heidemarie Alligs hatte versucht, ihrer Mutter zu helfen, Ordnung in deren Leben zu bringen, bis sie die Sinnlosigkeit eingesehen hatte, mit siebzehn ausgezogen war und ihr eigenes Leben begonnen hatte. Eine Lehre, ein eigenes Einkommen. Geregelt. Adrett. Nicht von Müllbergen bestimmt. Gold und strahlendes Weiß. Aber ihre Mutter hatte sie gefunden, hatte sich ihr aufgedrängt, sie um Geld angebettelt. Heidemarie hatte helfen wollen. Aus der Distanz. Mit dem Abstand, der es ihr ermöglicht hätte, nicht selbst wieder in den Strudel gezogen zu werden. Aber die Mutter hatte auf der Straße vor ihrer Wohnung geschrien. Hatte vor der Tür ihrer Arbeitsstätte getobt. So lange, bis Heidemarie das Gefühl hatte, die mitleidigen und misstrauischen Blicke der Kollegen und Nachbarn nicht mehr ertragen zu können. Sie war geflohen. In eine andere Stadt, mit geheimen Telefonnummern sich versteckt. Tief in ihrer Tasche verborgen lag ein altes Handy. Die einzige Verbindung in ihr altes Leben. Ein Sozialarbeiter kannte diese Nummer, für den Fall, dass der Mutter etwas zustoßen sollte. Sie hatte es stumm geschaltet. Sie wusste nicht, wie sie reagieren würde, wenn es eines Tages klingeln und Nachrichten überbringen würde. Wäre sie erleichtert? Würde sie trauern? Heidemarie Alligs verdrängte den Gedanken. Hier in dieser Umgebung war kein Platz dafür.
Das Fenster im hinteren Bereich knirschte leise, als sie es kippte. Ein paar Minuten Stoßlüften, bevor es Zeit für den ersten Termin des Tages würde. Sie legte die Handtücher zurecht, strich über das weiche Frottee und genoss den sanften Geruch, der von der frischen Wäsche ausging.
An der Eingangstür klingelte es. Heidemarie Alligs runzelte die Stirn. Sie mochte es gar nicht, wenn die Kunden zu früh erschienen. Trotzdem warf sie einen Blick in den Spiegel, strich über ihre Kleidung und zupfte eine Haarsträhne zurecht, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatte. Dann setzte sie ein strahlendes Lächeln auf und öffnete die Tür.
*
Verena zog den Stuhl neben ihrem Kollegen Christoph Todt mit dem Fuß näher zu sich heran und setzte sich.
»Morgen«, sagte sie und schob den Rucksack zwischen ihre Beine, wobei sie darauf achtete, nichts von dem heißen Kaffee zu verschütten, den sie balancierte. Christoph Todt nickte und verzog das Gesicht zu einem angedeuteten Lächeln, eine für seine Verhältnisse schon überschwängliche Begrüßung.
Leises Murmeln füllte den Raum. Etliche Kollegen hatten sich bereits zur morgendlichen Dienstbesprechung eingefunden. Das Licht der grellen Büroleuchten ließ einige von ihnen noch müder und abgespannter aussehen, als sie es ohnehin vermutlich waren. Das KK11 der Kriminalinspektion 1, zu dessen hauptsächlichen Aufgaben die Ermittlungen bei ungeklärten Todesfällen gehörten, hatte in den letzten Monaten, wenn auch nichts Spektakuläres, so doch viel zu tun gehabt. Ein junger Mann war tot in seinem Bett aufgefunden worden, gestorben an einer verdächtigen Schädelverletzung. Es hatte gedauert, bis sie die Umstände so weit klären und eine Tötung hatten ausschließen können. Sie hatten seine letzten Stunden rekonstruiert und mit den Freunden, Bekannten und der Familie gesprochen. Ein heftiger Streit mit der Exfreundin ergab ein naheliegendes Motiv. Sie hatten die Hintergründe mehr als gründlich unter die Lupe genommen, aber am Ende hatte es sich tatsächlich als ein furchtbares Unglück herausgestellt. Der junge Mann war betrunken mit dem Rad von einer Feier nach Hause gefahren und dabei gestürzt. Natürlich hatte er keinen Helm aufgehabt. Laut Aussage des Rechtsmediziners hatte ihm die innere Verletzung noch Zeit genug gegeben, nach Hause und in sein Bett zu kommen. Die Schwellung im Hirn, an der er schließlich gestorben war, musste entstanden sein, während er seinen Rausch ausschlief. Niemand war für den Tod des Mannes verantwortlich außer ihm selbst. Das hatte Verena auch der Exfreundin versucht klarzumachen, die sich darauf versteift hatte, die Schuld an seinem Tod zu tragen, weil er nur wegen ihrer Trennung getrunken hatte. Ihr Bemühen war allerdings ohne einen nennenswerten Erfolg geblieben. Die junge Frau würde noch lange mit dem Geschehen zu kämpfen haben. Verena bedauerte es, hier nicht weitermachen und den Hinterbliebenen einen Weg aufzeigen zu können, wie sie mit dem schrecklichen Ereignis umgehen konnten. Aber ihr Job war erledigt, sobald die Todesumstände geklärt waren und der Fall als gelöst in die Statistik eingehen konnte. Immerhin wies die Kriminalstatistik der Kölner Polizei für das letzte Jahr eine Aufklärungsquote von beinahe hundert Prozent auf. Daran hatten sie und Christoph Todt einen erheblichen Anteil. Trotz ihrer anfänglichen gegenseitigen Abneigung und den daraus resultierenden Schwierigkeiten hatten sie sich von Fall zu Fall mehr zusammengerauft und waren mittlerweile ein gut eingespieltes Team. Jeder akzeptierte die Schwächen des anderen, respektierte seine Eigenheiten und verließ sich auf die Fähigkeiten. Wenn sie ehrlich war und es ihr gelang, ihr schlechtes Gewissen ihrer ehemaligen Kollegin Leonie Ritte gegenüber auszublenden, empfand sie das letzte Jahr der gemeinsamen Tätigkeit als extrem erfolgreich. Sie hatte von seiner längeren Erfahrung profitiert, er von ihren unvoreingenommenen Ermittlungsansätzen. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Dafür nahmen sie die Härte ihres Berufs in Kauf. Der Anblick der Tatorte, deren Grauen immer die Befürchtungen übertraf und deren erbarmungslose Wirklichkeit man nie in einem Fernsehkrimi zu sehen bekam. Der erste Blick auf die Leiche, die Sekunden, die sie brauchte, um einen sachlichen Standpunkt zu finden, der ihr die Ermittlungsarbeit erst ermöglichte. Nicht das fremde Schicksal Oberhand gewinnen lassen. Die Fakten zählten, brachten sie in den Ermittlungen vorwärts. Ergaben die Puzzlestücke, eins nach dem anderen. Christophs nüchterne und sachbezogene Art half ihr. Sie schätzte ihn sehr und arbeitete gern mit ihm zusammen.
Verena drehte sich auf dem Stuhl nach hinten und grüßte die Kollegen in der Runde. Die Stühle waren nicht vollständig besetzt. Die Männer und Frauen saßen in kleinen Gruppen oder zu zweit zusammen. Auch wenn bei den Mordfällen die großen Teams immer wieder neu zusammengestellt wurden, um die vielfältigen und unterschiedlichen Aufgaben bewältigen zu können, hatten sich doch Kernteams gebildet, die gut aufeinander eingespielt waren und in den meisten Fällen gemeinsam an einen Fall gesetzt wurden.
»Ich habe gestern Abend noch die Akte fertig gemacht, damit das endlich erledigt ist. Wenn du Zeit hast, dann guck bitte gleich mal rein und gib dein Okay«, wandte sie sich an Christoph.
»Mach ich.«
»Weißt du, ob es was Neues für uns gibt?« Sie nippte an ihrem Kaffee.
»Werden wir bald erfahren.« Christoph Todt wies mit einer knappen Geste auf die Eingangstür, durch die gerade Walter Rogmann trat. Es dauerte einen Augenblick, bis Verena die Frau hinter ihm erkannte.
»Leo«, sagte sie lauter als beabsichtigt. Walter Rogmann wandte sich ihr und den anderen wartenden Kollegen zu.
»Kollegin Ritte wird ab heute wieder ihren Dienst aufnehmen. Noch nicht Vollzeit, aber jeden Tag einige Stunden, mit der Perspektive, dass es mehr wird. Wir werden von Fall zu Fall entscheiden, wo ihr Einsatzbereich sein wird.« Er berührte Leo leicht am Oberarm. »Ich freue mich, dich nach so langer Zeit wieder in unserer Runde begrüßen zu dürfen, und wünsche dir einen guten Wiedereinstieg.« Er deutete auf die Sitzreihen. »Du findest deinen Platz.« Leo nickte und steuerte den freien Stuhl neben Verena an.
»Du hast nichts davon gesagt, dass du wieder anfangen kannst«, flüsterte Verena ihr zu, nachdem Leo sich gesetzt hatte.
»Rogmann hat mich heute Morgen erst informiert, sonst hätte ich dich angerufen.«
»Ich freue mich für Sie, Frau Kollegin.« Christoph Todt beugte sich vor und reichte Leonie über Verenas Beine hinweg die Hand. »Dann werde ich mich wohl bald nach einem anderen Teampartner umsehen müssen.« Er lächelte freundlich, aber verhalten. Verena rückte mit ihrem Stuhl ein Stückchen nach hinten, damit sie nicht mehr so eingeklemmt zwischen den beiden saß.
»Hauptsache, du bist erst mal wieder da, Leo.« Demonstrativ richtete sie den Blick nach vorn, wo Rogmann die Dienstbesprechung mit der Aufteilung der anstehenden Fälle beginnen wollte. Leo nickte. Christoph verharrte für einen Moment in der Körperhaltung und musterte sie auf eine Art und Weise, die sie an ihre Anfangsschwierigkeiten miteinander erinnerte. Verena hatte nicht vor, sich jetzt auf eine Diskussion einzulassen. Er wusste aus vielen Gesprächen und Erzählungen, wie eingeschworen sie und Leo bis zu deren Unfall gewesen waren. Aber er wusste auch, so hoffte sie, um die Wertschätzung, die sie ihm mittlerweile entgegenbrachte. Beides gegeneinander auszuspielen war das Letzte, was Verena sich vorstellen konnte.
»Heute Nacht wurde eine männliche Leiche aus dem Rhein gezogen. Der Tote weist mehrere Messerstiche auf und hatte keinerlei Papiere, dafür aber eine Tüte Crystal Meth bei sich.« Rogmann blickte in die Runde. »Ebenfalls neu im Angebot haben wir einen Journalisten, bei dem nicht klar ist, ob bei seinem Autounfall vielleicht doch noch jemand anderer die Hände im Spiel hatte. Die Kollegen vom Verkehr haben uns die Sache rübergegeben. Da wartet einiges an Akten.« Er zog ein Papiertaschentuch aus der Hose und putzte sich die Nase. »Verena und Christoph, ihr bearbeitet die Wasser …«, fuhr er fort, wurde aber von Verena unterbrochen: »Wir nehmen den Journalisten. Leo kann den Papierkram machen.«
»Was?«, fragten Christoph Todt, Leo und Rogmann gleichzeitig und starrten sie an.
»Bei dem Fall können wir zu dritt arbeiten. Walter, du hast doch gesagt, da wäre eine Menge Schriftkram.«
»Wer sagt denn, dass ich das will?« Leo kniff die Lippen zusammen. »Ihr müsst auf mich keine Rücksicht nehmen, fangt erst gar nicht damit an«, zischte sie in Verenas Richtung.
»Ich nehme keine Rücksicht, ich dachte nur …«
»Du brauchst auch nicht für mich zu denken.«
»Wenn hier überhaupt jemand denken würde, wäre das auch unbedingt hilfreich.« Christoph Todt verschränkte die Arme vor der Brust. »Es ist komplett egal, welchen der beiden Fälle wir übernehmen, so oder so müssen Sie schauen, wie weit Ihre Kräfte reichen, Frau Ritte.«
»Die reichen schon ziemlich weit. Da bin ich sicher.«
»Rogmann ja anscheinend auch, sonst säßen Sie nicht hier.«
»Diese Diskussion können wir gerne im kleinen Kreis weiterführen«, mischte der sich mit lauter Stimme ein. Ärgerlich stopfte er das Taschentuch zurück. »Jetzt haben wir hier eine Dienstbesprechung, die ich sehr gerne zu Ende bringen möchte.«
2. Kapitel
Das Haus ist dunkel und kalt. Wasser tropft von den Wänden. Wind streicht durch die leeren Fensteröffnungen und bringt Regen mit sich. Das Kind kauert in einer Ecke, zieht den löchrigen Mantel enger um sich, sucht Wärme in der eigenen Umarmung. Es friert. Aber hier ist es heller als in den anderen Räumen, und die Gesichter aus seinen Träumen verschwinden in den Schatten. Hunger frisst sich durch seinen kleinen Leib. Vor mehr als zwei Tagen hat es das letzte Mal etwas gegessen. Da, wo es war, bevor der Mann es weggeholt hat.
Im Haus ist nichts. Keine Möbel. Es muss schon lange verlassen worden sein. Verfällt. Die Haustür ist verschlossen. Die Fenster in der unteren Etage vernagelt, sperren das schale Licht aus. Das Kind hat am Holz gerüttelt, versucht, einen Spalt zu finden, durch den es kriechen und fliehen kann. Vergeblich. Den Sprung aus den oberen Fenstern wagt es nicht. Zu hoch.
Schritte knarzen auf der Holztreppe. Das Kind schließt die Augen, versucht, sich unsichtbar zu machen. Der Mann betritt den Raum. Es kann ihn riechen. Seinen Geruch nach Schweiß und Dreck und etwas, was wie süßes Eisen auf dem Gaumen schmeckt. Das Kind blinzelt durch die vom Weinen verklebten Wimpern. Der Mann legt ein schmales Paket vor die Füße des Kindes, faltet die Hülle aus altem Zeitungspapier auseinander. Brot. Ein winziges Stück Speck. Eine Kartoffel. Er schiebt alles auf das Kind zu. Nickt.
»Iss das.«
Das Kind presst die Lippen zusammen, dreht den Kopf weg.
»Iss es.«
Das Kind zieht die Beine nah an den Körper, legt die Stirn auf seine Knie, umklammert sich selbst und atmet flach.
Der Mann reißt den Arm des Kindes nach oben, packt sein Kinn und presst Daumen und Zeigefinger auf die Kiefer, bis es den Schmerz nicht mehr aushält und nachgibt. Mit einem Schrei öffnet es den Mund. Der Mann stopft das Brot zwischen die Lippen des Kindes. Es schmeckt Schimmel, würgt, aber der bohrende Hunger ist stärker. Es schlingt und verschluckt sich an den Brocken, die sich lösen. Der Mann schlägt es auf den Rücken, heftig. Zu heftig. Es tut weh. Das Kind stöhnt, hustet noch mehr. Der Mann zieht eine Flasche aus der Manteltasche, öffnet sie und drückt sie dem Kind an die Lippen. Es schmeckt modriges Wasser. Der Gestank des Mannes wird stärker, als er sich neben dem Kind niederkniet. Die Schwaden kommen aus dem dicken Stoff des schweren Mantels, aus seinen Haaren und aus seinem Mund. Er starrt ihm in die Augen. Sucht und forscht darin. Dann steht er auf, dreht sich um und geht zur Tür.
»Bleib hier«, sagt er und schaut das Kind noch einmal an. »Wenn du wegläufst, werde ich dich finden.«
*
»Deine Absicht in allen Ehren, Verena«, knurrte Rogmann eine halbe Stunde später und schloss die Tür zu seinem Büro, in das er sie alle drei zitiert hatte. »Aber du solltest dich daran erinnern, wer der Hauptverantwortliche in diesem Laden ist.« Er ging um seinen Schreibtisch herum, setzte sich. »Das bin ich. Und es geht überhaupt nicht, dass du einfach öffentlich meine Entscheidungen infrage stellst.«
»Ich wollte nur …« Verenas Blick blieb an einem Strauß rosafarbener Nelken hängen, die in Rogmanns ansonsten nüchternem Büro seltsam fehl am Platz erschienen. Er brachte sie regelmäßig aus der Mittagspause mit und nahm sie am Abend für seine Frau mit nach Hause, weil es ihre Lieblingsblumen waren, seitdem er ihr bei ihrem ersten Treffen genau so einen Strauß geschenkt hatte. Rogmann hatte ihr irgendwann davon erzählt, und sie hatte den Eindruck gehabt, es sei ihm peinlich. Dabei fand Verena es wundervoll, dass er nach vielen Jahren Ehe noch daran dachte, seiner Frau eine Freude zu machen. Rogmann war ein durch und durch friedfertiger Mensch, der es hasste, mit anderen Konflikte auszutragen, die sich hätten vermeiden lassen. Sein scharfer Ton ließ darauf schließen, wie ungehalten er über die Situation war.
Der schwere Duft der Blumen hing in der Luft und legte sich auf ihre Lunge wie ein altmodisches Parfüm. Sie räusperte sich.
»Ich weiß, was du wolltest, Verena. Und du hast sogar recht. Trotzdem. So nicht noch mal.« Rogmann schaute in die Runde. »Leo soll sich erst mal wieder in Ruhe einarbeiten, bevor sie an einen Fall muss.«
»Wenn ich nur stundenweise arbeiten darf, dann bitte an einem richtigen Fall, Walter. Ich kann meine Kräfte sehr gut einschätzen und weiß, wann es zu viel ist. Und sprich nicht von mir, als wenn ich nicht da wäre«, entgegnete Leo in scharfem Ton.
»Deine Kräfte schon. Aber was ist mit deinem Ehrgeiz, Leo. Ich habe dich heute auf dem Schießstand beobachtet.«
»Und was hast du da gesehen?«
»Jemanden, der um jeden Preis sein Ziel erreichen will.«
»Ist das schlecht?«
»Ja, verdammt, das ist es. Wenn du darüber deine Objektivität in der Sache vergisst. Wenn der Fall nur dazu da ist, damit du dir selbst beweisen kannst, dass du wieder im Spiel bist«, donnerte er. Leo zuckte zurück.
»Du hast mich hierhergeholt, weil du denkst, ich packe es.«
»Der Arzt hat es bestätigt.«
»Er hat meine Knochen, Nerven und Muskeln begutachtet. Nicht mich.«
»Zur Dienstfähigkeit gehört auch die psychische Belastbarkeit. Wenn du die noch nicht hast, kannst du noch nicht bleiben. Egal, was der Doc über deine Knochen sagt.« Rogmann senkte den Kopf und atmete langsam aus. Niemand erwiderte etwas. Nur die Stimmen der Kollegen auf dem Gang vor dem Büro und der gleichmäßige Verkehrslärm von der Straße füllten die Stille.
»Teil mich da ein, wo du es für am besten hältst, Walter«, brach Leo nach einer kurzen Weile das Schweigen. Sie verschränkte die Hände im Schoß und knetete ihre Finger.
»Ich möchte sie wirklich gerne dabeihaben, Walter, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir zu dritt hervorragende Arbeit leisten können«, erklärte Verena.
Walter Rogmann schürzte die Lippen, zögerte kurz.
»Also gut, Leo. Du bist dabei.«, sagte er schließlich. »Und ihr drei habt den Fall. Kai Ziegler heißt der gute Mann.«
»Wo finden wir ihn, wenn wir mit ihm reden wollen?«
»Im Krankenhaus. Auf der Intensivstation. Allerdings ist er zurzeit ein sehr schlechter Ansprechpartner, weil er im Koma liegt.«
»Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert.« Leo betrat ohne anzuklopfen das Büro, nahm sich einen der Besucherstühle und setzte sich neben Verena. Sie legte einen Notizblock auf den Schreibtisch und schlug ihn auf. »Die Ergebnisse der Blutuntersuchung liegen vor. Er hatte Barbiturate intus, und das nicht zu knapp. Er ist nach wie vor nicht ansprechbar, und sie können nicht abschätzen, wie lange das noch dauert. Seine Verletzungen sind ziemlich schwer, und sie halten ihn im künstlichen Koma, damit der Heilungsprozess besser verlaufen kann. Vielleicht hat er Glück. Soll ja vorkommen.« Sie sah zu Christoph Todt hinüber, der den beiden Frauen gegenübersaß, musterte ihn und ließ dann den Blick langsam über den Schreibtisch wandern. »Sie haben umgeräumt. Ich hatte das Telefon immer an der anderen Seite stehen«, warf sie ein und fuhr dann, ohne Christoph Todt antworten zu lassen, fort: »Die Kollegen haben mir aber die Kontaktdaten seiner Freundin und der Uni gegeben …«
»Der Uni? Ich dachte, er wäre Journalist«, unterbrach Verena sie. Christoph hatte in Rogmanns Büro geschwiegen, als es um Leo ging, und auch bisher nichts verlauten lassen, wie er die ganze Sache sah.
»Er arbeitet dort als Dozent. Nicht Vollzeit, sondern nur stundenweise. Aber schon in dem Umfang, dass es ihm ein kleines Grundeinkommen sichert. Bis vor anderthalb Jahren war er noch bei einer Zeitung. Dann hat der Verlag beschlossen, seine festangestellten Redakteure, bis auf die Chefetage, zu feuern und nur noch mit Freien zu arbeiten. Meistens sind das dann die gleichen Leute, nur wesentlich schlechter bezahlt und ohne Sozialleistungen.« Sie machte eine Pause, griff nach dem Wasserglas und trank einen Schluck. »Außerdem habe ich den genauen Wortlaut der Drohung, die er per SMS bekommen hat.« Sie beugte sich vor und blätterte eine Seite des Blocks um. »›Hören Sie auf, solange Sie noch können. Zu viel Neugierde ist lebensgefährlich.‹«
»Konnte das Handy ermittelt werden, von dem aus die Nachricht verschickt wurde?«, brach Christoph Todt sein Schweigen.
»Nein. Es ist ein Prepaidhandy eines Discounters. Zum Versendezeitpunkt der SMS war es in einen Sendemast in der Innenstadt eingeloggt. Andere Daten konnten die Kollegen nicht finden. Entweder ist es wirklich nur zu diesem Zweck gekauft worden, oder es wird nur sehr selten benutzt.«
»Der Wortlaut hört sich eher wie eine Warnung und nicht wie eine Drohung an.« Verena lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
»Stimmt. Aber die Radmuttern des Wagens, mit dem er verunglückt ist, wurden manipuliert. Das spricht nicht für einen Profi.«
»Wissen wir, ob er die Barbiturate freiwillig geschluckt hat?«
»Du meinst, ob da jemand besonders gründlich sein wollte? Erst das Auto manipulieren und ihn gleichzeitig mit Betäubungsmitteln füttern?«
»Zum Beispiel.«
»Der Wirkstoff Diazepam, den sie in seinem Blut gefunden haben, ist nicht ungewöhnlich und hat viele Anwendungsgebiete. Epilepsie zum Beispiel.«
»Ist Ziegler Epileptiker?«
»Bisher weiß ich nichts davon. Auf jeden Fall macht das Zeug süchtig, wenn man nicht aufpasst.« Leo fuhr mit dem Finger an den Notizen entlang und runzelte die Stirn. »Der Doktor hat gesagt, ich solle den rechten Arm und die Hand so oft benutzen, wie es geht, aber meine Schrift sieht immer noch aus wie Hühnerdreck.« Sie nickte. »Ah ja, hier. Ich habe noch mehr an Infos über ihn: Ziegler hätte heute Nachmittag ein Seminar durchführen müssen. Vielleicht habt ihr Glück, und noch nicht alle Studenten haben mitgekriegt, dass er nicht kommen wird.« Sie hob den Kopf, setzte sich gerade und ließ sich dann gegen die Lehne des Stuhls sacken. »Das war’s, was ich in der Kürze der Zeit zusammenbekommen habe.«
»Beachtlich.« Christoph Todt stand auf, nahm seine Jacke von der Rückenlehne des Stuhls und griff nach dem Wagenschlüssel, bevor er zur Tür ging und sie öffnete. »Wie lange man ohne Luft zu holen reden kann, ist beeindruckend«, ergänzte er, ohne eine Miene zu verziehen. »Aber ich danke Ihnen für die wirklich umfassende Auskunft.« Er ging und schloss die Tür lauter als notwendig.
Das Telefon klingelte. Leo riss wortlos ein Blatt aus dem Block und reichte es Verena.
»Hier sind die Angaben zur Uni. Wo das Seminar stattfindet, die Nummer der Sekretärin und so weiter.«
»Danke.« Verena stand ebenfalls auf.
Leo nahm den Hörer ab, meldete sich und hörte schweigend zu. Am Ende bedankte sie sich und legte wieder auf. Sie war bleich geworden. »Das war das Krankenhaus. Ziegler hat es nicht geschafft.«
*
»Ziegler ist tot.« Verena erreichte Christoph Todt vor dem Fahrstuhl. Sie drückte auf den Knopf.
»Sehr unerfreulich. Für ihn und für uns.« Er sah sie kurz von der Seite an, schob die Hände in die Hosentaschen und wippte auf den Fußspitzen auf und ab, während sie auf den Fahrstuhl warteten. »Haben wir das offizielle Go?«
»Wenn wir die Studenten erwischen wollen, bevor sie merken, dass ihr Kurs heute ausfällt, können wir darauf keine Rücksicht nehmen. Leo kümmert sich darum und gibt uns Bescheid. Wir fangen an.« Die Fahrstuhltür öffnete sich, und sie betraten die Kabine.
»Sagt das unsere Chefin?«
»Wieso Chefin?«
Statt einer Antwort hob Christoph Todt eine Augenbraue und wies mit einer ruckartigen Bewegung des Kopfes in Richtung ihres Büros.
»Leo kämpft darum, wieder gute Arbeit als Polizistin leisten zu können. Es bedeutet ihr so viel. Sie war immer schon ehrgeizig, und jetzt wird sie das Gefühl haben, doppelt und dreifach so gute Arbeit abliefern zu müssen.«
»Warum verteidigst du sie? Hat sie das nötig?«
»Warum greifst du sie an? Hast du das nötig?«
»Hab ich sie angegriffen?«
»Ja. Hast du. Jetzt tu nicht so unschuldig. Das war von dir doch nicht als Scherz gedacht.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.