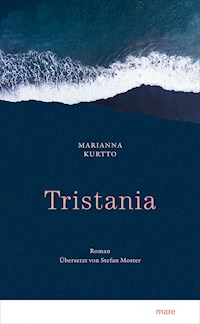
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen, die sich in ihrer heimischen Inselgemeinschaft nicht zu Hause fühlen: Der Fischer Lars lässt Frau und Sohn auf Tristan da Cunha zurück, weil er sich in England neu verliebt hat. Und auch Martha, die Insellehrerin, träumt von einem Schiff, das sie mitnimmt. Sie musste erfahren, dass sie nicht allen Insulanern vertrauen und überdies mit ihrem Mann kein Kind bekommen kann. Und dann, eines Tages, bricht auf Tristan der Vulkan aus. Alle Bewohner müssen fliehen. Nur Jon, Lars' Sohn und Marthas Schüler, wird plötzlich vermisst, und Lars und Martha erkennen, dass ihre Schicksale untrennbar mit der Insel verbunden sind. In poetischer, bildmächtiger Sprache erzählt Marianna Kurtto eine universell menschliche Geschichte voll spannungsreicher Wendungen – mit Figuren, die uns nahe sind in ihren Irrungen und Wirrungen und in ihrer Sehnsucht nach der wirklichen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIANNA KURTTO
Tristania
Roman
Aus dem Finnischenvon Stefan Moster
© 2021 by mareverlag, Hamburg
CovergestaltungNadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
CoverabbildungGaudiLab / shutterstock.com
Datenkonvertierung E-BookBookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-816-8
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-656-0
www.mare.de
Knüpfst du die Bande des Siebengestirns, oder löst du des Orions Fesseln?
Hiob 38, 31
Inhalt
EINS: Tristan da Cunha, Oktober 1961
ZWEI: England, Oktober 1961
DREI: Tristan da Cunha, 1956–1960
VIER: England, Oktober 1961
FÜNF: Tristan da Cunha, Oktober 1961
SECHS: England, Oktober 1961
SIEBEN: Tristan da Cunha, Oktober 1961
ACHT: England, Oktober 1961
NEUN: Tristan da Cunha, Oktober 1961
ZEHN: Atlantik, Oktober 1961
ELF: England, Oktober 1961
ZWÖLF: Kapstadt, Oktober 1961
DREIZEHN: England, Oktober 1961
VIERZEHN: Tristan da Cunha, Oktober 1961
FÜNFZEHN: Kapstadt, November 1961
SECHZEHN: Kapstadt, Dezember 1961
SIEBZEHN: Kapstadt, Dezember 1961
Würden die Wellen etwas fühlen, würden sie sich wundern, wenn sie auf die Insel träfen; sie haben geglaubt, ihr Weg wäre endlos, eigentlich sogar, ihre Welt wäre die Unendlichkeit. Aber jetzt prallen sie auf grauen Stein und schwarzen Sand, werden in die Höhe geschleudert und zerstieben, regnen in wütenden Spritzern auf die empfindungslose Uferlinie herab. Sie drängen immer weiter, Stück für Stück tiefer, sodass die im Sand vergrabenen Schnecken bald das Wasser im Nacken spüren, sich an ihr Zuhause erinnern, es in sich tragen.
Und irgendwo in der Nähe der Schnecken würden die Wellen, falls sie etwas dächten, immer größeren Überraschungen begegnen: Sie träfen auf eine vom Ufer ins Wasser geronnene Skulptur. Diese Skulptur ist schwarz, hat gerade noch vor Hitze gezischt, als sie das Wasser und die Kälte berührte, aber jetzt ist sie verstummt, fest geworden, als wäre ein Wasserfall aus Öl plötzlich erstarrt. Der Wasserfall ist wie für diese Stelle bestimmt, fertig, obschon jeder Mensch, der dieses Bild betrachten würde, verstände, dass der Berg noch unvollendet ist und die Insel, noch lange nachdem unser Verständnis erloschen ist, ihre Ränder umformen wird.
Und wenn der Mensch, der die Stelle sieht, an der die Lava ins Meer eintritt, weiter nach oben ginge, den von hoffnungsvollen Füßen getrampelten Pfad zum Dorf hinaufstiege – wenn er den Spähhügel passierte, ohne zu spähen, weiterginge, ohne an der Weggabelung seine Möglichkeiten zu zählen –, träfe er dort keine Lebenden an, obwohl das Leben nah wäre, der Atem sich in den Tapeten wellte, Fingerabdrücke die Gardinenstoffe befleckten und in den Laken hartnäckig ein menschlicher Geruch läge.
Er würde das Dorf hinter sich lassen und immer weiter hinaufsteigen, einer Gegend zu, in der es weniger Menschliches und die Leblosigkeit des Steins in größerer Dichte gibt, Gras, das sich im Wind biegt, ohne es zu wissen. Er wäre allein. Er begäbe sich immer weiter nach oben, als zöge ihn eine entschlossene Kraft an, zerrte ihn dorthin, wo die Erde endet und der Himmel in seiner Schleierhaftigkeit beginnt. Und dort, ganz oben, befindet sich die Stelle, wo sich das Herz des Berges glühend auftut.
Aber bis an den Rand dieses Herzens ist es ein weiter Weg.
Und weit unten schlagen die Wellen auf das immer kälter werdende Ufer.
Würden sie etwas fühlen, hätten sie vor der Insel so viel Angst, dass sie erstarrten, und es gäbe kein Wasser mehr. Aber sie fühlen nichts, sie schlagen an Land, ziehen sich aufs Meer zurück und lösen sich auf.
Und es bleibt nichts als Formlosigkeit und Wasser und dazwischen schwarze Sandkörner wie erloschene Sterne.
EINS
Tristan da Cunha, Oktober 1961
JON
Heute liege ich länger im Bett als an den anderen Morgen und sehe zu, wie das Sonnenlicht über die Vorhänge auf die Zehen zu schleicht. Ich muss nicht darum bitten, ausschlafen zu dürfen, denn heute ist Samstag. Heute bleibt die Tür der Schule zu, die Kinder knistern nicht mit ihren Heften, und auch die Lehrerin eilt nicht den Hügel hinauf und wischt sich dabei die letzten Reste vom Schlaf aus dem Gesicht.
Das Licht schleicht, aber etwas saust geschwind über die Wand: eine Ameise, eine Soldatin, die sich von ihrer Familie wegverirrt hat. Sie bleibt stehen, schwenkt die Fühler, korrigiert die Richtung und läuft weiter.
Auch Mutter schläft heute länger. Erst jetzt höre ich, wie sie aufsteht, sich in der Küche zu schaffen macht und vor sich hin summt. Die Melodie ist immer die gleiche: Mutter kocht Wasser und gießt es in die Kanne, in der Teeblätter warten, die schon einmal gezogen haben. Gedankenverloren liest sie an der Wand die Seite aus einer alten Zeitung, die als Tapete dient. Die Zeitungsseite zeigt das Foto einer Katze, sie wurde vor langer Zeit irgendwo weit weg aus einem brennenden Haus gerettet. Auf der Handfläche des Feuerwehrmanns sieht sie aus wie eine Wunde.
Wenig später hat sich Mutter ans andere Ende des Raums begeben. Sie steckt sich die Haare zu einem losen Dutt hoch und bindet ein gefärbtes Taschentuch darüber.
Als sie sich meinem Zimmer nähert, höre ich nur das Rascheln ihrer Kleider. Sie öffnet die Tür und lugt herein, sodass die Tür möglichst wenig knarrt.
Ich spiele den Schlafenden.
Meine Mutter spielt die Mutter.
Sie schließt die Tür hinter sich und geht.
LISE
An diesem Morgen macht Lise einen Spaziergang, aber auf Tristan kann man nicht spazieren gehen wie anderswo. Man kann nicht gehen, wohin man Lust hat, denn es ist eine Insel, die ein Berg ist, zwei Kilometer hoch, ozeantief und von Schluchten gespalten.
Es ist Frühling. Die Sonne verströmt Gelb und Weiß, der Wind saust zwischen Häusern und Sträuchern hindurch und lässt alles lebendig erscheinen.
Lise zieht einen langen Rock und einen Pullover an. Sie tritt aus der Tür und geht die mittlere Querstraße des Dorfes entlang, deren vorletztes Haus ihr Zuhause ist, und bald erreicht sie die Gabelung, auf die alle Straßen zulaufen und wo aufgerichtet drei Steine stehen. Es heißt, die Steine seien Grabsteine, unter ihnen lägen die ersten Bewohner der Insel, die Männer, über deren Schicksal viele Geschichten umgehen – so viele, dass die Wahrheit vorzeiten schon überdeckt wurde wie die Leichen, die niemals gefunden worden sind.
Auf den Steinen steht nichts. Aber da sind sie und geben der Drei-Steine-Gabelung den Namen, dem allgemeinen Treffpunkt im Dorf, wo Lise sich heute mit Elide trifft.
Elide kommt spät, wie immer; sie ist immer voll von den Sorgen des Familienlebens, von häuslichen Pflichten und Kinderkrankheiten.
»Hilde hat wieder die ganze Nacht wegen ihrer Ohren geschrien«, sagt sie und küsst Lise auf die Wangen.
»Das arme Mädchen.«
»Du kannst von Glück sagen, dass Jon schon so groß ist. Und gesund.«
»Da hast du wohl recht … «, sagt Lise und lächelt, während sie an den Jungen denkt, der als warmes, weiches Bündel in seinem Zimmer schläft.
Nur anderswo im Haus ist es kalt.
»Gehen wir?«, fragt sie und hebt ihre ausgefransten Rocksäume.
Sie gehen von der Weggabelung aus weiter, zuerst an Tildas Haus vorbei – »Eines Tages wird dieses Haus noch in der Erde versinken«, sagt Elide – und dann vorbei an der Konservenfabrik, wo Krebse und Fische eingedost werden. Hinter der Fabrik fängt der Weg an, der die Zigeunerschlucht streift, und den sie zur Schafsebene hinaufgehen.
Auf halber Strecke bleibt Elide stehen und stützt sich auf die Knie.
»Warum kommt es mir so vor, als wäre die Ebene weiter oben als sonst?«
»Vielleicht hat der Berg Steine verrückt, um uns zu ärgern«, antwortet Lise, »oder es liegt an unseren Beinen.«
»Das kann nicht sein. Wir haben die Beine von Steinböcken!«
Am Ziel angekommen ist auch Lise außer Atem und erhitzt. Sie zieht den Pullover aus, wendet sich der Aussicht zu und sieht den blauen Himmel als Kuppel über ihnen ruhen. Alles unter dem Himmel ist klar: das Gras, das Meer, die Fischerboote wie ins Wasser gefallene große Vögel. Es ist, als leuchteten sogar die Algen unter der Wasseroberfläche.
»Schön«, sagt Lise.
»Das wird ein guter Tag«, meint Elide.
Lise dreht sich zum Berg um und blickt auf die Schafe, die langsam und sorglos am Hang grasen, ohne um etwas anderes zu wissen.
Sie beschirmt die Augen mit der Hand und sucht unter den Tieren diejenigen, die am Ohr das von ihrem Mann hineingeschnittene Zeichen tragen.
JON
Jetzt bin ich bereit: Jetzt stehe ich auf, ziehe die Vorhänge zur Seite und lasse das vor Freude zuckende Licht mein Zimmer erobern.
Das Fenster ist fleckig, aber der Himmel glänzt an jeder Stelle.
Ich schlurfe in die Küche und wickle das Brot aus dem weißen Handtuch. Mutter hat für mich gebacken, die Finger im Teig versenkt und ihn geknetet, den Ofen vorgeheizt und das Brot genau so gebacken, dass ich davon essen möchte.
Ich hole die Butter aus der Kammer, streiche sie aufs Brot und nehme den Tag entgegen, der allmählich seine Form annimmt.
Nachdem ich gegessen habe, setze ich mich vor das Regal, um mir ein Buch auszusuchen.
Ich bin stolz auf meine Sammlung, denn es gibt auf der Insel nicht viele Bücher, nicht einmal Schulbücher, aber bei uns füllen sie ein ganzes Regal. Mein Vater hat sie von seinen Reisen mitgebracht, obwohl er noch vieles andere dabeihatte und der Platz begrenzt war – aber für Wissen ist immer Platz, sagte er, und für Geschichten, die uns zu Menschen machen, fügte er hinzu und reichte mir die Bücher, die so viel wogen, dass ich in die Knie ging.
Die Väter der anderen sind nie so weit weggefahren. Die Väter der anderen haben Vogeleier und Guano von Nightingale geholt, aber Nightingale ist nah, man segelt in wenigen Stunden hin, und es gibt dort keine hohen Gebäude oder bunten Autos. Dort gibt es nur Vögel, und die Vögel haben endlos zu tun.
Die Väter der anderen blieben bei ihren Fahrten eine Nacht weg oder zwei, und wenn sie zurückkehrten, klagten sie darüber, wie anstrengend es gewesen war. Man musste sie ausruhen lassen, ihre Hände schmerzten und die Beine taten ihnen weh, aber mein Vater wurde nie müde. Nein, obwohl er die in den Bündeln versteckten Süßigkeiten von weiter weg holte, als man sich vorstellen konnte; er war wochenlang weg, so viele Wochen, dass ich beim Zählen durcheinanderkam und die Tage zu einer gleichmäßigen, vom Warten gefärbten Masse wurden.
Auch für meine Mutter veränderten sich die Tage und wurden undeutlich, wenngleich sie das zu vertuschen versuchte. Es kam etwas seltsam Schrilles in ihre Stimme, ihre dunklen Augen verblassten, und sie geriet beim Zählen nie durcheinander, da bin ich mir sicher – aber wenn ich sie manchmal fragte, wann Vater kommt, sagte sie, sie wisse es nicht, iss jetzt deinen Teller leer, sagte sie mit fremder Stimme und ging in ein anderes Zimmer, um alleine zu zählen.
Und wenn mein Vater endlich zurückkehrte, fühlte ich mich viel größer als bei seiner Abreise. Er watete ans Ufer, die Leute ringsum zerstoben wie Rauchvögel in der Luft, und es gab nur noch meinen Vater, das Bein meines Vaters, an das ich mich klammerte, und seine Worte: »Was ist denn das für ein großer Junge!«
Ich wollte platzen vor Stolz, denn der große Junge war ich, und weil alle auf ihn gewartet hatten, auf meinen Vater, in dessen Augen ein geheimes Wissen über die Außenwelt glänzte.
Aber ich konnte eigentlich nicht sonderlich groß sein, denn mein Vater hob mich hoch wie einen abgebrochenen Zweig.
Er befestigte den Zweig wieder an dem Baum, der er selbst war, und da kam es mir vor, als wäre das Leben ein einziges Wachsen direkt in den Himmel hinein.
LISE
Nachdem Lise und Elide die Schafe in Augenschein genommen haben, steigen sie den Berghang wieder hinab: gehen an der Fabrik, an der Drei-Steine-Gabelung vorbei bis an den Spähhügel und von dort hinunter zum kleinen Strand.
Am Strand schmeckt Lise das Salz. Sie stellt sich das Leben im Meer vor: die bedächtigen Korallen und die silbern wallenden Schwärme der Fische, die Wale wie glitschige Planeten. Sie stellt sich auch das vor, was tot ist, die am Grund zerbröckelten Krebse, die Seemänner, die sich nie in Sicherheit bringen konnten – aber die Gedanken sind zu groß, besser man konzentriert sich auf kleine Dinge, nimmt eine Muschel in die Hand und streichelt ihre leblose Oberfläche.
»Schau nur, was für schöne Farben«, sagt Lise und zeigt Elide die Muschel. Die Freundin nickt, versteht aber nicht, warum man schmutzige Dinge anfassen soll anstatt die wenigen sauberen.
Elide ist derart im Alltagsleben verstrickt, dass sie das Wunder nicht sieht, in dem sie lebt. Sie kocht in riesigen Töpfen und klagt über den Wind und die Sonne und, wenn es regnerisch ist, über den Regen. Sie hätte gern hellere Haut. Sie schaut auf die mit Schmuck behängten Frauen auf den Tapeten und kommt sich wie eine verdorbene Perle vor. Sie hat harte Fersen, vom Spülwasser raue Hände und sechs windzerzauste Kinder sowie einen Mann, der mit den Augen lacht, weil ihm im Mund ein großer Zahn fehlt.
Lise hat ein Kind, ihr Mann ist fort. Ein am Grund zerbröckelter Krebs oder einer, der ans Ufer kam und sich einen neuen Panzer wachsen ließ.
Lise hält sich die Muschel ans Ohr, hört aber nichts.
Sie wirft sie ins Wasser. Plötzlich erinnert sie sich an die Kindheit, an die langen Stunden am Strand, als sie und Elide den Hunden aus dem Handgelenk Stöckchen warfen; sie hatten mit den Jungen Krebse gefangen, ein Stück Fleisch an die Schnur gebunden und als Gewicht einen kleinen Stein. Dann hatten sie gewartet. Wenn ein Krebs kam und nach dem Köder tastete, konnte man ihn einfach aus dem Wasser pflücken, und wer den größten fing, wurde mit einer Krone aus Stirnstacheln gekrönt.
Die Krone stach, aber man trug sie stolz bis nach Hause.
Jetzt hat sie nur ein Taschentuch auf dem Kopf, so glatt, dass es verrutscht.
Lise rückt es zurecht.
»Gut siehst du aus«, sagt Elide.
»Danke. Aber das nützt mir nichts.«
»Vielleicht solltest du … Es wäre an der Zeit.«
»Elide, nein. Darüber haben wir schon mehr als einmal geredet.«
»Du bist gerade mal etwas über vierzig. Vergeude deine Jugend nicht!«
»Was man sich alles anhören muss. Wenn man alt wird.«
»Wenn du alt bist, was bin dann ich? Und ich fühle mich nicht so.«
»Du hast Kinder, die dich jung halten.«
»Das wüsste ich aber. Und außerdem hast du Jon!«
»Ja, aber Jon ist so ein … kleiner Erwachsener. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er klüger daherredet als ich.«
»Soll er doch. Aber tut er auch etwas?«
Lise spürt Wut aufsteigen. Warum kritisiert Elide ihre Entscheidungen, ihren Sohn? Sie selbst nörgelt ja auch nicht an Elides Kindern herum, die mit ihren endlos langen Gliedmaßen und schrillen Stimmen durchs Dorf rennen.
Jon macht Jon-Sachen, möchte sie sagen, wischt sich aber nur Sand von den Kleidern. Ein Teil gerät unter die Nägel, sieht dort nach Asche aus.
»Nun gut, Zeit, nach Hause zu gehen«, sagt Elide. »Die Kinder haben bestimmt schon Hunger.«
»Lassen wir die Kleinen nicht warten«, erwidert Lise und denkt an Brot, an eine Jungenhand, die Brot umklammert.
Die mit einem zu scharfen Messer die zu harte Kruste schneidet.
JON
Ich weiß noch, wie meine Mutter einmal, vor hundert oder tausend Jahren, im Garten am Apfelbaum lehnte und mein Vater am Fenster und sie sich anschauten.
Ihre Blicke bildeten einen Strahl, der den Garten durchstach.
Vater hatte sein Buch unterbrochen. Er ließ den Kaffee auf dem Tisch kalt werden und den Fisch in der Pfanne stinken, alles ließ er liegen wegen einer Frau, die am Apfelbaum lehnte.
Und als er das Fenster aufmachte, ging Mutter am Strahl entlang hin und kletterte hinein, als hätte sie das schon immer so gemacht.
Sie duftete nach Zucker. Duftete nach nackten Schultern.
Und ich war draußen und schaute auf das geschlossene Fenster, in dem sich Licht und Schatten spiegelten.
Sie bildeten senkrechte Spuren.
LISE
Als Lise und Elide vom Strandweg auf ebenen Boden kommen, richtet Lise den Blick auf den Berggipfel. Der Schnee leuchtet weiß wie immer.
Aber etwas hat sich verschoben: Den Gipfel umgibt ein Lichtring, für den man nicht leicht eine Erklärung findet. Es ist schwer zu sagen, was sich verschoben hat, aber Lise weiß, dass man es nicht mit einer Handbewegung rückgängig machen könnte.
Sie beschleunigt ihre Schritte.
»Wieso hast du es auf einmal so eilig?«, fragt Elide.
»Ich frage mich bloß, ob Jon zurechtkommt«, antwortet Lise, denn sie weiß, dass es sinnlos ist, Elide etwas über den Berg zu sagen.
»Natürlich kommt Jon zurecht. Der sitzt bestimmt im Garten und liest, was sonst? Er schlägt nach seinem Vater«, sagt Elide, lacht auf und merkt erst dann, dass sie etwas Falsches gesagt hat.
Aber diesmal macht es nichts, nicht jetzt, weil Lise an den Berg denkt und nicht an den leeren Platz am Esstisch, nicht an die toten Blumen, die sie im Garten vergrub, um die lebenden wachsen zu lassen.
Elide geht schneller, um mit Lise mitzuhalten. Bald werden sie die Drei-Steine-Gabelung erreichen, wo sich ihre Wege trennen, und dann wird Elide froh sein, dass sie nicht Lise ist, obwohl diese dickere Haare hat und eine schmalere Taille, wo ein Mann gut Halt fände.
Aber Lars ist fort.
Paul hat wenige Zähne und die Hände voller Blasen, aber er ist wenigstens hier: Er bringt Kartoffeln vom Kartoffelacker mit und Äpfel von Sandy Point, tötet den Ochsen, wenn es Zeit dafür ist. Er sitzt mit Elide und den Kindern beim Abendessen, auch wenn er oft schlechte Laune hat, und wenn er mal gute hat, hält es nie lange an.
Nachts schnarcht er, dass es die Nachbarn hören.
»Vielleicht hast du recht … «, sagt Lise. »Jon hat sich allein immer wohlgefühlt.«
»Im Gegensatz zu meinen kleinen Affen«, sagt Elide, und Lise zuckt zusammen.
Dann erreichen sie die Gabelung und hören die altbekannte Stimme.
Die alte Henderson ist die inoffizielle Hebamme der Insel, die auf der Höhe der Gabelung wohnt, in der dritten Querstraße des Dorfes, in der, die am dichtesten am Berg und am weitesten vom Meer entfernt liegt.
Als sie Lise und Elide näher kommen sieht, eilt sie aus dem Haus und lädt sie zum Kaffee ein.
»Was für ein schöner Zufall!«, ruft sie, als die Gäste sich beim Eintreten bücken.
»Stimmt«, sagt Lise, obwohl sie nach Hause möchte und genau weiß, dass der Zufall hier nicht beteiligt ist.
Die Alte schaut sie mit ihren tief liegenden Augen an und fragt: »Aber warum so ein besorgtes Gesicht?«
»Ich denke nur nach.«
»Immer so nachdenklich, die Lise … «, sagt die Alte, »grübelt für die ganze Insel über alles nach! Dabei ist an so einem kleinen Ort gar kein Platz für viele Sorgen … «
»Stimmt«, antwortet Lise, denkt aber, dass die Sorge kein Volumen und die Trauer keine Menge kennt.
Als die Alte Kaffee eingegossen hat, führt Elide ihre Tasse an die Lippen und kostet.
»Der ist aber gut! Deswegen dürfen die Kinder gern noch eine Weile hungern!«
»Er ist doch nicht etwa zu stark? Nimm dir Zucker«, sagt die Alte und reicht die Zuckerdose, die eine englische Landschaft ziert – auch die ist von einem großen Schiff hierher geraten, denkt Lise und spürt, wie ein träger Wind durch die Fensterrahmen sickert.
Vielleicht ist jetzt alles gut, und der Lichtring verblasst … Vielleicht sitzt Jon tatsächlich im Garten auf seinem ewig gleichen Stuhl, auf dem, der zu klein ist und weggeworfen gehört.
Es wird aber nichts weggeworfen, niemals.
»Ich dachte, ich zaubere heute mal einen Kuchen«, sagt die Alte, und Lise schreckt hoch.
»Mit Nüssen?«, fragt Elide, denn sie steht immer fest im Alltag.
»Ja, ein richtiger Festtagskuchen! Zum Hochzeitstag. Auch wenn der Kerl ihn unter der Erde feiert …«, lacht die Alte und lächelt ihr Lächeln, das Lise noch nie echt vorgekommen ist: Der Mund bleibt zu, die Augen versinken noch tiefer in ihren Höhlen.
Elide lacht mit.
Lise trinkt ihre Tasse leer, obwohl sie keinen Kaffee mag, nicht versteht, wie jemand den bitteren Geschmack genießen kann. Aber weil er kostbar ist und es sich gehört, ihn zu mögen, sagt sie nichts, sie tötet das Bittere mit Milch und Zucker ab. Sie erträgt die Worte der Alten, der Kerl unter der Erde, sie erträgt die Blicke der Alten, die Bescheid wissen, die Alte ist alt und hat vieles gesehen.
»Danke«, sagt Lise und schiebt den Stuhl zurück. »Damit hält man es wieder einen Tag länger aus.«
»Wenn der Schöpfer es will«, erwidert die Alte, »und die Sterne am Himmel bleiben, wo sie sind.«
Sie steht auf, reibt sich die runzligen Hände und nimmt die Tassen vom Tisch, wie man Kindern Spielsachen abnimmt.
ZWEI
England, Oktober 1961
LARS
Yvonne schläft, den Kopf auf dem Kissen mit dem Kuhmuster, und das ist der schönste Anblick der Welt. Der Welt, in der ich jetzt lebe: in der Kaufhäuser aufragen, die voller Bettwäsche mit Tiermustern, blinkender Kochtöpfe und Dosen aus Blech sind, in denen man alles mögliche Kleine und Vergängliche versteckt.
Hier gibt es Häuser mit unversehrtem Dach.
Die Häuser haben Fenster nach allen Seiten und Zimmer für jeden Zweck: Wohnzimmer zum Wohnen, Schlafzimmer zum Schlafen und Ankleidezimmer mit komplizierten Tischen zum Ankleiden. Die Tische haben feinfaserige Gravierungen und einen Spiegel, vor dem sich die Frauen ihre papierdünnen Schläfen pudern und den Schmuck anlegen, den sie mit Blumen verzierten Schachteln entnommen haben.
Die Perlen liegen erstarrt an den schmalen Hälsen.
Ich komme von einer Insel, auf der der Sand schwarz ist. Hier ist der Sand hell und kalt, er fühlt sich grob in der Hand an. Die Menschen hier sind laut und schwer, die Vögel klein wie Kinderfäuste. Sie bauen zerbrechliche Nester und schützen ihre Knochen vor der Sonne, vor dem Wind, den man kaum Wind nennen kann. Hier kommt das Wasser aus Rohren, das kalte vom warmen getrennt, das Fleisch stammt vom Fleischer, der es in dickes Papier schlägt. Die Milch landet in einer Flasche geräuschvoll vor der Tür, und niemand trocknet eine Ochsenhaut in der Sonne, damit die Familie für den Winter Schuhe hat – die Familie hat schon Schuhe, viele Paar mit dicken Sohlen. Und wenn der Winter kommt, bespritzt uns der Himmel mit Formen von Regen, von denen meine vom Wasser lebende Insel nicht einmal träumt.
Auf meiner Insel ist das Wasser Wasser und der Nebel Nebel, und auf den Tischen sieht man die Spuren vom Entschuppen der Fische.
Ich wollte Lise getrocknete Rosen mitbringen. So fing alles an, dass ich meiner Frau eine Freude machen wollte, damit sie mir meine Abwesenheit verzeiht, damit sie beim Blick auf die Blütenblätter denkt: Ein Stück von ihm ist hier. Ich wollte ein aufmerksamer Mann sein und ein guter, denn in mir steckte viel Schuldgefühl, das ich für Liebe hielt. Ich sagte, die Fahrten müssen gemacht werden, damit wir über die Runden kommen, damit wir bekommen, was wir haben. Wir hatten mehr als die anderen. Mehr Bücher, die der Junge im Essensgeruch in der Küche und draußen in der Sonne las; mehr Stoffe, aus denen Lise lange Kleider und saubere Blusen mit hohen Kragen nähte. Und Süßigkeiten hatten wir, klebrige Wunder, die der Junge in der Pause an alle Kinder verteilte und die sie dann im Schulhof lutschten, die Gesichter zum Lächeln geweitet vor Genuss. Es gab getrocknete Früchte, Tee mit Zitrusduft und dunkelbraune Flaschen, die ich mit Paul samstagabends leerte, wenn Lise und Elide in der Küche über Liebe und Rockstoffe redeten (so glaubten wir jedenfalls).
Dabei waren die Fahrten gar nicht so wichtig. Wir wären auch ohne sie klargekommen, wie die anderen auch, wären mit dem ausgekommen, was die Insel gibt, auch wenn sie nicht viel gibt und nicht, ohne dass es Arbeit macht. Und die vorbeifahrenden Schiffe hinterließen uns auch immer etwas, wenn welche vorbeifuhren und wenn die Launen der Winde, die Fahrpläne der Handelsrouten und die unsteten Gemüter der Kapitäne es ihnen erlaubten, in unseren Gewässern haltzumachen.
Von den Schiffen bekamen wir im Tausch, was sie gerade beförderten: Mehl und Konserven, Nägel oder Seife. Manchmal bekamen wir Briefe, die in großen Säcken aus festem Stoff ans Ufer gebracht wurden (die Säcke wurden aufgehoben, aus ihnen wurden später Segel gemacht). Wir versammelten uns mit leuchtenden Augen um die Säcke und warteten, ob der Amtmann – der immer die Briefe verteilte – unseren Namen aufrief. Die Tinte war zerlaufen, die Kuverts waren feucht oder trocken und wellten sich. Aber es waren immer Schätze.
Von uns bekamen die Schiffe Trinkwasser, Handarbeiten und Schafe, manchmal auch eine halbe Kuh. Sie bekamen Hühner, Gänse und schüchterne, raue Händedrücke, und so kommt man auf Tristan über die Runden, schon immer.
Aber ringsum wogt die große Erde, und ich gehöre nicht zu den einheimischen Spezies. Das Teichhuhn bleibt, wo es ist, es träumt nicht von anderen Inseln mit andersfarbigen Vögeln und stilleren Wassern – aber der Mann träumt, hält mitten beim Brennholzsammeln am Strand inne. Wischt sich die Hand an der Hose ab und erblickt am Horizont hellere Farben, größere Fische, eine Frau mit weißeren Wangen als die, neben der er nachts schwimmt.
Der Mann schläft in der Tiefe. Dort verschließt er sich, nach und nach, sodass es niemand merkt.
Schließlich geht er ganz zu, und dann packt er seine nach Fisch riechenden Sachen. Er packt seine Haken und seine Netze, bindet die Taschen mit Schnüren und Gürteln zu, lädt sie auf den Karren und schiebt den Karren ans Ufer hinunter. Der Weg ist steil, der Himmel grau und die Frau böse.
Der Mann sagt: Dienstreise, so wie immer.
Er drückt die Frau an sich, lässt sie los und rudert zum Schiff.
Für die Zuschauer am Ufer sieht es aus, als hinge das am Horizont hängende Schiff am Dach des Himmels.
Lise und ich haben ein Kind, einen nachdenklichen und findigen Jungen. Als er das letzte Mal Geburtstag hatte – er wurde neun –, ging ich an den Strand, um eine Muschel zu suchen. Die mag er. Er ist ein Freund von Dingen und Insekten. Ich habe ein Foto von ihm, einen Gesichtsausdruck, auf dem ich mir all seine anderen Mienen vorstellen muss. Manchmal, wenn ich abends am Rand des Schlafes schwanke, höre ich seine Stimme, sie spricht von Äpfeln und Raupen, von Schmetterlingen, die auf- und absteigen wie kleine mit Tusche bemalte Kreisel.
Ich möchte die Hand auf sein Haar legen und es verwuscheln, aber das ist unmöglich.
Es ist meine eigene Schuld.
Ich wollte Lise getrocknete Rosen mitbringen. Ich war einige Wochen an meinem Zielort gewesen, in einer großen Stadt jenseits des großen Meeres, und allmählich stand die Rückfahrt an. Eine Nacht hatte ich noch vor mir, die letzte Nacht in meinem Stammhotel, in dem ich mich wohlfühlte, weil es nicht so vornehm war. Ich saß im Taxi auf dem Weg zum Hotel, als mir die Rosen einfielen. Ich wusste, dass zwei Häuserblocks weiter eine verblasste grüne Markise hervorragte, auf der stand: Harry’s Flowers.
Als ich die Ladentür öffnete, klingelte die Glocke, um einen Kunden anzukündigen. Ich stellte mich in die Schlange und guckte nach den Rosen: weiße, gelbe, rote in allen Schattierungen.
Und dahinter, versteckt, blaue.
Solche hatte ich noch nie gesehen.
Bislang war nur eine einzige Sorte Rosen nach Tristan mitgebracht worden, deren blasses Rot Lise zum Grinsen veranlasst hatte, als die empfindlichen Blütenblätter endlich bereit gewesen waren, sich zu zeigen. Zwei Tage später waren sie bereits verwelkt gewesen.
Die Verkäuferin redete zu viel: Bei der Pflege von Orchideen heißt es genau sein … unbedingt in handwarmes Wasser stellen …, solche Sachen sagte sie, und mich überkam eine Unruhe, wie ich sie zu Hause nie empfand, mit der mich die Stadt aber ansteckte.
Schließlich wandte die Verkäuferin mir ihr Gesicht zu.
Die hellgrünen Augen, deren Blick ein klein wenig schielte, suchten ihr Ziel. In den braunen Haaren lag ein Hauch von Rot, und sie waren zu einem achtlosen Dutt hochgesteckt, aus dem immer wieder Strähnen auf das von Sommersprossen übersäte Gesicht fielen.
»Wie kann ich helfen?«, fragte sie.
»Rosen«, antwortete ich, »ich hätte gern welche in verschiedenen Farben. Eine Auswahl. Sie dürfen entscheiden.«
»Wie viele?«
»Viele. Vielleicht zwölf.«
»Bei Rosen nimmt man üblicherweise eine ungerade Zahl.«
»Das macht nichts. Ich bringe sie weit weg, dort zählt sie niemand.« Aber Lise zählt sie, dachte ich, ich wusste, dass sie sie zählt und daraus Schlussfolgerungen über meine Liebe zieht.
Die junge Frau sah mich verwundert an, machte sich aber an die Auswahl. Sie runzelte die Stirn und trommelte mit den Nägeln, deren Lack abblätterte, auf den Tisch.
In den Strauß kamen viele Rottöne, aber die blauen fasste sie nicht an.
»Ich möchte blaue«, sagte ich. »Ein bisschen Meer.«
»Sind Sie Seemann?«
»Nein, aber ich wohne im Meer. Auf einer Insel, meine ich.«
Nun sah sie mich amüsiert an, und die Augen fanden mühelos ihr Ziel. Also gut, wenn es sein muss, Männer haben eben keinen Geschmack, schien der Blick zu sagen, und als der Strauß fertig war, wickelte sie ihn in Papier und gab mir Anweisungen, von denen ich kein Wort wahrnahm, denn ich konzentrierte mich auf ihre Hände. Wie klein sie waren. Wie schnell sie arbeiteten, ohne Angst vor den Dornen, so wie meine Hände mit den Fischen.
»15 Pence, bitte.« Ich fuhr zusammen und grub in meinen Taschen. Ich habe mich nie daran gewöhnt, wie sich Geld anfühlt, an den metallischen Geruch der Münzen, weshalb ich die Hand ausstreckte und die Verkäuferin die richtige Summe herauspicken ließ. Ihre Finger kitzelten.
Auf der Straße spürte ich ein neues Gewicht auf der Brust. Oder war es Leichtigkeit? Es war da und blieb auf dem ganzen Weg zum Hotel, es blieb, als ich das Foyer betrat und an den Schlüsselfächern der Rezeption vorbeiging, als ich die Treppe zum ersten Stock hinaufstieg und den Flur mit dem dunkelroten Teppich betrat, der mir plötzlich länger erschien als zuvor.
Ich drehte den Schlüssel im Schloss und trat über die Schwelle in mein Zimmer. Ich setzte mich auf das straff bezogene Bett, griff nach der Speisekarte auf dem Nachttisch und fing an zu lesen, denn ich brauchte etwas anderes: eine Störung. Ich musste an etwas anderes denken.
Ich nahm den Plastikhörer des Telefons ans Ohr, wählte die Nummer vom Zimmerservice und bestellte ein Gericht, bei dem ich mir vorstellte, dass es am ehesten an etwas erinnerte, was zu Hause gegessen wurde. Zu Hause, dachte ich, und plötzlich kam mir Tristan wie eine Fata Morgana oder eine Geisterinsel vor, die ich einmal durchs Schiffsfenster gesehen hatte und die beim Näherkommen nicht mehr da war.
Schon der Name war mir so fremd wie die sonderbaren Wörter auf der Speisekarte.
Am nächsten Morgen packte ich die Sachen, die ich nicht vorab aufs Schiff geschickt hatte, und schrieb mich im Hotel aus. Ich bat darum, mir ein Taxi zu rufen, aber als ich auf die Straße trat, wartete ich nicht auf den Wagen, sondern ging zu Fuß los.
»Hallo Seemann, noch mehr blaue Rosen?«, fragte die Verkäuferin, als sie mich sah.
Diesmal war niemand sonst im Laden, sodass ich ihre ganze Aufmerksamkeit bekam. Ich wusste nur nicht, was ich damit anfangen, wie ich meine Anwesenheit erklären sollte, wo ich sie doch selbst nicht verstand.
Dann war der Moment vorbei: Die Tür knarrte, die Glocke klingelte und eine Frau trat ein, eine von der Sorte, die weiß, dass alle auf ihren Willen hören. Sie wollte Lilien für ihre Tochter. Sie wird schon fünfundzwanzig, ist aber noch so hübsch … Das sind aber blasse Farben … Was heute nicht alles verkauft wird … beklagte sich die Frau, aber die Verkäuferin war geduldig, regte sich nicht auf und malträtierte die Blumen nicht beim Einpacken, sondern lächelte nur ihr schiefes Lächeln, als hätte sie vor langer Zeit beschlossen, dass dieses Lächeln sie vor den Unfreundlichkeiten und Bitternissen dieser Welt beschützte.
»Die blassen sind für blasse Leute«, sagte sie, und ich dachte, das ist eine, die immer weiß, was sie sagen muss.
Geh jetzt, sagte ich mir, geh jetzt und komm nicht wieder zurück.
Ich blieb auf der Stelle stehen.
Die Kundin zahlte und ging zur Tür, und von dort aus schaute sie mich an, musterte mich. Plötzlich sah ich mich mit den Augen jener Frau: mein wirres Haar, die Fingerknöchel, die strapaziert und trocken waren. Ich sah das Dunkle meiner Haut, das sich von der hiesigen Blässe abhob wie eine einsame Gewitterwolke am Himmel.
»Manche Leute«, sagte die Verkäuferin zu mir, als die Frau gegangen war, und ich wandte mich ihr erleichtert zu.
»Ja, es ist nicht immer leicht.« Ich lächelte verschwörerisch, und sie lächelte zurück.
»Aber weiter. Wie kann ich helfen?«, fragte sie, legte die Handflächen entschlossen auf den Tresen und schaute mich an, als hoffte sie, die Antwort würde lange dauern.
Dennoch gehe ich noch einmal fort.
Ich sammle meine Beine und Hände ein, mein Herz, das verrückt geworden ist und eine sonderbare Sprache spricht. Sei still, sage ich zu ihm und trete aus dem Laden, lasse die Frau hinter dem Tresen zurück, die ich dort zurücklassen muss, um ihr Licht in der Dunkelheit ihrer Tage leuchten zu lassen.





























