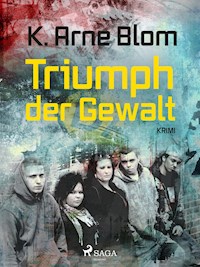
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Kripo im schwedischen Lund hat alle Hände voll zu tun. In der Stadt häuft sich die Zahl brutaler Verbrechen: Eine Frau wird ermordet, alte Menschen werden in ihrer Wohnung überfallen, ein Baby verschwindet am hellichten Tag spurlos. Kripo-Chef Oloffson nimmt sich den Fällen an und entdeckt bald, dass alle Verbrechen irgendwie miteinander zusammenhänge. Nur wie? Er beginnt zu ermitteln und taucht ein in die düstere Vergangenheit der Täter, die selbst ein dunkles Schicksal teilen. –Packend, fesselnd und schockierend zugleich. Schweden-Krimi mit erschreckend realem Bild der heutigen Gesellschaft. AUTORENPORTRÄT Karl Arne Blom (*22.01.1946) ist ein schwedischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer. Blom arbeitete bis in die 1970er Jahre als Journalist für das "Sydsvenska Dagbladet". Seit 1976 widmet er sich vollkommen der Schriftstellerei und dem Übersetzen. Bekanntheit erlangte Blom vor allem durch seine Kriminalromane. Sein Erstlingswerk "Någon borde sörja" veröffentliche Blom bereits 1971 unter dem Schriftstellernamen K.Arne Blom, den er seitdem als feste Signatur für alle seine literarischen Arbeiten beibehielt. Neben seinen Kriminalromanen, schreibt Blom noch Jugendbücher, historische Romane und Sachbücher, besonders über die Geschichte von Skåne und Lund. Zusammen mit Jenny Berthelius und Jean Bolinder hat er unter dem Pseudonym Bo Lagevi Kriminalromane veröffentlicht. RENZENSION "Blom benutzt die einzelnen Polizisten, um die verschiedenen Gesellschaftsanschauungen beschreiben zu können. Da gibt es den liberal Gemäßigten, den Radikalen, den Beamten mit leicht faschistischen Anhauch, den Verstandesmensch und den Emotionalen. Sie sind Schablonen, ohne aber so zu wirken. Sie haben immer noch ein Eigenleben. Auch die Protagonisten auf der anderen Seite, die Täter werden dazu benutzt, Fehlentwicklung der Gesellschaft aufzuzeigen. Das ist manchmal etwas holzschnitzartig aber trotzdem führt es natürlich dazu, mit den Tätern mitzuempfinden, deren Taten teilweise nachzuvollziehen." – www.schweden-krimi.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Arne Blom
Triumph der Gewalt
Saga
Eine Art Prolog
Man spricht von Sphärenmusik, als könnte man einen Zustand in Tönen schildern. Es heißt, daß eine Tonlage oder eine Melodie einen Gemütszustand auszudrücken vermag. Nun war es Winter.
Der Winter hatte sich in Schonen und in der Stadt Lund früh eingestellt.
Jetzt war es Nacht.
Eine dunkle Winternacht, die vom Schnee auf dem Boden erhellt wurde.
Der Schnee war in diesem Jahr früh gekommen, sogar ungewöhnlich früh für diesen südlichen Landesteil. Schon um den ersten Advent herum war die Witterung radikal umgeschlagen. Die Kälte hielt die Stadt umklammert. In den Nächten war es so kalt, daß man die Bäume knacken hörte. Tagsüber kniff der Frost die Leute in die Wangen und färbte sie rot.
In den ersten Dezembertagen hatte es zu schneien angefangen.
Zuerst fielen die Flocken gleichsam schüchtern und verschämt, als bäten sie um Entschuldigung für ihre Aufdringlichkeit.
Aber mit jedem Tag fiel der Schnee ausgiebiger.
Nicht genug damit, daß der Schnee fiel, er blieb auch auf dem Boden liegen, ohne zu Matsch zu werden, ohne zu schmelzen.
So wurden im Verlauf der Zeit Straßen, Bürgersteige, Rasen, Dächer, Bäume und alles ringsum weiß.
Die Stadt Lund wurde in eine freundliche, weiße und beruhigende Decke gehüllt.
Die Bewohner freuten sich auf eine weiße Weihnacht.
Es war das Jahr 1969.
Die Melodie, die man ahnte, erinnerte an ein weiches, abrollendes Saxophonsolo in ein wenig wehmütiger Tonart.
Die durchfahrenden Reisenden, die durchs Fenster eines Eisenbahnabteils einen Blick auf die Stadt erhaschten oder sie vom Auto aus betrachteten, gewannen den Eindruck einer friedlichen Idylle.
Im großen und ganzen war dieser Eindruck vielleicht richtig. Lund ähnelte den Städten, die man in den alten englischen Weihnachtsfilmen zu sehen bekommt: mit dem Schnee, den niedrigen Häusern, den freundlichen Menschen, den Tannen im Lichterglanz, den weihnachtlich geschmückten Fenstern, den Girlanden über der Haustür. Es sah wie eine Stadt aus, die keinen Raum hat für Gewalttätiges, Brutales oder Erschreckendes.
In Wirklichkeit aber war Lund keine romantische Weihnachtspostkarte mit schmuckem Schnee, Sorglosigkeit und warmherziger Freude.
Ein wütender Trompetenstoß zerschnitt die Stimmung, die das Saxophonsolo schilderte.
Die Fußspur im Schnee
Ganz plötzlich tauchte er vor dem Auto auf. Um ein Haar wäre er überfahren worden. Bei etwas höherem Tempo hätte es ihn sicher erfaßt und auf die Straße geschleudert. Dann wäre der kleine Körper zu Boden gestürzt, und die Räder wären darüber hinweggerollt.
Fraglich, ob die kleine Gestalt mit dem Leben davongekommen wäre.
Zum Glück reagierte der Fahrer schnell und bremste, so daß das Kind vor der Motorhaube vorbeihuschte, ehe es von dem schwarzen Volvo erfaßt wurde.
Nach ungefähr zehn Metern brachte der Fahrer den Wagen zum Stehen. Die Reifen bissen sich auf dem schlüpfrigen Boden fest, und der Wagen zitterte nach der jähen Bremsung.
Der Mann am Steuer blickte in den Rückspiegel.
Aber die Gestalt, die er fast überfahren hätte, war nicht zu sehen. Er drehte sich um und spähte durch das Rückfenster, doch ohne einen Menschen zu gewahren.
Er kurbelte das Seitenfenster herunter, steckte den Kopf hinaus und schaute nach hinten.
Er sah nur die weiß verschneite Straße.
Er sah die Bremsspur im Schnee und unter einer Laterne den Abdruck kleiner bloßer Füße.
Da wurde ihm klar, wie nahe er daran gewesen war, die Gestalt zu überfahren.
Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus, und der Magen drehte sich ihm um.
Er seufzte erleichtert auf und dankte dem Himmel, daß er nicht schneller gefahren war.
Während er immer noch mit hinausgestecktem Kopf rückwärts schaute, kramte er mit bebender Hand in der Tasche nach einem Zigarettenpäckchen. Seine Zähne klapperten, und sein keuchender Atem stieg dampfend auf. Weiße Wölkchen, bei jedem Atemzug eins.
Den Mann, der neben ihm saß, hatte er vollständig vergessen.
Der Mitfahrer war zusammengesackt, nachdem er sich beim plötzlichen Bremsen den Kopf an der Windschutzscheibe angeschlagen hatte.
Der Knabe auf der Schaukel
Es war Freitag, der neunzehnte Dezember, kurz nach Mitternacht, als der Schnee so weiß lag, als der Atem wie Wolken aus dem Munde der Menschen aufstieg, als der Fahrer des Streifenwagens um ein Haar den kleinen Jungen überfahren hätte, der so plötzlich vor dem Kühler aufgetaucht war.
Er schien aus dem Nichts aufgetaucht zu sein.. Und man konnte meinen, er sei auch ins Nichts verschwunden.
Der Fahrer wußte nicht, was er davon halten sollte. Er fragte sich beunruhigt, ob er wohl ein Gespenst gesehen habe.
Das Kind war da gewesen, einen kurzen Augenblick beleuchtet vom Lichtkegel der Scheinwerfer.
Der Fahrer holte tief Atem und dachte an seinen eigenen Sohn, der jetzt zu Hause schlief.
Er dachte auch daran, daß das Bett des Kindes im Schlafzimmer der Eltern stand. Er wußte, daß die Mutter ebenfalls in ihrem Bett lag und schlief. Der Polizeibeamte dachte an seine Familie.
Er war grundsätzlich bereit, sein Kind und die Mutter seines Sohnes um jeden Preis gegen alles Übel zu schützen.
Er konnte nicht begreifen, wie es möglich war, daß ein Kind in dieser kalten, verschneiten Dezembernacht zu so später Stunde plötzlich vor seinem Wagen auftauchte.
Der Polizeibeamte hieß John Fransson.
Er war hochgewachsen, dunkelhaarig, hatte ein ovales Gesicht mit Aknenarben, ein Schnurrbärtchen unter der geraden Nase und sehr kleine Hände mit kurzen, weichen Fingern.
Er war dreißig Jahre alt und seit fünf Jahren verheiratet. Sein Sohn war vier Jahre alt.
Die kleine Gestalt, die so plötzlich vor dem Auto aufgetaucht war, mochte etwa fünf sein.
Der Mann auf dem Beifahrersitz war Franssons Kollege, Stig Rosén.
Er war von gedrungenem Wuchs, hatte blondes Haar, ein rundes glattrasiertes Gesicht mit kleiner Nase, volle Lippen und große Hände mit dicken Fingern. Er zeigte sich ziemlich oft mürrisch und verdrossen.
Er war siebenunddreißig Jahre alt.
Er hatte keine Familie und fühlte sich öfters einsam.
Rosén war ein Polizist der alten Schule. Er glaubte an Gesetz und Ordnung. Er stand vor der Fahne stramm und hielt das schwedische Königshaus für etwas nahezu Gottähnliches.
Seine einzige Liebhaberei war der Beruf.
In der Freizeit trainierte er eine Jugendmannschaft im Handball und übte sich selbst im Schießen.
Fransson verbrachte fast seine ganze Freizeit mit der Familie, und er fand es, im ganzen genommen, nicht besonders bemerkenswert, Polizeibeamter zu sein. Das war ein Beruf wie jeder andere.
Er war Republikaner und sehr musikalisch. Er behauptete steif und fest, die Nationalhymne klinge schlecht. Wenn er sie hörte, schämte er sich beinahe, Schwede zu sein.
Fransson hatte das unbehagliche Gefühl, das Polizeikorps sei im Begriff, sich zu militarisieren. Diese Entwicklung sagte ihm keineswegs zu.
Außerdem ärgerte es ihn, daß das Patrouillieren neuerdings fast ausschließlich im Auto vorgenommen wurde, daß man nur selten aussteigen konnte und kaum jemals zu Fuß durch die Straßen ging, unter Menschen.
Rosén kam zu sich.
Fransson hörte ihn stöhnen und wurde sich bewußt, daß sein Kollege neben ihm saß.
„Wie geht’s? Hast du dich angeschlagen?“ fragte er.
„Angeschlagen ... Wie fährst du eigentlich?“ brummte Rosén und rieb sich die Stirn mit der Handfläche. Er verzog das Gesicht. „Jetzt bekomme ich natürlich Kopfschmerzen. Wie fährst du bloß?“
„Hast du den Jungen nicht gesehen, der uns vors Auto gesprungen ist?“
„Den Jungen? Was für einen Jungen?“
„Ein kleines Kerlchen. Im Pyjama und mit bloßen Füßen. Möchte wissen, wohin er gelaufen ist.“
„Ein kleiner Junge? Du siehst wohl Gespenster? Ich habe kein Kind gesehen. Träumst du am Steuer?“
Fransson schüttelte den Kopf und warf die Zigarette hinaus.
„Ich frage mich bald selbst, ob ich nicht geträumt habe. Wenn dort under der Laterne nicht Fußspuren wären, würde ich es tatsächlich annehmen.“
Rosén drehte sich um und spähte rückwärts.
„Durchs hintere Fenster kannst du sie nicht sehen“, sagte Fransson. Er öffnete den Schlag auf seiner Seite und stieg aus.
„Eine Fußspur im Schnee“, murmelte Rosén und stieg ebenfalls aus. „Du hast wohl ein Heinzelmännchen gesehen, wir haben ja bald Weihnachten. Also, schauen wir uns die Sache einmal an. Sei so gut und gib mir eine Zigarette. Ich habe keine mehr.“
Sie standen unter der Laterne, und tatsächlich war eine Fußspur zu sehen: der Abdruck kleiner Füße in dem weichen, kalten Schnee.
„Alle Wetter“, stieß Rosén hervor.
„Wohin kann er nur gelaufen sein?“ fragte Fransson.
Sie blickten sich um.
Auf der einen Seite der Straße erstreckte sich eine Einfamilienhäuserreihe, zweistöckig und aus gelben Ziegelsteinen erbaut. Vor jedem Haus befand sich eine Außengarage.
Sie sahen, daß eine Haustür offen stand.
„Hol bitte die Lampe“, sagte Fransson. „Wir wollen der Spur folgen.“
Auf der anderen Seite erstreckte sich eine Anlage, wo am linken Ende gerade eine Schule gebaut wurde. Rechts hob sich ein massiver Hauskomplex vom Nachthimmel ab. Das war das Studentenheim Vildande.
„Hol du doch die Lampe“, empörte sich Rosén. „Hast du Zigaretten, oder muß man vor Verlangen vergehen?“
„Die Zigaretten liegen auf dem Vordersitz“, erklärte Fransson. „Du kannst dir eine nehmen, wenn du die Lampe holst.“
Rosén lächelte kurz und ging zum Streifenwagen.
Er kam mit der Lampe zurück, aber ohne Zigaretten.
„Dort lagen keine Zigaretten, zum Teufel!“
„Richtig, ja, ich vergaß, daß ich sie ja in der Tasche habe. Willst du eine?“
Rosén nahm das Päckchen entgegen und zündete sich eine Zigarette an, während Fransson zu der parkähnlichen Anlage hinüberstapfte.
Der Lichtkegel der Lampe glitt vor seinen Füßen dahin. Im Schein waren die kleinen Fußabdrücke zu sehen.
Sie gingen weiter; Fransson folgte dem Licht, und Rosén folgte seinem Kollegen, während er rauchte.
Nichts war zu hören außer dem Knirschen ihrer Schuhe im Schnee. Im übrigen war die Winternacht so still, daß man sie mit einem Diamanten hätte durchschneiden können.
Aber plötzlich hielt Fransson inne und blieb stehen.
Rosén prallte gegen ihn. „Was ist los?“ fragte er. „Warum gehst du nicht weiter?“
„Pssst. Horch!“
„Ich höre nichts.“
„Halt den Mund und horch! Dann hörst du’s.“
Sie lauschten. Da hörte Rosén es ebenfalls.
Es klang, als ob eine Schaukel vom Wind hin und her bewegt würde. Aber die Nacht war ganz windstill.
„Es kommt vom Spielplatz“, sagte Fransson und ging darauf zu.
Als sie dort anlangten, gewahrten beide ihn gleichzeitig.
Er sah klein aus, und er hatte nur einen Pyjama an. Er saß auf der mittleren Schaukel des Gerüstes und schaukelte in der Nacht sachte hin und her, wobei er mit sich selbst zu sprechen schien.
„Was in aller Welt!“ platzte Rosén heraus und merkte nicht, daß ihm die Zigarette aus der Hand fiel.
Fransson blieb direkt vor dem Kleinen stehen.
Das Kind gab seinen Blick neugierig zurück.
„Hallo“, sagte Fransson.
„Hallo“, sagte der Bub und schaukelte weiter.
„Hör mal, du“, begann Rosén und machte ein paar Schritte vorwärts. „Was treibst du hier eigentlich?“
„Ich schaukele, wie Sie sehen. Sind Sie von der Feuerwehr?“
„Nein, wir sind Polizisten“, antwortete Fransson. „Ich heiße John. Und wie heißt du?“
„Tommy.“
„Was sagen denn deine Eltern dazu, daß du weggelaufen bist?“
„Nichts. Sie wissen es ja gar nicht.“
„Nein?“
„Mama und Papa sind nicht zu Hause.“
„Du bist ganz allein?“
„Ja. Als ich aufwachte, fand ich niemand im ganzen Haus. Da dachte ich mir, ich gehe hinaus und spiele, bis sie zurückkommen.“
Fransson runzelte die Stirn. „Frierst du nicht?“ fragte er.
„Doch, ein bißchen.“
„Wie alt bist du?“
„Genau weiß ich’s nicht. Aber Papa sagt immer, ich wäre sehr stark für meine fünf Jahre.“
„Findest du es nicht langweilig, allein hier draußen in der Dunkelheit zu spielen?“
„Doch, ein bißchen. Aber dafür habe ich Ruhe vor Ake. Er plagt mich immer. Es ist schön, daß Åke nicht hier ist. Lasse und Ulf hätte ich gern hier. Mit ihnen kann man schön spielen. Haben Sie ein Auto? Papa hat einen riesengroßen Wagen. Nur die Farbe gefällt mir nicht. Was für eine Farbe hat Ihr Auto?“
„Es ist schwarz. Willst du mit mir kommen und es dir ansehen?“
„Ja, gern. Obwohl ich schwarze Autos nicht besonders mag. Sie sehen so langweilig aus. Ich darf wohl nicht mitfahren, aber ansehen kann ich es mir schon.“
„Also komm.“
„Oh, fein.“
Tommy sprang von der Schaukel. Als seine Füße den Schnee berührten, schauderte er fröstelnd.
„Warte“, sagte Fransson, schnallte sein Koppel ab und knöpfte den Uniformrock auf. „Ich will dir meinen Rock leihen, dann frierst du nicht so sehr.“
Nach einer Weile machten sie sich auf den Weg. Fransson trug den kleinen Jungen auf den Schultern. Tommy hatte den Uniformrock an und Franssons Mütze auf dem Kopf.
„Jetzt bin ich ein richtiger Polizist!“ rief er vergnügt. „Jetzt kann ich Åke totschlagen!“
„Das wirst du nicht tun“, mahnte Fransson.
„Na ja, vielleicht nicht. Aber ich kann ihn in die dunkelste Gefängniszelle einsperren.“
Rosén, der hinter ihnen ging, schüttelte den Kopf. So ein Dummkopf, dachte er. Er betrachtete Franssons Hemd. Nun wird er frieren und sich erkälten. So ein Dummkopf. Was sind das nur für Eltern, die der Junge hat?
Tommy durfte eine kurze Runde in dem Streifenwagen machen. Dann fand Fransson, daß es genüge, und fragte ihn, ob er denn nicht müde sei.
„Doch, ein bißchen“, antwortete Tommy. „Aber ich kann ebensogut morgen schlafen.“
„Jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Haus zu dir.“
Das hatte Rosén schon längst an der Zeit gefunden. Er saß im Eßzimmer auf dem Sofa und rauchte Franssons Zigaretten, als die beiden hereinkamen.
„Hier ist keine Menschenseele“, berichtete er.
„Du, Tommy“, sagte Fransson, „nun trinken wir eine Tasse heiße Schokolade, und dann kriechst du ins Bett, damit du morgen frisch und munter bist. Vergiß nicht, daß bald Weihnachten ist. Da muß man frisch und munter sein.“
„Kein Mensch ist im Hause“, sagte Rosén.
„Ja, das hörte ich schon. Tommy hat es ja erzählt.“
Gemeinsam kochten Fransson und Tommy die Schokolade. Nachdem alle ihre Tasse ausgetrunken hatten, meinte Tommy, es müsse eigentlich ganz schön sein, nun schlafen zu gehen. Er zeigte Fransson sein Zimmer, das eine Treppe höher lag, und bat den Polizisten, ihm etwas vorzulesen.
Tommy hatte noch keine fünf Seiten aus Andersens Schneekönigin vorgelesen, da gähnte Tommy laut, drehte sich auf die andere Seite, gab einen leichten Wind von sich und fiel in Schlaf.
Fransson schlich sich hinaus und schloß die Tür von außen ab.
Er blickte sich um.
Tommys Zimmer war der kleinste der drei Räume im zweiten Stock. Daneben lag das Schlafzimmer der Eltern, und am Ende des Flurs gelangte man durch eine Glastür ins Wohnzimmer. Hier stand an der einen Wand eine Polstergruppe: ein Sofa und Sessel aus schwarzem Leder um einen massiven Eichentisch. Das Fernsehgerät, eine Stereoanlage und der Teppichboden vervollständigten die gediegene Einrichtung.
Leise, um den Jungen nicht zu wecken, ging Fransson die Treppe hinunter.
Rosén saß in der Küche auf einem Schemel und trank Schokolade. Er zuckte zusammen, als sein Kollege eintrat.
„Schmeckt nicht gut, aber wärmt wenigstens“, sagte er. „Ich war ganz durchfroren.“
„Tu dir keinen Zwang an und trink du nur“, antwortete Fransson und setzte die Besichtigung fort.
Die geräumige Küche enthielt einen großen Tisch und eine Anrichte. In der Diele führte eine Tür in ein Arbeitszimmer.
Fransson betrachtete die Bücher auf dem Regal: ein paar Romane entdeckte er, die meisten aber waren Fachbücher über Architektur.
„Wenn du dir alles angeguckt hast“, sagte Rosén, „können wir wohl endlich weiterfahren.“
„O nein, wir warten, bis die Eltern nach Hause kommen“, entgegnete Fransson. „Möchte übrigens wissen, wie sie heißen ... “
„Das steht vermutlich auf dem Türschildchen.“
Fransson öffnete die Haustür und schaute nach: Lundberg.
Die Einrichtung im Reihenhaus der Familie Lundberg war gediegen und kostspielig. Die untadelige Ordnung im Haushalt zeugte von einer Hand, die oft abstaubte und sich beschäftigte. Das war auffallend.
Henry Lundberg war hager und trug einen Smoking. Er war ein wenig berauscht. Seine roten Haare standen wie ein Feuerschweif um den Kopf.
Alicia Lundberg war klein und mollig. Sie trug ein langes, auf beiden Seiten geschlitztes Kleid. Die blonden Haare umrahmten ein rundes Gesicht mit feinen Zügen. Um die Augen herum war sie stark geschminkt, und die rosigen Wangen verrieten, daß auch sie angeheitert war.
Beide sahen bestürzt aus, als sie die Polizisten erblickten, die in der Küche saßen und Schokolade tranken.
Fransson erklärte den Grund ihres Vorhandenseins.
Rosén sagte nicht viel.
„Sie meinen also, nur weil man Polizist ist, kann man einfach in ein Haus eindringen, wie es einem beliebt?“ polterte Henry Lundberg mit zorniger Miene.
„Mein Gott, ich habe Ihnen doch erklärt, wie es sich verhält“, gab Fransson zurück. „Ihr Sohn Tommy war mitten in der Nacht in die Kälte hinausgelaufen ... “
„Das hört sich unglaubhaft an“, fiel Alicia Lundberg mit scharfem Ton ein. „Wir sind nicht zum erstenmal ausgegangen. Er hat immer fest geschlafen, wenn wir fort waren, warum also nicht auch heute abend? Übrigens konnte er die Haustür gar nicht öffnen. Sollte er das auf einmal gelernt haben?“
„Wie er die Tür aufbekommen hat, weiß ich nicht“, sagte Fransson. „Jedenfalls ist es ihm gelungen, denn sie stand offen.“
„Verflucht und zugenäht“, schimpfte Lundberg, „wir waren nur für ein paar Stunden bei Bekannten ganz in der Nähe, und da kommt man nach Hause und stellt fest, daß die Polizei eingedrungen ist. Das ist doch verrückt!“
„Sie waren ganz in der Nähe?“ wiederholte Fransson verwundert.
„Ja, bloß sieben Häuser weiter. Und da finden wir Sie hier vor. Leben wir eigentlich in einem Polizeistaat?“
„Die Polizei glaubt wohl, sie darf sich alles herausnehmen“, zeterte Alicia Lundberg. „Gestapomanieren sind das, jawohl. Die jungen Leute, die demonstrieren, haben wahrhaftig recht. Einen Polizeistaat, genau das haben wir hierzulande!“
„Jetzt habe ich aber genug!“ platzte Rosén unvermittelt heraus. „Da kommen Sie besoffen nach Hause und unterstehen sich, meinen Kollegen zu schurigeln, der so freundlich war, sich um Ihren verlassenen Sohn zu kümmern. Sie bewerfen die Polizei mit Schmutz und benehmen sich wie ... wie ... Sie haben sich auf einer pinkelfeinen Gesellschaft mit teurem Alkohol vollaufen lassen und sich den Teufel darum geschert, daß Ihr Sohn aufwachen und so allein im Haus Angst bekommen könnte! Das Kind war Ihnen gleich, es interessierte Sie ja nur, sich mit Ihren Oberklassenfreunden zu amüsieren! Zum Kotzen finde ich das! Komm, Fransson, wir gehen.“
Es geschah selten, daß Rosén die Beherrschung verlor.
„Das hier ist kein sogenanntes Oberklassenviertel“, brauste Lundberg auf und funkelte Rosén an.
„Aber Sie gehören zu den reichen Scheißkerlen!“ brüllte Rosén.
„Ich warne Sie, nehmen Sie Ihre Worte in acht, sonst ... “
„Komm jetzt“, sagte Fransson, zog seinen zornroten Kollegen zur Tür und drängte ihn zum Haus hinaus.
Bevor er die Haustür hinter sich zumachen konnte, knallte Lundberg sie zu, daß es nur so krachte.
Henry Lundberg war dreiunddreißig Jahre alt, Alicia neun- undzwanzig. Er war Architekt, sie Hausfrau. Beide waren ganz gewöhnliche Menschen, die sich eine Villa leisten konnten. Man hätte nicht behaupten können, daß sie ihren Sohn bewußt vernachlässigten.
Das Zuknallen der Tür klang ohrenbetäubend.
Fransson, der auf dem Vorplatz verweilte, glaubte ein Kind weinen zu hören. Als ob der jähe Lärm es aus dem Schlaf geschreckt hätte. Als ob ihm angst und bange wäre.
Es war das erstemal, daß die Familie Lundberg mit der Polizei zu tun bekommen hatte.
Aber es war nicht das letztemal.
Die vier Gewalttaten
Im Frühling
Magnus Pettersson war klein und körperlich schwach. Im Jahr 1970 wurde er zwölf.
1965 war seine Mutter begraben worden. Sein Vater mußte fünf Tage in der Woche von sieben bis siebzehn Uhr auf dem Bau arbeiten. Samstags und sonntags war er selten nüchtern. Es war als notwendig erachtet worden, ihm das Sorgerecht für den Sohn zu entziehen.
Magnus wurde in Pflege gegeben.
Die Pflegeeltern waren liebe Menschen. Sie hatten nie ein eigenes Kind gehabt und konnten sich gar nicht genug an liebevoller Güte tun. Wahrscheinlich verwöhnten sie Magnus mehr, als sie es bei einem eigenen Kind getan hätten.
Von seiten der Pflegeeltern war das Verhältnis zwischen ihnen gut. Aber vom Standpunkt des Kindes war es ziemlich sonderbar und gekünstelt, fast eine Quelle der Gereiztheit. Er wurde eher wie eine Puppe als wie ein Kind behandelt. Er wurde verzärtelt, und das empfand er als Belastung.
Aber andrerseits sagte ihm dieser Zustand zu, und er merkte bald, wie er die Güte seiner Pflegeeltern ausnutzen konnte. Er bekam alles, was er wollte. Er brauchte nur einen Wunsch zu äußern, und schon wurde er ihm erfüllt. Sie brachten es nicht über sich, nein zu sagen.
Oft spürte Magnus, wie sehr ihm seine richtige Mutter fehlte. Doch die Erinnerung an sie verblaßte mit der Zeit, die wahre Erinnerung, wohlgemerkt. Er vergaß seine Mutter nicht, aber das wahre Bild wurde von einem Heiligenbild ersetzt.
Die Mutter wurde ein Engel, ein wunderbarer Mensch, mit dem es niemand aufnehmen konnte.
Das wahre Bild, das Magnus verdrängte, zeigte eine versoffene, liederliche Frau, die sich aus ihrem Sohn nichts gemacht und sich kaum um ihn gekümmert hatte.
Mit der Erinnerung an den Vater gab sich Magnus nicht ab. Davon hatte er sich bewußt befreit.
Sie waren nie miteinander ausgekommen.
Nicht etwa, daß der Vater ihn geprügelt hätte oder sonstwie handgreiflich geworden wäre. Er hatte sich nur nicht mit dem Jungen abgegeben.
Die Erklärung war vielleicht darin zu suchen, daß der Bauarbeiter Pettersson nicht der richtige Vater des Knaben war. Er hatte mit dem Hurenbalg, wie er sich ausdrückte, möglichst wenig zu tun haben wollen.
Die alkoholgeschädigte Mutter war oft aggressiv zu ihrem Kind gewesen, dessen Vorhandensein ihrer Ansicht nach ihr den Mann entfremdete.
Vor Magnus’ Geburt waren die beiden recht gut miteinander ausgekommen. Sie hatten es gemütlich gehabt, wenn sie zusammen Alkohol tranken. Da konnten sie eine oberflächliche gegenseitige Zuneigung entfalten.
Einmal hatte der Vater einige Arbeitskameraden zu sich nach Hause eingeladen. Es wurde ein feuchter Abend, und zu später Stunde taumelten alle bis auf einen heim. Sie tranken weiter, der Bauarbeiter, seine Frau und der Kollege.
Schließlich schlief Pettersson auf seinem Stuhl ein.
Magnus war das Ergebnis dieses Abends.
Die Pflegeeltern wollten, daß Magnus es gut hatte und seinen düsteren Erinnerungen entwuchs. Sie meinten es gut, aber für Magnus war es bereits zu spät. Nach seiner Meinung waren seine Pflegeeltern an seiner Lage schuld.
In der Schule wurde er gehänselt, weil er klein und schwächlich war und nicht in normalen Verhältnissen aufwuchs.
Zu Hause sprach er nie davon, daß er von seinen Schulkameraden verspottet wurde. Aber als er sieben Tage hintereinander mit Leidensmiene, blutverschmiert und abgerissen nach Hause kam, beschlossen seine Pflegeeltern, ihn um jeden Preis zum Reden zu bringen.
Schließlich kam es heraus. Doch nachdem Magnus berichtet hatte, schämte er sich, daß er sich das Geständnis hatte entlocken lassen. Und er schämte sich seiner Kleinheit.
Der Pflegevater setzte sich am selben Abend hin und schrieb dem Rektor einen Brief.
In dem Brief beschwerte er sich über die Mißhandlungen und teilte dem Rektor mit, was Magnus berichtet hatte.
Die Schulkameraden zerrten ihn in die Toilette und zwangen ihn, zu rauchen. Wenn er ihnen nicht gehorchte, verprügelten sie ihn.
Magnus bekam regelmäßig Taschengeld. Die andern Kinder nahmen es ihm weg. Wenn er es nicht freiwillig hergab, bedrohten sie ihn mit Taschenmessern, mit denen sie wütend vor seinem Gesicht herumfuchtelten.
Nach der Turnstunde ergötzten sich die Buben daran, ihm mit dem Handtuch einen Peitschenschlag nach dem andern ans Bein zu versetzen. Beim Schwimmunterricht hielten sie seinen Kopf unters Wasser, einmal so lange, daß ihm schwarz vor den Augen wurde.
Im Grunde fürchtete sich Magnus, zur Schule zu gehen. Trotzdem hatte er nie geschwänzt.
Der Rektor sorgte dafür, daß der Schulinspektor diesen Brief nicht zu sehen bekam, und rief Magnus zu sich.
Er fragte ihn, was für einen Unsinn er da seinen Pflegeeltern erzählt habe. „Willst du wirklich behaupten, daß derartige Dummheiten in meiner Schule vorkommen?“ fuhr er den Jungen an.
Darauf erzwangen die Pflegeeltern ein Gespräch mit dem Rektor, dem Klassenlehrer, dem Schulpsychologen und dem Berufsberater.
Die Sache kam der Presse zu Ohren – auf welche Weise, erfuhr man nie.
„Nach der Unterredung erklärten die Pflegeeltern, sich nicht mit den Maßregeln zufriedenzugeben, die die Schule treffen wird“, sagte der Rektor einige Tage später in einem Zeitungsinterview. „In jeder Schule besteht eine gewisse Neigung zu Pöbeleien. Wir tun, was wir können, sie beizeiten aufzudecken und einen Riegel vorzuschieben. Unter anderm werden die Schüler in der Pause auf dem Hof stets beaufsichtigt. Ich bin aber leider überzeugt, daß wir nur einen geringen Teil der Pöbeleien verhindern können. Es ist unmöglich, die heutige Verrohung von der Schule fernzuhalten. Dahin hat die Entwicklung leider geführt.“
„Meinen Sie damit, Herr Rektor, daß es früher derartige Vorfälle nicht gegeben hat?“
„Das habe ich nicht gesagt.“
Natürlich wurde daraus kein Fall für die Polizei.
Im übrigen war 1970, im ganzen betrachtet, ein recht gutes und angenehmes Jahr in Lund. Das neunhunderfünfzigste Jubiläum der Stadt wurde auf alle mögliche Weise gefeiert. Magnus Petterssons erste Berührung mit der Polizei sollte sich erst viel später in seinem Leben ergeben.
Im Sommer
Das Jahr 1971 zeichnete sich durch einen Sommer aus, der als „der heiße Sommer“ in die Geschichte Schonens einging.
Die Sonne brannte auf die fruchtbare Erde und auf die Menschen, die guten und die schlechten.
Wer konnte, flüchtete aus der Steinwüste der Stadt, als die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreichte. Es war tatsächlich so, daß man den Turm der Domkirche im Wärmedunst zittern zu sehen glaubte.
Die Abende waren lang, hell und schön.
Die Anlagen waren dichtbelaubt und spendeten wohltuenden Schatten.
Viele verliebten sich in diesem Sommer, und an einem heißen Augustabend liebte ein junger Mann sein Mädchen im Stehen am Tor des Ostfriedhofs.
Eine ältere Dame, die ihren Hund ausführte, wurde bei diesem Anblick vom Schlag getroffen.
Inger Elwing wurde in diesem Sommer, genauer gesagt, am 3. August, fünfzehn Jahre alt.
Am 22. Juli verbrachte sie den Abend bei ihrer Freundin Kerstin Johansson.
Die beiden Mädchen ließen Schallplatten laufen und rauchten am offenen Fenster.
Kerstins Eltern waren an diesem Abend ausgegangen. Kerstin hatte ein Flasche Rotwein aus dem Keller geholt, und sie hoffte, daß ihr Vater das Fehlen der Flasche nicht merken würde. Die Mädchen tranken ausgiebig.
Um Viertel vor neun verließ Inger das Mietshaus in der Brunnenstraße, wo Kerstin wohnte. Sie ging zu Fuß zum Botulfplatz. Von dort wollte sie mit dem Bus nach Nordfäladen heimfahren. Nordfäladen ist ein Viertel mit Mietskasernen im Norden der Stadt.
Der Botulfplatz ist die Endhaltestelle des Autobusses. Dort liegt auch die große Markthalle, die in den Jahren 1907/08 von der Stadt erbaut worden ist. Sie besteht aus roten Ziegelsteinen und sieht viel älter aus, als sie in Wirklichkeit ist.
Inger fühlte sich etwas unsicher auf den Beinen und kicherte immerzu vor sich hin. Der Wein tat seine Wirkung.
Im Sommer verkehren die städtischen Autobusse in Lund nur spärlich.
Inger sah den Bus, den sie hatte nehmen wollen, gerade abfahren, als sie den Botulfplatz erreichte.
Der nächste ging erst in vierzig Minuten.
„Scheiße“, sagte sie laut, als sie das feststellte.
Da sie keine Lust hatte, so lange zu warten, beschloß sie, ein Stück zu Fuß zu gehen. Den Rest des Weges wollte sie dann fahren.
Vom Wein benebelt, ging sie aufs Geratewohl los.
Sie hätte die nördliche Richtung einschlagen müssen, zum Marktplatz, an der Domkirche vorbei, über die Breitestraße und am Krankenhaus vorbei.
Aber aus irgendeinem unersichtlichen Grund schwenkte sie bei Gleerups Buchhandlung ab und nahm Kurs gen Westen, zum Grand Hotel und zum Bahnhofsplatz.
Erst beim Bahnhofsplatz merkte sie, daß sie die verkehrte Richtung eingeschlagen hatte.
Ihre Schwipsstimmung war von Müdigkeit abgelöst worden, von schlechtem Befinden und Schwindelgefühl. Sie ging im Schneckentempo und hatte die größte Lust, sich in die Gosse zu legen und zu schlafen.
Krampfhaft bemühte sie sich, die Richtung auszumachen, obwohl die Umgebung doppelte Konturen zu haben schien. Sie ging am Bahnhof vorbei zum Clemensplatz.
Als sie beim Clemensplatz anlangte, überwältigte die Müdigkeit sie so sehr, daß sie mitten auf dem Platz beim Brunnen auf eine Bank sank. Ihr war sehr übel.
Plötzlich erbrach sie sich, sie konnte gerade noch den Kopf abwenden, so daß ihr Kleid nichts abbekam.
Sie wußte nicht, was sie tun oder wohin sie gehen sollte. In diesem Augenblick gewahrte er sie.
Er hieß Rolf Jönsson und war siebenundvierzig Jahre alt.
Er ging auf sie zu.
„Ist dir nicht gut?“
Inger rülpste als Antwort.
Er erbot sich, sie zu sich nach Hause mitzunehmen, damit sie durch eine Tasse Kaffee wieder nüchtern wurde.
Sie kam willenlos mit.
Rolf Jönsson hatte ganz in der Nähe, in der Spolestraße, eine Zweizimmerwohnung mit Küche.
Er ließ sie auf einem Sofa Platz nehmen; dann begab er sich in die Küche, um den Kaffee zu kochen.
Sie saßen nebeneinander auf dem Sofa und tranken Kaffee. Sie sahen sich den Fernsehfilm an. Aber nach einer Weile wurde Inger so müde, daß sie einnickte.
Auch Jönsson war nicht ganz nüchtern; doch er war es gewohnt, Alkohol zu sich zu nehmen.
Inger hatte zum erstenmal in ihrem Leben Wein getrunken. Er stieß sie an. „Du, Inger, streck dich auf dem Sofa aus. Ich hole dir etwas zum Zudecken.“
„Mmmmm“, murmelte sie und streckte sich aus.
Er holte zwei Wolldecken, die er über sie ausbreitete. Er betrachtete sie und seufzte.
Er ging in die Küche und trank ein großes Glas Wodka, rauchte eine Zigarette und setzte sich mit dem zweiten Glas an den Küchtentisch.





























