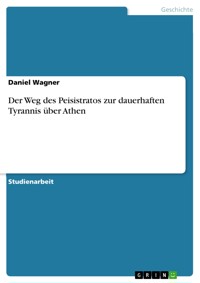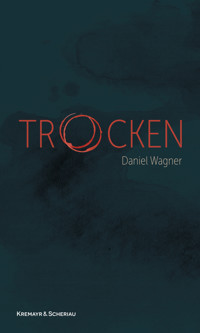
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie führt man ein Leben im Sog der Sucht? Wie fühlt es sich an, am Totenbett der eigenen Mutter besoffen sein zu müssen, weil nichts wichtiger ist als der nächste Schluck? Wie ist es, wenn sich jeder Tag und jede Nacht um die Sucht dreht und man bereit ist, alles zu vernichten, um ihr zu dienen? In gnadenloser Offenheit schreibt Daniel Wagner von der Hölle und den Monstern, die jahrelang sein Leben definierten. Er gibt einen ungeschönten Einblick in das Innenleben einer Suchterkrankung und wie sie nach außen hin explodiert. Ein bewegendes Buch, das aufdeckt und wachrüttelt: Betroffene, Nahestehende und Antwortsuchende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Sucht
Flüssig | Eins
Rot-Weiß-Rotwein
Flüssig | Zwei
Liebe
Flüssig | Drei
Aber-kadabra
Flüssig | Vier
Die Rechnung, bitte!
Flüssig | Fünf
Schlucke
Flüssig | Sechs
Der Tropfen
Flüssig | Sieben
Depression
Rausch
Absprung
Station A
Realität
Nass | Eins
Station B
Samen
Nass | Zwei
Tagebuch | Eins
Nass | Drei
Fetzen
Nass | Vier
Austrinken
Station C
Tagebuch | Zwei
Heimkommen
Trocken | Eins
Der ewige Kater
Tagebuch | Drei
Trocken | Zwei
Druck
Tagebuch | Vier
Trocken | Drei
Dieses Buch
Tagebuch | Fünf
Trocken | Vier
Musiktherapie
Nachtspaziergang
Sprache der Jugend
Trocken | Fünf
Anmerkungen/Zitate
Als du mich zu einem letzten Gespräch
gebeten hast, war ich betrunken.
Bei deiner letzten, so tröstenden Umarmung
war ich betrunken.
Deine letzten Worte hast du an mein
betrunkenes Ich gerichtet.
Ich war jedes verdammte Mal betrunken,
als wir uns in deinem Sterbejahr sahen.
Ich war bei jedem Lächeln betrunken,
ich war bei jeder Träne betrunken.
Ich war betrunken, als du gestorben bist, und
ich war betrunken, als du beerdigt wurdest.
Es tut mir unendlich leid, Mama.
Dei Bua ist jetzt trocken.
Sucht
Gib mir irgendwas, egal was, das mich flüchten lässt, und ich gehöre dir.
Mit ungefähr sechs Jahren lernte ich Rollschuh fahren. Ordentlich versorgt mit Knie- und Ellbogenschonern. Das Rollschuhfahren an sich wusste mich nicht zu überzeugen. Mir gefiel es nicht, andauernd hinzufallen, und ich sah prinzipiell kein Problem im klassischen Zu-Fuß-Gehen. Ich konnte das erst seit ein paar Jahren und mir wollte die Notwendigkeit von herausfordernden Schuhen nicht einleuchten. Egal, denn was ich mochte, war das erleichternde Gefühl, meine Gelenke von den beklemmenden Schonern zu befreien. Ich liebte es. Ich liebte es so sehr, dass ich weiterhin Rollschuh fahren wollte, einzig aus dem Grund, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Aber das reichte mir nicht. Ich fing an, mir einfach so Knie- und Ellbogenschoner anzulegen und mich möglichst lange damit, einmal über Nacht, zu malträtieren, um das selige Gefühl der Befreiung zu erfahren. Meine Eltern meinten irgendwann, dass ich es damit übertreibe, also begann ich meine Schoner heimlich, unter der Kleidung, zu tragen. Ich weiß noch, wie ich mich im Kasten in meinem Kinderzimmer versteckte und die Schoner dort abnahm. Zum Teil aus Scham, aber auch, weil ich allein sein wollte, mit mir und dem Moment.
Diese fünf Sekunden nach dem Abnehmen, diese Handvoll Augenblicke der Freiheit und des Glücks, waren es mir wert, über mehrere Stunden zu leiden. Denn es war unangenehm. Es war heiß und es juckte und ich konnte meine Arme und Beine kaum bewegen. Aber das war es mir wert. Und im Wesentlichen beschreibt, was ich da erlebt habe, das Wesen einer Sucht.
Sich selbst zu opfern, um sich lebendig zu fühlen.
Flüssig | Eins
Villach, 2017
Die Welt hat mich ausgekotzt und ich hab ihrdie Haare gehalten.
Mit diesem Gedanken öffne ich schwerfällig meine verklebten Augen. Es ist irgendein beschissener Tag irgendeines beschissenen Wintermonats. Schmatzend versuche ich Speichel in meinem Mund zu produzieren. Da ist nichts als Dürre und Sehnsucht. Sehnsucht nach Flüssigkeit. Mein Körper fühlt sich völlig zerstört an. Ich nehme Schmerzen in so gut wie jedem Körperteil wahr und eine beklemmende Unruhe kommt in mir auf. Eine Unruhe, die mir quer durch mein Innerstes brüllt, dass ich flüchten muss. Diese abscheuliche Unruhe ist der letzte Antrieb, der mir geblieben ist.
In meinem Bett schlafe ich seit Wochen nicht mehr. Vor mir, am Wohnzimmertisch, stehen ein Wasserglas und meine Sicherheitsbierflasche. Zur Hälfte ausgetrunken und raumtemperiert. Ich nehme einen Schluck vom Bier. Es würgt und es schüttelt mich. Ich nehme drei weitere Schlucke, halte kurz inne und nichts passiert. Die Unruhe, die mich geweckt hat, legt sich wieder schlafen und ich stehe auf. Von Schwindelanfällen geplagt, torkle ich in die Küche und zünde mir noch auf dem Weg eine Zigarette an. Das Bier nehme ich mit. Mein erster bewusster Blick richtet sich auf die Uhr am Backrohr in der Hoffnung, ausreichend geschlafen zu haben. Fuck.
Es ist fünf Uhr morgens. Dürften nicht mehr als zwei, vielleicht drei Stunden gewesen sein. Ich öffne frustriert das Fenster und rauche in den jungfräulichen Himmel. Auf dem Fensterbrett steht noch eines der Biere, die ich am Vortag an allen möglichen Plätzen in und außerhalb meiner Wohnung platziert oder versteckt habe. Die meisten davon sind offen und angetrunken. In diesem Bier ist vielleicht noch ein Drittel übrig. Ohne irgendeinen Zweifel greife ich zur Flasche und trinke sie aus. Ich muss mich konzentrieren, um den Inhalt in mir zu behalten, und versuche die Würgereflexe wegzuatmen. Es gelingt mir fürs Erste und das Wissen, zumindest ein wenig Alkohol in mir zu haben, beruhigt mich. Aber mit dem nächsten Zug an meiner Zigarette überfällt mich der morgendliche Hustenanfall. Es ist ein schwerer Husten, tief aus meinem geschundenen Körper, der sich gegen all das Gift zu wehren versucht, das ich ihm zufüge. Ich muss die Zigarette abtöten und beuge mich über das Waschbecken. Es würgt mich und es beutelt mich und ich ringe nach Luft, als ob ich unter Wasser getaucht würde. Ich bekomme Angst und möchte sofort etwas trinken, aber ich gehöre gerade dem Waschbecken. Ich umklammere es wie eine Geliebte und breche all das Schlechte dieser Welt aus mir heraus. Einem minutenlangen Kampf ausgesetzt, den ich verliere, sobald ich mich wehre, harre ich unter Krämpfen und Atemnot aus, bis es irgendwann endlich endet.
Es gelingt mir, mich aufzurichten, und ich spüle meinen Mund aus. Bloß um ihn im nächsten Moment wieder mit Alkohol zu füllen. Ich schwanke zum Kühlschrank, in dem drei offene Bierflaschen stehen. Die „Biere vom Vortag“. Die stehen da immer drin und sie gehen niemals aus. Ist ein Bier leer, wird eine neue Flasche geöffnet, angetrunken und mit der leeren ausgetauscht. Dieses System garantiert mir, dass ich immer wieder Schlucke nehmen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Unter Zeitdruck fülle ich, was ich getrunken habe, mit Wasser nach.
Ich nehme das Bier mit dem wenigsten Inhalt und trinke es aus. Es würgt mich kurz, aber ich behalte die Fassung und schlichte ein neues nach. Jetzt nehme ich das Bier mit dem meisten Inhalt, stelle mich wieder ans Fenster und zünde mir eine Zigarette an. Ich rülpse, schnaufe durch und versuche so gut ich kann in der Realität anzukommen. Mein Blick fällt auf meine Hand und ich sehe, wie sie zittert. Es ist zwar arschkalt, aber ich kenne dieses Zittern und es hat nichts mit der Temperatur zu tun. Hallo Suchtdruck, du einzige Konstante in meinem Leben. Während ich das Bier in immer größeren Schlucken trinke, gehe ich in meinem Kopf durch, wie viel Alkohol in der Wohnung ist. Sechs geschlossene und drei offene Biere im Kühlschrank, fünf in der Kiste, das da, nein, das nicht, zwei am Balkon in der Kiste, im Schlafzimmer ein paar Dosen, in der Abstellkammer zwei Liter Rotwein und eine angetrunkene 1,5-Liter-Flasche, im Rucksack eine Flasche Weißwein und natürlich die harten Getränke zur Not.
Ich komme zu dem Schluss, es sei zu wenig. In mir machen sich Angst und Überforderung breit, da ich mich jetzt mit einem Einkauf konfrontiert sehe. Gerade habe ich absolut keine Ahnung, wie ich das bewältigen soll, und ich fange an, panisch zu werden. Vom bloßen Gedanken daran beginnt mein Herz zu rasen und ich kann nur trinken, um mich zu beruhigen. Ich versuche mir gut zuzureden und gehe im Geist den Einkauf durch. Neben dem Leeren meines Bieres hilft mir der Gedanke, eine Flasche Rotwein in ein Tetrapak Multivitaminsaft umzufüllen und mitzunehmen. Das ist der Plan.
Während die Übergänge zwischen den Zigaretten beinahe nahtlos und die Gedanken in meinem Kopf immer lauter werden, setze ich mich an den Tisch und schalte den Fernseher an. Fuck. Noch zwanzig Minuten, bis meine Morgensendung losgeht. Zwanzig Minuten sind verdammt lange in einer Welt, deren Raum- und Zeitgefüge an einem Alkoholpegel hängen. Ich werde nervös und starre abwechselnd in den Fernseher und auf die Uhr an der Wand, während meine Gedanken beginnen, ihren eigenen Film zu drehen.
Die Möglichkeiten eines neuen Tages sind Finger, die auf einen zeigen.
Ich brauche Rotwein.
Rot-Weiß-Rotwein
Wir haben ein Alkoholproblem. Vielleicht nicht du und vielleicht auch nicht deine Zahnärztin oder dein Zahnarzt, aber wir, als Gesellschaft in Österreich, wir haben ein Alkoholproblem. Wir haben ein Problem mit dem Konsum von Alkohol, wir haben ein Problem mit der Aufklärung darüber und wir haben ein großes Problem mit der Behandlung von Alkoholkrankheit. Aber das größte Problem, das wir mit diesem Thema haben und das daraus erst ein Dilemma macht, ist die generelle Tabuisierung von all diesen Problemen.
Irgendwann haben wir in Österreich still und heimlich Alkohol als Kulturgut ausgerufen und beschlossen, dass wir uns gemeinschaftlich einfach so lange ansaufen, bis wir kritische Stimmen als kulturfeindlich wahrnehmen. Und wir brauchen dafür nicht einmal eine Lobby, wie die Tabak- oder Waffenindustrie. Überall, in jedem Gasthaus, auf jeder Feier, bei jeder noch so beliebigen Veranstaltung findet man sie, die ehrenamtlichen Lobbyisten, die für den Stellenwert von Alkohol in unserer Gesellschaft kämpfen. Alkohol gehört dazu, Punkt, aus. Wer sich diesem Mantra nicht anschließen will, wird ausgegrenzt.
Mit Slogans wie „Ein Bier ist kein Bier!“ oder „Darauf müssen wir anstoßen!“ laufen die unbezahlten Testimonials durch die Gegend und propagieren die Harmlosigkeit dieser Droge. Wir lernen von Kind auf, dass Alkohol „einfach dazugehört“. In jedem Lebensbereich, durch alle Gesellschaftsschichten. Wir lernen, dass es ein gutes Essen nicht ohne Weinbegleitung gibt. Wir lernen, dass jegliche Feierlichkeiten wie Geburtstage oder Silvester erst durch Alkohol zu richtigen Feiern werden. Wir lernen, dass man sich nach einem harten Tag ein Feierabendbier verdient hat. Wir lernen, dass Erfolge, ob in der Arbeitswelt oder im Sport, mit Alkohol zelebriert werden.
Und ich möchte hier festhalten, dass ich das weitgehend in Ordnung finde und absolut der Meinung bin, dass Menschen feiern und sich berauschen sollen. Aber wir lernen all diese Dinge und werden auf Alkohol als Gesellschaftsdroge konditioniert, ohne ausreichend über seine Schattenseiten aufgeklärt zu werden. Wir wachsen nicht mit der Information auf, dass die Folgen von Alkoholkonsum zu den häufigsten Todesursachen in Österreich gehören. Wir lernen nicht, wie schnell er abhängig macht und wie brutal eine Suchterkrankung zuschlagen kann. Wir lernen zwar, dass Drogen schlecht sind, bekommen aber vermittelt, dass Alkohol keine wäre.
Wir dürfen in Österreich früher saufen als Auto fahren, rauchen, bis Mitternacht draußen bleiben und ein fucking Rubbellos kaufen. Wie harmlos können wir das Licht gestalten, in das wir Alkohol als Gesellschaft rücken? Wie sehr können wir den Weg für Jugendliche noch ebnen, um sie in unsere allgemeine Abhängigkeit zu ziehen?
Österreich verhält sich als Gesamtes wie ein besoffener Typ auf einer Party, der Nüchterne mit einer selbstverständlichen Penetranz zum Trinken überreden will. Der einem bei jeder Möglichkeit ins Ohr lallt, man möge nicht so langweilig sein und etwas saufen. Der einem das Wasser in der Hand schlechtredet und sich so lange aufdrängt, bis man selbst entweder trinkt oder die Party verlässt.
Ich hatte schon immer eine Angststörung. Soll heißen, ich hatte als Kind vor allem Angst, was ich irgendwie mit Gefahr in Verbindung brachte. Und vor Schmetterlingen, warum auch immer. Ich bin sehr wachsam, nach potenziellen Gefahren suchend, durch die Welt gewandert und habe alles Bedrohliche aufgesaugt und verinnerlicht, um mich davor zu schützen. In meinen Schulheften stand eine Zeit lang „Keine Macht den Drogen“, ein Satz, den ich nicht verstanden habe, aber er war eine Warnung, also habe ich mich informiert und hatte fortan Angst vor Drogen. Aber Drogen waren für mich fragwürdige Substanzen, die man unter einer Brücke kauft, und nicht das Getränk, das so gut wie jedes meiner Vorbilder konsumierte. Es erstaunt und erschüttert mich, dass ich als Kind, das vor absolut allem inklusive Schmetterlingen Angst hatte, in Alkohol nicht den Hauch einer Gefahr wahrnahm. Es ist schwierig bis unmöglich für Heranwachsende, der Substanz, die den Menschen so viel Spaß bereitet, mit einem anderen Gefühl als Vorfreude zu begegnen.
Und dieser Umstand ist kein Versagen der Eltern oder von einzelnen Lehrkräften. Es ist ein alles übergreifendes, strukturelles Problem, das in erster Linie auf politischer Ebene seit Jahrzehnten tabuisiert und ignoriert wird.
Land der Weinberge, Land der Bierströme. Oh, du dichtes Österreich.
Flüssig | Zwei
Wäre meine Zukunft eine Flasche Wein, ich würde sie exen.
Mit diesem Gedanken mache ich mich auf die Suche nach der angetrunkenen Rotweinflasche in meinem Kleiderzimmer. Ich habe sie gestern noch spät am Abend in der nächsten Tankstelle gekauft, aus meiner ewigen Angst heraus, mir könnte mein Stoff ausgehen, und irgendwo in diesem Raum versteckt. Angespannt und an meiner Wahrnehmung zweifelnd durchwühle ich meine Kästen, bis ich sie schließlich in einer Sporttasche finde. Ich sehe die Heilung versprechenden gut 1,2 Liter nicht. Lediglich die 0,3 fehlenden Liter fallen mir auf und beunruhigen mich. Das Glas eines Alkoholikers ist nie halbvoll. Der Gedanke daran, heute noch einkaufen zu müssen, versetzt mich erneut in Schwindel und zwingt mich zum ersten großen Schluck noch direkt aus der Flasche. Der billige und starke Geschmack des Weins fährt durch meinen ganzen Körper und schüttelt mich durch. Meine Gesichtszüge verkrampfen und entspannen sich erst langsam zu einem sanften, beruhigten Lächeln. Ich liebe Wein. Ich liebe, wie schnell und effektiv er mich „gesund macht“. Beschwingt von meiner Medizin gehe ich wieder in die Küche, nehme mir ein Glas und mache es voll.
Zigarette an, Glas aus, Kopf aus. Wiederholung.
Endlich ist es sechs Uhr und meine Sendung, ein beliebiges Morgenmagazin, geht los. Das ist wichtig für mich. Mein Leben hat keine Struktur, keine Konstanten außer den Rausch, und ich habe das Gefühl, dieses Morgenmagazin zu brauchen, um nicht völlig den Halt zu verlieren. Die Sendung läuft und ich stehe am Fenster, das ich nicht mehr öffne, um zu rauchen. Meine Stirn klebt an der Scheibe und stiert in eine Welt, die meiner nicht ferner sein könnte. Ich beobachte Menschen, die einfach so am Leben teilnehmen, und ich fühle mich ihnen gegenüber so unbeschreiblich fremd. Eine Frau joggt durch mein Blickfeld. In meinem ganzen Körper spüre ich eine beißende, tiefe Sehnsucht nach ihrem, einem normalen, Leben. Mir treibt es die Tränen in die Augen und ich kann nicht anders, als mir das nächste Glas Rotwein in den Rachen zu schütten. Ich brauche Luft und öffne schließlich das Fenster. Die Augen sind verquollen und ich schluchze vor mich hin. Mehrmals täglich bringt mich die Diskrepanz zwischen Sucht und Sehnsucht an meine Grenzen. Die Sehnsucht nach einem nüchternen Leben kämpft gegen die Sucht nach Alkohol. Die zerrende Angst und die unendliche Leere in mir kämpfen gegen den anhaltenden Rausch. Der Gewinner steht wie immer schon vorher fest. Aus meiner Trauer wird Aggression.
Ich schlage das Fenster zu, schalte den Fernseher aus, hocke mich auf den Boden und vergrabe meinen Kopf in meinen Armen. Wütende, alkoholgetränkte Atemzüge begleiten meine tiefschwarzen Gedanken. Ich stehe auf und schlage mit der Faust gegen die Wand. Einmal, zweimal, dreimal. Dutzende kleinere und größere Dellen im Mauerwerk sind Zeuge meines Tauschhandels: Selbsthass gegen Schmerz.
Meine Hand pulsiert und brennt, aber ich fühle mich besser und kann wieder ruhiger durchatmen. Ich setze mich an den Tisch, schalte den Fernseher wieder an und saufe das nächste Glas Wein aus. Die jetzt zur Hälfte geleerte Flasche fülle ich fast komplett mit Wasser wieder auf. In meinem Kopf reime ich mir das dann so zusammen, dass ich eigentlich noch keinen Schluck von dem Wein genommen habe. Die Selbstlügen eines Alkoholikers haben keine Beine.
Ich stelle die Flasche in den Kühlschrank und nehme eines der offenen Biere heraus. Endlich fühle ich mich zumindest angetrunken und ein wenig Stress und Angst fallen von mir ab. Es gelingt mir, halbwegs entspannt am Tisch zu sitzen, mein Bier zu trinken und beiläufig fernzusehen. Dann aber ein Geräusch, das mich schlagartig in den Panikmodus versetzt: Weckerklingeln. Meine Freundin ist wach.
Liebe
Lass mich in deinen Augen sehen, was ich reflektieren will.
Ich kannte sie schon seit meiner Kindheit, aber erst als ich fünfzehn war, begannen wir uns näher kennenzulernen. Man kann durchaus sagen, dass ich auf den ersten Blick verliebt war. Sie war neu, sie war aufregend und sie offenbarte mir eine Welt, die schöner war als meine. Ich hatte unterm Strich eine gute Kindheit und Jugend, aber meine Welt war auch geprägt von Ängsten, von Selbstzweifeln und Verschlossenheit. Sie kam und sie nahm mir das. Sie nahm mir meine mich ständig begleitenden Ängste und gab mir Sicherheit. Sie riss meine Schutzmauern nieder und öffnete mir Türen. In die Pubertät, eine Zeit, in der jeder Tag Veränderungen mit sich brachte, brachte sie Stabilität. Ich genoss es, wenn sie bei mir war, und fühlte mich einsam, wenn sie es nicht war. In den ersten Monaten trafen wir uns heimlich, da ich mich nicht bereit fühlte, sie meinen Eltern vorzustellen. Ich wollte Kind bleiben. Mein Kopf war zwar verdreht und ich schwer verliebt, aber ich war auch vorsichtig und entschlossen, es langsam anzugehen.
Jede Emotion zu dieser Zeit war neu für mich. All die Gefühle waren berauschend und überwältigend. So auch das Gefühl, sie zu vermissen. Die Tage ohne sie wurden länger und die Tage mit ihr wurden kürzer. Wochen und Monate des vorsichtigen Kennenlernens vergingen und unsere Bindung wurde von Mal zu Mal stärker. Immer wieder verfiel ich ihren Küssen, ihren warmen Berührungen und ihren klaren Worten, die den Rest der Welt verstummen ließen. Sie verstand es, mir genau das zu geben, was ich brauchte. Manchmal mehr, aber nie weniger.
Zwischen uns wurde es zunehmend ernster, also beschloss ich schließlich, meinen Eltern von ihr zu erzählen. Die Heimlichtuerei wurde meinen Gefühlen nicht mehr gerecht. Ihren „Segen“ zu bekommen war ein wesentlicher Schritt für mich, der aus meiner Liebelei eine handfeste Beziehung machen würde. Ich war jetzt bereit. Ich war bereit, mich zu binden und Hand in Hand mit ihr durchs Leben zu gehen. Aber mit den großen Gefühlen kamen auch erste Probleme. Kurz vor Silvester hatten wir einen furchtbaren Streit. Es eskalierte völlig und unsere noch so junge Beziehung stand vor dem Aus. Ich war am Boden zerstört und suchte Trost bei meinen Eltern. Sie sahen die Schuld bei ihr und rieten mir, Abstand zu nehmen. Sie wäre zu viel für mich gewesen. Ich wusste, dass sie recht hatten, und es ging mir beschissen, aber noch sicherer wusste ich, dass ich sie wiedersehen wollte. Ich glaubte an uns. Heimlich traf ich sie noch am nächsten Tag, um ein klärendes Gespräch zu führen, und wir versöhnten uns. Etwas war anders, aber es fühlte sich richtig an, wieder bei ihr zu sein und bei ihr Halt zu finden.
Es verstrichen Jahre. Aufregende, eindrucksvolle Jahre, in denen wir zwar keine feste Bindung eingingen, aber auch nicht voneinander loskamen. Zumindest ich kam nicht von ihr los. Ich lernte Mädchen kennen und hatte meine ersten Beziehungen neben ihr. Ich fühlte mich frei in meinen Entscheidungen und Handlungen, aber das war ich nicht. Sie war es, die den Ton angab. Wenn sie es wollte, brachte sie meine Beziehungen ins Schwanken und das tat sie auch. Sie war unheimlich intelligent und manipulativ und ich zu achtlos und blind, um das zu erkennen. Die ersten festen Bindungen gingen in die Brüche und rückten sie wieder mehr in meinen Fokus. An jedem Abgrund wartete sie, mit ausgestreckten Armen, bereit, mich aufzufangen. Und ich fiel gern in ihre Arme. Mit ihr war es viel einfacher. Bei ihr wurde ich zu dem Menschen, der ich immer sein wollte. Aber eigentlich machte sie lediglich den Menschen aus mir, den sie haben wollte. Ich wurde gefügig. Mit der Zeit hörte und überhörte ich Geschichten über sie. Warnende Geschichten. Ich sah und übersah ihre Verflossenen. Überall begegnete ich Überresten aus ihren vergangenen Beziehungen und ignorierte sie. Arme Gestalten, die an ihr zerbrochen waren. Menschen aus allen Schichten, mit unterschiedlichsten Geschichten, die mit ihrer Liebe nicht umzugehen vermochten. Ich sah und übersah sie alle. Mit mir wird es anders, versprachen wir uns. Und mir selbst versprach ich, wachsam zu bleiben, um diese einzigartige Beziehung, die wir führten, am Leben zu erhalten. Doch ich führte nicht mehr. Im Schein der Kontrolle gab ich die Führung ab und verfiel immer mehr ihrem Zauber, unfähig, ihre Tricks zu durchschauen. Zu geschickt zog sie ihre Fäden. Zu hell ließ sie das Licht scheinen, um noch Schatten wahrzunehmen. Sie war das Gift und sie war das Gegenmittel. Aus mir wurde ein Wir.
Ich war mittlerweile zwanzig und wir zogen von Kärnten nach Wien. Gemeinsam waren wir wie geschaffen für diese Stadt. Vor unseren Füßen breitete sich ein roter Teppich aus und wir tanzten leichtfüßig darüber. O ja, wir waren angekommen. Wir studierten zusammen, wir feierten zusammen, wir lernten die Stadt und neue Leute kennen. In Kärnten mussten wir uns noch Gründe suchen, um uns zu sehen oder etwas zu unternehmen. Ganz Wien war ein Grund. Ich lebte mit meinen zwei besten Freunden in einer Wohngemeinschaft und sie war ein gern gesehener Gast. Beide mochten sie und verstanden sich gut mit ihr, aber geliebt habe nur ich sie.
Relativ schnell wurde mir klar, dass wir hierhin gehörten. Mir wurde aber auch klar, dass das nicht für mich allein galt. Ohne sie würde ich diese Stadt nicht überleben. Wien war ein Nährboden für meine Angststörung und ich war zu dieser Zeit noch völlig unbeholfen im Umgang damit. Noch in meiner ersten Nacht in der neuen Wohnung und der neuen Stadt hatte ich die erste Panikattacke meines Lebens, ohne zu wissen, was eine Panikattacke ist. Kurz vorm Einschlafen schreckte ich auf, mit dem eindeutigen Gefühl zu sterben. Mein Puls flog mir um die Ohren und ich atmete, als hätte man mich minutenlang unter Wasser getaucht. Das, was einer Panikattacke ihren Grauen verleiht, ist das große Unbekannte. In absoluter Dunkelheit durchlebt man eine Nahtoderfahrung. Man weiß weder, was mit einem geschieht, noch wie man es beendet. Man weiß nur, dass man stirbt. Bis man es überlebt. Aber das Unbekannte bleibt. Es begleitet einen fortan und es stellt Fragen, auf die man keine Antworten hat. Und es flüstert einem immer wieder ins Ohr, dass es jederzeit bereit ist, die Kontrolle an sich zu reißen. Ich war dem nicht gewachsen. In kürzester Zeit breiteten sich meine Ängste aus und machten es mir unmöglich, ein freies Leben zu führen. Jeder Einkauf, jede Fahrt mit der U-Bahn und jeder Spaziergang wurden zu Horrortrips. Meine Panikattacken häuften sich und die Zeit dazwischen war geprägt von der Angst vor der nächsten.
Aber nicht, wenn sie dabei war. Wenn sie bei mir war, war ich in Sicherheit. Es war aber nicht nur das Gefühl von Sicherheit, das sie mir gab. Sie machte aus dieser mich so überfordernden Zeit die gefühlt beste meines Lebens. Wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander und ich bat sie