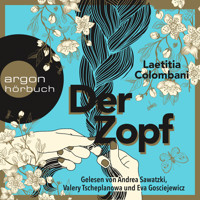9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wohnt das Glück im zentralen Himalaya? Titus Arnus aufregender Expeditionsbericht Titus Arnu begibt sich auf die Reise zu einem wahrhaft unbekannten und weltfernen Ziel: Tsum, das Tal des Glücks, versteckt im zentralen Himalaya und ziemlich schwer und mit modernen Transportmitteln überhaupt nicht zu erreichen. Erst seit wenigen Jahren ist die Region für Fremde zugänglich. Die Bewohner des Hochtals, das zwischen Sieben- und Achttausendern liegt, blieben unberührt von jeder modernen Entwicklung, ob aus Nepal, Indien oder dem benachbarten China. Sie leben in kompletter Abgeschiedenheit nach ihren eigenen Traditionen und in vielerlei Weise anders: Sie haben sich verpflichtet, komplett auf Gewalt zu verzichten – und zwar gegen Menschen und Tiere (wer ein Tier tötet, hat ein großes moralisches Problem) –, und leben in Polyandrie, also eine Frau mit mehreren Männern. Der renommierte Reiseautor Arnu will herausfinden, wie es dort tatsächlich aussieht, wie man dort lebt und was das über unsere durchorganisierte Welt im Westen aussagt. «Wie glücklich sind die Menschen wirklich im Tal des Glücks? Und verändert man sich selbst, wenn man eine Weile dort ist? Ist es für verwöhnte Westler eher eine Qual, sich dort aufzuhalten – oder eine Befreiung?» Ein mitreißendes Reiseabenteuer, geleitet von einer der ganz großen Fragen: Was ist Glück?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Ähnliche
Titus Arnu
Tsum - eine Himalaya-Expedition in das Tal des Glücks
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wohnt das Glück im zentralen Himalaya? Titus Arnus aufregender Expeditionsbericht
Titus Arnu begibt sich auf die Reise zu einem wahrhaft unbekannten und weltfernen Ziel: Tsum, das Tal des Glücks, versteckt im zentralen Himalaya und ziemlich schwer und mit modernen Transportmitteln überhaupt nicht zu erreichen. Erst seit wenigen Jahren ist die Region für Fremde zugänglich. Die Bewohner des Hochtals, das zwischen Sieben- und Achttausendern liegt, blieben unberührt von jeder modernen Entwicklung, ob aus Nepal, Indien oder dem benachbarten China. Sie leben in kompletter Abgeschiedenheit nach ihren eigenen Traditionen und in vielerlei Weise anders: Sie haben sich verpflichtet, komplett auf Gewalt zu verzichten – und zwar gegen Menschen und Tiere (wer ein Tier tötet, hat ein großes moralisches Problem) –, und leben in Polyandrie, also eine Frau mit mehreren Männern.
Über Titus Arnu
Titus Arnu, Jahrgang 1966, schreibt für die «Süddeutsche Zeitung», «Geo Special», «Natur», «Bergwelten» und verschiedene Outdoor- und Reisemagazine. Zuvor arbeitete er u. a. für das Magazin «SZ Wissen», den «Spiegel» und «Mare». Er hat mehrere Bücher verfasst, darunter fünf Bände der «Übelsetzungen» über Sprachpannen aus aller Welt, die zu Bestsellern wurden.
«Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg.»
Siddhartha Gautama Buddha
«Wenn man unglücklich ist, findet man auch auf einem weichen Sofa keinen Schlaf. Wir sind hier so glücklich, dass wir auch auf einem Felsen schlafen können.»
Nima Dorze,Bauer aus dem Tsum-Tal
«Die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denker Sache sein. Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können.»
Hermann Hesse
Kapitel 1Heulen und Zähneklappern
Wir hatten das Tal des Glücks gesucht. Nun fühlte es sich so an, als hätten wir das Tal der Tränen gefunden. In meiner naiven Phantasie hatte ich blühende Bergwiesen gesehen, glücklich lächelnde Menschen und friedlich grasende Tiere. Ich wollte mir von erleuchteten Mönchen erhellende Weisheiten in den Block diktieren lassen und in der Abendsonne, mit spektakulärem Blick auf vereiste Siebentausender, über den Sinn des Lebens, den Weg zum Glück und den ganzen Rest sinnieren.
Wie sich aber überraschend herausstellte, gibt es überhaupt keine Abendsonne, wenn man am Fuß eines vereisten Siebentausenders campiert. Das schließt sich gegenseitig aus, denn Siebentausender werfen verdammt lange Schatten, besonders im Spätherbst. Im November wird es auf knapp viertausend Metern im Himalaya auch empfindlich kalt, sodass man eher mit Zittern beschäftigt ist als mit Sinnieren. Philosophische Gedankengänge? Eingefroren. Erkundungen zum Thema Glück? Mich quälte eher die Frage, ob man sich beim Gang aufs Plumpsklo Erfrierungen an delikaten Körperteilen holen könnte. Die Antwort lautete: wahrscheinlich ja. Ich versuchte deshalb, es noch eine Weile länger hinauszuzögern, obwohl ich wusste, dass diese Taktik auf Dauer nicht funktionieren würde. Tagsüber viel trinken, mindestens vier Liter, und nachts zehn Stunden im Schlafsack liegen, ohne auf die Toilette zu gehen, das schloss sich auch gegenseitig aus.
Es war eine grauenvoll kalte Nacht im Zelt mit schrecklichen Geräuschen und schrecklichen Gerüchen um uns herum. Geheule, Gestank, Geklapper, Gegrunze. Gab es den Yeti wirklich? Und wenn ja, war er es, der da draußen um die Zelte schlich und höchst verdächtige Töne von sich gab? Menschlich hörte sich das jedenfalls nicht an.
Na toll. Und das sollte jetzt das sagenumwobene Shangri-La sein, für das wir um die halbe Welt gereist waren? Jenes versteckte Paradies in einem Hochtal des Himalayas? Eine weltentrückte Gegend, in der angeblich eine geradezu utopische Gesellschaft existierte, die sich den Prinzipien der Gewaltlosigkeit verschrieben hatte? Die Schnittstelle zwischen einfachem Leben und spirituellen Erkenntnissen, hübsch eingebettet zwischen grünen Wiesen, golden schimmernden Getreidefeldern und vergletscherten Bergriesen? War das Ganze etwa ein Mythos, der mit der kargen Wirklichkeit dieser eigentlich lebensfeindlichen Umgebung nichts zu tun hatte?
Der Auftrag lautete: Finde das Glück. Das Ziel der Expedition hätte kaum höher gesteckt sein können. Zum einen geographisch, zum anderen inhaltlich. Dreieinhalb Wochen lang wanderte ich durch ein abgelegenes Hochtal an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, in Höhen zwischen eintausend und knapp fünftausend Metern, immer geleitet von der Frage, ob das weltabgewandte, naturnahe und tiefreligiöse Leben dort glücklicher macht als unser luxuriöser, multioptionaler und informationsüberfrachteter Alltag im Westen. Oder war dieser Blick schon im Ansatz idealisierend?
Was ich im Vorfeld über die uralte buddhistische Kultur im Tsum-Tal recherchiert hatte, klang hochinteressant. Die Bewohner des Tals hatten offiziell gelobt, weder Tiere noch Menschen zu töten, und angeblich hielten sie sich seit fast hundert Jahren streng daran. Es gab Genossenschaften, Gemeinschaftseigentum und Großfamilien mit der seltenen Eheform der Polyandrie. Das bedeutete: eine Frau hat mehrere Männer. Dazu fleischlose Ernährung, nur frisches Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Reis und Getreide, alles in Bioqualität. Viel Meditation, viel Arbeit, viel Platz. Keine Straße, kein Strom, kein Facebook, keine Ablenkung. Das hörte sich alles sehr traditionell und gleichzeitig sehr modern an. War das Tal etwa ein Modell für eine bessere Lebensweise – naturnah, beruhigend und ohne das nervenaufreibende Gezerre um mehr Geld, mehr Macht, mehr Aufmerksamkeit? Wenn man uralten buddhistischen Mythen Glauben schenkte, war es genau so. Das Tsum-Tal galt als heiliger Ort, als verborgenes Paradies.
Offen gesagt: Es klang und roch im Moment absolut nicht paradiesisch um mich herum. Die akustischen Eindrücke dieses bitterkalten Abends im Zelt ließen sich grob in Außen- und Innengeräusche unterscheiden. Draußen: dumpfes Grunzen und heiseres Heulen, dazu hektisches Rascheln und leises Fluchen. Drinnen: rhythmisches Klappern, wie von Kastagnetten. Wie sich herausstellte, kam das Klappern von meinen eigenen Zähnen. Draußen waren es minus fünf Grad, im Zelt hatte es vielleicht ein Grad plus. Trotz Daunenschlafsack, Wollmütze, langer Unterwäsche und Pullover zitterte ich am ganzen Leib.
Mit klammen Fingern zog ich den Reißverschluss ein Stückchen auf. Vor meinem Gesicht bildeten sich Wölkchen, der Atem kondensierte in der schneidend kalten, trockenen Luft. Ein Blick aus dem Zelt beruhigte mich. Es war nicht der Yeti. Das Grunzen kam von den Yaks, muskelbepackten Fellmonstern, entfernten Verwandten unserer Kühe. Eine zahme oberbayerische Milchkuh hatte mit einem nepalesischen Yak ungefähr so viel zu tun wie eine Hauskatze mit einem Schneeleoparden – gleiche Familie, aber komplett anderer Charakter. Die intelligent bis verschlagen dreinblickenden Yaks und ihre weiblichen Verbündeten, die Naks, lungerten die ganze Nacht lang vor den Zelten herum. Angeblich um zu grasen, aber irgendwie sahen die Biester verdächtig aus. Was führten sie bloß im Schilde? Warum rasteten sie in dieser weitläufigen Bergeinsamkeit ausgerechnet neben den Zelten von schlotternden Touristen?
Das hektische Rascheln kam aus dem Nachbarzelt, wo Enno, der Expeditionsfotograf und mein bester Freund, in einem Gewirr aus Kabeln, Akkus und Ladegeräten kauerte, um seine Fotos digital zu sichern, aber ein technisches Problem/die Kälte/eine Kombination aus beidem genau dieses Vorhaben zu vereiteln drohte. Daher das leise, beständige Fluchen.
Aber das Heulen? Vielleicht waren das die Goldschakale, von denen es hieß, dass sie immer wieder Ziegen und Hühner in der Gegend fraßen. Oder die tibetischen Wölfe, über die im Tal Gruselgeschichten erzählt wurden. Von Babys, die spurlos aus der Wiege verschwunden waren, von Ponys, denen die Wölfe Fleischstücke aus den Beinen rissen, nur so zum Spaß. Die Wölfe zerfleischten angeblich komplette Schafherden und ließen dann die Kadaver liegen, ohne sie zu fressen.
«Sie töten nur aus Lust am Töten», hatte einer der Dorfbewohner mit düsterem Blick gesagt.
Dabei machten es die Raubtiere im Prinzip auch nicht anders als die Bauern, die im November die Gerste mähen, das Getreide dreschen und in die Kornspeicher schaffen. Sie legten Vorräte an, und was wäre aus Sicht eines Wolfs ein besserer Wintervorrat als eine komplette Schafherde? Einen Kühlschrank brauchten sie nicht, das ganze Tal ist ein einziger Kühlschrank während der kalten Jahreszeit. Die kalte Jahreszeit dauert übrigens von Oktober bis April. Nach einer kurzen Schonzeit von ein paar Wochen geht sie dann prompt in die nasse Jahreszeit über – den Monsun. Den ganzen Sommer über regnet es wie aus Kübeln, dann kommt wieder die kalte Jahreszeit. Als Winterquartier für deutsche Rentner würde sich die Destination wohl nie durchsetzen. Immerhin war es zu unserer Reisezeit im November angenehm trocken und sonnig, wenn auch eiskalt und stellenweise arg verheult.
Vielleicht war es ja doch der leibhaftige Yeti, der heulend durch die Gegend marodierte – obwohl doch alle seine Existenz verleugneten. Fast alle. Unsere Träger und unser Guide waren felsenfest überzeugt, dass der legendäre Affenbergmensch existiert. Die aus Tibet stammenden Einwohner des Tals glaubten an ein Wesen, das «Mehti» hieß und dem nepalesischen Yeti sehr ähnlich war.
Und dann waren da noch die Gerüche: eine spezielle Mischung aus kaltem Rauch, warmem Schweiß und lauwarmem Yak-Dung. Unsere Zelte standen so im Wind, dass sie den Rauch des Lagerfeuers eingefangen hatten, an dem sich die Träger früher am Abend gewärmt und in verschiedenen verrußten Alutöpfen ihr Essen gekocht hatten. Es gab Reis und Linsen, dazu Schwarztee mit viel Zucker, wie jeden Tag. Innerhalb kurzer Zeit im Zelt waren wir kaltgeräuchert. Wahrscheinlich dufteten wir längst wie verzehrreife Schwarzwälder Schinken. Leckere Langnasen-Schinken, schön warm verpackt in Daunenjacken! Ob das die Wölfe und Schakale anlockte?
«Besser nichts draußen liegen lassen», hatte uns Kami Tshering Sherpa gewarnt. Er stammte aus der Sherpa-Region im Osten Tibets, er sprach die Sherpa-Sprache, er hieß Sherpa mit Nachnamen – aber er war nicht das, was Touristen oft meinen, wenn sie«Sherpa» sagen. Im Westen wird der Begriff «Sherpa» oft mit «Träger» gleichgesetzt, aber in erster Linie bezeichnet er die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Kami war auch nicht Träger, sondern unser Guide. Außerdem war er unser Übersetzer, und er erzählte gerne Geschichten. Viele handelten von ihm selbst und seinen abenteuerlichen Begegnungen mit wilden Tieren, zum Beispiel Schneeleoparden, Bären, Yaks und Yetis. An diesem Abend hatte er beim Abendessen eine Schakal-Geschichte erzählt. «Vor vielen Jahren», begann Kami, während wir bei Kerzenschein im Dinnerzelt Suppe aus Blechnäpfen löffelten, «als es noch keine ultraleichten Gore-Tex-Bergstiefel gab, keine Funktionsjacken aus Kunststoff und keine Carbon-Wanderstöcke», sei er mal mit europäischen Touristen auf einer Trekkingtour im Khumbu-Gebiet in der Nähe des Mount Everest unterwegs gewesen. Alle trugen klassische Bergschuhe aus Leder. Jeden Abend musste man die feuchten Stiefel mit Zeitungspapier ausstopfen und zum Trocknen ans Lagerfeuer stellen. Man durfte aber nicht vergessen, sie nachts mit ins Zelt zu nehmen. «Sonst sind sie am nächsten Morgen weg», hatte Kami gewarnt. Tatsächlich habe einer der Bergsteiger mal seine Stiefel draußen stehen lassen, und am nächsten Morgen war nichts mehr von ihnen übrig. «Ein Schakal hatte die Schuhe aufgefressen, komplett», erzählte Kami. Die Tiere liebten offenbar den Geschmack getragener Wanderstiefel, und weil sie praktisch immer sehr großen Hunger hatten und weder besonders wählerisch noch besonders schlau waren, fraßen sie die Zeitung und die Schnürsenkel gleich mit. Ergebnis: Die Schakale hatten einen vollen Magen, und der Tourist musste in Schlappen ins Tal zurückschlurfen.
Wir waren also gewarnt. Und wir sollten noch mehr lernen auf unseren langen Etappen durch das Tal des Glücks. Wir lernten in vielen kleinen Schritten, in bis zu 33532 am Tag, um genau zu sein. Jeden Tag kam eine neue Lektion hinzu. Manchmal waren es nur Feststellungen über alltägliche Kleinigkeiten, die man allzu oft für selbstverständlich nimmt, manchmal waren es Einsichten über die minimale Bedeutung des Menschen in der übermächtigen Natur, manchmal waren es tiefschürfende Gedanken über das Leben oder Aphorismen über das Glück, die uns ein hoher Lama mit auf den Weg gab. Manchmal sollten wir sogar politische Botschaften der Talbewohner an die gesamte Weltbevölkerung weitergeben. Diesem letzteren Wunsch wollte ich auf jeden Fall ordnungsgemäß nachkommen, aber langsam, eins nach dem anderen.
Am Morgen nach der Nacht des Heulens und des Zähneklapperns bedeutete Glück für uns: Die Sonne erhob sich hinter einem vereisten Siebentausender, sie taute langsam unsere festgefrorenen Gesichtszüge auf, es gab heißen Tee, und unsere Schuhe waren noch da. Gut so. Ohne die Stiefel wäre die Fortsetzung der Tour zwar möglich, aber unangenehm gewesen. Wir hatten zusätzlich zu den Bergstiefeln noch Halbschuhe und Flipflops dabei. Einige unserer Träger absolvierten den Großteil der Strecke in Flipflops, mit vierzig Kilogramm Last auf dem Rücken und bei Minusgraden, sie liefen damit über schwankende Hängebrücken, durch Flussbetten und durch Geröllfelder. Als westlicher Weicheiwanderer wäre man mit solchen Gummilatschen an den Füßen und so viel Gepäck auf dem Rücken wahrscheinlich keine zweihundert Meter weit gekommen.
Glück ist, wenn einem der Schakal nicht die Schuhe wegfrisst.
Kapitel 2Busfahrt durch die Vorhölle
Am Morgen war meine Unterhose, die ich am Vorabend am Brunnen gewaschen hatte, steif wie ein Brett. Ich lehnte sie an eine Mauer, hinter der ein dampfender Flokati mit Hörnern lag und mich vertraulich anblinzelte – ein wuscheliges, schwarz-weiß gemustertes Yak-Kalb. Die ersten Sonnenstrahlen kamen hinter dem Pashubo hervor, einem Sechstausender an der Grenze zu Tibet, dessen Gipfel von einem mächtigen Gletscher bedeckt war. Aus dem Küchenzelt roch es nach Spiegeleiern, Kaffee und frischgebackenem Fladenbrot. Schulkinder in blauen Uniformen liefen barfuß über von Frost bedeckte Kieselsteine in Richtung Dorf. Im fahlen Morgenlicht kreisten zwei Geier.
Alles war so phantastisch um mich herum, dass es mich überhaupt nicht gewundert hätte, wenn aus dem grünen Zelt neben meinem ein Yeti gekrochen wäre, sich gähnend den Rücken gekratzt und mich dabei freundlich gegrüßt hätte. Es war aber nur Enno, der Fotograf. Er kam aus dem Zelt gekrochen, kratzte sich den Rücken und grüßte mich dabei freundlich. Vom Bergaffen war er aber doch ganz deutlich unterscheidbar durch folgende Merkmale: weitgehend fellfreies Gesicht, blaue Mütze, an der Schulter baumelnde Kamera, grüne Daunenjacke, Trekkinghose, Wanderstiefel in Schuhgröße 43 wie bei einem ausgewachsenen Mann – und nicht 72 wie beim ausgewachsenen Yeti.
Während der Reise hatte ich öfter das Gefühl, neben mir zu stehen. Vieles wirkte so unwirklich und erstaunlich, dass ich mir vorkam wie in einer real existierenden Fantasy-Welt, in der vor etwa tausend Jahren die Zeit stehengeblieben war. Oft hatte ich auch das seltsame Gefühl, neben fünfzehn Leuten zu stehen. Und das war keine Halluzination, hervorgerufen durch eine Sauerstoff-Unterversorgung bestimmter Hirnarale. Unser Team bestand inklusive Fotograf Enno und mir tatsächlich aus sagenhaften sechzehn Leuten. Ohne Übersetzer und Guide ging gar nichts, also ließen wir uns von Kami Sherpa führen, einem erfahrenen Trekking-Guide, der aus dem Everest-Gebiet stammt und die Sprache der Tsumba spricht, einen tibetischen Dialekt. Kami hatte vorab die Genehmigungen für den Besuch des Schutzgebiets bei den Behörden in Kathmandu für uns beantragt, er hatte die Ausrüstung organisiert und die Mannschaft zusammengestellt. Die meisten Träger kamen aus seinem Heimatort, er kannte sie von anderen Trekkingtouren und verschaffte ihnen immer wieder Jobs. Die jüngsten von ihnen sahen aus wie sechzehn, waren aber wahrscheinlich schon achtzehn, sie knipsten dauernd Selfies mit ihren Smartphones und trugen Jeans und Turnschuhe. Der älteste Träger war fünfundfünfzig, aber immer noch topfit.
Im Tsum-Tal gibt es keine Hotels, nur ein paar vereinzelte sehr einfache Gasthäuser und Privatzimmer. Wobei «Privatzimmer» bedeutete: Nebenraum oder ehemaliger Stall auf einem Bauernhof, mit Stroh gefüllte Matte auf einer Holzpritsche, die man sich oft auch noch mit Wanzen, Flöhen und anderen unangenehmen Bettgesellen teilen musste. Ganz oben am Ganesh-Himal-Basecamp auf über viertausend Metern Höhe und am Ngula Dhojhyang, dem Pass in Richtung Tibet, den höchsten Orten unserer Tour, gab es gar keine Unterkünfte. Also brauchten wir Zelte. Weil wir niemals angekommen wären, wenn wir die Zelte selbst hätten schleppen müssen, brauchten wir Träger. Um alle diese Menschen zu verpflegen, brauchten wir einen Koch. Der Koch wiederum brauchte Küchenhelfer und weitere Träger, die die Kochgeräte und die Lebensmittel herumschleppten. So summierte sich das immer weiter, bis wir schließlich eine stattliche Gruppe zusammenhatten, die einen eigenen Bus benötigte, um von Kathmandu zum Ausgangspunkt der Wandertour zu gelangen. Wir hatten jede Menge Ausrüstung dabei – Daunenjacken, Funktionsjacken, Skihandschuhe, weitere Kleidung sowohl für subtropische Hitze als auch für Kälte in extremen Höhenlagen und für alle Klimazonen dazwischen, diverse Mützen, Hüte und Tücher, Teleskopstöcke, Isomatten, Schlafsäcke, Thermoskannen, Verpflegung, Sonnenbrillen und Solarpanels, um Kameras, Smartphones und Tablets aufladen zu können. Unsere Trekkingtaschen wogen dreizehn bis fünfzehn Kilo, die Träger nahmen jeweils zwei davon auf die Schultern und dazu noch ihr eigenes Gepäck. Wir selbst hatten nur die Rucksäcke zu tragen, meiner wog lächerliche sieben bis acht Kilo. Enno hatte dreizehn Kilo auf dem Rücken, wegen der Fotoausrüstung – allein die Akkus, zwei Kameras und das Stativ wogen sieben Kilo.
Und so hatte sich ein paar Tage vor Beginn der Wanderung ein beinahe unübersichtlicher Tross von Männern mit sehr viel Zeug an einer Ausfallstraße am Stadtrand von Kathmandu zur Abfahrt mit dem Bus in Richtung Osten getroffen. Es ging auf der sogenannten Autobahn in Richtung Pokhara und Indien. Um uns herum suchten Hunde in Müllhaufen nach Essbarem, überfüllte Busse brachten Pendler ins Stadtzentrum, bunt bemalte indische Lastwagen bliesen schwarze Abgasschwaden in die kühle Morgenluft. Unser erstes Ziel, das Örtchen Sothikhola, lag hundertdreißig Kilometer von Kathmandu entfernt. Auf Google Maps sah das nicht weit aus, aber die Realität verhält sich oft anders als eine digitale Karte, besonders in Nepal. Hundertdreißig Kilometer, anderthalb Stunden? Vergiss es. Hundertdreißig Kilometer können hier schon mal einen ganzen Tag Fahrt über holprige, staubige Pisten bedeuten. Wenn alles gutgeht. Wenn es nicht gutgeht, was öfter mal vorkommt, bricht unterwegs eine Achse, ein Reifen platzt, oder schlimmer noch, die Bremsen versagen, und der Bus stürzt in eine Schlucht. Oder vor einem stürzt ein anderes Fahrzeug in die Schlucht, und die Straße wird auf unbestimmte Zeit gesperrt, bis sich die Rettungsfahrzeuge den Weg durch den Monsterstau gebahnt haben.
Kami trug einen weißen Mundschutz, der mit weißen Gummibändchen in Position gehalten wurde. Er sah damit aus wie ein Zahnarzt, zumal er auch ein weißes Hemd, eine weiße Hose und eine weiße Kappe trug. Er hatte sogar einen Alukoffer mit Medikamenten, Verbandsmaterial und Notfallausrüstung dabei. Hoffentlich waren darin auch starke Betäubungsmittel, je länger wir fuhren, desto sicherer war ich mir, dass wir sie brauchen könnten.
Kami saß im Bus in der Reihe hinter mir. Unter der weißen Maske, die sein halbes Gesicht bedeckte, kamen seltsame Töne hervor: «Ooom ooom mantra mani murmel murmel, om murmel murmel.» So ging das die ganze Zeit. Erst dachte ich, der Mann führe ständig Selbstgespräche. Dann kapierte ich: Kami betete. Er sagte Mantras auf, den ganzen Tag lang. An heiklen Stellen, etwa vor Brücken, in besonders engen Kurven oder auf Strecken mit steilem Gefälle, wurde das Gemurmel intensiver.
Das Problem war allerdings: Die Strecke von Kathmandu nach Sothikhola bestand mehr oder weniger durchgehend aus heiklen Stellen. Es fielen eher jene Stellen auf, die nicht heikel wirkten, etwa weil sie geteert waren, geradeaus verliefen, nicht an einem tausend Meter tiefen Abgrund vorbeiführten und frei waren von heiligen Kühen, heimtückischen Löchern und ausgebrannten Wracks. Wir waren um sieben Uhr morgens in Kathmandu aufgebrochen und kamen gegen achtzehn Uhr an unserem Ziel an, waren also beinahe elf Stunden auf heikler Mission unterwegs.
Die Straßen waren erst verstopft, dann verstopft und staubig, dann verstopft, staubig und kaputt, dann verstopft, staubig, kaputt und voller Tiere. In Deutschland hätte man die Straße, auf der wir unterwegs waren, höchstens als Feldweg bezeichnet und für den Durchgangsverkehr gesperrt. In Nepal war es ein «Highway» und die einzige Überlandverbindung nach Indien. Eine Zugstrecke oder andere nennenswerte Verkehrsverbindungen existierten nicht. Der gesamte Personenverkehr und alle Gütertransporte wurden über diese sogenannte Straße abgewickelt. Uns begegneten Lastwagen voller Hühner, Kälber und Gemüse, Milch-, Benzin- und Gastransporter, völlig überbesetzte Busse mit Arbeitern, die zu weit entfernten Einsatzorten fuhren, ab und zu sah man Touristenbusse. Diese waren daran zu erkennen, dass nicht drei bis vier Menschen auf einem Sitz gestapelt waren und dass niemand im Gang, in den offenen Türen sowie auf dem Dach saß – und dass die Passagiere einen leicht panischen Blick hatten.
Die deutschen Autofahrer würden sich auf so einer Strecke über kleinste Details aufregen, etwa dass sich niemand an die Verkehrsregeln hält, dass vollbetankte Gaslaster vor nicht einsehbaren Kurven bergauf zum Überholen ansetzen, während ihnen ein vollbesetzter Reisebus mit überhöhter Geschwindigkeit und rauchenden Bremsen entgegenrumpelt, dass ein Fernfahrer mitten auf der Straße campiert und dort in aller Seelenruhe ein Mittagessen auf dem Lagerfeuer kocht, weil sein Lastwagen liegengeblieben ist – oder dass sich eine Baustelle innerhalb von zwei Jahrzehnten nicht die kleinste Spur verändert. So spießig und ungeduldig war man in Nepal aber nicht. Was würde es auch bringen?
«Road construction 19 years in limbo» stand am Morgen unserer Abfahrt von Kathmandu in der Himalayan Times – Straßenbau seit 19 Jahren in der Schwebe. Im Zeitungsbericht ging es um den Ausbau einer Überlandverbindung, die seit zwei Jahrzehnten keinen Meter vorangekommen war. Wobei man «Limbo» auch mit «Vorhölle» übersetzen kann – ein Ort, in dem Seelen gefangen sind, denen die Himmelspforten ohne eigenes Verschulden versperrt bleiben – etwa weil sie gestorben waren, bevor sie getauft wurden. Laut einer bizarren katholischen Theorie, die aus dem Mittelalter stammt, leiden die im Limbus gefangenen Seelen an geistiger Umnachtung und Traurigkeit, sie bekommen aber im Gegensatz zu den Insassen der Hölle nur «milde Sinnesstrafen» zu spüren. Die größte Strafe für ihr Heidentum, für das sie gar nichts können, ist laut dieser Lehre: Sie dürfen Gott nicht sehen.
Genauso fühlte ich mich im Bus – unschuldig in der Vorhölle gefangen. Geistige Umnachtung und Traurigkeit waren nicht zu beklagen. Zumindest vorerst. Gott wollte ich sowieso noch nicht so bald persönlich treffen, das war ganz in Ordnung so. Aber «milde Sinnesstrafen» war noch leicht untertrieben für den Zustand, in dem ich mich befand. Vom permanenten Wackeln und Holpern war mir schon nach einer halben Stunde hundeelend. Laut der Werbung auf der Heckscheibe des Busses verfügte das Fahrzeug über Klimaanlage, WiFi, Liegesitze, LED-Bildschirme, Fernsehen und noch viele Annehmlichkeiten mehr. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass wir schon glücklich sein konnten, dass der Bus vier Räder, einen Motor und eine funktionierende Bremse besaß. Der Rest war ein raffinierter Marketingtrick und hatte nichts, aber auch gar nichts, mit der Ausstattung an Bord zu tun. Nicht mal die analoge Uhr funktionierte. Über dem Fahrersitz war ein rätselhafter Kasten aus Sperrholz angebracht, er war mit einem einfachen Vorhängeschloss gesichert. «Dadrin ist wahrscheinlich das verschlüsselte WLAN!», mutmaßte Enno.
Derartig hochkarätige Scherze vergingen uns, als wir die Hochebene von Kathmandu verließen und auf die extrem abschüssige, schlaglochübersäte und verkehrsüberlastete Strecke in Richtung Pokhara kamen. Ab diesem Zeitpunkt war mein Gehirn zu neunzig Prozent mit Angsthaben und zu zehn Prozent mit entsetztem Staunen beschäftigt. Die Straße war eine einzige Baustelle – auf der aber kein einziger Bauarbeiter zu sehen war. Dafür gab es alle paar Kilometer eine Polizeikontrolle, einen Wachposten der Armee oder eine Mautstelle. Alle wollten Geld kassieren. Es waren geringe Beträge, umgerechnet weniger als ein Euro, aber es war jedes Mal ein bürokratischer Akt, bis der Bezahlvorgang abgeschlossen war.
Unser Busfahrer Arjun und sein Kopilot kommunizierten über Klopfzeichen. Der Klopfer hatte ungefähr die gleiche Aufgabe, die elektronische Sensoren und Rückfahrkameras in modernen Autos übernehmen: Er half beim Einparken, Abstandhalten und Vermeiden von Auffahrunfällen. Nur piepte er eben nicht elektronisch, sondern klopfte analog mit der Hand auf das Blech. Der Klopfer stand in der offenen Tür, spähte hinaus und gab dem Fahrer Zeichen, wenn es eng wurde. Und das passierte öfter mal, denn nachdem wir die sogenannte Autobahn verlassen hatten, wurde es erst richtig abenteuerlich. Der Bus schraubte sich mühsam über einen knapp zweitausend Meter hohen Pass, auf einer ungeteerten Straße mit herrlicher Aussicht auf den Achttausender Annapurna und den Siebentausender Ganesh 1, aber auch mit schrecklicher Aussicht auf den Tausender-Abgrund neben dem Straßenrand.
Wenn uns ein anderes Auto, eine Ziegenherde oder ein Lastwagen entgegenkam, stieg der Klopfer aus und dirigierte den Fahrer mit Hilfe eines geheimnisvollen Morsecodes so lange hin und her, bis der Bus gerade so am Hindernis vorbeikam. Unsere Mannschaft schlief während solcher Manöver selig auf den eisenharten Sitzen, wir Westler starrten dagegen schweißgebadet aus dem Fenster und schlossen innerlich schon mal mit dem Leben ab. Zum Aufschreiben der letzten Grüße an die Lieben daheim war es mir allerdings viel zu wackelig. Zum Anrufen fehlte mir erstens die ruhige Hand und zweitens das Handynetz.
Warum hatten wir das Glück auch unbedingt herausfordern müssen? Und wäre es nicht geradezu zynisch, wenn wir auf der Suche nach dem Glück gleich zu Beginn Pech haben sollten, etwa weil der Klopfer sich verklopft hatte oder ein Rad unseres Busses im knöcheltiefen Staub durchdrehte? Wir waren nicht mal am Anfang unserer Unternehmung, die fast einen ganzen Monat lang dauern sollte, und mir war schlecht, vielleicht wegen der vielen Kurven, vielleicht aber auch vor Angst. Innerlich sang ich «The long and winding road» von den Beatles, immer wieder, während Kami hinter mir im Halbschlaf seine Mantras murmelte. Im Unterschied zu mir nickte er immer wieder friedlich ein.
Das Minimalziel der Expedition schien mir bereits erreicht, als ich in Sothikhola aus dem Bus wankte: möglichst jeden Tag am Leben bleiben. Der Staub hatte sich in den Haaren, in der Kleidung und auf der Haut festgesetzt. Ich wollte eigentlich den Boden küssen wie Papst Johannes Paul II. nach einem Langstreckenflug, aber ich nahm dann doch wieder Abstand von dieser melodramatischen Geste. Ich hatte gesehen, wie einige unserer Träger beim Aussteigen auf den Boden gespuckt hatten. Anschließend waren zehn Mulis über den Platz marschiert und hatten ihre Muliäpfel fallenlassen. Alle Mulis hatten danach auf einen bestimmten Fleck uriniert, bis sich dort ein gelber, stinkender Teich bildete. Dieser Geruch würde uns die nächsten Wochen begleiten. Dann kamen ein paar verdreckte Dorfhunde vorbeigeschlichen und markierten all das recht ausführlich auf ihre hundetypische Art. Ich pries das Land also nur innerlich und rollte demütig meinen Schlafsack auf der harten Holzpritsche im Zimmer eines einfachen Gasthauses aus.
Die Pension war direkt ans Ufer des Flusses Budhi Gandaki gebaut, der sehr viel Wasser führte und den Kiesboden unter dem Gebäude aushöhlte, wie es aussah. Ich wusste nicht, ob der Boden meines Zimmers schwankte, weil das Haus demnächst in den Fluss stürzte, weil es ein leichtes Erdbeben gab oder weil ich mich fühlte, als sei ich nicht in einem Bus durch die Berge gefahren, sondern auf einem Schiff durch stürmische See. Alle diese Thesen schienen mir gleich wahrscheinlich zu sein. Auch Mehrfachnennungen waren möglich.
Dennoch: Der erste Schritt war schon mal getan. Es war zwar nur ein winziger und inhaltlich völlig irrelevanter Schritt auf dem langen, gewundenen und holprigen Weg zum Glück. Aber es war ein Anfang, und wir hatten die Vorhölle einigermaßen gesund überstanden, ohne in geistige Umnachtung und Traurigkeit zu verfallen.
Das Gemurmel aus dem Nachbarzimmer beruhigte mich etwas: «Om om mani dingsbums murmel murmel.» Andererseits machte es mir auch ein bisschen Sorgen. Als ich meine auf Alpenhütten erprobten Silikonpfropfen in die Ohren stöpselte, hörte ich nur noch das dumpfe Rauschen des Wassers unter dem Haus. Ab und zu glaubte ich, den Klopfer klopfen zu hören. Es klang ziemlich alarmierend. Aber das konnte auch ein Irrtum oder mein Herz gewesen sein.
Glück ist, wenn man abends überrascht feststellt, dass man noch lebt.
Kapitel 3Die Legende vom versteckten Paradies
Das Gepäck, die in Kisten verpackten Essensvorräte und die Zelte lagen auf einem absurd großen Haufen. Daneben standen absurd viele Helfer, die alle für uns arbeiteten. Man hätte schlussfolgern können, dass wir am Startpunkt einer absurd langen Expedition waren, die das Ziel hatte, eine neue Route von Sothikhola quer durch das Hochland von Tibet bis in die Mongolei ausfindig zu machen. Die Ausrüstung wäre wohl die gleiche gewesen.
Wir kamen uns ziemlich kolonialistisch vor mit allen vierzehn Helfern, die wir fast einen Monat lang beschäftigten. Einerseits ein unangenehmes Gefühl, andererseits hatte ich noch nie so viele Arbeitsplätze geschaffen. Eines stand ohne Frage fest: Unsere Forschungsreise war logistisch bestens vorbereitet, und die geballte Manpower unserer Helfer sollte wohl ausreichen, um unser Equipment ins Tal des Glücks zu bringen – und mit etwas Glück kehrten wir hoffentlich auch vollzählig und ohne materielle Verluste wieder zurück.
Aber wie sah es mit dem theoretischen Unterbau aus? Vorab fand ich nur wenige Informationen über das Tal. Es war erst seit wenigen Jahren für Touristen zugänglich, vorher galt es als Sperrgebiet. Einige Trekkingveranstalter hatten bereits Touren ins Tsum-Tal in ihr Angebot aufgenommen. In den jeweiligen Reiseprogrammen waren ein paar Rahmendaten über die Gegend zu erfahren: Die Namen der Dörfer, die in Höhen von zweitausendvierhundert bis viertausend Metern lagen, die Namen der wichtigsten Klöster und der höchsten Berge. Die Reise war als «anspruchsvolle Bergwanderung» ausgeschrieben und als Expedition in ein spirituelles Zentrum des Buddhismus.
Als philosophische Sekundärliteratur für unterwegs hatten wir verschiedene Bücher auf iPads und iPhones geladen, unter anderem ein Interview mit dem Dalai Lama. Zum Thema Glück hatte er sich ja schon oft ausgelassen, mal eher lebensnah, mal eher religionsphilosophisch. Im Buddhismus spielt das diesseitige Glück eigentlich keine Rolle, es geht darum, Leiden zu beenden, Gutes zu tun und den Kreis der Wiedergeburten zu durchbrechen. Trotzdem hatte der Dalai Lama mehrere Bücher zum Thema Lebensglück verfasst. Man wurde nicht recht schlau daraus. Die Interpretationen des Dalai Lama schienen mir ein bisschen indifferent zu sein – man konnte sich herauspicken, was gerade am besten passte. Unter anderem sagte der Dalai Lama: «Unsere Aufgabe besteht darin, das abzulegen, was zum Leid führt, und das anzunehmen, was uns Glück beschert… Vor jeder Entscheidung sollten wir uns fragen: Wird sie mir Glück bereiten?»
Tja, das fragte ich mich vor der ersten Etappe auch. Vor uns lagen achtzehn Trekkingtage und einige Ungewissheiten. Waren alle Wege und Brücken nach dem großen Erdbeben von 2015 wieder begehbar? Drohte ein Wintereinbruch, es war schließlich schon Anfang November? Für alle Fälle hatten wir sogar Steigeisen eingepackt, um verschneite und vereiste Passagen sicher meistern zu können.
Würden die Einheimischen überhaupt mit uns sprechen, zumal über so persönliche Themen wie Glück, Liebe und Zufriedenheit? Wie viel Leid müssten wir im Sinne des Dalai Lama ablegen, um das anzunehmen, was uns Glück beschert? Ganz ohne Anstrengung war unser Ziel sicher nicht zu erreichen, aber wie hoch würde der Leidensfaktor ausfallen? Enno und ich waren schon viel zusammen gewandert und kannten uns seit fast zwanzig Jahren sehr gut, aber wie würden wir uns verstehen, wenn wir so lange aufeinander angewiesen sind? Dazu kam noch die Frage, wie wir die Höhe körperlich vertragen würden. Die Route führte uns schließlich bis auf knapp fünftausend Meter. Schon ab dreitausend Metern können Symptome der Höhenkrankheit auftreten – Kopfweh, Übelkeit, Schlaflosigkeit. Also ungefähr so wie in der Vorhölle, nur dass man dort der Theorie nach schon tot ist; im Hochgebirge kann man dagegen nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich an fortgeschrittener Höhenkrankheit sterben, die medizinischen Stichworte dazu lauteten Lungenödem, Thrombose und Hirnödem.
2013 war ich schon einmal in der Gegend gewesen, bei einer Trekkingtour rund um den Manaslu, einen 8163 Meter hohen Berg im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet. Die Tour um den Manaslu, den achthöchsten Gipfel der Welt, dauerte knapp drei Wochen, es waren 220 Kilometer zu laufen, von 550 Metern bis hinauf auf 5100 Meter und wieder hinunter auf 840 Meter. Wir wanderten von den Subtropen ins ewige Eis und zurück. Schritt für Schritt hatten wir uns von den Annehmlichkeiten der Zivilisation entfernt. Im Vergleich zu den bekannteren Touren im Everest- und Annapurna-Gebiet gab es auf dem Manaslu noch nicht an jeder Ecke ein WiFi-Café, es gab auch noch keine befahrbare Schotterpiste, sondern nur schmale Fußpfade. Die Unterkünfte waren sehr rustikal – die Betten der üblichen Lodges bestanden aus einer Holzpritsche mit dünner Schaumstoffauflage, meist gab es nicht mal eine Heizung, ganz zu schweigen von warmem Wasser oder Internet. Manaslu – das heißt «Berg der Seele» auf Nepali. Der Berg hatte seine Seele offenbar noch nicht verloren, im Gegensatz zum Everest-Gebiet ging es in der Region noch einigermaßen beschaulich zu, da der Zustieg so lange dauerte. Etwa dreitausend Touristen pro Jahr absolvierten die Manaslu-Runde, und nur dreihundert von ihnen wagten den Abstecher ins Tsum-Tal. Das Leben in den Bergdörfern rund um den Manaslu wirkte größtenteils noch so ursprünglich, wie es vor Hunderten von Jahren gewesen sein musste – nur in Samagaon, einem Ort auf dreitausendfünfhundert Metern am Fuß des Achttausenders, war in den letzten Jahren eine richtige kleine Bergsteigerstadt mit Lodges und Restaurants entstanden. Das Dorf war der Ausgangspunkt für Manaslu-Besteigungen und eine wichtige Etappe auf der Manaslu-Umrundung.
Die Region wurde für Wandertouristen erst im Jahr 1991 geöffnet. Einzelne Bergsteigerexpeditionen hatten allerdings bereits früher Zugang zu diesem Gebiet gehabt. Bis Anfang der fünfziger Jahre war der Manaslu kaum erforscht. In den Jahren 1950 bis 1955 gab es nach ersten britischen Erkundungen vier japanische Expeditionen, die nach möglichen Routen auf den Gipfel suchten. Am 9. Mai 1956 gelang einer japanischen Gruppe unter der Führung von Yuko Maki die Erstbesteigung über die Nordostflanke. Als Reinhold Messner den Manaslu im Jahr 1972 über die Südwand bestieg, war dies erst der insgesamt dritte Gipfelerfolg – was zeigt, wie gefährlich und unberechenbar dieser Achttausender ist.
Während der Manaslu-Tour war ich auf Tsum aufmerksam geworden. «Wenn du Nepal erleben willst, wie es vor fünfzig Jahren noch war», hatte unser damaliger Guide Mingma Nuru Sherpa gesagt, «dann musst du beim nächsten Mal hinter Jagat abbiegen und ins Tsum-Tal wandern.» Er beschrieb das Hochtal als verstecktes Juwel. Es sei ein intaktes Schutzgebiet für seltene Tiere und ein kulturelles Reservat, schwärmte Mingma. Der tibetische Buddhismus sei dort in einzigartiger Weise erhalten geblieben und werde von der Bevölkerung und von den vielen Mönchen aus tiefster Überzeugung praktiziert. Er erwähnte auch, dass die Einwohner des Tals sich dazu verpflichtet hätten, keine Lebewesen zu töten, weder Tiere noch Menschen, aus ethischen Gründen. Und dass der Yeti dort lebe. Mingmas Erzählungen weckten meine Neugier.
Meine Vorrecherche von zu Hause aus klang trotz der spärlichen Informationen, die man im Internet finden konnte, recht vielsprechend. Erst seit 2008 war das Gebiet an der Grenze zu China für Fremde zugänglich, zuvor galt es als «Restricted Area». Lange war das Hochtal ein eigenes kleines Königreich, dessen antike Überreste noch an verschiedenen Stellen zu sehen waren. Nepal war seit seiner Staatsgründung durch den Gorkha-König Prithvi Narayan im Jahr 1768 das einzige hinduistische Königreich der Welt, Regionen mit vorwiegend buddhistischer Bevölkerung wurden toleriert oder weitgehend ignoriert, solange sie so versteckt lagen wie das Tsum-Tal. Historische Quellen deuten darauf hin, dass Tsum erst nach dem Nepal-Tibet-Krieg von 1856 ein Teil Nepals wurde.
Im zentralen Himalaya existierten der Legende nach mehrere versteckte Täler, die seit jeher als paradiesische Zufluchtsorte mit einem Zugang zur spirituellen Welt dargestellt werden, als sogenanntes Shangri-La. Tsum galt immer als eines davon.
Die Vorstellung vom Paradies auf Erden gibt es in den meisten Religionen und Kulturen, vom Garten Eden bis zum Traum von der unentdeckten Südsee-Insel. Zum größten Teil waren diese fiktiven Orte als Gegenentwurf zur jeweiligen Lebenswirklichkeit entstanden – im Krieg sehnen sich die Menschen eben nach Frieden; wenn sie Hunger haben, nach einem Schlaraffenland, und wenn es nicht genug Wasser gibt und die Ernte verdorrt, träumen sie von einer Oase inmitten der Wüste. Gemeinsam ist den Paradiesen, dass die Natur dort intakt ist und keine Bedrohung darstellt, sondern die Menschheit mit Nahrung versorgt. Wenn es Raubtiere gibt, sind diese friedlich, und der Mensch lässt seinerseits die Tiere in Ruhe, weil er sowieso genug zu essen hat. Typisch ist auch die Abgeschlossenheit nach außen: Der Paradiesgarten ist von einer schützenden Mauer umgeben, die Paradiesinsel liegt einsam irgendwo im Meer, das versteckte Tal ist über geheime Wege, durch Tunnel oder versteckte Tore hinter Wasserfällen erreichbar. Und noch eine Gemeinsamkeit weisen die verschiedenen Paradiese auf: Die Menschen leben dort harmonisch zusammen, in einer Art Urzustand ohne gesellschaftliche und materielle Zwänge, es gibt keine Hierarchien, keine sozialen Klassen und keinen Stress im Büro, weil es ja auch kein Büro gibt.
Im Buddhismus entstand die Vorstellung vom paradiesischen Tal zu einer Zeit, als der buddhistische Glaube sich von Indien in Richtung Westen ausbreitete und mit dem Islam in Konkurrenz geriet. Die Idee des Paradiesgartens mit lebenspendender Natur und friedlichen Tieren entstand wahrscheinlich auch als Abgrenzung von einer bedrohlichen Natur, die im Himalaya besonders gefährlich sein konnte für den Menschen.
In den Schriften von Padmasambhava, auch bekannt als Guru Rinpoche, einem indischen Heiligen, der den Buddhismus im 8. Jahrhundert nach Tibet brachte, ist von Tsum als «Beyul» die Rede. Ein Beyul gilt als Oase des Friedens, des Wohlstands und des geistigen Fortschritts, als Zufluchtsort für gläubige Buddhisten. In buddhistischen Texten wird Tsum als idealer Platz zum Meditieren beschrieben: «Du vergisst dort deine Probleme, die unnötigen Beeinträchtigungen des Stadtlebens verschwinden, Körper, Sprache und Geist werden frisch und leicht, mit positiven Gedanken, die ganz einfach von selbst auftauchen.» Unter Umständen könne man dort sogar schon zu Lebzeiten Erlösung finden.
Im tibetischen Buddhismus werden die Beyuls als verborgene Täler beschrieben, die mehrere hundert Quadratkilometer umfassen. Die Wegbeschreibungen dorthin wurden auf Schriftrollen festgehalten und unter Felsen und in Höhlen, in Stupas und Klöstern versteckt. Sie galten als Orte, an denen sich die physische und die spirituelle Welt überschneiden.
Padmasambhava habe Gottheiten damit beauftragt, die geheimen Täler zu schützen, hieß es. Diese göttlichen Kräfte traten in Gestalt von Schneestürmen, Nebel und Schneeleoparden auf – die es im Tsum-Tal wirklich gibt, ob sie göttlich waren oder nicht, würde sich noch herausstellen. Die heiligen Täler wurden beschrieben als Orte, in denen die Natur und jegliches Leben als heilig gelten, die aber nur mit enormer Anstrengung erreicht werden können – ebenfalls eine Parallele zum Tsum-Tal. Nur Pilger, die reinen Herzens waren, gelangten der Legende nach ans Ziel und bekamen Einlass ins Tal. Menschen, die in schlechter Absicht kamen, fanden entweder den Weg nicht, oder sie starben unterwegs. Das würde uns hoffentlich erspart bleiben, wir hatten eine Karte, einen Guide und ortskundige Träger dabei.
Als Beyuls galten unter anderem Demoshong, heutzutage bekannt als der indische Bundesstaat Sikkim, die Solokhumbu-Region am Mount Everest, außerdem die Regionen Mustang, Rongshar und Rolwaling in Nepal und Gyirong in China. In Bhutan und Indien existierten weitere versteckte Täler, die der Legende nach heilig waren – mittlerweile aber längst für den Tourismus entdeckt wurden.
Die sagenhaften Beyuls haben viele Gemeinsamkeiten mit dem sogenannten Shambala, einem mythischen Königreich, das dem frühen Buddhismus und auch dem Hinduismus zufolge irgendwo in Zentralasien existieren sollte. Der Mythos Shambala, wörtlich übersetzt «Quelle des Glücks», wurde wahrscheinlich von den Buddhisten aus dem Hinduismus übernommen. Ursprünglich wurde Shambala als gesegnetes Dorf beschrieben, in dem weise Brahmanen leben. Es wuchs im Laufe der Jahrhunderte jedoch zu einem magischen Imperium heran, das aus «96 Ländern und mehr als einer Milliarde Dörfer» bestehen soll.
Als Nordwestindien Anfang des 11. Jahrhunderts vom Islam erobert wurde, wurden viele buddhistische Tempel zerstört, Tausende Buddhisten als Ungläubige verfolgt, getötet oder vertrieben. Als Zufluchtsorte dienten geschützte, abgelegene Täler im Himalaya – so entstand der Mythos vom paradiesischen Tal.
Aus westlicher Sicht galt Tibet lange als Shambhala, die Tibeter selbst verorteten das Königreich des Glücks irgendwo nördlich von Tibet, hinter hohen Schneebergen versteckt. Eine Dynastie erleuchteter Könige bewache dort die geheimsten Lehren des Buddhismus bis zu einer Zeit, in der Krieg und die Gier nach Macht und Reichtum die Wahrheit von der Welt vertrieben haben werden, hieß es. Dann werde der König von Shambhala mit einer Armee erscheinen und die Mächte des Bösen vernichtend schlagen, um das «goldene Zeitalter» einzuleiten.
Noch phantastischer wurde die Geschichte, als der britische Schriftsteller James Hilton im Jahr 1933 diesen uralten Mythos aufgriff, sich davon zum utopischen Abenteuerroman «Lost Horizon» inspirieren ließ – und den Begriff Shambala zu Shangri-La verballhornte. Hilton verwandelte den spirituellen Zufluchtsort der buddhistischen Überlieferung in einen magischen «Quell der Jugend». Kern seiner Geschichte, die an die späteren Indiana-Jones-Filme erinnert, ist eine mysteriöse Klosteranlage im Himalaya namens Shangri-La. Dort war dem Roman zufolge ein jahrtausendealter Schatz versteckt, das «Elixier der ewigen Jugend». «Lost Horizon», mehrmals verfilmt und weltweit als Klassiker geltend, steht in der Tradition der europäischen utopischen Literatur, die von Thomas Morus mit seinem Werk «Utopia» begründet wurde. Wie die Insel Utopia ist auch Shangri-La ein fiktiver Ort, der von Harmonie, Ruhe und «Leidenschaftslosigkeit» geprägt ist. Es klingt so, als könnten anhaltendes Glück und ewige Jugend auf Dauer ziemlich langweilig werden.