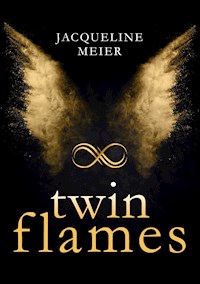
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Mia und Caspar beginnt schon lange, bevor die beiden sich zum ersten Mal begegnen. Ausgehend von einer uralten Verbindung, die auf mysteriöse Weise bedroht wird, entwickelt sich eine tragische Liebe - eine Liebe gegen jede Gesetzmäßigkeit. "Mach`s gut auf deiner Reise", sagte ich und umarmte ihn. "Es ist unsere Reise", flüsterte er und berührte mich noch einmal mit seiner ganzen Zärtlichkeit. Plötzlich wurde ich von einer gewaltigen Kraft umfasst, die mich von ihm wegzog. "Ich liebe dich", sagte ich und hoffte, er konnte es noch hören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Tochter Gwendolyn Ladina
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
SEIN BESUCH
DIE ZEIT DAVOR
DER FREMDE
IM LICHT DER SONNE
BIS DAS WILD ERLEGT IST
VERTRAUTE WÄRME
WIEDERGUTMACHUNG DER UNVOLLKOMMENHEIT
WIE ELEKTRISIERT
BIS ANS ENDE DER TAGE
DIE VEREINIGUNG DER ZWEIHEIT
DIE ACHILLESFERSE DER GEISTER
DAS FREMDE ZIMMER
ZWEI TEILE
NUR FÜR EINEN ABEND
DIE HITZE DER FURCHT
BIS ANS ENDE DER TAGE
ZU SPÄT
DIE SUCHE NACH DER ERINNERUNG
DAS WARME GEFÜHL
DER DUNKLE RAUM
NEUGIERIGE BLICKE
BEDROHLICHE ZEITEN
FÜR IMMER
DANKE AN
PROLOG
Mach’s gut auf deiner Reise«, sagte ich und umarmte ihn.
»Es ist unsere Reise«, flüsterte er und berührte mich noch einmal mit seiner ganzen Zärtlichkeit.
Plötzlich wurde ich von einer gewaltigen Kraft umfasst, die mich von ihm wegzog. »Ich liebe dich«, flüsterte ich und hoffte, er konnte es noch hören.
SEIN BESUCH
Etwas war anders, als Mia an diesem Tag erwachte. Es war nicht das blaugrüne Licht des Morgens, der kalte Kaffee, der immer noch unberührt am Fuße ihres Bettes stand, oder der Regen, der unermüdlich gegen die Scheiben prasselte und wie Tränen an den Fenstern herunterrann.
Es schien nichts von alledem zu sein. Sie ließ ihren Kopf mit dem langen blonden Haar aufs Kissen zurücksinken und stieß einen Seufzer aus. Wenn sie so liegen bleiben könnte, ohne jeden Gedanken. Wie würde es sich wohl anfühlen? Befreit? Kaum strömte dieses Gefühl, das ihr in so wunderbarer Weise richtig erschien, durch ihren Körper, war schon wieder dieser brennende Stich in ihrer linken Brust da. Ein bekannter Schmerz der Verlassenheit, der sich pulsierend und unaufhörlich in ihrer Seele bekunden wollte. Ohne Anfang und scheinbar ohne Ende.
Wie lange war es wohl her? Einen Tag, eine Woche oder ein Jahr? Es schien ihr, als würde ihr das Erlebte entgleiten. Fast schon war es so, als würden die Gedanken daran, je mehr sie die Erinnerung suchte, sich noch schneller im Strudel ihrer Emotionen verlieren.
Sie richtete sich noch leicht schlaftrunken auf, strich sich durch das zerzauste Haar und setzte sich gedankenverloren in ihren Schaukelstuhl neben dem Bett. Langsam wippte sie mit dem Stuhl hin und her, im Takt einer Melodie, die sie schon so lange nicht mehr gehört hatte.
Behutsam rieb sie sich mit den Fingerspitzen die Stirn, ihr Blick wanderte durch ihr Loft. Ihr ganzer Stolz. Hier konnte sie sich verkriechen, fast schon wie damals in ihren Jugendtagen im Mohnblumenfeld. Hier hatte sie sich ihre eigene Welt erschaffen, fernab von der Klinik, fernab von ihren Patienten, fernab von allen Krankheiten und vor allen Dingen, fernab der Realität.
Etwas Weiches, Wuscheliges riss Mia aus ihrem Tagtraum. Pluto, ihr Labradormischlingshund, legte seinen Kopf auf ihr Knie und bedachte sie mit einem vorwurfsvollen Blick, fast so, als wollte er ihr sagen: »Komm, komm endlich zurück, ich bin auch noch hier. Ich lebe und ich will endlich Gassi gehen!«
Sie musste sich ein Lachen verkneifen.
»Ich weiß, dass du hier bist. Ich komme ja schon.«
Langsam zog sie sich ihren lilafarbenen Trenchcoat über und strich sich ihre Haare zurecht. Der Blick in den Spiegel würde sich für heute erübrigen. Doch bevor sie die Türe öffnete, war er wieder da.
Nicht er, nicht seine Stimme, sondern einfach die Erinnerung an ihn. Was würde er ihr wohl in diesem Moment sagen?
Er würde sie wohl fragen: »Was ist mit deinen Tränen?«
Sie zog den rechten Mundwinkel kaum merklich zu einem Lächeln, während ihr Handrücken gleichzeitig noch schnell über das Gesicht strich. Schließlich sollte niemand ihre Tränen sehen.
Lilafarben und mit verquollenen Augen trat sie mit einem ungeduldigen Pluto an der Leine in einen verregneten Sonntagmorgen hinaus. Sie spazierte durch die nassen Straßen und dachte daran, dass heute ein wichtiger Tag sei. Bald würde besonderer Besuch erscheinen.
DIE ZEIT DAVOR
Mia, Miiiaaa! Zieh dich schnell an, ich muss dir draußen was zeigen.
Das musst du dir ansehen. Komm, bevor Sharon erwacht und uns den ganzen Spaß versaut.«
Genervt zog sich Mia das Kissen über den Kopf und drückte es schützend auf ihre Ohren. »Mia, nun komm schon!« Ihr Bett schien sich selbständig zu machen und wirbelte sie auf und ab. Genervt wagte sie einen Blick unter dem Kopfkissen hervor und entdeckte auch sogleich den Räuber ihres Schlafes. Ihr Bruder Gabriel hüpfte mit seinen goldenen Locken, die ihm fast über seine engelhaften blauen Augen ragten, auf ihrem Bett auf und ab.
»Meine Güte, wie spät ist es überhaupt?« Mia drehte sich zur Seite, um einen Blick auf den Wecker werfen zu können, als sie eine Karte mit zwei roten Luftballons auf ihrem Nachttisch bemerkte. Sie setzte sich noch leicht benommen auf und griff nach der Karte.
»Die hast du von Papa erhalten«, erzählte Gabriel in freudigem Ton und setzte sich neben seine Schwester. »Mama hat sie dir heute früh hingelegt, damit du sie gleich siehst, wenn du erwachst. Schön nicht, die Luftballons?«
Mia öffnete die Karte.
Alles Gute zu deinem 16. Geburtstag.
Ich bin bald wieder bei euch.
In Liebe
Papa
»Ist wohl einen Tag zu spät«, murmelte Mia leise vor sich hin und legte die Karte mit der Vorderseite nach unten zurück auf den Nachttisch.
»Aber die Luftballons sind schön«, meinte Gabriel, »und nun komm bitte endlich!«, quengelnd zog er an den Ärmeln von ihrem roten Pyjama.
»Was ist denn? Siehst du nicht, dass ich nicht in der Stimmung für deine Späße bin?«, schnauzte sie ihren acht Jahre jüngeren Bruder entnervt an.
»Ach bitte, nun komm schon. Das wirst du mir sowieso nicht glauben. Das musst du dir mit eigenen Augen ansehen!«, meinte Gabriel und hüpfte weiter in der Hoffnung, so seine Schwester schneller aus dem Bett zu kriegen.
»Na gut, du Dreikäsehoch, ich stehe auf und sehe mir das an. Aber ich warne dich, wenn es sich wieder um eine deiner unsinnigen Kindereien handelt, dreh ich dir den Kopf um.«
Noch schlaftrunken schälte sie sich mühsam aus ihrem Bett, schlüpfte in ihre Jeans und in den königsblauen Strickpullover, den sie von ihrer Mutter zum Geburtstag bekommen hatte. Die Haare band sie zu einem lockeren Pferdeschwanz hoch.
Dies war definitiv einer dieser Tage, an denen sie es vorgezogen hätte, Einzelkind zu sein. Auch wenn sie ihren kleinen Bruder eigentlich ja schrecklich liebhatte, in solchen Momenten fragte sie sich dann doch, weshalb ihre Eltern sich unbedingt ein zweites Kind anschaffen mussten. Ein Hund wäre ihr auf alle Fälle lieber gewesen. Und da sie sich für die Kindereien von Gabriel sowieso zu alt fühlte, konnte sie auch keine gemeinsamen Interessen mit dem kleinen Plagegeist ausmachen.
Als sie die Küche betrat, konnte sie durch die Gardinen gerade noch ihre Mutter sehen, die, wie jeden Morgen, mit der Post in der Hand die Garagenauffahrt hoch rannte. Sharon arbeitete als Assistentin in einer Anwaltskanzlei und schien es irgendwie immer eilig zu haben, obschon Mia nie genau verstand, warum das so war.
Da es Samstag war, war Sharon nicht wie üblich mit Minirock und Blazer gekleidet, sondern passend fürs Yoga in einem blauen Trenchcoat. Ihre blonden Locken fielen ihr gewohnt leicht chaotisch auf die Schultern.
Sie hätte sich gewünscht, Locken wie die ihrer Mutter zu haben. Doch dieser reizende Bonus wurde Gabriel zuteil. Ihre Haare waren auch blond, aber gerade und dünn, so dass sich frisurentechnisch gesehen kaum was mit ihnen anstellen ließ. Sie hatte es schon vor Jahren aufgegeben, eine einigermaßen ansehnliche Frisur zu zaubern. Meistens trug sie deshalb ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Dafür war sie mit ihrer kleinen, zierlichen Nase und ihren haselnussbraunen Augen zufrieden, die ihrer Meinung nach einen einigermaßen vorzeigbaren Kontrast zu den hellen Haaren ergaben. Die Augenfarbe hatte sie von ihrem Vater geerbt, der mehr auf Geschäftsreisen als zu Hause war.
»Mia, nun komm schon!«, schrie Gabriel, der sich bereits auf der Fußschwelle der Haustüre befand. Er konnte es kaum erwarten, ihr das zu zeigen, was ihn so in Aufruhr versetzte. Mia trottete wenig begeistert hinter ihrem Bruder her und konnte gerade noch sehen, wie Sharon mit ihrem schwarzen Opel davonbrauste. Vermutlich war sie wieder einmal knapp in der Zeit. Sharon kam immer auf den letzten Drücker zu ihren Terminen. Eine Eigenschaft, die sie auf die Palme bringen konnte. Ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter war sie meist sogar vor der abgemachten Uhrzeit am vereinbarten Ort.
»Wir müssen schon ein Stück laufen«, meinte Gabriel und fügte hinzu: »Also in den Wald, meine ich.«
Sie verdrehte die Augen. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich liegengeblieben«, sagte sie genervt.
Petrus schien sich im Datum geirrt zu haben, denn für einen Tag Mitte April schien die Sonne gnadenlos auf die asphaltierten Straßen hinunter und Mia war für einmal froh, dass sie von Natur aus überbesorgt war und die Sonnenbrille mit eingepackt hatte. Gabriel, der genau das Gegenteil von ihr war und lieber in den Tag hineinlebte, als sich um irgendwas zu kümmern, lief fröhlich pfeifend barfuß vor ihr her.
Als sie ihren Bruder genauer betrachtete, fiel ihr auf, dass seine Beine, die unter den Shorts hervorlugten, total zerkratzt und äußerst notdürftig mit Pflaster versehen waren.
Gabriel führte sie in den Wald. Der kaum sichtbare Pfad führte durch Dickicht und Geäste. Der Weg wurde schon lange nicht mehr von jemandem genutzt. Efeu und Farne eroberten ihren Platz zurück und erschwerten das Durchkommen.
»Wie kommt man auf die Idee, hier lang zu gehen? Der Pfad ist ja kaum noch zu erkennen und ich habe mir bereits das Bein an einem der Sträucher aufgekratzt«, meinte sie zu dem immer noch munter pfeifenden Gabriel. »Ich saß auf der Wiese vor unserem Haus und hab Cornflakes und Kekse gegessen. Da kam plötzlich ein angsteinflößendes Tier, es sah aus wie ein graues Pferd mit einem Hundekopf«, erklärte Gabriel, griff mit seiner linken Hand in seine Hosentasche und holte verkrümelte Kekse hervor, die dann auch sogleich in seinen Mund wanderten. Mampfend fuhr er fort: »Erst schaute es mich nur traurig an, dann schnappte es sich meine Kekse und lief davon und ich ihm hinterher.«
»Ja klar, Gabriel, das Tier war eine Mischung zwischen Pferd und Hund. Glaubst du ja selber nicht!« – »Wenn ich es doch sage!«, verteidigte sich Gabriel.
Sie hatte keine Lust, mit ihrem Bruder zu diskutieren, und lief schweigend hinter ihm her.
Der Weg wurde immer dunkler. Das vom Morgentau feuchte Holz erschien fast schon schwarz und verlieh diesem ohnehin schon düsteren Pfad noch mehr Kälte und Dunkelheit. Gerade als sie dachte, dass der Weg nicht noch trostloser werden könnte, bahnten sich wie aus dem Nichts Lichtstrahlen ihren Weg durch das dunkle Dickicht. Allmählich wurde es immer heller und unter ihren Füssen fühlte sich die matschige Erde plötzlich warm und weich an. Sie schaute erstaunt auf den Boden und stellte leicht erschrocken fest, dass sie auf Moos lief, und dass das Moos unter ihren Füssen schneeweiß war. Durch die hellen Strahlen, die auf das weiße Moos fielen, schien es durch die Reflexion des Lichtes fast schon so, als würden sie über tausende von weißen Schneekristallen spazieren. So etwas hatte sie noch nie zuvor gesehen. Doch ihr blieb keine Zeit darüber nachzudenken, denn was sie als Nächstes sah, ließ ihr den Atem stocken. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund stand sie staunend da und ihre Hand suchte nach ihrem Bruder.
»Das ist unglaublich, nicht?«, jauchzte Gabriel vor Freude und hüpfte vor ihr herum.
»Das ist überwältigend schön«, sagte Mia, die endlich wieder ihren Atem gefunden hatte.
Vor ihren Augen öffnete sich eine große Weite, ein Feld voller Mohnblumen, die alle rot leuchteten. Es schien, als würden die roten Köpfe der Blumen von kleinen Lichtern beleuchtet werden. In der Mitte des Feldes stand ein Stein und auf diesem thronte die größte aller Blumen.
Sie rannte vor lauter Freude los und ließ sich lachend inmitten der Mohnblumen fallen.
»Nicht!«, rief Gabriel. »Nein! Du hast allen Blumen das Licht geklaut!« Gabriel starrte seine große Schwester fassungslos an. Seine weit geöffneten Augen spiegelten seine Fassungslosigkeit wider. »Was hast du getan, Mia?«, fragte er entrüstet.
Entsetzt schaute sie um sich. Gabriel hatte Recht. Alle Mohnblumen hatten ihr Leuchten verloren und waren plötzlich schwarz und trostlos.
»Aber warum?« Sie stand auf und schaute verwirrt zu Gabriel, als ihr Blick auf etwas Graues direkt hinter ihrem Bruder fiel.
Ein graues, über drei Meter hohes, pferdeähnliches Wesen mit einem Hundekopf stand zähnefletschend dort am Rande des Feldes und starrte Mia aus seinen schwarzen Augen wütend an. Es war ein angsteinflößender Anblick. Sie verspürte einen peitschenden Stich im Herzen. Der Schmerz schien ihr die Kehle zuzuschnüren, so dass ihr keine Möglichkeit mehr blieb zu atmen. Sie fasste sich erschrocken an den Hals und rang vergeblich nach Luft. Ihr wurde schwindelig. Kurz bevor ihre Beine versagten, ließ der durchdringende Blick des fürchterlichen Tiers von ihr ab und der Schmerz in ihrem Körper machte der Entspannung Platz. Sie verlor den Halt unter den Füssen und sackte zu Boden.
»Mia, mein Schatz, komm trink etwas Tee.«
Mia öffnete ihre Augen und nahm verschwommen die Gestalt ihrer Mutter wahr. »Mama, was machst du denn hier? Wo sind wir?«
»Du bist zu Hause, mein Schatz, wo sollten wir sonst sein?«, entgegnete ihre Mutter mit sanfter Stimme. Mia konnte erkennen, wie ihr Sharon eine Tasse mit dampfendem Tee entgegenstreckte. Sie setzte sich langsam auf und griff sich an ihre Stirn, die sich heiß und feucht anfühlte.
»Nein. Das Feld. Das Tier. Gabriel. Die schwarzen Augen. Ich habe Schmerzen.«
»Du bist hier zu Hause in deinem Bett, jetzt trink deinen Tee.«
»Nein, Mama, ich habe die Lichter ausgelöscht, ich bin schuld, ich muss zurück. Wo ist Gabriel?«
»Gabriel schläft schon lange. Du bleibst jetzt schön hier in deinem Bett, du bist ja völlig verwirrt. Nimm einen Schluck Tee.«
Mia nahm widerwillig einen Schluck des heißen Pfefferminztees. Der erfrischende Geschmack wirkte belebend.
»Danke, Mama«, flüsterte sie.
»Gerne, mein Schatz. Und jetzt versuch nochmal zu schlafen.« Sanft drückte Sharon ihr einen Kuss auf die Stirn, löschte das Licht und ging aus dem Zimmer.
Mia tastete mit ihren Händen die feine Seide ihres roten Bettbezuges ab. Sie fühlte sich echt an. Langsam und mit geschwächten Armen griff ihre Hand nach dem Lichtschalter ihrer Nachtischlampe. Das schummrige Licht ließ das Zimmer beinahe so scheinen, als sei es aus einem romantischen Gemälde entsprungen, aber das war wirklich ihr Zimmer. Um sicherzugehen, schaute sie sich hastig um.
Da waren ihre Kleider vom Vortag, die wie gewohnt unachtsam auf den Stuhl geworfen waren und zerknittert die Lehne bedeckten. Die beiden roten Luftballons und die Geburtstagskarte von Papa. Ihr Deutschbuch und ein Vortrag über »Die Nebel von Avalon« für die nächste Deutschstunde lagen auf dem Boden. Die silberne Kette mit einem Herzanhänger und der Innschrift »Die Beste« von ihrer Freundin Lea hing über ihrem Bettpfosten und der kleine Teddy von Ben bedachte sie aus seinen schwarzen Knopfaugen mit einem fragenden Blick. Das war wirklich ihr Zimmer.
Die roten Vorhänge bewegten sich neben dem offenen Fenster sanft im Wind. Plötzlich drängte sich ein angsteinflößender Gedanke in ihr Bewusstsein.
»Wenn ich die ganze Zeit schon schlafend im Bett gelegen hatte, was war dann passiert, nachdem Gabriel mich so unsanft aufgeweckt hatte? Habe ich einfach weitergeschlafen und das Erlebnis mit dem Mohnblumenfeld und dem furchteinflößenden Tier mit den beängstigend schwarzen Augen nur geträumt?«, dachte sie und fuhr sich nachdenklich mit beiden Händen über die Stirn.
Aber wie war es möglich, einen ganzen Tag zu verschlafen, ohne dabei von einem Hunger- oder Durstgefühl geweckt zu werden? Auch konnte sie sich beim besten Willen nicht daran erinnern, die Toilette mal aufgesucht zu haben. Und krank fühlte sie sich auch nicht, abgesehen davon, dass sich ihre Augenlider schwer und geschwollen anfühlten. Sie musste wohl geweint haben. Irgendwas schien hier ganz falsch zu sein. Der Gedanke daran ließ sie erschaudern. Schützend zog sie sich ihre Bettdecke bis ans Kinn, ließ ihren Kopf müde ins Kissen zurücksinken, schloss die Augen und wurde mit sanften, aber fordernden Händen vom Schlaf eingehüllt.
In ihrem Traum rannte sie in einem weißen Kleid durch ein leuchtendes Mohnblumenfeld. Hinter ihr vernahm sie das Lachen von Gabriel. Sie fühlte sich wunderbar leicht und drehte sich in einer schwungvollen Pirouette zu ihrem Bruder. Doch statt Gabriel sah sie zu ihrem Entsetzen erneut das riesige graue Pferd mit dem Hundekopf. Seine schwarzen Augen leuchteten und sie hatte das Gefühl, sie verbrenne bei lebendigem Leib. Die Augen des Tieres schauten sie durchdringend und siegessicher an, bis plötzlich der ganze Körper des Wesens vollkommen in brennendem Feuer erstrahlte und an der Stelle dieses Tieres der brennende Körper eines Mannes zum Vorschein kam.
Sie erwachte erneut und schrie. Schweißüberströmt setzte sie sich auf und schaute sich verwirrt in ihrem Zimmer um. Sie ging zum Fenster. Der Mond leuchtete hell und silbern. Sie versuchte gleichmäßig zu atmen. Alles schien normal zu sein. Der Traum, das Tier und der brennende Körper: sie waren plötzlich ganz weit weg.
DER FREMDE
Aus weiter Ferne drang das schrillende Piepsen des Weckers in Mias Ohren und drängte sich unsanft in ihr Bewusstsein. Mühsam schälte sie sich aus ihrem Bett. Sie fühlte sich gerädert, so als ob ihr Körper eine schwere Krankheit ausgestanden hätte. Noch schlaftrunken setzte sie sich langsam auf. Ihre Füße berührten den rosafarbenen Teppich, den sie damals mit ihrer Mutter zusammen für ihr Zimmer aussuchen durfte. Es tat gut, Boden unter den Füssen zu spüren.
»Mia!« Mia zuckte zusammen, als sie die Stimme ihrer Mutter hinter ihr vernahm.
Sharon stand in der Tür.
»Mia, mein Schatz, wie fühlst du dich? Du siehst immer noch etwas käsig aus«, meinte sie besorgt und fuhr fort: »Wenn du dich angezogen hast, dann komm in die Küche. Ich möchte, dass du noch was isst, bevor du in die Schule gehst. Du hast sehr lange geschlafen.«
Mia starrte gedankenverloren und schläfrig auf den Fußboden. »Hast du mich verstanden, Mia?«, ihre Mutter musterte sie mit einem besorgten Blick. »Ja, Mama, ich werde noch etwas essen, bevor ich zur Schule gehe«, antwortete sie leise und mit trockener Stimme. Sie lief langsam zum Schrank, griff nach den Jeans, die zuoberst auf dem Kleiderstapel lagen, und entschied sich für einen roten Pullover. Die Haare band sie sich zu einem lockeren Pferdeschwanz hoch, ehe sie die Treppe runterrannte, sich ein Stück Marmeladenbrot aus der Küche schnappte, das Sharon für sie vorbereitet hatte, und es in kleinen hastigen Bissen aß, während sie bereits zu ihrem Fahrrad ging. Kaum hatte sie den letzten Bissen hinuntergeschluckt, fuhr sie los.
Der kalte Fahrtwind wirkte erfrischend und sie fühlte sich schon viel lebendiger als noch vor ein paar Minuten. Sie schloss für einen kurzen Moment die Augen, hob beide Arme hoch, atmete tief ein und aus und fühlte sich, als würde sie fliegen, weit weg fliegen. Sie lachte und war glücklich. In der Schule angekommen, wünschte sie sich, der Weg dorthin hätte länger gedauert.
Als sie das Klassenzimmer betrat, saß ihre Deutschlehrerin mit einer dampfenden Tasse Tee bereits an ihrem Pult. Susanne Merte war ihr Name. Eine Frau Mitte fünfzig. Ihr schwarzes Haar mit den grau melierten Strähnen trug sie zu einem strengen Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Der schwarze Pullover mit dem grauen knielangen Rock und den schwarzen geschnürten Schuhen unterstrich ihr strenges Erscheinungsbild. Passend dazu trug sie eine schwarze Hornbrille mit dicken Gläsern.
Müde von der kräftezehrenden Nacht und immer noch bleich ließ sich Mia lustlos auf dem freien Stuhl neben ihrer besten Freundin Lea nieder.
Lea hieß eigentlich Lexandra, wurde aber schon seit Mia sich erinnern konnte ganz einfach Lea genannt.
»Wie siehst denn du aus? Also das Monster von Loch Ness ist heute ja wohl gar nichts im Vergleich zu dir. So was nach deinem Geburtstag, also ich weiß ja nicht. Oder ist das wohl schon das Alter?«, stellte Lea mit einem neckischen Unterton fest und drehte mit ihren Fingern Locken in ihr schwarzes Haar.
Lea hatte schwarzes dickes Haar, olivgrüne Augen, einen das ganze Jahr hindurch natürlich gebräunten Teint und einen athletischen Körper. Zudem war Lea, ganz im Gegensatz zu Mia, immer nach der neusten Mode der angesagten Hochglanzmagazine gekleidet.
Mia hingegen bevorzugte den »Hauptsache-bequem-Look«, den sie jedoch immer so kombinierte, dass es wenigstens einigermaßen danach aussah, als würde sie der Mode zumindest einen kleinen Stellenwert einräumen. Am liebsten trug sie einen etwas übergroßen Pullover mit Strumpfhosen und Stiefel. Im Winter durfte dann auch der gigantisch lange Schal dazu nicht fehlen. Auf der Prioritätenliste bei der Kleiderzusammensetzung stand vor allen Dingen aber ein übergroßes Oberteil. Und dies nicht deshalb, weil sie etwas zu verbergen hätte. Schließlich hatte sie, dafür dass sie kaum Sport trieb, eine fast schon zerbrechliche Figur. Der Grund für die übergroßen Oberteile war der, dass sie darin das spezielle Gefühl der Sicherheit hatte. So als könnte sie jeden Moment ganz einfach darin abtauchen, wenn ihr etwas zu viel werden würde.
»Hallo, Erde an Mia. Bist du noch hier?«, Lea schnipste nervös mit ihren Fingern vor Mias Gesicht herum. »Ich habe dich gefragt, ob sich das Alter bei dir schon bemerkbar gemacht hat, so fürchterlich mitgenommen wie du heute aussiehst.«
Mia hatte keine Nerven, um auf die zynische Bemerkung ihrer besten Freundin einzugehen. Ihr Blick schweifte aus dem Fenster, direkt auf das Schulgebäude.
Der kleine Vorhof der Schule von Kentää erschien im grauen Aprilwetter noch trostloser und wirkte mit den immer noch nackten Bäumen fast schon gespenstisch.
In Valmostaat, wo Mia herkam, trugen wenigstens bereits die ersten Bäume ihre Blüten. Doch es schien, als hätte der Frühling in Kentää es sich anders überlegt und sein Erscheinen auf später verschoben. Wie so oft erinnerte der Himmel an ein graues Tuch. Mit dem noch trostloseren Unterschied, dass der Regen unaufhörlich und fast fordernd gegen die Fensterscheiben des Klassenzimmers prasselte.
Sie lebte seit ihrer Geburt auf der Insel Marvengaard, einer Insel zwischen Norwegen und den britischen Inseln, die bekannt war für ihr wechselhaftes Wetter. Auf Sonnenschein konnte stärkster Regen folgen und es geschah häufiger, dass das Wetter an nebeneinanderliegenden Orten vollkommen anders war. So konnte es vorkommen, dass es in Kentää regnete, in Valmostaat aber die Sonne schien. Und dies, obwohl sich die beiden Dörfer direkt nebeneinander befanden und nur durch den kleinen See Lake Kutamo getrennt wurden. Kentää und Valmostaat befanden sich im Herzen der Insel Marvengaard. Die Insel zu Fuß zu umrunden, würde ganze vier Tage benötigen.
Mia strich sich gedankenverloren eine blonde Strähne aus dem Gesicht.
»Was ist los mit dir?«, flüsterte Lea neben Mias Ohr. »Nichts, alles okay«, hörte Mia sich selber sagen und spürte, wie das Blut in ihren Kopf stieg. Eine unangenehme Reaktion ihres Körpers auf Lügen. »Komm schon, ich sehe es deinem Gesicht an, dass du mir etwas verheimlichst. Du bist ja rot wie ein Krebs.«
»Es ist alles gut, wirklich«, entgegnete Mia mit einem bestimmenden Unterton, um der nervenden Fragerei von Lea ein Ende setzen zu können.
»Sharon war gestern nur wieder mal genervt, weil Papa seine Geschäftsreise verlängern musste. Und seine Geburtstagskarte kam natürlich auch noch verspätet. Da hätte er es besser gleich gelassen.«
Mia war sich bewusst, dass Lea bei diesem Thema klein beigeben würde. Schließlich waren die Probleme von Mia mit ihrem Vater nicht erst seit kurzem in ihrem Leben vorhanden, und sie wollte sich schlichtweg nicht mehr damit befassen.
Eine Tatsache, die Lea sehr wohl bewusst war.
»Wenn du meinst. Was ist eigentlich mit deinem Vortrag? Hast du ihn noch fertig geschrieben?« Erschrocken schaute Mia ihre Freundin an. Klar, den Vortrag, den hätte sie ja fast vergessen. Heute waren die ersten drei Schüler dran und Mia gehörte zu den ersten dreien, die ins kalte Wasser geworfen wurden und vor all ihren Klassenkameraden referieren mussten. »Auch das noch, das hätte ich ja fast schon vergessen«, sagte sie erschrocken. Lea musste sich ein Lachen verkneifen.
»Ach Murmel, du wirst das schon packen. Roter als eine Tomate wirst ja wohl auch du nicht werden können.«
»Scherzkeks«, entgegnete Mia. »Du hast etwas gut bei mir. Erinnere mich daran, wenn du deinen Vortrag halten musst«, fügte sie neckisch hinzu und freute sich darüber, dass Lea es irgendwie immer wieder schaffte sie aufzumuntern.
»Mia!« Die Stimme von Frau Merte verschaffte sich Gehör durch das ganze Klassenzimmer, bis hin zu Mias Ohren. »Dann wäre ich froh, wenn du mit deinem Vortrag über …«, Frau Merte fasste mit ihren dünnen langen Fingern suchend in einen Papierstapel und schielte über ihre schwarze Hornbrille hinweg auf ihre Notizen, »ach ja, mit deinem Vortrag über Avalon beginnen könntest.«
»Wünsch mir Glück«, meinte Mia, erhob sich von ihrem Platz und drehte sich noch einmal hilfesuchend zu ihrer besten Freundin um.
Lea hob beide Daumen in die Höhe und schenkte ihr ein Lächeln, wie es wohl optimistischer nicht hätte sein können. Mia lief zwischen den Stühlen durch das Klassenzimmer und spürte förmlich, wie ihre Knie immer weicher wurden. Sie stolperte Richtung Lehrerpult und fand im letzten Moment das Gleichgewicht wieder.
Die Klasse lachte und Mia wünschte sich, es würde sich ein Loch im Boden öffnen, in dem sie versinken könnte. Endlich beim Lehrerpult angekommen, gab Frau Merte ihr ihren Stuhl frei und schaltete den Tageslichtprojektor ein.
Die ganze Klasse saß gespannt da.
»Gib’s uns, Baby!«, schrie Sven aus der rechten hinteren Ecke des Klassenzimmers nach vorne. Allgemeines Gelächter brach aus.
»Fertig mit euren humorvollen Einlagen. Auch du, Sven!«, meinte Frau Merte in einer leicht erhöhten Stimmlage. Stille. Alle Augen waren auf Mia gerichtet. Glücklicherweise wurde sie aber derart vom hellen Licht des Projektors geblendet, dass sie die Blicke zwar auf ihrer Haut spüren, aber nicht sehen konnte. Eine fast schon beruhigende Tatsache. Sie atmete tief ein und aus und begann ihren Vortrag. »Die Nebel von Avalon – ein Fantasy-Roman von Marion Zimmer Bradley.«
Mia hielt kurz inne, um neuen Atem zu holen, als im selben Moment die Tür des Klassenzimmers mit einer enormen Wucht aufgerissen wurde, fast schon so, als wäre der Urheber dieser brachialen Aktion auf der Flucht.
Mitten im Türrahmen stand ein Junge. Verwaschene Bluejeans, ein graues Kapuzenshirt und eine ziemlich vergilbte, aber merklich schwarze Lederjacke. Seine Kleidung war vollkommen durchnässt und seine vollen braunen Haare ließen das Wasser des Regens auf den Boden des Klassenzimmers tropfen.
Totenstille herrschte unter den Schülern und alle blickten leicht entsetzt und neugierig zugleich auf den fremden Jungen. Und der fremde Junge blickte leicht entsetzt und neugierig zugleich direkt in die Augen von Mia.
Mia sah wie gebannt in die Augen des Jungen und verspürte einen peitschenden Stich im Herzen. Gleichzeitig fühlte sie jedoch jede einzelne Faser ihres Körpers und spürte das Blut in ihren Adern fließen. Es schien, als würde das erste Mal Leben in ihrem Körper existieren.
Sie hielt den Atem an und konnte ihren Blick nicht von den wundervoll karamellfarbenen Augen des unbekannten Jungen lassen. Der Blick in seine Augen fühlte sich befremdend und zugleich unendlich vertraut an, so als wäre sie endlich zu Hause.
In ihrem Kopf drehte sich ein Karussell. Ihr Kreislauf versagte und sie stürzte seitwärts vom Stuhl auf den Boden. Ihr Kopf schlug dumpf auf dem harten Linoleum des Klassenzimmers auf.
Schwarz.
IM LICHT DER SONNE
Als Mia erwachte, lag sie auf dem Rücken mitten in einem Mohnblumenfeld und sah den wundervollen roten Mohnblumen zu, wie sie im Licht der Sonne tanzten. Ein warmes Gefühl der Sicherheit breitete sich in ihrem Körper aus.
Langsam drehte sie ihren Kopf zur Seite und ihr Mund öffnete sich voller Erstaunen, als sie in wunderschöne karamellfarbene Augen blickte.
Ein Junge, den sie noch nie zuvor gesehen hatte, lag neben ihr. Er sah sie mit seinen hellen Augen an und schmunzelte. »Hey Blume, was ist? Warum schaust du mich so erschrocken an, als hättest du die neue Hexe unseres Dorfes erblickt?«, flüsterte er mit einer samtweichen Stimme und strich ihr ein braunes Haar aus der Stirn.
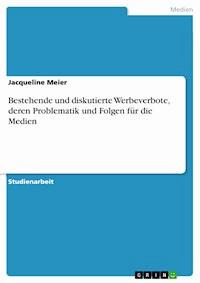
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











