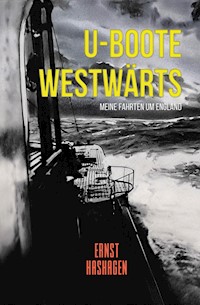
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit Wochen durchpflügt "U 62" den Nordatlantik ohne Feindberührung. Etwas musste geschehen. So entschließt sich der Kommandant Ernst Hashagen zu einem Kurswechsel in südlicher Richtung, um endlich feindlichen Schiffen zu begegnen. Dem Kommandanten fällt die Entscheidung nicht leicht, denn er weiß, dass ihm und seinen Männern eine große Gefahr bevorsteht. Sie müssen durch den engsten Teil des Ärmelkanals hindurch, der mit einer tödlichen Netzsperre voller Minen durchzogen ist, bereit, um jedes deutsche U-Boot zu vernichten. Aber Ernst Hashagen glaubt, dass das Netz eine Lücke hat. An einer Stelle des Meeresbodens soll ein Graben mit einer größeren Meerestiefe unter dem Netz hindurchführen, die sogenannte "Rinne". Doch niemand kennt deren genaue Lage. Vorerst geht das Kalkül Ernst Hashagens Auf. Er entdeckt und torpediert zahlreiche feindliche Schiffe. Am Abend des 31. August 1917 ist der Augenblick gekommen. "U 62" steht vor dem Netz. Die Bewachung über Wasser ist so stark, dass der Kommandant den Befehl zum Tauchen gibt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wird der Durchbruch gelingen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
U-Boote
Westwärts!
von
Ernst Hashagen
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag von E. S. Mittler & Sohn,
Berlin, 1931
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
Klarwelt-Verlag, Leipzig, 2022
© Alle Rechte vorbehalten.
www.klarweltverlag.de
Meinen gefallenen
und noch lebenden Mitkämpfern
auf den deutschen Unterseebooten
„U 22“, „UB 21“ und „U 62“
gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Einleitung
Das Meer ist Schicksal und Gesetz
Der Seehund
Tauchpanne
Sterbende Schiffe
Die Welt des Unterseebootes
Gefesselte Kraft
Menschenköder
“U 62”
Wie ich “Q 12” versenkte
Minentod
Fragen aus der Tiefe
Durch die Netzsperre Dover—Calais
Mimikry
Konvoiangriffe
U-Boots-Morgen
Winternacht in der Irischen See
1918
Ausklang
Vorwort
ls England am 4. August 1914 den Krieg erklärte, waren wir in der deutschen Marine sicher, dass wir in allerkürzester Zeit einen schweren, äußerst schweren Kampf zu bestehen haben würden. Wir wussten, was uns bevorstand. Wir kannten unsere Schiffe, unsere Waffen und unsere Pflicht. Die Stimmung war ernst, aber zuversichtlich. Wir warteten auf die Schlacht.
Das Material der deutschen Schiffe war hervorragend, der Geist ihrer Besatzungen und ihre Ausbildung unübertroffen und das Ganze, die deutsche Hochseeflotte, ein in langer, mühevoller Friedensarbeit geschaffenes, unvergleichliches Instrument, die einzige Verkörperung des nationalen Einheitswillens aller deutschen Stämme. In den Händen einer energischen und zielbewussten Seekriegsleitung musste sie dem deutschen Volk in der Stunde der Not ein Mittel sein, um seine Stellung als wachsende Seemacht zu behaupten und seine Freiheit wirksam zu verteidigen.
Aber die englische Flotte kam nicht, und die deutsche durfte nur kämpfen, wenn sie dazu gezwungen wurde oder wenn sich dabei „ernstere Verluste mit Sicherheit vermeiden ließen“. Schon der erste Operationsbefehl an die Flotte war negativ und nagte von diesem Tage an am Mark der Schiffe. Man legte die Geschwader an die Kette und verdammte sie zur Untätigkeit in den Flussmündungen. Die „Politik“ hielt sie zurück und verhalf so unseren Gegnern zu einer ohne Verluste gewonnenen Schlacht. Als die U-Boote anfingen, zu wirken und unseren Feinden gefährlich zu werden, fiel man auch ihnen in den Arm.
Krieg ist ein Spiel ums Leben. Wehe dem, der seine Karten nicht im richtigen Augenblick ausspielt! Ein kurzes Zögern gibt schon dem Gegner alle Vorteile in die Hand.
Die deutsche Flotte ist im November 1918 materiell völlig intakt zur Internierung nach Scapa Flow gefahren. Ihr Geist war durch die Politik zerschunden. Die letzten deutschen Männer haben sie mit eigener Hand versenkt. Die U-Boote mussten nach Harwich, es war „vaterländische Pflicht“, sie dem Feinde auszuliefern.
Kann man daraus lernen? Lohnt es sich, die Geschichte dieser Flotte zu lesen? Die Geschichte der Torpedoboote, Minensucher und der U-Boote, deren Besatzungen bis zum letzten Matrosen und Heizer keine „Kulis“ waren, sondern gutwillige und tapfere Deutsche, welche zu Tausenden freudig ihr Leben hingegeben haben für Sieg und Freiheit? Lohnt es sich für den Deutschen und seine Zukunft, zu erkennen, wie eine schlechte Politische Führung den besten Geist zermürben, auch das tapferste Volk an den Abgrund reißen kann?
Auf dem Meere standen sich Deutschland und England als Gegner gegenüber. Zu großen Seeschlachten ist es mit Ausnahme der Skagerrakschlacht nicht gekommen. Trotzdem ist dieser Seekrieg für uns Deutsche das lehrreichste Kapitel des ganzen Krieges. Er ist der lebendige Ausdruck des Kampfes zweier Geisteswelten, vor allem aber ist er ein getreues Spiegelbild der „Politik“ der kämpfenden Parteien. Gerade deswegen zwingt seine Geschichte unmittelbar jeden Deutschen, dem es ernst ist mit dem Suchen nach Erkenntnis und Wahrheit, mit dem Lernenwollen für eine bessere Zukunft, darin zu studieren. Von deutscher Seite ist sie in einem fesselnd geschriebenen Admiralstabswerk „Der Krieg zur See 1914 bis 1918 niedergelegt, in England in den „Narval Operations“ durch den inzwischen verstorbenen Sir Julian Corbett. Beide Werke sind auch für den Laien von allerhöchstem Interesse.
Politik treiben, erfolgreiche Politik treiben, kann nur, wer über Erfahrung und Wissen verfügt. Lernen, aus der Vergangenheit lernen, ist uns Deutschen bitter nötig. Nicht Schlagworte, nicht das Lesen von Zeitungen allein ist die Hauptaufgabe heute für uns und die kommenden Generationen. Wir haben im Großen Kriege die Politik nicht gemeistert. Nur wenn wir lernen, wenn wir politisch etwas „können“ und wissen, werden wir bei einer neuen Prüfung besser bestehen.
Das Unterseeboot war eine wesentliche, zuletzt die ausschlaggebende Waffe im Kampfe gegen England. Westwärts sind wir auf unseren Booten gefahren durch Monate und Jahre. Dort, wo die Sonne an jedem Tage ins Meer sank, stand unser Feind, England. Im Westen, wo der Atlantik frei heranrollte an die felsigen Küsten des Inselreiches, dort, wo die großen Schlagadern des Britischen Weltreiches, die Handelsstraßen, offen zutage lagen, war der weitgespannte und sturmdurchbrauste Kampfplatz der U-Boote. Westwärts zogen wir immer wieder hinaus. Denn im Westen, im Kampfe gegen England, musste sich das deutsche Schicksal entscheiden.
Was wir auf diesen Fahrten erlebt haben, ist in diesem Buche beschrieben. Es soll ein Bild zeichnen aus den Schicksalsjahren der deutschen Flotte, als deren äußerste Vorposten wir U-Boots-Fahrer im Atlantik kämpten. Es erzählt von der Welt des U-Bootes und von den Kämpfen auf und unter dem Meere. Deutsche U-Boote gibt es heute nicht mehr. Was an deutschem Geist und Willen in ihnen war, habe ich hier zu schildern versucht.
Die nachstehenden Blätter enthalten viele „Ich“-Sätze. Das liegt in einer technischen Eigentümlichkeit des U-Bootes begründet. Es hatte nur ein Sehrohr. An diesem stand der Kommandant. Er allein sah und führte, er schoss, und er konnte niemanden fragen, was er jetzt gerade tun und ob er schießen sollte. Wir Kommandanten haben in der deutschen Marine eine gute Führerschule durchgemacht. Wenn wir durch sie erfolgreich waren, wollen wir das dieser Schule danken.
Viel höher zu bewerten ist die Haltung der „Geführten“, die Haltung unserer Besatzungen. Ihnen, die nichts sahen, die blind, im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen mussten, die unten im Boot ausharrten und ruhig ihre Pflicht taten, wenn die Bomben dichter und dichter einschlugen um die stählernen Wände, ihnen, die bis zum letzten, auch in den Revolutionstagen, treu zu ihren Führern gestanden haben, soll dieses Buch ein Denkmal setzen, den Lebenden und den Toten. Das Band zwischen allen U-Boots-Fahrern, gleichviel ob sie Offiziere oder Mannschaften waren, kann uns niemand zerreißen.
Hamburg, im Juni 1930.
Einleitung
1917 bis 1929
m 30. April 1917 donnerten die Kanonen eines deutschen U-Bootes weit draußen im Atlantik. Heulend und triumphierend warfen sich deutsche Granaten über das Deck eines unheimlichen schwarzen Schiffes. Schnell und unerbittlich taten sie ihre Arbeit, als wenn sie wüssten, welch gefährlichen Feind sie da in den Zähnen hatten. Es war die englische U-Boots-Falle H. M. S. „Q 12“, welche ihr verwegenes Spiel gegen deutsche U-Boote zum letzten Male versucht und diesmal endgültig verloren hatte. Vom Torpedo getroffen und von Granaten zerfetzt, versank das Schiff in den Fluten.
Wenige Minuten später stand der überlebende Führer der Engländer, Commander Norman Lewis, als Gefangener vor mir, als dem Kommandanten des deutschen U-Bootes. Das Schicksal hatte es diesmal eilig gehabt, seine Fäden zu spinnen. Erst vor vier Tagen war er mit seinem Schiffe aus seinem Heimathafen Queenstown an der Südküste Irlands ausgelaufen, nicht viel später, als wir mit „U 62“ Helgoland verlassen hatten; und schon waren die Rollen fast vertauscht. Die U-Boots-Falle lag auf dem Grunde des Meeres, und der Engländer fühlte zu seiner Pein deutsches Eisen unter den Füßen, das Deck eines jener verhassten deutschen U-Boote, welche er doch eigentlich hatte überlisten und vernichten wollen.
Dieser Krieg war wirklich voll von Zufällen und Überraschungen, besonders auf dem Meere. Auf dieser weiträumigen und wildbewegten Bühne schienen sich alle Kräfte zu befehden, und doch war irgendwo ein großer Regisseur, der das Spiel meisterte. Ihm gefiel es zuweilen in einer grimmigen Laune, groteske Szenen zu spielen und die handelnden Personen gründlich durcheinanderzuwürfeln.
So fuhr Lewis 19 Tage mit uns, kreuz und quer durch den Atlantik. Er sah uns wachen und schlafen, suchen und kämpfen und fand dabei zu seinem Erstaunen, dass die deutschen U-Boots-Fahrer sich gar nicht so sehr von seinen eigenen Landsleuten unterschieden. Gewiss, es waren Deutsche und keine Engländer. Sicher aber keine „Hunnen“ oder „Barbaren“, wie es die Lügenpropaganda seines Landes zu verbreiten suchte.
Ich will von den damaligen Erlebnissen in einem späteren Kapitel dieses Buches noch mehr erzählen. Hier soll zunächst nur das Ereignis selbst, die Versenkung der Falle und die Gefangennahme des englischen Kommandanten, erwähnt werden, weil es jetzt, nach Ablauf von 12 Jahren, noch ein ganz unerwartetes und die Öffentlichkeit lebhaft beschäftigendes Nachspiel gehabt hat.
Commander Lewis verbrachte den Rest des Krieges als Gefangener in Freiburg. Die Tatsachen der Begegnung mit ihm bewahrte mein Kriegstagebuch. Neue Fahnen und neue Kämpfe folgten. Der große, eherne Schritt des Krieges ließ nicht viel Zeit zum Zurückblicken. So verblassten auch bei uns allmählich die Einzelheiten dieser Episode. Erst in späten Jahren nach dem Kriege habe ich zuweilen sinnend vor meinen U-Boots-Bildern gestanden und jenes Tages gedacht, an dem uns die berstende Kraft unseres Torpedos noch in letzter Sekunde vor den tödlichen Fängen der Falle gerettet hatte.
Von Lewis hörte ich nichts wieder. Ich wusste nicht einmal, ob er noch lebte. Da kam im Sommer 1929 ein Brief aus England, der in der Übersetzung wie folgt lautete:
„Lieber Kapitän Hashagen!
Am 30. April 1917, als ich das Kommando des englischen Schiffes „Q l2“ führte, wurde mein Schiff torpediert und versenkt durch ein deutsches U-Boot. Ich selbst wurde gefangengenommen und verbrachte 19 Tage an Bord des deutschen U-Bootes. Ich bin alle Zeit sehr dankbar gewesen für die Behandlung, welche ich durch den Kommandanten und seine Offiziere erfuhr. Kürzlich las ich ein durch den amerikanischen Schriftsteller Lowell Thomas herausgegebenes Buch „Raiders of the Deep“ und sah eine Fotografie von einem Offizier Hashagen, welche ganz und gar dem Offizier ähnelte, welcher mich gefangen nahm. Ich schrieb dann an die Deutsche Botschaft in London, welche die Freundlichkeit hatte, mir Ihre Adresse zu geben. Heute möchte ich Sie fragen, ob Sie der Offizier sind, welchen ich suche. Ich habe schon so lange gewünscht, meine Dankbarkeit dem Kommandanten des deutschen U-Bootes auszusprechen.
Zur Zeit bin ich Sekretär bei der League of Nations Union in Reading und habe oft Gelegenheit, öffentlich zu sprechen. Ich kann Sie versichern, dass viele Tausende von Leuten durch mich von der chevaleresken Art gehört haben, mit welcher ich behandelt wurde. Ich nehme an, dass Sie die League of Nations Union kennen und wissen, dass ihr Bestreben ist, für den Frieden der Welt zu arbeiten. Ich habe nebenbei ein gut Teil meiner Tätigkeit als öffentlicher Redner dazu verwandt, dem englischen Publikum zu zeigen, dass Deutschland, für welches ich eine große Bewunderung hege, nicht das Land ist, zu dem Kriegspropaganda es versucht hat, zu machen.
In Erwartung, bald wieder von Ihnen zu hören, bin ich
Ihr
(gez.) Commander N. Lewis R. N.“
Man kann sich meine Überraschung vorstellen. Persönliche Feindschaft hatte ja nie zwischen Lewis und mir bestanden. Ich hatte ihn so behandelt, wie jeder andere deutsche Offizier einen wehrlosen Gefangenen unter diesen besonderen Umständen auch behandelt haben würde. Sofort stand mir wieder das scharf geschnittene Gesicht des Mannes lebendig vor Augen. Andere Bilder tauchten auf aus der Erinnerung, und ich schrieb Lewis in ehrlicher Bewegung zurück, dass auch in mir die gemeinsamen Erlebnisse aus dem Kriege unvergessen seien, und dass ich mich sehr gefreut hätte, die Verbindung mit ihm wiedergefunden zu haben.
Man sagt ja, dass Reisebekanntschaften sich zu wiederholen pflegen. In unserem Falle war es zweifellos eine ganz besondere Art von „gemeinsamer Reise“ gewesen. Ich konnte mir vorstellen, dass es sowohl für Lewis als für mich interessant sein musste, diese „Bekanntschaft“ aus dem Kriege jetzt unter besseren und friedlicheren Bedingungen zu erneuern.
Dann wechselten wir einige Briefe miteinander, und eines Tages forderte Lewis mich auf, nach England zu kommen, um dort einen Vortrag über meine U-Boots-Erlebnisse zu halten. Am Schluss des Briefes schrieb er mir:
„Nach meiner guten Behandlung in Deutschland und in der Überzeugung, dass vieles, was gegen Deutschland gesagt wird, unwahr ist, habe ich fortgesetzt mein Bestes getan, um die Wahrheit in England bekanntzumachen.
Jetzt bietet sich Ihnen selbst die Gelegenheit, vor der englischen Öffentlichkeit die Wahrheit über die deutschen U-Boote zu sagen. Ich hoffe, dass Sie aus patriotischen Gründen und um die Verleumdungen zu bekämpfen, welche gegen die große deutsche Marine ausgestreut waren, in der Lage sind, meine Einladung anzunehmen.“
Das war nun doch wirklich eine erstaunliche und nicht ganz alltägliche Entwicklung der Dinge:
Kampf zwischen U-Boot und -Falle bis aufs Messer, Untergang der letzteren, Gefangennahme ihres Kommandanten, drei Wochen eingeschlossen und schicksalsverbunden mit 40 verhassten Deutschen, von eigenen (englischen) Bomben verfolgt, ein Fegefeuer . . .
Dann zwölf Jahre Pause — und jetzt ein gemeinsamer Vortrag in England, sozusagen Hand in Hand vor Völkerbund- und Friedensfreunden!
Das war zum mindesten sehr ungewöhnlich, und ich begann lange über die ganzen Zusammenhänge nachzudenken.
Eine alte Erinnerung kam mir, es war im Herbst 1917, als ich von mehrwöchiger, anstrengender Fernfahrt nach Wilhelmshaven zurückkehrte. Kaum hatte ich einmal wieder in einem richtigen Bett geschlafen und von einem gedeckten Tisch gegessen, als man ebenso höflich wie bestimmt von höherer Stelle bei mir anfragte, ob ich bereit sei, in einigen Tagen in mehreren großen rheinischen Städten Vorträge über den U-Boots-Krieg zu halten. Das Volk brauche Aufklärung über das, was im Felde und auf See vor sich ginge, usw.
Dem Soldaten bleibt ja bei bestimmten Fragen nichts anderes übrig, als ja zu sagen. So packte ich denn, wenn auch ungern, meine Koffer, innerlich durchaus nicht überzeugt davon, dass diese Art von Aufklärung viel nützen würde, solange es uns immer noch fehlte an der straffen Führung der ganzen Nation, welche ein Volk nun einmal nicht entbehren kann, am allerwenigsten aber in einem solchen Kriege. Im Übrigen — dachten wir damals — treibt man Aufklärung im Kriege am besten mit der Waffe am Feinde und nicht mit Reden zu Hause. Heute wissen wir, wie schwer sich dieser Mangel an einheitlicher Führung bei uns gerächt hat.
Dann vergingen zwölf schwere Jahre, 1917 bis 1929. Und jetzt fragte man wieder bei mir an, diesmal von England, ob ich „aufklären“ wollte. Ob ich bereit sei, vor der englischen Öffentlichkeit die Wahrheit über die deutschen U-Boote zu sagen?!
Zunächst schien es mir ganz unmöglich, dieser Aufforderung
Folge zu leisten. In Deutschland wusste man ja, wie und in welchem Geiste unsere U-Boote gekämpft hatten, und in England jetzt noch nach zwölf Jahren darüber aufzuklären, hatte doch wohl kaum einen Sinn. Würde ich nicht meine alten U-Boots-Kameraden vor den Kopf stoßen, wenn ich die Einladung annahm? Waren nicht auch noch nach dem Kriege Verleumdungen über die Kampfesweise der deutschen U-Boote gerade von England ausgegangen? Sollten wir uns nicht besser gerade England gegenüber ganz passiv verhalten, zum mindesten so lange, bis der letzte englische Besatzungssoldat unser Land verlassen hatte, oder noch besser, bis der „Frieden“ von Versailles in einen wirklichen und gerechten Frieden umgewandelt war? Die widerstreitendsten Gefühle und Vorstellungen bestürmten mich. Aber ich habe dann an den Fehler gedacht, welchen wir Deutschen ja leider so häufig machen, unsere Wünsche und Ziele mit dem zu verwechseln, was praktisch möglich und erreichbar ist.
Wir laufen heute Gefahr, klein zu werden im klein gewordenen Deutschland. Seitdem wir unsere Kolonien verloren haben, ist unser Gesichtskreis noch enger geworden, und doch brauchen wir heute mehr denn je Fühlung und Beziehungen mit der Umwelt.
Als ich das alles sorgfältig überdachte, schien es mir falsch zu sein, eine Einladung abzulehnen, die von einem Engländer an mich ergangen war, und die in der Aufforderung gipfelte, in England persönlich über die deutsche U-Boots-Kriegsführung zu sprechen.
Unser U-Boots-Krieg gegen den englischen Handel war für England das ernsteste Kriegsproblem gewesen. Nur einmal im Kriege war England wirklich am Ende seiner Kraft. Das war im April 1917, als der uneingeschränkte U-Boots-Krieg die ersten, überraschend großen Resultate gebracht hatte. Damals kam der amerikanische Admiral Sims nach England und hörte zu seiner tiefsten Bestürzung, dass die englischen Verluste an Tonnage weit größer waren, als die Zeitungen melden durften. Damals war es, dass Jellicoe den Amerikaner mit den Worten begrüßte: „The Germans will win, unless we stop those losses and stop them soon1.“ Auch diese Gedankengänge waren es, welche es mir klar machten, dass ich die englische Einladung nicht ablehnen durfte. Das umstrittene Thema: „Das U-Boot und der U-Boots-Krieg“ beherrschte ich, so dass ich in dieser Hinsicht keine Bedenken zu haben brauchte. Vom Februar 1915 an bis November 1918 habe ich auf kleinen und großen U-Booten gefahren und alle Stadien und Methoden: des U-Boots-Krieges praktisch selbst mit durchgemacht. Das war mein „Kriegserlebnis“, über das es sich vielleicht auch jetzt noch nach zwölf Jahren lohnte, in England und zu Engländern zu sprechen. Gleichzeitig hatte ich Gelegenheit, durch eigenes Zeugnis die noch vorhandenen Reste der Lügenpropaganda unserer Gegner aus dem Kriege zu bekämpfen. Unsere früheren Feinde sollen wissen, dass wir den Krieg „zwar nicht mit Handschuhen, aber mit reinen Händen“ geführt haben. Da ich gewisse Möglichkeiten zu sehen glaubte, Deutschland durch Übernahme der mir angetragenen Aufgabe zu nützen, mussten alle anderen Bedenken mehr gefühlsmäßiger und persönlicher Art zurückstehen. Letzten Endes schien es mir auch eine Ehrenpflicht zu sein, Commander Lewis in seinem in England geführten Kampf gegen die Kriegslügen nicht im Stich zu lassen.
So fuhr ich Mitte November des letzten Jahres über den Kanal und sprach am 18. November in Reading vor mehreren tausend Engländern und unter starker Anteilnahme der gesamten englischen Presse über das Wesen und den Geist des U-Boots-Krieges.
Das gemeinsame Auftreten von Commander Lewis und mir und unsere Erzählungen über „U“-Boote und „Q“-Boote lösten ein in diesem Umfang ganz unerwartetes Echo aus. Hunderte von englischen und deutschen Zeitungen brachten ausführliche Schilderungen über unsere Begegnung im Kriege und das jetzige Wiedersehen. In weit überwiegender Anzahl sprachen die englischen Zeitungen in sympathischer und anerkennender Weise über meinen Besuch und den Vortrag. Meine „Presse“ war gut, wie man zu sagen pflegt, und da man ja im allgemeinen nach dem Erfolg urteilt, kann man wohl daraus schließen, dass mein Entschluss, die Mission zu übernehmen, richtig war.
Selbstverständlich gab es auch missvergnügte oder missverstehende Leute in beiden Ländern. In England holten unbelehrbare Zeitungsleser die „Lusitania“-Affäre und die „Hospitalschiffe“ wieder hervor und glaubten damit die Wirkung meines Besuches abschwächen zu können. In Deutschland witterten einige Leute Morgenluft. Ein U-Boots-Kommandant als Friedensredner, das war ja Wasser auf die Mühle ihrer Politik, „Frieden und Versöhnung um jeden Preis“! Auch hier das tief bedauerliche Fehlen jeglicher politischen Instinkte. Meine Aufgabe in England war ja klar und eindeutig, eine Darstellung des Wesens und der Seele des deutschen U-Boot-Krieges zu geben, und der Zweck, eine Atmosphäre besseren Verstehens zwischen beiden Nationen zu schaffen. Aber so mancher Deutscher kann sich ja keinen Reim machen, wenn es um eine allgemeine deutsche Sache geht, an der seine „Partei“ keinen besonderen Anteil hat.
Mein Besuch in England hatte noch eine andere und unerwartete Wirkung.
Meine Kriegserfahrungen und Erlebnisse habe ich während des Krieges jeden Tag nach Ort und Stunde genau in einem offiziellen Kriegstagebuch niedergelegt, wie es für alle Boote vorgeschrieben war. Hiervon wurden, wie von den Tagebüchern aller anderen Boote auch, mehrere Abschriften angefertigt für den Führer der U-Boote, den Flottenchef, den Admiralstab usw. Ein Exemplar meines Kriegstagebuches ist in meinem Besitz geblieben. Nebenher konnte ich während des Krieges und nach dem Kriege noch viele Aufzeichnungen machen, so dass ich fast lückenlose Einzelheiten über meine Kriegsfahrten besitze.
Gleich nach dem Kriege wurde ich mehrfach aufgefordert, meine Erlebnisse zu veröffentlichen. Aus verschiedenen Gründen habe ich das damals nicht getan. In dem Deutschland der ersten Nachkriegsjahre schien kein ehrliches Interesse dafür zu sein, von den Erlebnissen derjenigen zu hören, die heiß um die Freiheit des Vaterlandes gekämpft und gelitten hatten. Man hatte eine neue, andere „Freiheit“ gefunden und sonnte sich in der Erwartung eines baldigen, behaglichen Schlaraffenlebens. Inzwischen ist das erste Jahrzehnt nach dem Kriege vergangen und hat nicht alle Erwartungen erfüllt. Man ist wieder ernster geworden und wagt heute zuweilen schon, herzhaftere Lektüre in die Hand zu nehmen.
Eine andere Erscheinung ist, dass es heute heranwachsende Jugend gibt, die vom Kriege keine Vorstellung hat und gerade deswegen wissen will, warum die Väter gefallen sind, gegen wen sie gekämpft haben, und letzten Endes, warum denn eigentlich Deutschland heute in die zweite Linie unter den großen Nationen der Erde gedrückt worden ist.
Es ist schwer zu sagen, ob die jüngste Fülle in Kriegsromanen, Theaterstücken aus den Schützengräben und sonstiger Kriegsliteratur ein zufälliges Zusammentreffen ist mit dieser Erscheinung, oder ob es geschäftstüchtige Journalisten sind, welche dies Bedürfnis der heutigen Jugend rechtzeitig erkannt haben. Es ist manches Gute unter den letzten Kriegsbüchern, namentlich dann, wenn sie von Männern geschrieben wurden, welche den Krieg in vorderster Reihe mit durchgekämpft haben. Auch sind Kunstwerke dabei, soweit man nur den Stil des Geschriebenen und die Macht der Schilderung betrachtet. Aber am besten lassen sich heute Kriegsbücher verkaufen, welche nicht vom „Heldentum“ sprechen und nicht den Mut und den Patriotismus derjenigen beschreiben, die täglich und stündlich dem Tode ins Auge sahen, weil sie das einfach als ihre vaterländische Pflicht betrachteten, sondern solche Bücher, die das ganze Kriegsgeschäft als aufreizend und beschämend für diejenigen ausmalen, die gezwungen waren, daran teilzunehmen, ganz gleich, welches Motiv sie beseelt haben mag.
Hierin liegt eine große Gefahr, gerade auch für unsere Jugend. Gewiss ist es gut, wenn die Völker zum Frieden angehalten werden, was zweckmäßigerweise mit dadurch geschieht, das; man ihnen auch die Schrecken eines Krieges deutlich vor Augen führt. Der letzte Krieg hatte wirklich davon mehr als genug und brachte Leiden auf Leiden über die Völker wie noch kein anderer. Aber, wenn die Welt fortfährt, das „Problem Krieg“ nur unter diesem einen Gesichtswinkel zu betrachten, werden wir sehr bald eine neue Generation haben, die nicht nur den Krieg an sich verachtet, sondern auch aufhört, diejenigen zu verehren, welche 1914 bis 1918 für ihr Land gekämpft haben und für feine Freiheit gefallen sind.
Kein vernünftiger Mensch redet heute dem Kriege das Wort. Im Gegenteil, auch wir, die wir den Krieg kennen und durch seine Schrecken gegangen sind, sind ehrlich genug, für den Frieden einzutreten, wo immer das mit Würde geschehen kann. Niemand wehrt sich dagegen, der neuen Generation eine ehrliche Schilderung unserer Kämpfe zu geben. Sie hat einen Anspruch darauf und soll alles wissen und mit uns erleben, auch die Schrecken und das Grauen, aber sie soll auch wissen, dass die Freiheit das höchste Gut eines Volkes ist, das die höchsten Opfer verlangt. Eines Tages können solche Opfer von uns Deutschen wieder gefordert werden. Ein wahrer Friede kann nur durch ein freies Volk errungen werden.
Jetzt, nach meinem Besuch in England, bin ich wieder gefragt worden, ob ich nicht meine Kriegserlebnisse veröffentlichen wolle. Diesmal habe ich zugestimmt. Es ist in den letzten Jahren viel „gedichtet“ worden über den Krieg. Wir U-Boots-Fahrer sind keine Poeten, aber wir haben wirklich etwas erlebt und haben etwas zu erzählen aus einer anderen, fremdartigen, unterseeischen Welt, in der wir im „Schützengraben“ lagen. Möge die neue Generation das erringen, worum wir vergeblich gestritten haben!
Die Begriffe „Pflicht“ und „Opfer“ drohen aus der Ideologie unseres Volkes zu verschwinden. Pflichten haben wir zuerst gegen uns selbst. Wenn wir diese erfüllen, sind wir wahrhaft friedfertig und ein nützliches Mitglied unseres Vaterlandes.
Ohne Opfer kann kein Mensch und kein Volk sich entwickeln. Die deutsche Jugend soll daher stets der Inschrift am Ehrenmal der im Weltkriege gefallenen Studierenden der Berliner Universität gedenken:
„INVICTIS — VICTI — VICTURI.“
1 Die Deutschen werden gewinnen, wenn wir diese Verluste stoppen und bald stoppen!
Das Meer ist Schicksal und Gesetz
ie Welt um uns ändert sich, die Natur bleibt. Sie ist ewig und mit ihr das Meer. Seit undenklichen Zeiten wehen die Stürme von West nach Ost und von Ost nach West. Menschengenerationen kommen und gehen. Das Meer bleibt, ewig unfassbar in seiner unendlichen Weite.
Der Seefahrer ist heute Kämpfer wie vor Tausenden von Jahren.
Das Schiff änderte seine Gestalt, das Meer blieb, wie es war. Die weißen Segel verschwanden, der Sturm nicht. Die Küsten wurden befeuert und sinnreiche Signale erfunden. Das Meer blieb frei und stark und spottete aller menschlichen Erfindungen und Künste. Ungezählte Schiffe wirft es alljährlich an den Strand. Besiegen lässt es sich nicht. Kämpfen muss, wer es befahren will.
Die Geschichte lehrt, dass Landkriege tiefe Umwälzungen in Ländern und unter Völkern verursachen können. Noch nach Jahrhunderten sind ihre Wirkungen zu spüren. Das Meer kennt keine Eroberung. Es lässt sich nicht halten und organisieren. Es verwischt alle Spuren und ist jeden Tag so neu und unberührt, wie von Anbeginn.
Auch der Landkrieg selbst hat sich in seinem Wesen ständig gewandelt. Wäre heute noch ein Zug denkbar wie der Alexanders des Großen? Ein Eroberungszug, der durch nie gesehene Länder bis an den Indus führte und die Soldaten sechs Jahre ihrer hellenischen Heimat fern hielt? Würde es heute ein Napoleon noch wagen, nach Ägypten zu greifen oder nach Moskau zu marschieren?
Ganz anders der Seekrieg. Sein Element ist ewig und unveränderlich. Das Meer fordert gebieterisch sein Recht. Ist heute Freund und morgen Feind. Immer unberechenbar, launisch und gewalttätig. Bestenfalls neutral, aber in seiner Ungewissheit doch immer Feind. Alle Seekriege haben daher von jeher einen gemeinsamen Zug. Die Waffen und ihre Anwendung wechselten. Aber die Grundlage blieb, „die Wechselwirkung zwischen Meer, Schiffen, Menschen und Völkern“1.
Das Meer ist das Schicksal.
m 8. Dezember 1914 unterlag das deutsche Kreuzergeschwader unter dem Grafen Spee den starken aus der Heimat beorderten englischen Schlachtkreuzern bei den Falklandsinseln. Eine fast nebensächliche Aufgabe — die Zerstörung der englischen Funkstation in Port Stanley — sollte so im Vorbeifahren mit erledigt werden. Die Engländer lagen im Hafen beim Kohlen und wussten nichts von der Nähe der deutschen Schiffe. Unser Admiral kam in schwerem Wetter ums Kap Horn, um sich nach der Heimat durchzuschlagen. Auch ihn hatte keine Nachricht vor der Berührung der Falklandsinseln gewarnt. Wäre er aus Sicht der Inseln geblieben, so hätte keiner vom anderen erfahren, und die englischen Schiffe hätten wochenlang vergeblich nach den Deutschen im Südatlantik gesucht. Ahnungslos steuerten die beiden Kreuzer „Gneisenau“ und „Nürnberg“ die im Morgengrauen aus dem Ozean auftauchenden Inseln an. Welche Gedanken mag Graf Spee gehabt haben, als er dann auf Grund der Meldungen seiner Späher die Lage erkannte?
Der Übermacht der modernen englischen Schlachtkreuzer, die, einen Tag vorher von England kommend, in Port Stanley eingelaufen waren, war er mit seinen älteren Schiffen nicht gewachsen.
Näher und näherer wuchsen die Dreibein-Masken der schweren englischen Schiffe wie das Schicksal selbst hinter den deutschen Schiffen über den Horizont. Der Kampf begann — und das Meer blieb neutral. Kein Nebel und kein Sturm warf sich den Engländern entgegen. Keine schützende Regenbö nahm die Deutschen in ihre verhüllenden und rettenden Arme. Bei Kap Coronel einen Monat vorher standen die englischen Schiffe wie scharfe Silhouetten gegen den roten Abendhimmel und erleichterten den Deutschen das Schießen. Wind und See fuhren in jener Nacht mit rauer Hand durch die englischen Reihen und vollendeten den deutschen Sieg. Um die Falklandsinseln war das Meer kalt und still am 8. Dezember.
Die deutschen Schiffe sanken wie ihre englischen Gegner bei Kap Coronel mit wehender Flagge in die Tiefe.
Das Meer ist das Schicksal.
anz im Gegensatz zu Landkriegen sind Seekriege fast immer Wirtschaftskriege gewesen. Aber im Altertum war die Welt noch klein, und der Ozean brandete aus unbekannter Ferne an die Küsten des Abendlandes. Eine lange Zeit blieb er für die Menschheit ein geheimnisvolles und unergründliches Rätsel. Was mochte hinter jener Ferne liegen, da, wo Himmel und Erde zusammenfließen? Welche Geheimnisse verhüllten die im Abendrot brennenden Wolkenberge am Horizont?
Die Erde ist doch rund, grübelte man im Mittelalter. Also muss ein Schiff auf dem Ozean, wenn es sich allzu weit nach Westen vorwagt, notwendigerweise an einen Punkt kommen, wo es „bergab“ fährt. Fantasie und Mystik, Aberglaube und die ersten Anfänge wissenschaftlichen und astronomischen Denkens kämpften miteinander. Dann kam Kolumbus und segelte nach Westen. Er suchte Indien und fand Amerika. Die Welt wurde weit. Das Meer blieb zwar immer noch stürmisch und gefährlich, aber man konnte es doch befahren. Es war keine unüberschreitbare Grenze mehr. Man segelte hinaus und fand eine Insel nach der anderen, schließlich auch das Festland und neue Erdteile.
Die Zeit der großen Kauffahrteiflotten kam herauf und mit ihr Neid und Habsucht. Man rüstete Schiffe aus und bewaffnete sie. Man fuhr aus, um die Handelskonkurrenz zu bekämpfen. So sind der Handel über See und seine Träger, die Kauffahrteischiffe, zu allen Zeiten zugleich Quelle und Objekt der meisten Seekriege der Geschichte gewesen.
Ein altes Gesetz sagt: Handelsschiffe und ihre Ladungen sind im Kriege, auch wenn sie Privateigentum sind, vogelfrei, das heißt, der Wegnahme durch den Feind verfallen. Das gilt auch für Schiffe unter neutraler Flagge dann, wenn sie Konterbande an Bord führen, d. h., wenn sie Ladungen haben, welche dem Gegner direkt oder indirekt zur Unterstützung seiner Kriegführung dienen.
Die ewigen Gesetze des Meeres und diese von Menschen geschaffenen Begriffe über seine „Freiheit“ bestimmten die Lage zur See, als der Weltkrieg 1914 begann. Die „Freiheit der Meere“ war in Wort und Schrift ein bekannter Begriff. Vielleicht gab es Leute, welche wirklich an seine Echtheit geglaubt haben. Hatten sie keine Geschichte gelesen? Das Meer ist in Friedenszeiten frei, in Kriegszeiten frei nur für den Stärkeren. Wenn ein Volk um sein Leben kämpft, macht es das Meer frei für sich selbst.
So erklärten die Engländer die Blockade. Kein Schiff erreichte mehr von außen die deutschen Küsten. Ein Dampfer mit Weizen aus Argentinien war „Konterbande“, ebenso wie ein Bananenschiff von den Azoren. Was galten Begriffe und Bestimmungen! Es war Krieg. Wozu gab es das Seebeuterecht! Man brauchte es nur etwas weiter auszudehnen und richtig anzuwenden. Dann war Deutschland bald ausgehungert. Also die Blockadel Aber es war keine effektive Blockade, wie das Seekriegsrecht sie vorsah, also eine enge Bewachung und Abschließung unserer Küsten und Häfen. Das war gefährlich und schwierig, wenn nicht unmöglich, durchzuführen. England beschränkte sich auf eine Blockadeerklärung und fing im Übrigen jedes Schiff ab, welches durch den Kanal oder nordwärts um Schottland die deutsche Küste zu erreichen versuchte. Tatsächlich hat während des ganzen Krieges kein fremdes Handelsschiff, von Westen kommend, jemals einen deutschen Hafen erreicht. Für Deutschland war die Lage verzweifelt. Wie lange konnte unsere Bevölkerung einen solchen Hungerkrieg aushalten? Kein Mensch wusste ein wirksames Mittel dagegen.
Da brachte der Krieg selbst die Antwort. Eine neue Waffe, das U-Boot, trat auf den Plan. „U 17“ untersuchte am 20. Oktober 1914 vor Norwegen den englischen Dampfer „Glytra“ und versenkte ihn, weil er Konterbande führte. Das, was schon in den letzten Jahren vor dem Kriege in verschiedenen Ländern theoretisch erörtert war, die Verwendung von U-Booten gegen Handelsschiffe, wurde mit einem Schlage Wirklichkeit. Das deutsche U-Boot gegen die englische Hungerblockade! Das war ein praktischer Gegenzug, aber doch nicht das Ergebnis einer schon im Frieden wohl vorbereiteten Überlegung, sondern ein ganz aus sich selbst und spontan hervorbrechender Betätigungswille der neuen Waffe.
Der U-Boots-Krieg begann.
Das U-Boot war 1914 noch unerprobt. Erst 1912 war die Entwicklung des Dieselmotors so weit vorangeschritten, dass an eine Verwendung aus U-Booten gedacht werden konnte. Alle anderen Maschinen hatten sich als kaum brauchbar erwiesen. Deutschland hatte bei Beginn des großen Krieges zwar nicht die größte Anzahl von U-Booten, verglichen mit seinen Gegnern, wohl aber die meisten hochseefähigen U-Boote, die man auch offensiv auf weiten Fahrten verwenden konnte.
Jetzt hieß es, die Leistung der neuen Waffe zu beweisen. Der Dienst auf U-Booten galt als gefährlich. So konnten viele wichtige Versuche, z. B. Tauchen in größeren Tiefen und lange Fahrten bei schwerem Wetter, erst richtig durchgeführt werden, als der Krieg alle Bedenken und Hemmungen beseitigte.
Schon bald nach der englischen Kriegserklärung drang ein deutsches U-Boot in den Firth of Forth ein. Tagsüber beobachtete es durchs Sehrohr die Bewegungen der feindlichen Schiffe. Nachts kam es an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Staunend sahen die deutschen Seeleute englische Kriegsschiffe an sich vorüberziehen wie lautlose Schemen, selbst unsichtbar und wohl verdeckt durch die tiefen Schatten der schottischen Steilküste. Für den Rest der Nacht ging man auf den Grund des Meeres, um der Besatzung Schlaf und Ruhe zu geben. Mitten in Feindesland, umfangen von einer märchenhaften Stille, war das Traum oder Wirklichkeit?
Zuweilen schlugen ferne Geräusche an die stählernen Wände. Leise scheuerte sich das Boot auf dem Meeresboden. Geborgen und unangreifbar. Bis am anderen Morgen die Strahlen der aufgehenden Sonne sich wieder fingen in einem kleinen, aber scharfgeschliffenen Glasspiegel, der sich vorsichtig, sehr vorsichtig über die Meeresoberfläche schob. . . .
Es muss nicht allzu schwer fallen, sich mit etwas Fantasie die Wirkung dieser ersten U-Boots-Berichte auf die Heimat vorzustellen. Kühne Patrouillen hatte es auch schon in anderen Kriegen gegeben. Aber war das denn möglich? Man fuhr einfach mitten hinein in den Feind, beobachtete ihn so genau und solange man Lust hatte und verschwand wieder spurlos von der Bildfläche, wenn man wollte! So einfach und selbstverständlich klingt das alles heute. Und doch waren wir damals sprachlos vor Staunen. Das U-Boot schien todbringend und doch selbst unverletzlich zu sein.
Damit waren die ersten Erfahrungen gewonnen. Die Leistungen der U-Boote gingen sprunghaft vorwärts. Die Fahrten wurden weiter in den Kanal und nordwärts ausgedehnt. England wurde umfasst. Hersing versenkte den englischen Kreuzer „Pathfinder“, das erste durch ein U-Boot vernichtete englische Kriegsschiff, Weddigen die drei englischen Panzerkreuzer „Hogue“, „Cressy“ und „Abukir“. Deutschland wachte auf, und England rieb sich die Augen. Drei große Schiffe auf einmal mit 2000 Menschenleben! Und das alles durch ein kleines Boot mit einer Besatzung von 20 Mann!
Ein U- Boot konnte also nicht nur beobachten, sondern auch schlagen und vernichten! Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der ganzen Welt. Der „Daily Telegraph“ schrieb dazu am 23. September 1914:
„Man fragt vielleicht, ob es klug war, sich überhaupt mit der Unterseebootwaffe abzugeben. Als vor mehr denn 100 Jahren der große Kriegsminister etlichen Versuchen mit einer Art Torpedo zusah, bemerkte der damalige Erste Lord der Admiralität, Earl St. Vincent:
„Pitt ist der größte Narr, den es je gab, weil er die Schaffung eines Kampfmittels ermutigt, das diejenigen, die die See beherrschen, nicht brauchen und das, wenn es erfolgreich wäre, sie ihnen rauben könnte.“
Was wiederum beweist, dass es immer Leute gegeben hat, deren seherische Erkenntnis ihrer Zeit weit vorauseilt.
Aber es gab auch Verluste bei uns. „U 13“ und „U 15“ kehrten nicht zurück. Das letztere Boot wurde beim Angriff von der „Birmingham“ gerammt, wie später die Engländer bestätigt haben. „U 13“ blieb spurlos verschollen. Es liegt irgendwo auf dem Grunde des Kanals, zerschmettert, wie so viele seiner späteren Kameraden. Für abergläubische Leute war der Verlust von „U 13“ ein böses Vorzeichen.
Weddigen ereilte bald darauf das gleiche Schicksal. Ein englisches Linienschiff schnitt sein Boot in zwei Teile. Der Bug bäumte sich noch einmal hoch auf unter der tödlichen Verwundung und zeigte die in großen weißen Buchstaben aufgemalte Nummer „U 29“. Damit wusste die englische Admiralität viele Wochen früher als wir, welch großen Gegner sie vernichtet hatte.
Und doch war der Glaube an die Zukunft der U-Boote unerschütterlich. Das U-Boot war aus einem unbekannten und unheimlichen technischen Instrument zu einem lebendigen Wesen geworden. In den Flussmündungen der Deutschen Bucht lag die schlagfertige Hochseeflotte, personell und materiell zu höchsten Leistungen befähigt. Beide brauchte man nur richtig anzuwenden, um unseren Feinden erfolgreich zu trotzen. Aber wie Tirpitz am Schluss seiner Erinnerungen sagt: „Das Deutsche Volk hat die See nicht verstanden. In seiner Schicksalsstunde hat es die Flotte nicht ausgenutzt.“ In diesem schlichten Satz liegt eine tiefe Tragik. In unzähligen Landkriegen haben wir Deutschen uns durch Jahrhunderte hindurch gegen Feinde aus allen Seiten gewehrt und behauptet. Wir bauten Schiffe, wir arbeiteten und organisierten. Wir gewannen Kolonien und hatten Handelsbeziehungen über die ganze Erde. Aber eine Flotte ist noch keine Seemacht, auch wenn sie U-Boote besitzt. Erst der Wille eines ganzen Volkes macht sie lebendig.
Wer wie wir U-Bootsfahrer jahraus, jahrein die Gewalt des Meeres gespürt hat, wer sie auf kleinen Booten hat heranrollen sehen, die vom Weststurm gepeitschten gigantischen Seen, wer hörte, wie sie mit harter Faust an die Inseln und Felsen der englischen Westküsten mahnend und aufrüttelnd schlugen, der versteht den tiefen Sinn, der in der Natur des Meeres liegt. Es hat manche Großmächte gegeben ohne Seemacht und ohne Seegeltung. Eine Weltmacht wird nur, wer das Meer versteht. Das Meer ist Schicksal und Gesetz. Wer es missachtet, muss büßen.
Das erste im großen Kriege war die Absperrung Deutschlands von jeder Zufuhr durch die englische Blockade. Kein Paragraph des von allen Seemächten anerkannten Seekriegsrechtes erlaubte England, neutrale Schiffe mit Nahrungsmitteln oder anderen nicht für die Kriegführung bestimmten Ladungen auf dem Wege nach Deutschland mit Gewalt anzuhalten. England begann als erster den Krieg zu führen nicht gegen die deutschen Heere und Flotten, sondern gegen das deutsche Volk und seine Nichtkämpfer, die Frauen und Kinder.
Das zweite war die deutsche Antwort. Wir erklärten ein Sperrgebiet um England und sandten unsere U-Boote hinaus, um die feindliche Blockade zu brechen und dem feindlichen Handel zu schaden. Auge um Auge, Zahn um Zahn!
Was hätte wohl in unserer Lage ein großes Seevolk wie die Engländer mit seinen U-Booten gemacht! Es hätte sie kämpfen lassen für Englands Freiheit bis zum letzten Boot. Den Wert diplomatischer Noten kannte man aus alter Erfahrung. Man wusste mit ihnen umzugehen. Eine Sage wäre in England um die U-Boote entstanden, eine Sage, die berichtet hätte von einem hohen und tapferen Geist ihrer Besatzungen und einer klaren und klugen Führung durch die verantwortlichen Führer der Nation.
Dass unsere Flotte diesen Geist in sich trug, zeigen Hunderte von Beispielen. Der nur schwach armierte Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm“ behauptete sich unter Thierfelders Führung fast neun Monate lang im Atlantischen Ozean und fügte dem englischen Handel schweren Schaden zu. Der Geist der „Emden“ und ihres kühnen Kommandanten von Müller spukt noch heute an den Küsten Indiens. Ganz auf sich selbst gestellt, streiften die deutschen Hilfskreuzer „Möwe“„ und „Wolf“ über ein Jahr durch alle Ozeane und brachten reiche Beute heim. Es war derselbe Geist, welcher Admiral Scheer in der Skagerrakschlacht mit seiner schwächeren Flotte zweimal in das Herz der englischen Schlachtlinie vorstoßen ließ.
Wir Seeleute kannten das Meer und fühlten seine Kraft in uns. Sie hätte uns befreien können, wenn wir gewollt hätten.
Das sind die Wurzeln und Anfänge des letzten großen Krieges auf dem Meer. Nicht wie sie sich in den Köpfen von Staatsmännern oder Politikern nach langem Grübeln und Studieren der Akten und Weißbücher ergeben, sondern wie sie das vom Meereswind geöffnete Auge des deutschen Seemannes sieht.
Man hat viele Bücher über den U-Boots-Krieg in allen Staaten geschrieben. Sie forschen nach dem Ursprung der Ereignisse und den Beweggründen der handelnden Staatsmänner. Das, was in diesem Buche niedergeschrieben ist, kommt nicht vom grünen Tisch oder aus den Tiefen wissenschaftlicher Forschung. Es ist das Bild, wie es sich dem deutschen Seemann blitzartig bei Beginn des großen Kampfes enthüllte und wie es heute noch unverändert steht, es sind die Erlebnisse deutscher U-Bootsfahrer im Kampf um Licht und Luft und Freiheit.
Das Meer ist das Schicksal. Über allem steht sein Gesetz. Wer das Meer kennt, liebt seinen Sturm und seine pfadlose Weite.
1 A. Meurer: Seekriegsgeschichte in Umrissen 1925.
Der Seehund
pril 1915. Lärm und Bewegung an der U-Boots-Brücke in Wilhelmshaven.
Ein frischer Wind lässt Flaggen und Wimpel auswehen, dass sie knattern.
Grau in Grau spannt sich der friesische Himmel weit über den Deich. Es riecht nach Nordwest. Böen fegen wie Schatten über den Hafen, jagen Spritzer gegen Bollwerk und Schiffe, singen in Masten und Wanten und werfen sich mit verdoppelter Kraft weit draußen auf das grüngelbe Wasser der Jade.
An den Brücken liegen dichtgedrängt die U-Boote. Ein Netz von starken Stahlleinen spannt sich über ihre grauen Leiber. Zornig rüttelt der Wind an den Booten, schiebt sie vor und zurück, dass die Korksender ächzen und knarren zwischen ihren rostigen Flanken.
Kaum sind die Linien der Boote richtig zu unterscheiden in dem Durcheinander von Stagen und sich kreuzendem Tauwerk, Von Laufplanken, Stangen und weitgeöffneten Luken. Nur die Türme der Boote heben sich wuchtig heraus und zeigen an ihren Reihen trotziger Nietköpfe, dass es draußen und in der Tiefe des Meeres noch ganz andere Kräfte auszuhalten gibt.
Etwas schüchtern, wie immer im Leben, wenn man vor einer neuen Situation steht und unbekannten Menschen und Dingen entgegengeht, frage ich mich durch nach „U 22“, dem Boot, auf welchem ich mich heute als Wachoffizier melden soll. Vieles ist mir fremd und unverständlich, und doch erfüllt mich eine große und freudige Spannung. Endlich ein ernsthaftes Kommando! Endlich etwas Handfestes. Ein U-Boot, das nicht wartet, bis der Feind es aus den Flussmündungen holt. Endlich die freie See und der Feind!
Deprimierend war die letzte Zeit auf „Kaiser Barbarossa“ gewesen, einem alten Linienschiff des fünften Geschwaders, welches bei Kriegsausbruch aus dem „Kirchhof“ in Kiel wieder herausgeholt wurde, wo es schon seit Jahren zu altem Eisen gelegt zu sein schien. Monat für Monat hatten wir mit den anderen Schiffen des Geschwaders geübt und evolutioniert. Aber aus einem alten Kasten kann man auch beim besten Willen kein modernes Schlachtschiff machen. Wir unternahmen „kühne“ Fahrten in die Ostsee bis über Gotland hinaus und demonstrierten und blufften die Russen, so gut es ging. Aber im Stillen wunderten wir uns über ihre Lauheit. Sie hätten nur ein paar wirklich moderne Schiffe hinausschicken sollen, um uns einmal richtig anzufassen. Dann wäre es bald mit unserem veralteten fünften Geschwader vorbei gewesen.
Oder wir lagen als Vorposten wochenlang im Schutz der Elbsände vor Anker. Auch kein Vergnügen bei den Dezemberstürmen der Nordsee. Eines Tages waren feindliche U-Boote in der Deutschen Bucht gemeldet. Das ganze Geschwader geriet in Aufregung, und wir suchten uns die Augen aus nach dem bösen Feind. Plötzlich um 7 Uhr in der Frühe — es schneite etwas, und gerade schimmerten undeutlich die Elbufer aus der Dämmerung — Alarm!! Ich stürze auf meine Gefechtsstation, schon kracht direkt über mir eins der 15 cm-Kasemattgeschütze.
„Feindliches U-Boot vier Strich an Steuerbord!“





























