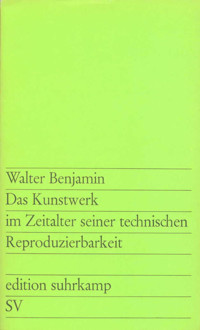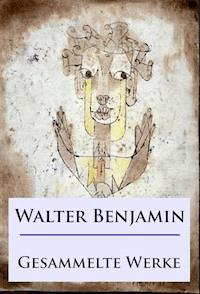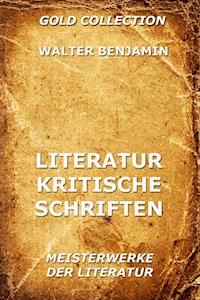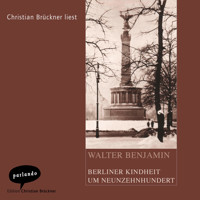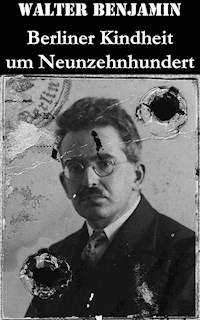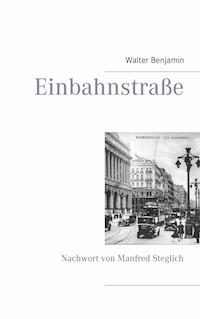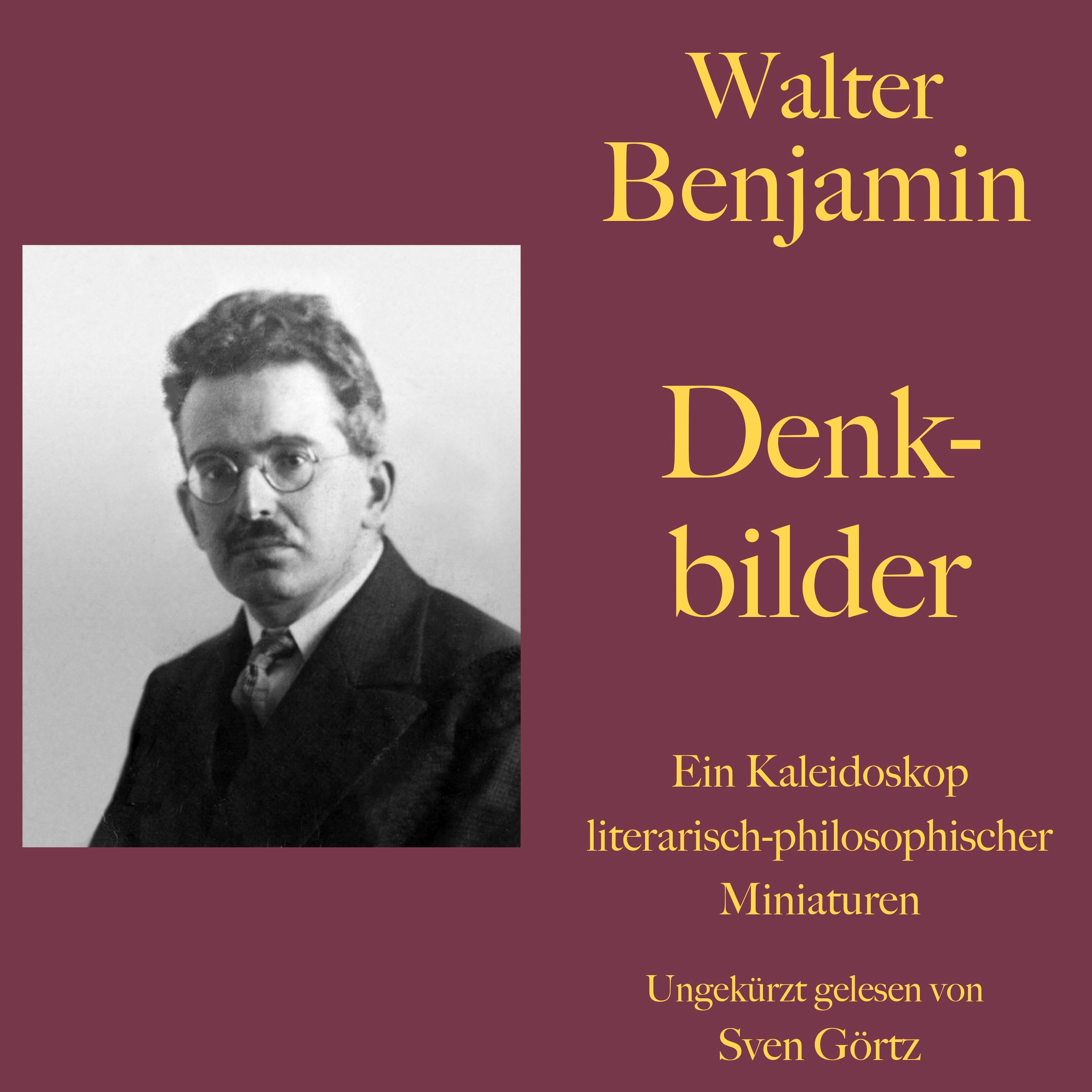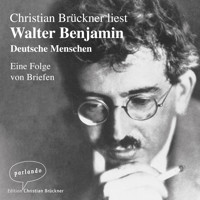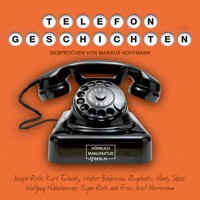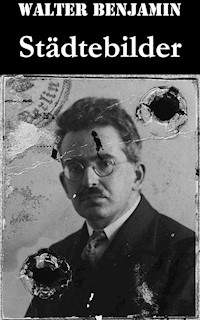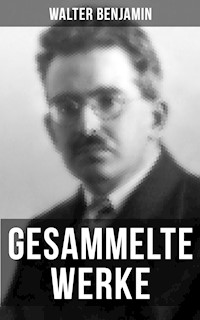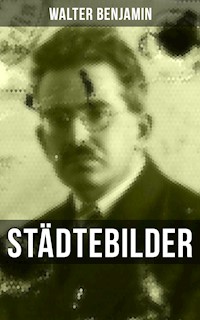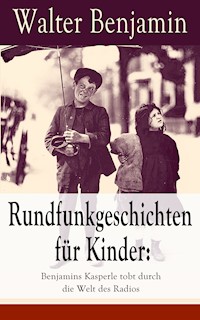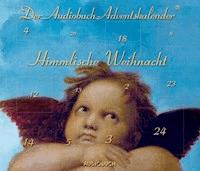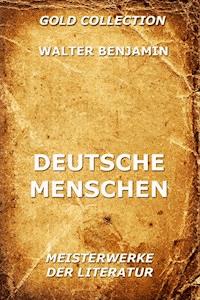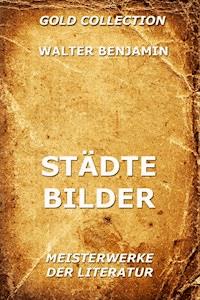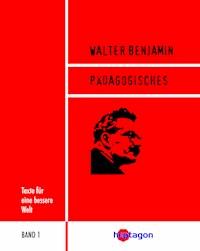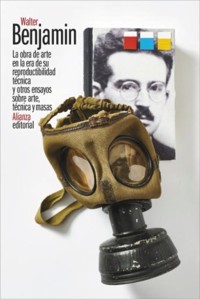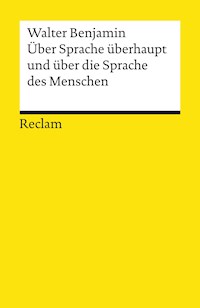
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Eines der wichtigsten und gleichzeitig dunkelsten Werke Walter Benjamins (1892–1940): In seinem kurzen Text über die Sprache verbindet er jüdisch-theologische Vorstellungen mit denen Johann Georg Hamanns (1730–1788) sowie eigenständigen sprachphilosophischen Überlegungen und versucht dabei nichts weniger als eine sprachphilosophische Begründung jeder Philosophie: Es geht um den Zusammenhang von schöpfendem und benennendem Wort. Der Text wird in dieser kritischen Ausgabe neu kommentiert und durch ein Nachwort zusätzlich entschlüsselt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Walter Benjamin
Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen
Herausgegeben von Fred Lönker
Reclam
2019 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961473-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019601-4
www.reclam.de
Inhalt
[7]Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen (1916)
[9]Jede Äußerung menschlichen Geisteslebens kann als eine Art der Sprache aufgefasst werden, und diese Auffassung erschließt nach Art einer wahrhaften Methode überall neue Fragestellungen. Man kann von einer Sprache der Musik und der Plastik reden, von einer Sprache der Justiz, die nichts mit denjenigen, in denen deutsche oder englische Rechtssprüche abgefasst sind, unmittelbar zu tun hat, von einer Sprache der Technik, die nicht die Fachsprache der Techniker ist. Sprache bedeutet in solchem Zusammenhang das auf Mitteilung geistiger Inhalte gerichtete Prinzip in den betreffenden Gegenständen: in Technik, Kunst, Justiz oder Religion. Mit einem Wort: jede Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache, wobei die Mitteilung durch das Wort nur ein besonderer Fall, der der menschlichen, und der ihr zugrunde liegenden oder auf ihr fundierten (Justiz, Poesie), ist. Das Dasein der Sprache erstreckt sich aber nicht nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung, der in irgendeinem Sinn immer Sprache innewohnt, sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles. Es gibt kein Geschehen oder Ding weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen geistigen Inhalt mitzuteilen. Eine Metapher aber ist das Wort »Sprache« in solchem Gebrauche durchaus nicht. Denn es ist eine volle inhaltliche Erkenntnis, dass wir uns nichts vorstellen können, das sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt; der größere oder geringere Bewusstseinsgrad, mit dem solche Mitteilung scheinbar (oder wirklich) verbunden ist, kann daran nichts ändern, dass wir uns völlige [10]Abwesenheit der Sprache in nichts vorstellen können. Ein Dasein, welches ganz ohne Beziehung zur Sprache wäre, ist eine Idee; aber diese Idee lässt sich auch im Bezirk der Ideen, deren Umkreis diejenige Gottes bezeichnet, nicht fruchtbar machen.
Nur soviel ist richtig, dass in dieser Terminologie jeder Ausdruck, sofern er eine Mitteilung geistiger Inhalte ist, der Sprache beigezählt wird. Und allerdings ist der Ausdruck seinem ganzen und innersten Wesen nach nur als Sprache zu verstehen; andererseits muss man, um ein sprachliches Wesen zu verstehen, immer fragen, für welches geistige Wesen es denn der unmittelbare Ausdruck sei. Das heißt: die deutsche Sprache z. B. ist keineswegs der Ausdruck für alles, was wir durch sie – vermeintlich – ausdrücken können, sondern sie ist der unmittelbare Ausdruck dessen, was sich in ihr mitteilt. Dieses »Sich« ist ein geistiges Wesen. Damit ist es zunächst selbstverständlich, dass das geistige Wesen, das sich in der Sprache mitteilt, nicht die Sprache selbst, sondern etwas von ihr zu Unterscheidendes ist. Die Ansicht, dass das geistige Wesen eines Dinges eben in seiner Sprache besteht – diese Ansicht als Hypothesis verstanden, ist der große Abgrund, dem alle Sprachtheorie zu verfallen droht,1 und über, gerade über ihm sich schwebend zu erhalten ist ihre Aufgabe. Die Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen und dem sprachlichen, in dem es mitteilt, ist die ursprünglichste in einer sprachtheoretischen Untersuchung, und es scheint dieser Unterschied so unzweifelhaft zu sein, dass vielmehr [11]die oft behauptete Identität zwischen dem geistigen und sprachlichen Wesen eine tiefe und unbegreifliche Paradoxie bildet, deren Ausdruck man in dem Doppelsinn des Wortes λόγος gefunden hat. Dennoch hat diese Paradoxie als Lösung ihre Stelle im Zentrum der Sprachtheorie, bleibt aber Paradoxie und da unlösbar, wo sie am Anfang steht.
Was teilt die Sprache mit? Sie teilt das ihr entsprechende geistige Wesen mit. Es ist fundamental zu wissen, dass dieses geistige Wesen sich in der Sprache mitteilt und nicht durch die Sprache. Es gibt also keinen Sprecher der Sprachen, wenn man damit den meint, der durch diese Sprachen sich mitteilt. Das geistige Wesen teilt sich in und nicht durch eine Sprache mit – das heißt: es ist nicht von außen gleich dem sprachlichen Wesen. Das geistige Wesen ist mit dem sprachlichen identisch, nur sofern es mitteilbar ist. Was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, das ist sein sprachliches Wesen. Die Sprache teilt also das jeweilige sprachliche Wesen der Dinge mit, ihr geistiges aber nur, sofern es unmittelbar im sprachlichen beschlossen liegt, sofern es mitteilbar ist.
Die Sprache teilt das sprachliche Wesen der Dinge mit. Dessen klarste Erscheinung ist aber die Sprache selbst. Die Antwort auf die Frage: was teilt die Sprache mit? lautet also: Jede Sprache teilt sich selbst mit. Die Sprache dieser Lampe z. B. teilt nicht die Lampe mit (denn das geistige Wesen der Lampe, sofern es mitteilbar ist, ist durchaus nicht die Lampe selbst), sondern: die Sprach-Lampe, die Lampe in der Mitteilung, die Lampe im Ausdruck. Denn in der Sprache verhält es sich so: Das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache. Das Verständnis der Sprachtheorie hängt davon ab, diesen Satz zu einer Klarheit zu [12]bringen, die auch jeden Schein einer Tautologie in ihm vernichtet. Dieser Satz ist untautologisch, denn er bedeutet: das, was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, ist seine Sprache. Auf diesem »ist« (gleich »ist unmittelbar«) beruht alles. – Nicht, was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, erscheint am klarsten in seiner Sprache, wie noch eben im Übergange gesagt wurde, sondern dieses Mitteilbare ist unmittelbar die Sprache selbst. Oder: die Sprache eines geistigen Wesens ist unmittelbar dasjenige, was an ihm mitteilbar ist. Was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, in dem teilt es sich mit; das heißt: jede Sprache teilt sich selbst mit. Oder genauer: jede Sprache teilt sich in sich selbst mit, sie ist im reinsten Sinne das »Medium« der Mitteilung. Das Mediale, das ist die Unmittelbarkeit aller geistigen Mitteilung, ist das Grundproblem der Sprachtheorie, und wenn man diese Unmittelbarkeit magisch nennen will, so ist das Urproblem der Sprache ihre Magie. Zugleich deutet das Wort von der Magie der Sprache auf ein anderes: auf ihre Unendlichkeit. Sie ist durch die Unmittelbarkeit bedingt. Denn gerade, weil durch die Sprache sich nichts mitteilt, kann, was in der Sprache sich mitteilt, nicht von außen beschränkt oder gemessen werden, und darum wohnt jeder Sprache ihre inkommensurable einziggeartete Unendlichkeit inne. Ihr sprachliches Wesen, nicht ihre verbalen Inhalte bezeichnen ihre Grenze.
Das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache; dieser Satz auf den Menschen angewandt besagt: Das sprachliche Wesen des Menschen ist seine Sprache. Das heißt: Der Mensch teilt sein eignes geistiges Wesen in seiner Sprache mit. Die Sprache des Menschen spricht aber in Worten. Der Mensch teilt also sein eignes geistiges Wesen (sofern es [13]mitteilbar ist) mit, indem er alle anderen Dinge benennt. Kennen wir aber noch andere Sprachen, welche die Dinge benennen? Man wende nicht ein, wir kennten keine Sprache außer der des Menschen, das ist unwahr. Nur keine benennende Sprache kennen wir außer der menschlichen; mit einer Identifizierung von benennender Sprache mit Sprache überhaupt beraubt sich die Sprachtheorie der tiefsten Einsichten. / Das sprachliche Wesen des Menschen ist also, dass er die Dinge benennt.
Wozu benennt? Wem teilt der Mensch sich mit? – Aber ist diese Frage beim Menschen eine andere als bei anderen Mitteilungen (Sprachen)? Wem teilt die Lampe sich mit? Das Gebirge? Der Fuchs? – Hier aber lautet die Antwort: dem Menschen. Das ist kein Anthropomorphismus. Die Wahrheit dieser Antwort erweist sich in der Erkenntnis und vielleicht auch in der Kunst. Zudem: wenn Lampe und Gebirge und der Fuchs sich dem Menschen nicht mitteilen würden, wie sollte er sie dann benennen? Aber er benennt sie; er teilt sich mit, indem er sie benennt. Wem teilt er sich mit?
Ehe diese Frage zu beantworten ist, gilt es noch einmal zu prüfen: Wie teilt der Mensch sich mit? Es ist ein tiefer Unterschied zu machen, eine Alternative zu stellen, vor der mit Sicherheit die wesentlich falsche Meinung von der Sprache sich verrät. Teilt der Mensch sein geistiges Wesen durch die Namen mit, die er den Dingen gibt? Oder in ihnen? In der Paradoxie dieser Fragestellung liegt ihre Beantwortung. Wer da glaubt, der Mensch teile sein geistiges Wesen durch die Namen mit, der kann wiederum nicht annehmen, dass es sein geistiges Wesen sei, das er mitteile, – denn das geschieht nicht durch Namen von Dingen, also [14]durch Worte, durch die er ein Ding bezeichnet. Und er kann wiederum nur annehmen, er teile eine Sache anderen Menschen mit, denn das geschieht durch das Wort, durch das ich ein Ding bezeichne. Diese Ansicht ist die bürgerliche Auffassung der Sprache, deren Unhaltbarkeit und Leere sich mit steigender Deutlichkeit im folgenden ergeben soll. Sie besagt: Das Mittel der Mitteilung ist das Wort, ihr Gegenstand die Sache, ihr Adressat ein Mensch. Dagegen kennt die andere kein Mittel, keinen Gegenstand und keinen Adressaten der Mitteilung. Sie besagt: im Namen teilt das geistige Wesen des Menschen sich Gott mit.
Der Name hat im Bereich der Sprache einzig diesen Sinn und diese unvergleichlich hohe Bedeutung: dass er das innerste Wesen der Sprache selbst ist. Der Name ist dasjenige, durch das sich nichts mehr, und in dem die Sprache selbst und absolut sich mitteilt. Im Namen ist das geistige Wesen, das sich mitteilt, die Sprache. Wo das geistige Wesen in seiner Mitteilung die Sprache selbst in ihrer absoluten Ganzheit ist, da allein gibt es den Namen, und da gibt es den Namen allein. Der Name als Erbteil der Menschensprache verbürgt also, dass die Sprache schlechthin