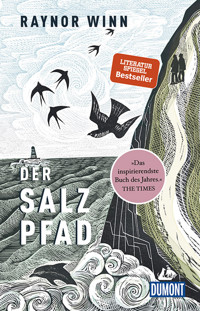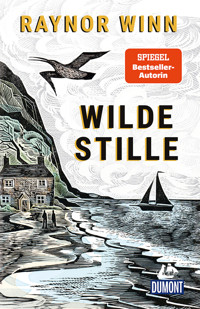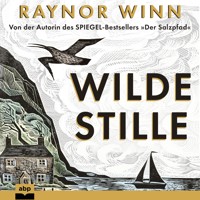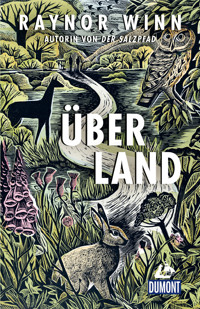
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mairdumont GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: DuMont Welt - Menschen - Reisen E-Book
- Sprache: Deutsch
Mit den E-Books der DuMont Welt - Menschen – Reisen sparen Sie Gewicht im Reisegepäck und können viele praktische Zusatzfunktionen nutzen!
Das E-Book basiert auf: 1. Auflage 2022, Dumont Reiseverlag
Die Geschichte von Raynor und Moth geht weiter: Nachdem sie Haus und Hof verloren hatten und den über 1000 Kilometer langen South West Coast Path gewandert waren, fanden sie in einer Farm in Wales eine neue Heimat. Moths Gesundheit stabilisierte sich, die Farm zu neuem Leben zu erwecken, war Herausforderung und Glück zugleich. Doch Stillstand ist keine Option für die beiden und so brechen sie erneut zu einer großen Wanderung auf, die sie erst durch das schottische Hochland und dann durch die schönsten und wildesten Landstriche Englands führt. Die Umstände sind andere als vor ein paar Jahren, doch die Fragen an das Leben, Raynors Glaube an die heilende Wirkung der Natur und die Liebe zwischen ihr und Moth sind geblieben. Ein Buch, das Mut macht!
Tipp: Setzen Sie Ihre persönlichen Lesezeichen an den interessanten Stellen und machen Sie sich Notizen… und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen Volltextsuche!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© Raynor Winn 2022
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe: Dumont Reiseverlag, Ostfildern
Alle Rechte vorbehalten
Die englische Originalausgabe ist 2022 unter dem Titel »Landlines« bei
Michael Joseph, Penguin Random House, London, erschienen.
Übersetzung: Heide Horn, Christa Prummer-Lehmair und Rita Seuß
Lektorat: Patrick Schär, Berlin
Gestaltung: Anja Linda Dicke, Berlin
Illustrationen Innenteil: Shutterstock.com/Yoko Design
Umschlagillustration: Angela Harding, Rutland (UK)
eBook: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG, Köln, www.ppp.eu
ISBN 978-3-616-03187-3
Zitatnachweis
S. 6: E. M. Forster, Zimmer mit Aussicht, übersetzt von Werner Peterich, Goldmann Verlag, München 1992; S. 13: John O’Donohue, Benedictus. Das Buch der irischen Segenswünsche, übersetzt von Giovanni und Ditte Bandini, Pattloch Verlag 2009; S. 55: Nan Sheperd: Der lebende Berg, herausgegeben von Judith Schalansky, übersetzt von Judith Zander, Einführung von Robert Macfarlane, Matthes & Seitz, Berlin 2020; S. 199: Seamus Heaney, »Moorland«, aus dem Zyklus »Eine Tür ins Dunkel«, in Ausgewählte Gedichte, übersetzt von Giovanni Bandini und Ditte König, Hanser Verlag, München 1995; S. 259: Simon Armitage, »Nicht was du machst, was es mit dir macht«, in Zoom! Gedichte, übersetzt von Jan Wagner, Berlin Verlag, Berlin 2011; S. 271: Philip Larkin, »Pfingsthochzeiten«, in Mich ruft nur meiner Glocke grober Klang, übersetzt von Klaus-Dieter Sommer, Verlag Volk und Welt, Berlin 1988
www.dumontreise.de
Für das Team
»Man suche sich einen Ort, wo man keinen Schaden anrichtet – ja, man suche sich einen Ort, wo man möglichst wenig Schaden anrichtet, dort stelle man sich hin mit allem, was man ist, und gebe sich dem Sonnenschein preis.«
Zimmer mit Aussicht, E. M. Forster
Inhalt
Prolog 8
TEIL 1 Den Kopf einziehen13
TEIL 2 Von Norden55
Der Sheigra Trail: Von Sheigra nach Fort William 68
Der West Highland Way: Von Fort William nach Milngavie 155
Die Borders: Von Milngavie nach Kirk Yetholm 183
TEIL 3 Das Rückgrat199
Der Pennine Way: Von Kirk Yetholm nach Edale 200
TEIL 4 Heartlands271
Pfade, Treidelpfade und der Offa’s Dyke Path: Von Edale nach Chepstow 272
TEIL 5 Nach Süden305
Haupt- und Nebenstraßen: Von Chepstow nach Plymouth 306
TEIL SECHS Tanz des Lichts337
Der South West Coast Path: Von Plymouth nach Polruan 338
Später 346
Danksagung 350
Prolog
Das Wasser stürzt mit solcher Wucht in die Tiefe, dass der dabei entstehende Wind tosenden Lärm und Gischt nach oben trägt, bis ich vom Sprühnebel durchnässt und vom Dröhnen, das von der Bergflanke zurückhallt, wie betäubt bin. Mein Stiefel rutscht auf dem feuchten Stein ab, sodass sich das Gewicht des Rucksacks auf meinem Rücken verlagert und ich Richtung Abgrund schlittere. Ich kann mich gerade noch an einem Felsen festhalten und abfangen, aber eine Steinlawine kullert über die nahezu senkrechte Wand aus triefender Vegetation und verschwindet weit unten in der Schlucht. Zitternd klammere ich mich an den Fels, durchzuckt von Angst, die wie Stromschläge durch meinen Körper geht. Doch als ich ganz kurz nach oben schaue, erblicke ich eine andere Welt: langsam ziehende Wolken an einem blauen Himmel, über den still eine Nebelkrähe gleitet.
Ich hole Luft, atme die grüne Feuchtigkeit ein und wünschte, ich hätte Flügel. Flügel, Seile, irgendetwas, was uns helfen würde, die Falls of Glomach unversehrt zu bewältigen. Es kostet mich eine fast körperliche Anstrengung, meine Gedanken von einem der höchsten Wasserfälle Großbritanniens und von der tiefen Rinne abzulenken, die er in den Fels gegraben hat, doch als mein Blick dem aufwärts führenden schmalen Pfad zwischen den Felsen folgt, weicht die Angst um mich der Angst um Moth.
»Alles klar da oben?«, rufe ich ihm zu, in der Hoffnung, dass er mich über das Rauschen des Wassers hinweg hören kann.
»Nein. Nein, ich schaffe das nicht, ich muss runter. Und du? Bei dir alles okay?«
Ich schaue wieder nach unten, zu dem Wasser und dem Verhängnis, das uns bei einem einzigen falschen Tritt droht. »Ja, alles gut, ich komme jetzt zu dir rauf.«
Ich klettere die rauen, zerklüfteten Felsen hinauf, über Stufen, die so hoch sind, dass ich auf allen vieren kriechen muss. Moth hat sich an die Wand der in einem 80-Grad-Winkel vor uns aufragenden Schlucht gepresst, so eng, wie er es mit dem Rucksack auf dem Rücken vermag, seine Füße füllen die gesamte Breite des Pfades aus, der in die Flanke des Bergs geschnitten ist.
»Ich kann nicht weiter.«
Ich richte mich auf, dicht hinter ihm, da nirgendwo sonst Platz ist. »Wir können nicht zurück.«
Auf dem Cape Wrath Trail durch den Norden Schottlands zu wandern erschien uns machbar, als wir die Tour in einem warmen kornischen Frühling planten, bei Sonnenschein und erblühenden Apfelbäumen. Diese außergewöhnliche Gegend hatte uns fast magisch angezogen; ein Landstrich mit einsamen Bergen, in denen sich Wildtiere tummeln, ein Ort der Schönheit und Abgeschiedenheit. Wir wussten, dass der unbeschilderte Trail ohne schnelle Ausstiegsmöglichkeiten nicht leicht zu bewältigen sein würde, aber das war ja gerade das Reizvolle. Die Momente ehrfürchtigen Staunens in einer dramatischen Wildnis, die wir bis dahin erlebt hatten, waren jeden langen Tag und schwer zu findenden Pfad wert gewesen. Doch als wir uns jetzt an die Wand dieser Schlucht klammern, ganz eingetaucht in die Natur, den Geruch von brackigem Wasser auf der Haut und in der Nase, erscheinen mir die Tage des Pläneschmiedens in Cornwall wie aus einem anderen Leben. Ich kann nur noch daran denken, wie wir hier wieder rauskommen. Und an Moth, dessen lebensbedrohliche Krankheit sich nicht gebessert hat. Trotz all meiner Hoffnungen und all der Kilometer, die wir bereits hinter uns haben, fällt es ihm immer noch schwer, den Rucksack aufzusetzen; er sagt, er habe vergessen, wie man eine Landkarte liest, und leidet jetzt auch noch an einem lähmenden Schwindel.
»Ich glaube, mir wird schlecht.« Moths Gesicht ist grau, als er sich, an einen Blaubeerstrauch geklammert, zu mir umdreht.
»Nein, dir wird nicht schlecht. Denk einfach nicht dran, halte deine Augen auf den Weg gerichtet und geh weiter. Du musst weitergehen.«
Ich bin ganz kraftlos vor Erleichterung, als der Pfad in ein Felsplateau mit einem stillen Wasserbecken mündet. Moth wirft seinen Rucksack, seine Angst und seine durchweichten Klamotten ab und springt hinein.
»Komm rein, alles ist gut, wir sind fast da.«
Wir sind überhaupt nicht »fast da«. Der Pfad windet sich höher und höher, bis er an einer Felsspalte mehr oder weniger verschwindet. Ich habe keine Ahnung, wie wir da weiterkommen wollen. Als ich ihm so beim Schwimmen zusehe – sein dünner, nackter Körper weiß im dunklen Wasser, sein Schwindel gelindert durch das kühle Nass –, entspanne auch ich mich für einen Moment, spüre, wie mein Adrenalinspiegel sinkt und Erschöpfung einsetzt. Was, wenn wir hier nie wieder rauskommen? Ich habe das Bild vor Augen, wie wir für immer und ewig neben diesem Becken kampieren und von Essenspaketen leben, die uns durchziehende Wanderer überlassen. Aber als ich mich zu Moth drehe und ihm von meiner Vision erzählen will, hat er sich bereits angezogen und schultert seinen Rucksack. Vom Becken aus erklimmen wir einen Hang mit rutschigem, nassem Gras, der so steil ist, dass ich, wenn ich die Hände ausstrecke, fast den Boden vor mir berühre. Während ich meine energielosen, nun nicht mehr von Adrenalin gepushten Beine hebe, fange ich allmählich an zu verzweifeln; ich habe kaum noch genug Kraft, um mich von diesem entsetzlichen Ort fortzuschleppen. Ich bin so auf jeden Schritt konzentriert, dass ich nicht sehe, wie er mich überholt, nicht sehe, wie er den Felsblock hinaufklettert, der zu hoch für mich ist. Ich sehe nur seine Hand, die sich mir entgegenstreckt und mich hinaufzieht.
Der Pfad verbreitert sich, aber nur kurz. Er windet sich immer steiler, schmaler und gefährlicher nach oben bis zur Fallkante des Wasserfalls und dann darüber hinaus.
»Schau einfach nicht runter. Wenn wir einen Weg hier heraus entdecken, bevor wir ganz oben sind, nehmen wir ihn.«
Ich lasse seine Hand los und folge ihm, die Augen auf seine Füße gerichtet. In der Felsspalte rinnt das Wasser über einen flacheren grasbewachsenen Hang, bevor es über Steine fast hundert Meter tief hinunterstürzt. Meine Beine gehorchen mir kaum noch, und ich will nur schlafen, aber ich folge ihm durch Wasser, das über glitschiges Gras fließt. Mit jedem Schritt trete ich in seine Spur, und an den kniffligsten Stellen ist immer seine Hand zur Stelle. Dann, endlich, der mattblaue Himmel eines Abends in den Highlands. Ich liege auf einem sonnengewärmten Felsen ohne tosendes Wasser oder kullerndes Geröll um mich herum, nur eine Nebelkrähe kreist über mir.
Wir stellen das Zelt an einer ebenen Stelle zwischen Heidekraut und Moorgras auf, hoch oben auf einem schottischen Hügel, und kaum bin ich drin, breche ich erschöpft zusammen. Zu allen Seiten erstrecken sich die Berge der Highlands in Schattierungen von Blau. Hohe Felsspitzen leuchten noch in den Rosa- und Pfirsichtönen der Dämmerung und umrahmen Moth, der auf dem kleinen Gaskocher Tee kocht und im flackernden Licht der Flammen die Karte liest.
»Morgen geht es die ganze Zeit bergab, ich glaube, das könnte ein leichterer Tag werden.«
Hoffnung erwacht im Abendtau und erhebt sich mit tausend Schnaken hinauf in die milde Luft.
TEIL 1 Den Kopf einziehen
Jetzt heißt es behutsam sein,
Den Kopf einziehen, unauffällig bleiben,
Warten, bis das raue Wetter abzieht.
This is the Time to Be Slow, John O’Donohue
1 Aus einem monotonen Grau treten kaum merklich die Töne einer fahlen Dämmerung hervor und ziehen sich durch den Raum, von ihrer nahezu weißen Quelle bis in die dunkelsten Winkel. Ein Lichtnebel, der in den Morgen kriecht. Ich weiß, dass das Zimmer Farben hat, aber sie sind verhüllt, verwaschen zu Schwarz-Weiß-Schattierungen. Über allem liegt schwer eine undurchdringliche Stille, die ich nicht zu stören wage. Ich schließe die Augen und versinke in dieser Stille, blende das Licht und den neuen Tag aus.
Doch die Dunkelheit bietet mir keine Zuflucht, sie birgt noch die nackte, ungeschminkte Wahrheit der Nacht, und so bin ich gefangen in der Morgendämmerung, zu traurig, um zurück-, und zu ängstlich, um vorwärtszugehen. Das Licht wird heller, es vertreibt das Grau, lässt Formen in gedämpften Farben erahnen und zieht mich in die Unausweichlichkeit des Tages. Langsam bewege ich mich durch das zunehmende Licht, ein grauer Wollpullover kratzt auf meiner kalten Haut, aber als ich leise die Tür etwas weiter öffne, stockt sein Atem. Ich halte inne, reglos, warte darauf, dass die Schrecken der Nacht zurückkehren, doch dann setzt wieder ein leiser Atemrhythmus ein, und ich schlüpfe durch die Tür, hinaus in den Morgen.
Draußen hängt weiß und nass der Nebel. Ich gehe vom Haus zur alten Obstwiese mit ihren knorrigen, sich dunkel abzeichnenden Bäumen, deren flechtenbewachsene Äste vor Feuchtigkeit triefen. Weiter den Hügel hinab verblassen ihre Konturen zu Weiß, bis sie ganz verschwinden und sich in Wasser und Luft auflösen. Der Bach fließt schnell zwischen der hohen Eiche und der Esche am Fuß des Abhangs hindurch, unsichtbar im dicken Nebel, der das Tal bis hinunter zum Flussarm einhüllt. Nur das Plätschern des Wassers deutet darauf hin, wie stark es bei dem Unwetter letzte Nacht geregnet hat. Unser kleiner weißer Hund ist auch irgendwo da unten, jagt Fasanen nach, die flügelschlagend und mit Warnrufen aus dem Unterholz hervorstürzen. Er taucht am verwilderten Rand der Wiese aus dem hohen Gras auf, rundum glücklich, wie seine Körperhaltung verrät; sein Morgen ist bereits ein Erfolg. Die Rehe äsen anscheinend irgendwo anders, vielleicht im Wald unten am Fluss, sonst wären auch sie zwischen den Bäumen hervorgebrochen. Der laute Moment ist vorbei. Als ich die Obstwiese verlasse, verhallt sogar das Plätschern des Baches, und die Stille kehrt zurück in die neblige Luft.
Im Haus kriecht Monty in seinen Hundekorb unter dem Tisch, das lange Fell verfilzt von Nässe und kleinen Zweigen. Er fällt in einen seligen Schlaf, während ich den Kessel aufsetze und Tee koche. Im Haus ist die Stille noch undurchdringlicher als auf der Obstwiese, doch die absolute Lautlosigkeit beruhigt mich, und ich hülle mich darin ein, als ich es mir im Sessel gemütlich mache und der Becher meine Hände wärmt. Die nasse Januarkälte dringt in jede Ritze des Hauses. Ich könnte den Holzofen anmachen, aber von dem Lärm würde Moth aufwachen, der noch im Bett liegt, deshalb schalte ich nur ein kleines Elektroheizgerät ein und kuschele mich in eine Jacke. Vielleicht ist es die Wärme, die sich allmählich in dieser Ecke des Zimmers ausbreitet, oder die beruhigende Wirkung des heißen Tees, aber als die Erinnerungen an die Nacht zurückkehren, wehre ich sie nicht ab, sondern lasse sie zu und betrachte sie aus der Distanz des Morgens.
***
Ich war jäh aus dem Tiefschlaf erwacht und fühlte mich in dem stockdunklen Zimmer desorientiert und verwirrt. Kein Mondlicht drang durch die dünnen Musselinvorhänge, nur die absolute Dunkelheit mitten auf dem Land, wo keine Straßenlaterne die Nacht erhellt und nur das Prasseln des Regens gegen die Scheiben eine Ahnung von den Geschehnissen draußen vermittelt. Doch das Geräusch, das mich geweckt hatte, kam nicht von draußen, sondern aus dem Bett neben mir. Ein rasselndes, keuchendes Luftholen, das beklemmende Geräusch von Luft, die sich durch blockierte Atemwege zwängt. Das ganze Bett bebte von Moths verzweifelten Versuchen zu atmen. Ich schaltete das Licht ein und half ihm, sich aufzusetzen. Sein Gesicht war angstverzerrt, und er war unfähig zu sprechen, kein Wort entrang sich seiner zugeschnürten Kehle.
»Entspann dich, kämpf nicht dagegen an, versuch dich einfach zu entspannen.«
Langsam, ganz langsam ließ der Krampf nach, und seine Atmung normalisierte sich.
»Wolltest du Wasser trinken und hast dich verschluckt?«
»Nein, ich bin aufgewacht und hab keine Luft mehr bekommen … Ich muss aufs Klo.« Auf dem Weg zur Toilette stützte er sich auf mich, weil ihn seine linke Körperhälfte nicht tragen wollte, doch als wir den schmalen Treppenabsatz erreichten, knickten ihm die Beine weg, er stürzte und zog mich mit sich auf den Boden. Eine Weile brachte vor Schreck keiner von uns ein Wort heraus.
»Dann ist es jetzt also so weit.«
»Nein, nein, bei dir wird es nicht so weit kommen, es war nur ein schlechter Moment, das geht vorüber.«
»Verdammt noch mal, Ray, hör mir zu! Ich hab keine Kraft mehr – warum hörst du mir nicht einfach mal zu?«
Wir lagen beide da, ein Knäuel aus Teppich und Pisse, und weinten lautlos, weil das, was passierte, so unendlich traurig war. Die Krankheit, gegen die er so lange angekämpft hatte, schlang, wie es schien, nun doch ihre kräftigen Arme um ihn, aber nicht, um ihn zu umarmen, sondern um ihn zu erdrücken. Wie lange würde es dauern, bis der Moth, den ich kannte, verschwand und er im Endstadium der Krankheit nur noch ein Schatten seiner selbst sein würde, ein Körper, der seine Funktionen aufgegeben hatte?
»Na, zumindest spare ich mir jetzt den Weg zum Klo.« Wie schafft er es nur, auch noch in den schlimmsten Augenblicken zu lachen?
»Versuchen wir lieber gar nicht erst aufzustehen. Sollen wir ins Schlafzimmer kriechen?«
Als wir vom Treppenabsatz auf allen vieren ins Schlafzimmer krochen und er seinen eins achtundachtzig großen Körper mit meiner Hilfe ins Bett hievte, war selbst im Dunkeln klar, dass wir auf einem schmalen Grat zwischen Komödie und Tragödie wandelten und jederzeit abstürzen konnten, und zwar auf die Seite der puren Verzweiflung.
Ich sah zu, wie er langsam zurück in einen tiefen Schlaf sank, dann schaltete ich das Licht aus und lauschte seinen gleichmäßigen Atemzügen. Jetzt war es real. Die Krankheit, von der wir gehofft hatten, sie würde immer auf der Türschwelle bleiben, war hereingekommen: bösartig, finster und sehr präsent. Sie war durch die Tür getreten und hatte das Kommando übernommen, hatte alles Lebendige aus dem Haus geworfen, um Platz für sich selbst zu schaffen. Ein Kuckuck im Nest, der alles zerstörte, was vor ihm dagewesen war.
***
Der frühmorgendliche Nebel steigt hinauf in einen Himmel mit tief hängenden, dichten Wolken. Es sieht nicht nach Regen aus, aber die Sonne wird auch nicht herauskommen: ein kalter, trüber Januartag. Ich werkle leise im Haus herum und lausche ständig, ob sich oben etwas rührt, aber Fehlanzeige. Am frühen Nachmittag wacht er schließlich auf.
»Mir ist schwindlig, und diese Schmerzen tief drin in meinem Kopf …« Die Worte kommen langsam aus ihm heraus, sie sprudeln nicht hervor wie früher, dem Strom seiner sich überschlagenden Gedanken folgend, sondern werden sorgfältig gebildet und zögernd ausgesprochen. Seit die Tage kürzer werden, gibt es diese sich lange hinziehenden Augenblicke zwischen uns, in denen er nach Worten sucht. Augenblicke, die unkommentiert bleiben, unerklärt, es sind nur stumme Momente des Wartens, des Wissens, dass in diesen ungeformten Worten und unausgesprochenen Gedanken eine Welt der Traurigkeit, des Leidens und des Verlusts liegt, die erst noch entdeckt werden muss.
»Ich hab dir Tee gebracht. Möchtest du ihn trinken und dann versuchen aufzustehen? Du fühlst dich bestimmt besser, wenn wir …«
»Nein. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht ständig zwingen.« Das graue Licht des Nachmittags zieht sich langsam zu seiner Quelle zurück und lässt Schatten entstehen, als der Tee nicht mehr dampft und der Raum vor Stille dröhnt.
»Ich tu so, als würde ich leben, dabei wissen wir doch inzwischen beide, dass ich eigentlich gerade lerne zu sterben.«
Am späten Nachmittag rinnt Regen die Scheiben hinunter, die Schatten werden dunkler. Mit genügend Zeit kann man sich darauf trainieren, eine reglose Miene aufzusetzen, die die Emotionen hinter der Fassade nicht verrät. Die glatte Haut, die entspannten Muskeln kaschieren einen gequälten Schrei der Traurigkeit, des Selbstmitleids und der Angst.
»Ich hole frischen Tee. Der hier ist kalt geworden.«
***
Das Tageslicht kehrt zurück, beharrlich, unausweichlich. Der Morgen geht in einen neuen Tag über, dem man sich stellen muss. Ich höre nicht, wie er aufsteht und sich anzieht, ich sehe nur, wie er ohne Hilfe die Treppe herunterkommt.
»Ich habe dich gar nicht aufstehen gehört – du hättest mich rufen sollen.« Fast jeder Morgen beginnt damit, dass ich ihm Tee bringe und ihm dabei helfe, sich aufzusetzen. Ein deprimierender Moment, und es braucht in der Regel eine zweite Tasse Tee, um darüber hinwegzukommen.
»Ich hab’s allein geschafft; im Bett waren so viele Kissen, dass ich sowieso fast aufrecht saß. Ich geh runter zur alten Obstwiese und mache mit dem Schneiden weiter.«
»Was? Warum das denn? Nach so einer Nacht und gestern? Iss wenigstens vorher was.«
»Ich hab keinen Hunger.«
Ich sehe ihm nach, wie er langsam mit unsicheren Schritten zwischen den Bäumen verschwindet, die Säge in der Hand, dicht gefolgt von Monty, der einen Tennisball im Maul hat. So geschieht es fast jeden Morgen im Januar, seitdem wir auf diese Farm mit der uralten Obstwiese gezogen sind. Moth verbringt im Winter so viel Zeit damit, abgestorbene, abgebrochene und vom Obstbaumkrebs befallene Äste von den alten, knorrigen Bäumen abzuschneiden, dass eine fast symbiotische Beziehung entstanden ist – die Bäume brauchen ebenso viel Fürsorge wie ihr Pfleger, um aufrecht stehen und am Leben zu bleiben. Die körperliche Anstrengung, die diese Pflege erfordert, scheint ihn entgegen allen Erwartungen beweglich zu halten, und die Apfelbäume tragen weiter Früchte, obwohl man dachte, ihre fruchtbare Zeit sei bereits vorbei. Allerdings sieht es im Moment so aus, als würden die Bäume den größeren Nutzen ziehen.
Ich bereite einen Imbiss und eine Thermoskanne Tee vor und folge seinen dunklen Fußspuren im nassen Gras zu einem Haufen abgesägter Äste unter den Bäumen. Als ich näherkomme, verstummt das Geräusch der Handsäge, und seine schlanke Gestalt bewegt sich mühsam hinaus auf die offene Wiese. Er hat schon vor Monaten den Appetit verloren und damit auch jeden Gedanken an Essen. Die unvermeidliche Folge waren rascher Muskelabbau und Kraftlosigkeit. Ich öffne die Sandwichbox versiert wie eine Kantinenkraft in der Schule, die sich nicht um Essensvorlieben schert. Ich biete einfach Speisen zum Verzehr an. Fehlt nur noch das blaue Häubchen und die Schürze.
»Käse und Essiggurke.«
»Ich hab eigentlich gar keinen Hunger.«
»Ja, aber du musst trotzdem essen.«
Ich halte ihm die Plastikdose hin, während er seine Handschuhe auszieht. Das Zittern der Hand, die zu dem Sandwich greift, ist jedes Mal, wenn ich mir erlaube, darauf zu achten, deutlicher zu sehen. Er fängt zu essen an, und ich werfe den Ball für Monty.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Dieser Mann, der sein Leben lang Marathons gelaufen und auf Berge geklettert ist, immer der Sonne entgegen, sollte, wenn er ein Sandwich aus einer Dose nimmt, nicht so sehr zittern, dass die Gurke vom Käse fällt. Nicht die Hand, die in den vierzig Jahren unseres wilden, verwickelten Lebens die meine gehalten hat, fest, sicher und so eng mit meiner verflochten, dass ich nicht mehr weiß, wo seine Hand aufhört und meine beginnt. Er zieht die Handschuhe wieder an, kommt unsicher auf die Beine, nimmt die Säge und verschwindet erneut zwischen den Bäumen. Wozu er eigentlich gar nicht mehr in der Lage sein dürfte.
Ich bleibe auf der Obstwiese, setze mich auf einen Baumstamm im nassen Gras und werde von Erinnerungen eingeholt. Erinnerungen an einen Arzt, der auf der Kante seines Schreibtisches saß und uns eröffnete, dass Moth an einer Krankheit litt, für die es weder eine Behandlung noch Heilung gab, einer Krankheit, die mir den Mann wegnehmen würde, den ich schon liebte, seit ich ein Teenager war. Langsam, aber sicher würde sie ihm erst die Fähigkeit rauben, gezielte Bewegungen auszuführen, dann sein Denk- und Erinnerungsvermögen, und irgendwann würde er qualvoll ersticken. Moth muss gar nichts sagen. Als ich ihm zusehe, wie er über die abgesägten Äste im hohen Gras stolpert, weiß ich, was er denkt: dass die Krankheit seit der Diagnose bereits weit fortgeschritten ist und die Zielgerade schon in Sicht kommt. Jeder Erstickungsanfall beim Essen oder beim Einatmen frischer Luft bringt ihn dem Punkt, an dem er aufhören wird zu kämpfen und einfach aufgibt, ein bisschen näher.
Andererseits dürfte selbst dieses von Schwierigkeiten und Schmerzen geprägte Leben inzwischen eigentlich gar nicht mehr möglich sein. Als in dem stillen Behandlungszimmer im Krankenhaus die Diagnose kortikobasale Degeneration fiel, hatte sie etwas Schweres, Endgültiges, Unumstößliches. Diese Krankheit schreitet immer weiter fort, sie bildet sich nicht zurück: ein langsames, unaufhaltsames Lauffeuer der Zerstörung, das sich durch wertvolle Hirnzellen frisst und alle Funktionen lahmlegt, die von ihnen kontrolliert werden.
Moth sägt einen weiteren Ast ab, legt ihn auf den Boden und setzt sich darauf, erschöpft von der Anstrengung, bereit aufzugeben. Ich kehre ins Haus zurück, um meine Handschuhe und eine zweite Säge zu holen. Er soll nicht allein dort arbeiten.
Als ich den Hügel hinaufgehe, sehe ich zwei Silbermöwen auf der Wiese hinter dem Haus. Jeden Winter kommen sie hierher, bleiben mehrere Tage oder auch Wochen und stehen oft stundenlang einfach hier zusammen. Gelegentlich picken sie im Gras nach Larven, meistens jedoch schauen sie nur. Wenn sie sich trennen und unterschiedliche Stellen auf der Wiese ansteuern, kehren sie danach stets zu ihrem Ausgangspunkt zurück, anscheinend zufrieden damit, den Bussard am Himmel zu beobachten oder die Wühlmäuse, die ihre Gänge unter dem Gras anlegen, oder uns, wie wir durch unser Leben gehen. Dann sind sie fort, so plötzlich, wie sie gekommen sind. Hinaus aufs Meer und die Küste entlang, magnetisch angezogen von der salzigen Luft, dem Ruf des Windes und dem weiten Horizont. Sie haben keine Ahnung von Ärzten oder Diagnosen; sie folgen einfach nur den Luftströmen, wissen instinktiv, was sie brauchen und wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen können, wie weit sie ihr Flug auch führen mag.
Ich suche im Schuppen nach den dicken Lederhandschuhen, die ich beim Arbeiten mit Holz benutze, aber ich kann sie nicht finden. Anders als Moth, bei dem alles seinen festen Platz hat, lasse ich sie meistens da liegen, wo ich sie zuletzt benutzt habe. Schließlich entdecke ich sie im Haus, achtlos hinter den Korb mit Brennholz neben dem Bücherregal geworfen. Als ich sie aufhebe, stoße ich einige kleine Bücher mit Kunststoffeinband vom untersten Regalbrett. Wanderführer in andere Welten, zu wilden Orten, entlegenen Bergen und fernen Ufern. Ich stelle sie wieder ins Regal. Einer ist schwerer als die anderen, zwischen den Seiten stecken getrocknete Blätter von Bäumen, Zettel, Sand und Federn, das Papier ist wellig vom Wasser wie ein Sandstrand bei Ebbe. Ich halte das Buch einen Augenblick in der Hand, spüre sein Gewicht, schlinge den schwarzen Haargummi wieder darum, der es zusammenhält. Und für einen Augenblick kann ich das Schlagen der Wellen gegen die Klippen hören und das Salz auf meinen Lippen schmecken. Dann stelle ich auch dieses Buch zurück, nehme die Handschuhe und mache mich auf zur Obstwiese.
Noch bevor ich bei den Bäumen angekommen bin, sehe ich Moth, der bereits wieder auf dem Rückweg zum Haus ist. Er bleibt kurz stehen, um nach Monty Ausschau zu halten, und als er sich zurück zu mir dreht, fällt er um. Er ist nicht gestolpert oder gestrauchelt, sondern einfach umgestürzt wie ein abgestorbener Baum im Sturm. Alles steht still, hält den Atem an, denn die Zielgerade ist näher gekommen und nun deutlich in Sicht. Ich fange an zu rennen, renne zu ihm, doch er schlägt bereits auf dem Boden auf, sein Oberkörper hebt sich noch einmal leicht und fällt dann wieder. Ich stürze zu ihm, halte seinen Kopf, rede mit ihm, schüttle ihn, während Monty den Ball fallen lässt und Moths Arm leckt. Mir schnürt sich die Kehle zu, dass mir das Sprechen schwerfällt, und durch die Tränen in meinen Augen kann ich kaum etwas sehen. Doch als ich zu den beiden Silbermöwen am grauen Himmel hochblicke, die ihre mächtigen Flügel spannen, sich vom Wind leiten lassen, kann ich die salzige Luft förmlich schmecken, die sie ruft.
2 »Hey, du.« Nach ein paar Sekunden, es können auch Minuten gewesen sein, öffnet er die Augen.
Er sieht mich an, als ob ich gar nicht da wäre. In seinen blauen Augen liegt etwas Verschwommenes, was ich so nicht kenne. Seit er mich zum ersten Mal wahrnahm, in der College-Kantine, als er aufsah und quer durch den Raum meinen schüchtern-neugierigen Blick auffing, haben mich diese Augen stets mit einer unbeirrbaren Intensität fixiert. Dieses abwesende, leere Starren und die ruckartigen Bewegungen seiner Pupillen, wenn er seinen Blick zu fokussieren versucht, sind mir neu. Ich habe inzwischen akzeptiert, dass sich sein Gesicht verändert hat, dass sich tiefe Falten eingegraben haben und die Konturen schärfer hervortreten, aber ich dachte, diese Augen würden für immer mir gehören. Diese Augen, die meine Tiefen ausloten und über einen überfüllten Raum hinweg meine Gedanken lesen können. Ich dachte, sie würden die Erinnerungen unserer vielen gemeinsamen Jahre für immer bewahren. Doch diese Augen sind leer, sie sehen nichts als den Nebel, der vom Fluss heraufzieht und nass in der Luft hängt.
»Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht, du musst gestolpert sein.« Monty hebt seinen Tennisball auf und läuft zum Haus. Mit meiner Hilfe kommt Moth auf seine wackeligen Beine, und wir folgen ihm. Während wir langsam den Hügel hinaufgehen, wird der Nebel dichter, hüllt die Mostscheune neben der Straße und die Bäume in seinen feuchten Schleier, bis nur noch die höchsten Wipfel zu sehen sind. Die Straße und die Kurve verschwinden aus unserem Blickfeld, und eine undurchdringliche, regenschwere Wolke folgt uns zum Haus.
»Soll ich den Arzt rufen?«
»Wozu? Der wird nur sagen: ›Das ist der natürliche Verlauf‹, und einen weiteren Punkt auf seiner Liste abhaken.«
»Trotzdem, es könnte auch andere Gründe haben – Blutdruck oder so.«
»Nein, ich werde mich hinlegen.« Er krabbelt auf Händen und Füßen die Treppe hoch, und ich helfe ihm ins Bett. Ich weiß, dass ich mich an Strohhalme klammere. Bei jedem neuen Krankheitsschub suche ich verzweifelt nach einer einfachen Erklärung, einem Etikett, das ich draufkleben kann. Die Ärzte machen es nicht anders. Doch sein Blutdruck bleibt stabil und das Etikett unbeschriftet.
Ich koche Tee und bringe ihn hinauf, aber er schläft schon, also decke ich ihn zu und gehe wieder nach unten. Im Haus ist es kalt, der feuchte Nebel kriecht herein und überzieht den Schieferboden im Flur mit einem rutschigen, glänzenden Film. Ich suche Anzünder und Kleinholz und mache den Holzofen an, die kleinen Scheite aus dem Korb sind trocken und brennen schnell. Meine Hand ist versucht, nach etwas zu greifen, von dem ich lieber die Finger lassen sollte. Während ich weiter Holz nachlege, halte ich die Augen fest auf die Flammen gerichtet und verbiete ihnen, woanders hinzusehen, dabei weiß ich doch genau, dass ich der magnetischen Anziehung nicht widerstehen werde. Als sich die Wärme im Raum auszubreiten beginnt, schließe ich die Ofentür und gebe der Versuchung nach. Ich greife ins unterste Brett des Bücherregals, ziehe den mit einem Haargummi zusammengehaltenen Wanderführer heraus, streiche über seinen welligen Rand und höre dabei, wie die Wellen gegen eine Felsküste schlagen. Ich lege ihn auf den Tisch und ziehe einen anderen heraus, der scharfkantig ist wie die Landschaft, die er beschreibt. Als ich ihn aufblättere, schlägt mir Schwefelgeruch entgegen, derselbe Geruch, der immer noch an den Schlafsäcken und an dem Zelt haftet, die wir auf unserem Islandtrip dabeihatten. Ich lege ihn neben den Wanderführer über den South West Coast Path und zögere. Es sind alte Freunde. Die abgegriffenen, vertrauten Seiten enthalten Wanderungen, die sich im Lauf der Zeit und der Gezeiten und mit den Landschaften, die wir durchquert haben, in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Aber was ich empfinde, ist mehr als das angenehme Gefühl, Abenteuer bestanden und Orte besucht zu haben. Da ist ein aufblitzender Funke, der mich nicht mehr loslässt. Ich wehre mich gegen den Gedanken, der in einer dunklen Ecke meines Gehirns Gestalt anzunehmen droht und bald ebenso hell lodern wird wie die Flammen hinter der Glastür des Holzofens. Ich stelle die Bücher zurück ins Regal, entziehe den Flammen den Sauerstoff, ersticke den Funken. Gib diesem Gedanken keinen Raum, es ist zu spät, diese Zeiten sind vorbei.
***
Das diffuse Morgenlicht ähnelt den grauen Knitterfalten des Kissenbezugs unter meinem Kopf. Moth schlägt langsam die Augen auf und hält meinen Blick fest. Seine Augen sind nicht mehr trüb vom Schlaf, sondern klar und fokussiert, so, wie ich sie kenne: blaue Prismen seiner Leidenschaft und all der Möglichkeiten, die er in sich trägt. Ist es wirklich zu spät? Er zieht seine schmerzende Hand unter der Decke hervor und umfasst mein Gesicht, und als er mich schief anlächelt, sehe ich den Mann von früher vor mir. Einen Mann, der noch vor zwei Jahren durch einen tosenden Gletscherfluss in den Aschefeldern im isländischen Hochland gewatet ist. Und ich sehe dieselbe Energie, die ihn Hunderte Kilometer weit über wilde Landzungen an den westlichsten Rand Englands geführt und bewiesen hat, dass Hoffnung möglich ist, obwohl alle um ihn herum sagten, es gebe keine. Er ist wieder da – aber darf ich es wagen vorzuschlagen, dass wir Luft ins Feuer pusten und den Funken erneut aufflammen lassen? Hat er genug Kraft, um es noch einmal zu probieren?
»Ich glaube, wir sollten es heute Morgen mit einem kleinen Spaziergang versuchen, um uns ein bisschen Bewegung zu verschaffen, was meinst du? Hast du Lust?«
»Ich weiß nicht. Nach gestern habe ich Angst. Was, wenn ich wieder hinfalle?«
»Dann lass uns erst mal frühstücken, und danach gehen wir vielleicht nur den Hügel rauf bis zur ersten Kurve und wieder zurück. Auf der Straße, wo der Untergrund eben ist, nicht auf der Wiese.«
»Vielleicht.«
Die Obstwiese liegt an einer Hügelflanke. In einem versteckten Tal in Cornwall, wo ein kleines Bächlein zu einem schlammigen Flussarm mit seichtem Wasser hinunterfließt, der wiederum einen Fluss speist, dessen Mündung einen Tiefwasserhafen bildet, bevor er schließlich in den Ärmelkanal und ins offene Meer strömt. Steht man oben auf dem Hügel hinter dem Haus, spürt man einerseits festen Boden unter den Füßen, andererseits lockt der ferne Horizont, der nur durch eine Flussschleife verborgen ist. Hier gibt es keine waagerechten Flächen: Sobald man das Haus verlässt, muss man entweder bergauf oder bergab gehen. Bergab ist es leicht, aber dann muss man auf dem Rückweg nach oben. Wenn man zuerst bergauf geht, spart man sich die einfachere Strecke für den Rückweg.
»Dann setze ich mal Wasser auf.«
***
Die Luft ist gesättigt von Feuchtigkeit, als wir unseren langsamen Aufstieg den kurzen, aber steilen Hügel hinauf beginnen. Monty läuft voraus und lässt seinen Ball fallen, um zuzusehen, wie er hinunterrollt, ehe er ohne ihn weiterläuft. Moths Gang ist unsicher, seine Füße treffen in dem vertraut ungleichmäßigen Rhythmus auf den Asphalt: eins … zw-ei, eins … zw-ei, anstatt: eins – zwei, eins – zwei. Seine unbeholfene, einseitige Gehhaltung ist ausgeprägter denn je. Auch wenn ich mich bemühe, nicht daran zu denken, wie steil der Weg ist, bezweifle ich ernsthaft, dass wir die hundert Meter bis nach oben schaffen werden.
»Ich habe mir vorhin den Wetterbericht angesehen, anscheinend ist dieses nasse Wetter bald vorbei, es könnte kälter und freundlicher werden.« Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Versuch ist, Moth vom Aufstieg abzulenken oder mich selbst von der Qual, ihm bei seinem Kampf zusehen zu müssen.
»Wirklich? Fühlt sich nicht so an.«
Nach der Hälfte legen wir eine Pause ein. Moth stützt die Hände auf seine Knie und macht tiefe Atemzüge.
»Sollen wir weitergehen oder willst du zurück?«
»Gehen wir noch hoch bis zu der Kurve, aber das war’s dann, mehr schaffe ich nicht.«
Noch nie habe ich so viele Krähen auf unserer Farm gesehen, ein ganzer Schwarm hat sich in einem Bogen mitten auf der Wiese niedergelassen und pickt im Gras. Da es zu dieser Jahreszeit so wenig zu fressen gibt, warten sie schon begierig darauf, dass die Schafe aufhören, um das Futter zu rangeln, das der Schäfer ihnen hingeworfen hat. Dann können sie sich auf die proteinreichen Pellets stürzen, die im Gras liegen geblieben sind. Krähen sind opportunistische Überlebenskünstler und lassen selten eine Gelegenheit aus, wenn sie ohne viel Mühe etwas zu fressen ergattern können. Ich würde gern als Krähe wiedergeboren werden, denke ich, als wir nach dem steilen Straßenabschnitt endlich das Gatter zur Wiese erreichen und daran gelehnt die graue Landschaft bis hinunter zum Fluss betrachten.
»Wollen wir über die Wiese zurück?« Der Weg über die Wiese führt direkt zu unserem Garten, das ist Montys bevorzugter Nachhauseweg, aber Moth dreht sich um und tritt auf die Straße.
»Nein, gehen wir weiter bis zur oberen Straße und kehren dann um. Der Rückweg ist ja leichter, weil es bergab geht.«
Ich beobachte, wie er sich auf der nun nicht mehr ganz so steilen Straße entfernt, seine Schritte sind langsam und ungleichmäßig. Ich sollte nicht mal daran denken, den Funken anzufachen.
Wir erreichen die obere Straße, die etwas breiter ist als die schmale Landstraße zu unserer Farm. Sie windet sich an einigen verstreut liegenden Häusern und der Kirche vorbei, ehe sie bergab zu einem noch schmaleren Weg verläuft, der von der anderen Richtung zurück zur Farm führt.
»Kehren wir um, das ist jetzt schon zu weit für dich.« Ich nehme seine Hand und wende mich zum Gehen.
»Nur noch bis zur Kirche, dieser ebene Straßenabschnitt ist immer angenehm.«
»Von mir aus. Du kannst dann an der Kirche warten, während ich zurückgehe und dich mit dem Lieferwagen abhole.«
Auf dem flachen Straßenstück öffnet sich der Blick zum Dartmoor in der Ferne, das heute als weiße Wellenlinie am Horizont erkennbar ist. Der Nieselregen und die Luftfeuchtigkeit hier im wärmeren Westen müssen in der kalten Luft des hohen, offenen Moorlands in Schnee übergehen. Er sammelt sich hinter Granitvorsprüngen und bedeckt Grasbüschel und Heidekraut. Es zieht mich förmlich zum Horizont hin. Wegen Corona waren wir so lange auf unsere enge Umgebung beschränkt, dass wir nur in unserer Fantasie in die Ferne schweifen konnten. Aber es ist nicht nur das Eingesperrtsein während des Lockdowns, meine Sehnsucht nach dem weiten Himmel und dem offenen Land ist stets präsent, ist mir ein tiefes, grundlegendes Bedürfnis. Das jetzt, wo Moths Krankheit den Horizont immer näher heranrückt, vielleicht nie wieder erfüllt werden wird.
Wir lehnen uns an die Friedhofsmauer. Ich kehre dem Friedhof den Rücken zu – angesichts von Moths sich immer weiter verschlechterndem Zustand mag ich nicht einmal an die kalte Erde denken, in der wir für immer ruhen werden.
»Wartest du hier? Dann hole ich den Lieferwagen.«
»Nein, machen wir die Runde fertig, ab hier geht es fast nur noch bergab.«
»Aber das ist doch zu weit, du wirst dich überfordern, und dann liegst du wieder tagelang im Bett.« Wenn er sich überanstrengt, kann er vor Erschöpfung oft mehrere Tage weder gehen noch irgendetwas anderes tun.
»Ich möchte weitergehen.«
Wir machen uns wieder auf den Weg. Vorbei am alten Reitstall und den Hügel hinunter, wo das Land steil zum Fluss abfällt und sich oft Seidenreiher, Brachvögel und Graureiher im seichten Wasser tummeln. Die Straße windet sich an den letzten Häusern vorbei, und zwischen den grünen Hügeln kommt hinter einem georgianischen Gutshaus am schlammigen Ufer die Farm wieder in Sicht. Früher einmal stand hier ein Kloster, bewohnt von einer Handvoll Mönche, die wohl die ersten Apfelbäume auf dem Boden pflanzten, auf dem jetzt die Farm steht. Sie lebten ein beschauliches Leben in diesem Tal, bauten Gemüse an, stellten Apfelwein her und nutzten den Fluss. Als die Klöster aufgelöst wurden, zogen sie fort, und das Kloster wurde wieder eins mit dem Hügel, aus dem es hervorgegangen war. Aber Apfelbäume gibt es hier immer noch, sie ziehen sich den steilen Hügel hinauf, der uns die Sicht versperrt.
»Wir hätten an der Kirche umdrehen sollen. Hier ist es viel zu steil für dich.«
Wir stehen an der Kurve, in knöcheltiefem Wasser. Bei trockenem Wetter läuft der Bach unter der Straße hindurch, aber nach einem Unwetter überflutet er den Asphalt und bildet eine Furt aus braunem Wasser und kleinen Zweigen. Von hier steigt die Straße zwischen hohen Hecken an, so steil, dass es im Kopf pocht und einem die Luft wegbleibt – das ist der Haken an unserer gut drei Kilometer langen Runde.
»Schlüpfen wir durch die Lücke in der Hecke und gehen dann über die Obstwiese zurück.«
Ohne hängen zu bleiben, steigt Moth über den kaputten Maschendrahtzaun, und ich reiche ihm Monty hinüber, der sich sofort durch das hohe Gras davonmacht, als Moth ihn auf den Boden stellt. Moth streckt mir die Hand entgegen, und für eine Sekunde wate ich das letzte Stück durch einen eiskalten Fluss in Island, bevor Moth mich an das mit schwarzer Asche bedeckte Ufer zieht, aber das ist jetzt nur noch eine Erinnerung.
Wir bahnen uns unseren Weg durch die Obstwiese, zwischen knorrigen Bäumen und den kegelförmigen Haufen abgesägter Äste hindurch. Als Moth vor drei Jahren anfing, die Bäume zu schneiden, schichtete er diese Äste zu Haufen auf, um sie später zu verbrennen. In denen, die geblieben sind, nisten im Frühling kleine Vögel und erfüllen die Luft mit ihrer Geschäftigkeit und ihrem Gesang. Und so warten die unverbrannten Haufen nun darauf, dass mit den länger werdenden Tagen Leben in das tote Holz zurückkehrt.
Im Haus mache ich Feuer. Monty sitzt vor dem Ofen und leckt sich die nassen Pfoten. Moth sitzt im Sessel daneben, schnürt seine Stiefel auf und hängt seine Socken zum Trocknen auf. Als ich mit Tee aus der Küche zurückkomme, ist Moth eingeschlafen, die langen Beine ausgestreckt, die Arme vor dem Bauch verschränkt, die nackten Füße dampfend in der Hitze. Ich stelle den Tee ab und betrachte Moth von der anderen Seite des Zimmers. Er ist heute eine längere Strecke gelaufen, als ich es für möglich gehalten hätte, also vielleicht, ja vielleicht.
Meine Hände wandern über die Buchrücken auf dem untersten Regalbrett, bis ich das Buch finde, das ich gesucht habe. Es ist sauber, neu und unbenutzt. Ich halte es in der Hand. Ein schmaler Band, es steht nicht viel drin, aber als ich mich neben den Ofen kauere, verheißen die wenigen Worte etwas Großes, Grenzenloses, Freies. Ich blättere durch die ungelesenen Seiten. Vielleicht. Es wäre verantwortungslos, irrational, egoistisch, unfair, ich finde tausend Einwände dagegen, und dennoch tue ich es. Leise, um ihn nicht zu wecken, lege ich das Buch neben seine Teetasse. Dann gehe ich in die Küche und fange an, Kartoffeln zu schälen.
Vielleicht, ja vielleicht.
***
»Vergiss es.« Er steht in der Küchentür, das Büchlein in der Hand. Bedächtig legt er es auf die Arbeitsfläche und wendet sich zum Gehen. »Meine Füße tun richtig weh. Früher waren sie nur taub, aber jetzt habe ich die ganze Zeit Schmerzen, und nach Spaziergängen ist es noch schlimmer.«
»Ich habe gehofft, dass du es gut verkraften würdest, aber eigentlich wusste ich, dass es zu weit ist.«
»Na ja, immerhin hast du den Spaziergang vorgeschlagen.«
»Schon, aber doch nicht so weit.«
»Ich weiß genau, was du vorhast, aber es ist zu spät. Es ist jetzt einfach zu spät, ich spüre, wie die Krankheit die Oberhand gewinnt, als wäre es gar nicht mehr mein Körper. Ich steuere auf das Ende zu, und es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre es nicht so.«
Ich wende den Blick ab, meine Kehle ist wie zugeschnürt, meine Augen brennen. Um mich abzulenken, fülle ich erneut den Kessel. Er geht nach oben, legt sich ins Bett und ist Sekunden später eingeschlafen. Der Schlaf durchdringt inzwischen sein Leben wie der Nebel die Obstwiese, löscht Zeit und Raum aus und raubt ihm seine Energie. Moth besucht die wache Welt nur wenige Stunden täglich und zieht sich bei jeder Gelegenheit wieder daraus zurück.
Seine Wut, Traurigkeit und Frustration sind noch spürbar, als Moth den Raum längst verlassen hat. Ich habe das Gefühl, als würde die Zeit stehen bleiben, als herrschte eine undurchdringliche, eisige Stille, die mich in ihrem Bann hält. Während ich durch das Fenster auf den Regen starre, der sich zwischen dem Haus und den Wellblechschuppen schwallartig ergießt, wird mir klar, dass ich irgendetwas tun muss, um ihm zu helfen, auch wenn man nichts tun kann. Moth hält sich neuerdings an die Empfehlung des Arztes, der uns die Diagnose mitgeteilt hat: »Vermeiden Sie Anstrengungen und passen Sie beim Treppensteigen auf.« Aber diese Akzeptanz fühlt sich an wie der Beginn einer Abwärtsspirale, aus der er nicht mehr herauskommen wird.
Ich gehe nach oben und beobachte, wie er schläft. Das Gesicht auf dem Kissen wirkt nicht wie das eines Sechzigjährigen; seltsam, wie der Schlaf Zeit, Stress, Schmerz und Angst auslöschen kann und den Körper in einen friedlichen, gelösten Zustand versetzt. Außer im Schlaf habe ich sein Gesicht in den Jahren seit der Diagnose nur wenige Male so gesehen. Als er zum Beispiel hinaus aufs Meer blickte, während am fernen Horizont ein Regenvorhang fiel, oder als er auf einem Felsvorsprung stand, mit Vulkanasche auf den Stiefeln und kaltem Wind im Haar. Vielleicht führt dieser Zustand der totalen Entspannung dazu, dass die Krämpfe und Schmerzen, die Dyspraxie und die Schluckstörung verschwinden und sich ein natürliches Wohlbefinden einstellt.
In der Küche nehme ich erneut den Wanderführer zur Hand. Der Cape Wrath Trail. Dreihundertsiebzig Kilometer von der nordwestlichen Ecke Schottlands nach Fort William im Süden. Ein Fernwanderweg, der als der härteste, abgelegenste Trail ganz Großbritanniens gilt. Was denke ich mir eigentlich dabei? Ich will das Buch zurück ins Regal stellen, doch ich kann nicht, die Flamme lodert bereits hell und lässt sich nicht mehr löschen. Bekäme er, wenn wir erneut wandern würden, noch einmal eine Chance? Würde ihn ein weiterer langer Trail von den Fesseln der CBD befreien, wenigstens für eine Weile? Könnte ich ihn dann noch ein bisschen länger behalten?
Aber muss es ausgerechnet dieser sein? Es gibt doch auch leichtere Trails und nicht nur diesen extremen durch die Berge und Moore der wilden Highlands. Ich blättere den Wanderführer durch, betrachte Bilder von Glens und Lochs und kenne die Antwort. Es muss dieser Weg sein, durch die Great Wilderness und in die Rough Bounds von Knoydart. Dort wollte er schon immer mal länger wandern, hatte aber nie mehr als eine Woche Zeit. Wenn es überhaupt einen Wanderweg gibt, der ihn dazu anstacheln kann, es noch einmal zu versuchen, dann dieser. Nein, er ist zu schwierig und zu lang. Das Buch kommt zurück ins Regal, und ich setze mich in den alten Sessel in der Ecke, von dem eine Wolke von Montys Haaren aufsteigt. Ich versuche mich damit abzufinden, nur noch kurze Spaziergänge zu machen und seinen langsamen Niedergang mit Würde und Empathie zu akzeptieren. Vergeblich. Mein Kopf ist schwer, die Traurigkeit lastet auf mir wie ein drückender Schmerz. Ich presse die Finger auf meine Augen, um die Gedanken und Tränen zurückzuhalten, und hoffe, nur Schwärze zu sehen. Doch stattdessen sehe ich unser gemeinsames Leben, es läuft wie ein Videofilm hinter meinen geschlossenen Lidern ab. Moths Gesicht, wie er sich beim Klettern auf einem Sandsteinfelsen in Derbyshire zu mir umdreht, Sonne auf der Haut, Wind in den Haaren; auf irgendwelchen Felsvorsprüngen hoch in den schottischen Bergen; auf Klippen an der Küste und auf Gletschereisfeldern. Ein Gesicht, das vor Erregung und Leidenschaft leuchtet, aber es ist nicht nur die Begeisterung für wilde Gegenden, sondern pure Lebenslust. Es muss der Cape Wrath Trail sein, nur dieser Wanderweg wird ihn dazu bringen, seine Stiefel zu schnüren und auf der Zielgeraden des Lebens noch einmal kehrtzumachen, dem Tod davonzulaufen und ihn auf einen anderen Tag zu verschieben.
***
Ich stehe in einem der Wellblechschuppen und belade eine Schubkarre mit Brennholz, als ich höre, wie das Tor geschlossen wird und er mit Monty den Hügel hinaufgeht. Soll ich ihn begleiten? Was ist, wenn er wieder stürzt? Ich lege die Holzscheite ab und setze mich in Bewegung, doch dann fällt mir ein, dass er heute Morgen noch kein Wort mit mir gewechselt hat und es sicher gesagt hätte, wenn er mich dabeihaben wollte. In all den Jahrzehnten, die wir gemeinsam verbracht haben, haben wir kaum gestritten – da werden wir doch wohl jetzt nicht damit anfangen? Nicht jetzt, wo mir die endlose Leere eines Lebens ohne ihn bevorsteht. Nicht jetzt, wo ich mich fester denn je an ihn klammern möchte.
Während ich die Holzscheite ins Haus bringe, krampft sich mein Magen vor dunkler Angst zusammen. Der Wanderführer über den Cape Wrath Trail liegt wieder auf dem Tisch. Ich habe ihn nicht dort hingelegt. Ich stelle mir vor, wie Moth wütend und traurig den Hügel hinaufgeht, mit dem Gefühl, dass ich ihm nicht zuhöre, wenn er sagt, dass er nicht mehr kann, ihn nicht ausruhen lasse, wenn er sagt, dass er sich nicht rühren kann, nicht akzeptiere, dass er eines Tages sterben wird. Unentwegt kreist in meinem Kopf der Gedanke, wie mitleidlos ich ihm vorkommen muss. Minuten werden zu einer Stunde, und ich weiß nicht, ob meine Sicht verschwimmt vom Regen, der an die Fensterscheibe schlägt, oder von den Tränen, von denen ich rote Augen und ein verquollenes Gesicht bekomme.
Das Tor wird geschlossen und die Haustür geöffnet, Monty springt herein und schüttelt sich, dass das schlammige Wasser an die Wände spritzt, und hinter ihm folgt Moth. Ich kann ihm kaum ins Gesicht sehen.
»Wo bist du denn gewesen? Es tut mir so leid, es tut mir so leid … Es ist nur – ich würde alles tun, um diese Krankheit zu stoppen, alles, damit es dir gut geht.«
»Ich bin nur ein bisschen spazieren gegangen. Ich dachte, wenn wir den Cape Wrath Trail machen, sollte ich zumindest das schaffen, ohne danach drei Stunden zu schlafen.«
»Natürlich können wir den nicht machen. Er ist zu lang und anspruchsvoll, es war dumm von mir, auch nur darüber nachzudenken.«
»Ja, war es, aber der Gedanke lässt sich jetzt nicht mehr aus der Welt schaffen.«
»Sag das nicht, ich zwinge dich nicht dazu.«
»O doch, das tust du.«
3 Kortikobasale Degeneration ist eine seltene und fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die zu Problemen mit der Motorik, der Artikulation, der Kognition und dem Schlucken führen kann und zu einer ganzen Palette weiterer Symptome, die Neurologen für sekundär halten, für den Patienten aber sehr lästig sein können: Sehstörungen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwäche. CBD zu diagnostizieren ist, als wollte man einen Aal in einem Becken mit Seegras fangen. Es gibt keine Tests, mit denen ein Neurologe eindeutig und ohne den Hauch eines Zweifels nachweisen könnte, dass ein Patient CBD hat, er kann lediglich andere Möglichkeiten ausschließen. Mit den verlangsamten Bewegungen, der Steifheit und den Gehproblemen zeigt CBD ähnliche Symptome wie viele andere parkinsonähnliche Erkrankungen, die als Parkinsonismus bezeichnet werden und einige, aber nicht alle Symptome von Parkinson aufweisen. CBD überschneidet sich mit der eigentlichen Parkinson-Krankheit, aber auch mit der progressiven supranukleären Blickparese, mit Alzheimer und weiteren Erkrankungen.
Der Auslöser von CBD ist unbekannt, sie wird jedoch als Tauopathie eingestuft – eine Krankheit, die dadurch hervorgerufen wird, dass sich das Tau-Protein, ein Bestandteil der Nervenzellen im Gehirn, übermäßig anreichert und zu deren Verfall führt. Wir saßen in einem Besprechungszimmer im Krankenhaus, als Moth die Diagnose bekam, hörten uns an, wie der Arzt uns so behutsam wie möglich erklärte, man könne erst post mortem mit Sicherheit ermitteln, ob Moth an dieser schrecklichen Krankheit gelitten habe. Inzwischen weiß ich, dass er das sagte, weil man die Tau-Fasern unter dem Mikroskop betrachten muss, um zwischen CBD-Fasern und beispielsweise Alzheimer-Fasern oder anderen Tauopathien unterscheiden zu können.
Obwohl Moth an vielen typischen CBD-Symptomen leidet, gingen dem Befund jahrelange medizinische Tests und Beobachtungen voraus, mit deren Hilfe andere Krankheiten ausgeschlossen wurden: bildgebende Verfahren, die zeigten, was es nicht war, nicht jedoch, was es war; medikamentöse Behandlungen, die sich als unwirksam erwiesen, wodurch jene Krankheiten, gegen die sie wirksam gewesen wären, ausschieden; die Messung der Nervenleitfähigkeit; Kognitionstests; Analysen über einen längeren Zeitraum hinweg. Doch all diese Dinge sagen dem Neurologen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es sich tatsächlich um CBD handelt. Sie sagen lediglich, was es nicht ist, und grenzen dadurch die Krankheit immer mehr ein, bis irgendwann als die wahrscheinlichste Möglichkeit nur noch CBD übrig bleibt. Jedes Mal, wenn ein Neurologe in das Becken fasst, denkt er, er zieht einen Aal heraus, um dann doch wieder nur Seegras in der Hand zu halten. Wenn man genug Seegras herausholt, bleibt irgendwann nur noch der Aal übrig, doch selbst dann kann es schwierig sein, ihn im braunen, trüben Wasser zu erkennen.
Einer der Tests jedoch war eindeutig. Er verriet uns zwar nicht, welche Art von Aal sich noch in dem Becken befand, ließ aber keinen Zweifel daran, dass dort ein Aal schwamm, und zwar einer, der sich ziemlich deutlich bemerkbar machte. Eine DaTSCAN-Szintigrafie dient dazu, die Dopamin-Rezeptorzellen im Gehirn sichtbar zu machen. Dopamin ist ein chemischer Botenstoff, der Signale zwischen Nervenzellen und Muskeln transportiert. Moths Szintigramm zeigte, dass die Rezeptorzellen – in der Aufnahme als Lichtpunkte zu sehen – deutlich reduziert waren. Seine Lichter gingen ganz offensichtlich aus. Welche Art von Aal noch in dem Becken schwimmt, werden wir vielleicht erst wissen, wenn der Stöpsel herausgezogen wird und das Wasser abläuft, aber in Kombination mit all den anderen Testergebnissen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es CBD ist. Diesen Diagnoseprozess durchläuft jeder, bei dem letztendlich eines der atypischen Parkinson-Syndrome diagnostiziert wird, was nicht mit der eigentlichen Parkinson-Krankheit zu verwechseln ist.
***
Moth litt laut Befund an einer Krankheit, für die es weder eine Therapie noch Heilung gab, und der einzige Ratschlag lautete, Anstrengungen zu vermeiden und beim Treppensteigen aufzupassen. Allerdings erhielten wir diesen Befund in derselben Woche, in der wir unser Haus, in dem wir zwanzig Jahre lang gelebt hatten, aufgrund einer gerichtlichen Räumungsanordnung verlassen mussten und somit obdachlos wurden. Es lag also nicht in unserer Macht, Anstrengungen zu vermeiden, weil wir nicht einmal mehr einen Platz zum Schlafen hatten, und wir konnten auch nicht beim Treppensteigen aufpassen, weil wir keine Treppe mehr besaßen. Und so packten wir unsere Rucksäcke und begannen eine über tausend Kilometer lange Wanderung auf einem nationalen Fernwanderweg, auf dem man so viele Höhenmeter bewältigt, als würde man vier Mal auf den Mount Everest klettern. Eine irrationale, unverantwortliche Entscheidung vielleicht, aber in jenem Moment der Verzweiflung bot sie uns alles, was wir brauchten – ein Dach über dem Kopf in Form unseres Zelts und eine Linie auf der Landkarte, der wir folgen konnten. Die Wanderung gab uns eine neue Richtung, ein Ziel, einen Grund, den nächsten Tag anzupacken, als alle anderen Gründe sich in Luft aufgelöst hatten.
Doch unterwegs ist etwas Merkwürdiges und vollkommen Unerwartetes passiert. Nachdem wir dreihundertzwanzig Kilometer über endlose Landzungen gewandert waren und dabei alles, was wir zum Leben brauchten, auf dem Rücken getragen hatten, begann Moths Gesundheitszustand sich in einem Maß zu verbessern, wie es eigentlich unmöglich sein sollte. Sein Gang wurde fast normal, er konnte klarer denken, sein Kurzzeitgedächtnis wurde besser, und Bewegungen, die ihm zuvor kaum noch möglich gewesen waren, fielen ihm nun leicht. Das hätte nicht sein dürfen. CBD ist eine Einbahnstraße. Moths Körper hätte nicht in der Lage sein dürfen, wie früher ohne fremde Hilfe ein Zelt aufzustellen, einen Rucksack ohne Schmerzen zu tragen, eine Karte zu lesen und tatsächlich an seinem Ziel anzukommen. Sobald bestimmte Schwellen des Krankheitsverlaufs einmal überschritten waren, gab es eigentlich kein Zurück mehr.
In den folgenden Jahren, in denen Moth ein Studium absolvierte und ein sesshafteres Leben führte, ging es mit seiner Gesundheit rapide bergab. Doch dann zogen wir auf die Farm mit der Obstwiese, wo Moth täglich körperliche Arbeit im Freien verrichten musste. Zunächst erholte er sich etwas, sein Gedächtnis wurde besser, sein Körper kräftiger, seine Bewegungen sicherer. Doch mit dem Winter, den Corona-Einschränkungen und dem Lockdown kehrte Stille in unserem Leben ein, und seine Symptome verschlechterten sich zusehends – bis zu dem Augenblick, in dem er umfiel, dem Augenblick, in dem ich neben ihm im Gras kniete, ihn schüttelte und flehte, dies möge nicht das Ende sein.
***
Seitdem wir den Küstenpfad gewandert sind, haben uns Ärzte, Physiotherapeuten und Neurologen kontaktiert und Gründe für die sichtliche Verbesserung seiner Gesundheit geliefert. Physiotherapie ist eine der wenigen Möglichkeiten, um die körperlichen Symptome von CBD zu lindern und mit behutsamen Bewegungen so lange wie möglich eine gewisse Beweglichkeit zu erhalten. Man könnte also sagen, dass diese sehr lange Wanderung nichts anderes war als eine extreme Form der Physiotherapie. Oder vielleicht war die ausgesprochen kalorienarme Ernährung ausschlaggebend, dadurch bedingt, dass wir uns nicht mehr Essen leisten konnten, oder der Aufenthalt in der Natur oder irgendwelche anderen Gründe, die noch nicht berücksichtigt wurden. Was außer Zweifel stand, war das Tempo, mit dem sich sein Zustand verschlechterte, sobald er zu einem sesshafteren Lebensstil zurückkehrte. Die alten Symptome traten noch aggressiver zutage als zuvor.
Eins jedoch sprechen die Ärzte nur äußerst ungern an: dass bei CBD das Ende absehbar ist. Kaum ein Erkrankter lebt länger als acht bis zehn Jahre nach Beginn der Symptome, die meisten weniger. Bei Moth sind es inzwischen vierzehn Jahre, und es geht immer noch weiter.
4 Mit dem Lockdown legt sich eine Lähmung über das ganze Land. Wintertage schleppen sich dahin und werden zu Wochen, es ist fast wie in einem Winterschlaf. Lebensmittel werden aus einem Lieferwagen über die Gartenmauer gereicht, Leute, die ihren Hund ausführen, winken von der anderen Seite der schmalen Landstraße. Alle sind argwöhnisch, unsicher, vorsichtig, während die Zahl der Corona-Toten steigt und wir uns kaum noch über die Obstwiese hinauswagen. Zu Hause liegt der Wanderführer nun ständig auf dem Tisch und strahlt einen schwachen Hoffnungsschimmer aus. Im frühmorgendlichen Dunkel lese ich Blogs von Wanderern, die den Cape Wrath Trail bezwungen haben, Geschichten über Strapazen, widriges Wetter, ausgedehnte Moorflächen und Männer, die das alles mit resignierter und doch stolzer Miene überstehen. Ich gehe die vielen Geschichten noch einmal durch – wo sind eigentlich die Frauen?
An den Abenden schauen wir uns eine Serie von Blog-Beiträgen an, von einem Mann, der den Trail in Begleitung seines treuen Collies in zwei Wochen absolviert. Er filmt sich mit dem Collie an seiner Seite – oder auf seinen Schultern, wenn er durch Flüsse watet, während er gleichzeitig in seine Action-Kamera spricht – und zum Schlafen zusammengerollt in seinem superleichten Zelt, reglos, völlig erschöpft. Ich durchforste das Internet nach einem South-Downs-Way-Wanderführer, in der Hoffnung, Moth für einen leichteren, kürzeren Trail begeistern und meine zunehmenden Schuldgefühle besänftigen zu können. Aber es ist zu spät: Er sieht sich schon in abgelegenen Glens, und egal wie hartnäckig ich versuche, ihm die Vorzüge einer leichteren Wanderung schmackhaft zu machen, es gibt kein Zurück. Er dreht jeden Tag seine Runde und schläft danach nur eine halbe Stunde.
Der Wanderführer beschreibt einen Weg, der weder offiziell festgelegt noch ausgeschildert ist. Einige Seiten lang wird eine Route vorgestellt, doch gleich darauf eine Alternative angeboten oder gar vorgeschlagen, sich selbst einen Pfad zu suchen, wenn Täler durch Überschwemmungen, Waldbrände oder andere Naturkatastrophen unpassierbar sind. Wir brauchen richtige Landkarten, die ein größeres Areal abdecken. Wenn wir vom vorgegebenen Weg abkommen, werden wir in einer Wildnis aus Bergen und Mooren ganz auf uns allein gestellt sein.