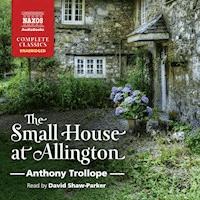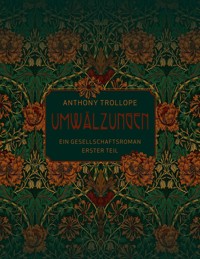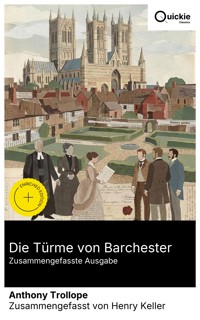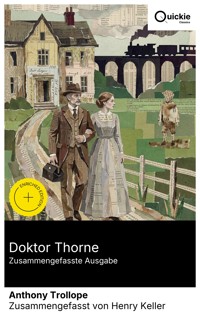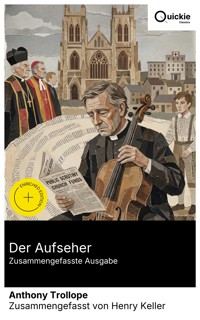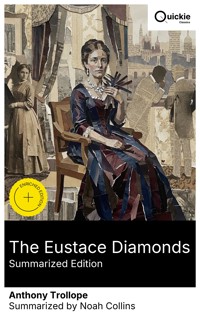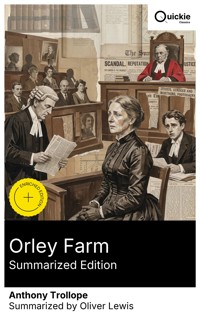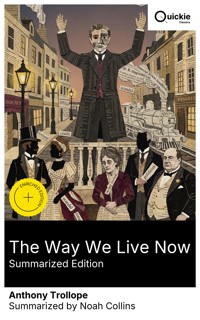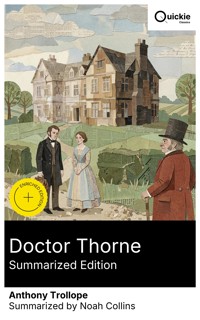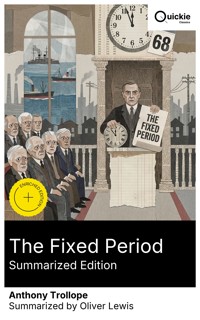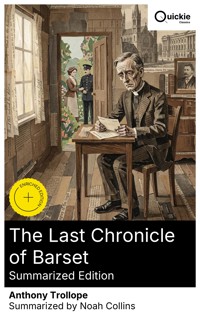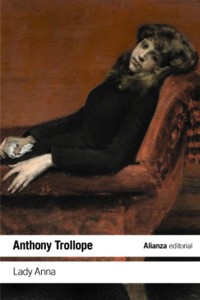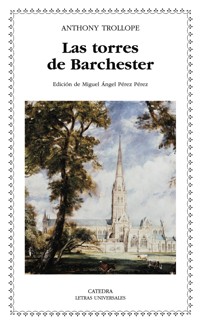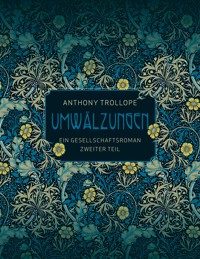
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Umwälzungen
- Sprache: Deutsch
The Way We Live Now / Umwälzungen Zweiter Teil von Trollopes Gesellschaftsroman London 1870. In der Metropole stoßen Gegensätze aufeinander. Verarmende Adelige sehen sich mit aufstrebenden Geschäftsleuten konfrontiert. Skrupellose Emporkömmlinge konkurrieren gegen honorige Kaufleute. Die Männerwelt wird durch selbstbewusste Frauen aufgeschreckt. Mit Witz und Einfühlungsvermögen schildert Anthony Trollope das Aufeinandertreffen zahlreicher Figuren und deren Konflikte und illustriert damit die Gesellschaft seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 881
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Anthony Trollope (1815-1882), einer der erfolgreichsten englischen Schriftsteller, setzte sich in seinen Romanen mit den Umbrüchen seiner Zeit auseinander und entwarf ein differenziertes und hellsichtiges Bild des gesellschaftlichen Lebens in London genauso wie in der Provinz. Seine besten Romane zeichnen sich durch subtile Ironie und unterhaltsame Milieuschilderung aus.
The Way We Live Now / Umwälzungen
London 1870. In der Metropole stoßen Gegensätze aufeinander. Verarmende Adelige sehen sich mit aufstrebenden Geschäftsleuten konfrontiert. Skrupellose Emporkömmlinge konkurrieren gegen honorige Kaufleute. Die Männerwelt wird durch selbstbewusste Frauen aufgeschreckt. Mit Witz und Einfühlungsvermögen schildert Anthony Trollope das Aufeinandertreffen zahlreicher Figuren und deren Konflikte und illustriert damit die Gesellschaft seiner Zeit.
ZWEITER TEIL
Inhaltsverzeichnis
ZWEITER TEIL
KAPITEL LI
KAPITEL LII
KAPITEL LIII
KAPITEL LIV
KAPITEL LV
KAPITEL LVI
KAPITEL LVII
KAPITEL LVIII
KAPITEL LIX
KAPITEL LX
KAPITEL LXI
KAPITEL LXII
KAPITEL LXIII
KAPITEL LXIV
KAPITEL LXV
KAPITEL LXVI
KAPITEL LXVII
KAPITEL LXVIII
KAPITEL LXIX
KAPITEL LXX
KAPITEL LXXI
KAPITEL LXXII
KAPITEL LXXIII
KAPITEL LXXIV
KAPITEL LXXV
KAPITEL LXXVI
KAPITEL LXXVII
KAPITEL LXXVIII
KAPITEL LXXIX
KAPITEL LXXX
KAPITEL LXXXI
KAPITEL LXXXII
KAPITEL LXXXIII
KAPITEL LXXXIV
KAPITEL LXXXV
KAPITEL LXXXVI
KAPITEL LXXXVII
KAPITEL LXXXVIII
KAPITEL LXXXIX
KAPITEL XC
KAPITEL XCI
KAPITEL XCII
KAPITEL XCIII
KAPITEL XCIV
KAPITEL XCV
KAPITEL XCVI
KAPITEL XCVII
KAPITEL XCVIII
KAPITEL XCIX
KAPITEL C
KAPITEL LI
Welcher soll es werden?
Paul Montague fuhr am frühen Montagmorgen von Suffolk nach London zurück, und tags darauf schrieb er an Mrs. Hurtle. Als er in seinem Pensionszimmer saß und über seine Lage nachdachte, wünschte er sich fast, er hätte Melmottes Angebot angenommen und wäre nach Mexiko gegangen. Er hätte sich zumindest bemühen können, das Eisenbahnprojekt ernsthaft voranzutreiben, und es aufgeben können, wenn sich die ganze Sache als Schwindel entpuppt hätte. In einem solchen Fall hätte er Hetta Carbury natürlich nie wiedergesehen, aber welchen Nutzen hatte seine Liebe schon, so wie die Dinge standen – welchen Nutzen für ihn oder für sie? Das Leben, das er sich erträumte, ein Leben in England, so beschaffen wie das von Roger Carbury oder wie das Leben, das Roger führen würde, wenn er eine Frau hätte, die er liebte, schien außerhalb seiner Reichweite. Niemand konnte Roger Carbury das Wasser reichen! Wäre es nicht das Richtige, er würde abreisen und zuvor an Hetta schreiben und ihr raten, den überhaupt besten Mann auf Erden zu heiraten?
Die Möglichkeit einer Reise nach Mexiko stand ihm jedoch nicht mehr offen. Er hatte den Vorschlag abgelehnt und mit Melmotte gestritten. Zudem musste er unverzüglich weitere Schritte wegen Mrs. Hurtle unternehmen. Zweimal bereits hatte er sich in der letzten Zeit mit dem Entschluss nach Islington begeben, diese Dame ein letztes Mal zu treffen. Dann hatte er sie mit dem gleichermaßen festen Vorsatz nach Lowestoft begleitet, dass er dort seine noch bestehende Verpflichtung zu einem Ende bringen werde. Jetzt hatte er versprochen, nochmals nach Islington zu kommen, und wusste genau, dass sie ihn aufsuchen würde, sollte er sein Versprechen nicht halten. Auf diese Weise würde die Sache nie ein Ende nehmen.
Er würde sich wie versprochen erneut dort einfinden, falls sie es immer noch verlangte, aber zunächst würde er herausfinden, ob ein Brief etwas ausrichten konnte – eine schlichte, ungeschminkte Schilderung. Würde eine schlichte, mit der Post zugestellte Schilderung vielleicht doch ausreichend Wirkung zeigen? Seine schlichte Schilderung lautete nun wie folgt:
Dienstag, 2. Juli 1873
Meine liebe Mrs. Hurtle –
ich hatte versprochen, Sie nochmals in Islington aufzusuchen, und das werde ich, wenn Sie es immer noch verlangen. Ich glaube jedoch, dass ein solches Treffen weder Ihnen noch mir einen Dienst erweist. Was soll damit erreicht werden? Ich habe nicht die geringste Absicht, mein Verhalten zu rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen. Als ich Sie auf unserer Reise von San Francisco nach England kennenlernte, war ich bezaubert von Ihrem Esprit, Ihrer Schönheit und Ihrem ganzen Wesen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber die Umstände haben dazu geführt, dass unsere Lebensweise und unser Naturell sich so unterschiedlich entwickelt haben, dass wir einander – davon bin ich überzeugt – in einer Ehe nicht glücklich machen würden. Selbstverständlich lag der Fehler bei mir, aber es ist besser, diesen Fehler einzugestehen und die Schuld auf mich zu nehmen, mitsamt den üblen Folgen, welche es auch sein mögen, zum Beispiel wie der Mann in Oregon erschossen zu werden, als mir bereits bei der Trauung bewusst zu sein, dass eine solche Ehe Leid und Reue nach sich ziehen würde. Sobald ich mir darüber im Klaren war, habe ich Ihnen geschrieben. Ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen für den Schritt, den Sie seitdem unternommen haben, und ich wage es auch nicht. Ich kann jedoch nicht anders, als bei der Entscheidung zu bleiben, der ich damals Ausdruck verliehen habe.
Als ich Sie hier in London traf, haben Sie mich sogleich gefragt, ob ich Gefühle für eine andere Frau empfände. Ich konnte Ihnen nur die Wahrheit sagen. Aber ich wäre nicht von mir aus auf die Veränderung meiner Gefühle Ihnen gegenüber zu sprechen gekommen. Erst nachdem ich beschlossen hatte, meine Verlobung mit Ihnen zu lösen, habe ich diese Frau kennengelernt. Ich habe nicht etwa die Verlobung gelöst, weil ich mich in sie verliebt hatte. Ich habe auch keinerlei Grund zu der Hoffnung, dass meiner Liebe ein glücklicher Ausgang beschieden sein könnte.
Ich habe Ihnen hiermit so genau wie möglich dargelegt, wie mir zumute ist. Wenn es mir irgendwie möglich wäre, Sie für das Leid, das ich Ihnen angetan habe, zu entschädigen – oder sogar Vergeltung dafür zu erleiden – würde ich es tun. Aber welche Entschädigung kann ich leisten, oder welche Vergeltung können Sie üben? Ich glaube, dass ein weiteres Treffen zu nichts führen wird. Falls Sie dennoch meinen Besuch wünschen, suche ich Sie ein letztes Mal auf – weil ich es versprochen habe.
Ihr aufrichtiger Freund
Paul Montague
Als Mrs. Hurtle dies las, fand sie sich in einem Zwiespalt. Was Paul geschrieben hatte, entsprach ganz den Worten, die sie selbst auf einem Blatt Papier notiert hatte, das sie immer noch in ihrer Tasche aufbewahrte. Diese Worte, in Reinschrift auf Briefpapier übertragen, wären die großmütigste und passendste Antwort, die sie geben könnte. Und es verlangte sie danach, großmütig zu sein. Sie hatte sehr wohl das typisch weibliche Verlangen, sich aufzuopfern. Aber das Opfer, das am meisten nach ihrem Geschmack gewesen wäre, hätte anders ausgesehen. Wäre sie ihm begegnet, wie er bankrott und mittellos war, hätte sie mit Freuden alles mit ihm geteilt, was sie besaß. Wäre er ihr als Krüppel, Blinder oder Schwerkranker begegnet, so hätte sie ihm beigestanden und hätte ihn gepflegt und getröstet. Selbst wenn er Schande über sich gebracht hätte, wäre sie mit ihm in irgendein fernes Land geflohen und hätte alle seine Fehler verziehen. Kein Opfer wäre ihr zu groß gewesen, wäre es von dem Gefühl begleitet gewesen, dass er zu schätzen wusste, was sie für ihn tat, und dass ihre Liebe erwidert wurde. Aber es war zu viel von ihr verlangt, sich aufzuopfern, indem sie verschwand und nie wieder von sich hören ließ. Welche Frau konnte solche Selbstaufopferung auf sich nehmen? Nicht nur auf ihre Liebe zu verzichten, sondern auch ihren Zorn – das war zu viel verlangt! Der Gedanke, sie müsse willfährig sein, erschreckte sie. Ihr Leben war nicht sonderlich erfolgreich verlaufen; was sie aus sich gemacht hatte, war jedoch das Ergebnis davon, dass sie es gewagt hatte, sich durch ihren Lebensmut zu behaupten. Und nun sollte sie doch noch kapitulieren und sich wie ein Wurm zertreten lassen? Sollte sie noch schlimmere Schwächlichkeit als eine Engländerin an den Tag legen? Sollte sie ihm gestatten, wie eine Biene die nächste Blüte anzusteuern, nachdem er mit ihrer Liebe sein Vergnügen gehabt hatte, eine »schöne Zeit« erlebt hatte, während ihr die Flügel versengt wurden, sie so schlimm verstümmelt und übel zugerichtet wurde! Hatte sie sich nicht ihr ganzes Leben über gegen ein solches Prinzip des passiven Erduldens gewehrt? Sie nahm das Blatt aus ihrer Tasche und las es durch, und trotz allem spürte sie darin eine typisch weibliche Nachgiebigkeit, die ihr gefiel.
Aber dennoch – sie konnte es nicht abschicken. Sie konnte nicht einmal die Worte in Reinschrift übertragen. Und daher ließ sie all ihren stärksten Gefühlen in die entgegengesetzte Richtung ihren Lauf – denn sie schwankte nun einmal zwischen den zwei Polen. Dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch und schrieb wie folgt rasch ihre spontan aufblitzenden Einfälle nieder:
Paul Montague –
ich habe viel Leid erdulden müssen, doch von allen leidvollen Erfahrungen ist diese die schlimmste und unverzeihlichste – und die erbärmlichste. Mit Sicherheit hat es nie zuvor einen solchen Feigling, nie einen so hinterhältigen Lügner gegeben. Der arme Teufel, den ich getötet habe, war nicht mehr bei Sinnen vor Trunkenheit und tat nur das für Seinesgleichen Übliche. Nicht einmal Caradoc Hurtle hat sich jemals solches Unrecht ausgedacht. Wie ist das doch? Zuerst wollen Sie sich an mich binden durch die feierlichste Verpflichtung, die ein Mann und eine Frau eingehen können, und dann sagen Sie mir – nachdem diese sich auf mein ganzes Leben ausgewirkt hat –, dass sie nicht mehr zählt, weil sie nicht mehr zu Ihrer Sicht der Dinge passt? Nach einigem Nachdenken fällt Ihnen auf, dass Sie es mit einer amerikanischen Ehefrau nicht so bequem haben wie mit einer Engländerin, und daher soll das alles nicht mehr zählen! Ich habe keinen Bruder und keinen männlichen Anverwandten – sonst würden Sie es nicht wagen, das zu tun. Sie können nur ein Feigling sein.
Sie sprechen von Entschädigung! Meinen Sie Geld? Sie wagen es nicht zu sagen, müssen es jedoch meinen. Die Beleidigung ist umso größer. Aber was Vergeltung angeht – Sie sollen Vergeltung erleiden. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass Sie mich – gemäß Ihrem Versprechen – aufsuchen, und Sie werden mich mit einem Folterinstrument in der Hand antreffen. Ich werde Sie foltern, bis mir die Luft ausgeht. Und dann werde ich sehen, was Sie sich trauen – ob Sie mich wegen tätlichen Angriffs vor Gericht zerren.
Ja, kommen Sie. Sie müssen kommen. Und jetzt wissen Sie auch, was Sie erwartet. Ich werde es kaufen, während dieser Brief unterwegs ist, und Sie können sich darauf verlassen, dass ich weiß, welche Art von Waffe genau ich aussuche. Ich verlange von Ihnen, dass Sie kommen. Sollten Sie jedoch Angst haben und Ihr Versprechen brechen, werde ich zu Ihnen kommen. Ich werde dafür sorgen, dass London ein zu heißes Pflaster für Sie wird, und wenn ich Sie nicht vorfinde, erzähle ich meine Geschichte allen Ihren Freunden.
Hiermit habe Ihnen so genau wie möglich dargelegt, wie mir zumute ist.
Winifred Hurtle
Nachdem sie diesen Brief geschrieben hatte, las sie nochmals ihre ursprüngliche kurze Notiz durch und brach dann in bittere Tränen aus. Doch an diesem Tag schickte sie nichts ab. Am folgenden Vormittag schrieb sie einen dritten Brief, und diesen schickte sie ab. Er lautete:
Ja. Komm.
W.H.
Dieser Brief kam rechtzeitig in Paul Montagues Pension an. Er machte sich sogleich nach Islington auf. Er hatte inzwischen nicht mehr den Wunsch, die Begegnung aufzuschieben. Zumindest hatte er ihr gezeigt, dass sein behutsamer Umgang mit ihr, sein Theaterbesuch zusammen mit ihr, der gemeinsame Nachmittagstee bei Mrs. Pipkin und die gemeinsame Reise ans Meer nicht als Anhaltspunkte dafür gedeutet werden konnten, dass er sich Schritt für Schritt erobern ließ. Er hatte seine Absicht in Lowestoft sehr deutlich gemacht – und war auch in seinem letzten Brief sehr deutlich gewesen. Sie hatte ihm im Hotel gesagt, sie hätte ihn erschossen, wenn sie zufällig in diesem Augenblick eine Waffe bei sich gehabt hätte. Sie konnte sich jetzt bewaffnen, wenn sie das wollte, aber seine schlimmste Befürchtung ging nicht in diese Richtung. Ihn schmerzte es, ihr immer wieder sagen zu müssen, dass er entschlossen war, ihr Unrecht zuzufügen. In dieser Hinsicht lag das Schlimmste inzwischen hinter ihm.
Ruby öffnete ihm die Haustür, und sie begrüßte ihn mit einer alles andere als glücklichen Miene. Es war der zweite Vormittag nach dem Abend, an dem sie Hausarrest gehabt hatte, und seitdem war nichts passiert, das ihren Kummer gelindert hätte. Genau in diesem Augenblick hätte ihr Verehrer in Liverpool sein sollen, tatsächlich lag er jedoch in der Welbeck Street im Bett. »Ja, Sir, sie ist zuhause«, sagte Ruby, mit einem Baby auf dem Arm und einem kleinen Kind, das sich an ihrem Kleid festhielt. »Zieh nicht so, Sally. Sagen Sie mir bitte, Sir, ist Sir Felix noch in London?« Ruby hatte unmittelbar am Abend ihres Hausarrests an Sir Felix geschrieben, doch bisher keine Antwort erhalten. Paul war mit den Gedanken bei seinen eigenen Problemen und erklärte, er wisse gegenwärtig nichts über Sir Felix, und darauf wurde er in Mrs. Hurtles Zimmer geführt.
»Sie sind also gekommen«, sagte sie, ohne sich von ihrem Stuhl zu erheben.
»Natürlich bin ich gekommen, das war ja Ihr Wunsch.«
»Ich wüsste nicht, warum Sie es tun sollten. Meine Wünsche scheinen keine große Rolle für Sie zu spielen. Wollen Sie dort Platz nehmen?« sagte sie und wies auf einen Stuhl in einiger Entfernung von ihr. »Sie glauben also, es wäre das Beste, wenn Sie und ich uns nie wieder sehen würden?« Sie war sehr ruhig, aber es schien ihm, als wäre ihre Ruhe nur gespielt und könnte jeden Augenblick in einen aggressiven Gefühlsausbruch umschlagen. Er meinte in ihrem Blick etwas zu sehen, das den Sprung einer Raubkatze ankündigte.
»Davon war ich völlig überzeugt. Was kann ich noch dazu sagen?«
»Oh, nichts, überhaupt nichts.« Ihre Stimme war sehr leise. »Warum sollte ein Gentleman sich die Mühe machen, noch etwas zu sagen, außer dass er seine Meinung geändert hat? Warum ein Theater veranstalten um Kleinigkeiten wie das Leben einer Frau oder das Herz einer Frau?« Sie schwieg für einen Augenblick. »Und nachdem Sie als Folge meines extravaganten Wunsches nun einmal hier sind, sind Sie so klug, nichts zu sagen?«
»Ich bin hier, weil ich es versprochen habe.«
»Aber Sie haben nicht versprochen, etwas zu sagen – nicht wahr?«
»Was würden Sie gern von mir hören?«
»Ach ja, was aber auch. Soll ich so tief sinken, dass ich Ihnen jetzt sage, was ich von Ihnen hören möchte? Nehmen wir einmal an, Sie würden sagen: ›Ich bin ein Gentleman und stehe zu meinem Wort, und ich bereue meine Absicht, niederträchtig und untreu zu sein‹ – glauben Sie nicht, dass Sie auf diese Weise davonkommen könnten? Wäre es nicht denkbar, ich würde antworten, Ihr Herz habe sich von mir abgewandt und daher könne Ihre Hand es ihm gleichtun, und dass ich die Ehe mit einem Mann ausschlagen würde, der mich nicht mehr liebt?« Bei dieser Frage hob sie nach und nach ihre Stimme, richtete sich auf ihrem Stuhl halb auf und beugte sich zu ihm vor.
»In der Tat, das könnten Sie tun«, antwortete er und wusste nicht richtig, was er sagen sollte.
»Ich würde es jedoch nicht tun. Ich für mein Teil will treu bleiben. Ich würde dich nehmen, Paul – auch jetzt noch, in dem Vertrauen darauf, dass ich dich durch meine Hingabe doch noch zurückgewinne. Ich empfinde immer noch Gefühle für dich – nicht aber für diese Frau, die wohl jünger ist als ich, und sanfter, und noch ein Mädchen.« Sie blickte ihn immer noch an, als erwartete sie eine Antwort, doch es konnte darauf keine Antwort geben. »Jetzt, Paul, da du mich verlassen wirst, kannst du mir nicht einen Rat geben, was ich als nächstes tun soll? Ich habe alle Freunde für dich aufgegeben, die ich jemals hatte. Ich habe kein Zuhause. Das Zimmer bei Mrs. Pipkin ist eher mein Zuhause als irgendein Ort sonst in der Welt. Ich kann mich für jeden Ort in der Welt entscheiden, habe aber überhaupt keinen Grund, warum ich einen bestimmten wählen sollte. Ich habe mein Vermögen. Was soll ich damit anstellen, Paul? Wenn ich sterben und von der Bildfläche verschwinden würde, könntest du es gern haben.« Darauf war keine Antwort möglich. Die Fragen wurden gestellt, weil keine Antwort auf sie möglich war. »Wenigstens könntest du mir einen Rat geben. Paul, du bist doch bis zu einem gewissen Grad verantwortlich für meine Einsamkeit – oder etwa nicht?«
»Das bin ich. Aber Sie wissen auch, dass ich Ihre Fragen nicht beantworten kann.«
»Es dürfte dich nicht wundern, dass ich etwas im Zweifel bin über mein künftiges Leben. Soweit ich sehe, bleibe ich am besten hier. Jedenfalls tue ich Mrs. Pipkin einen Gefallen. Sie wurde geradezu hysterisch, als ich gestern davon sprach, ihr Haus zu verlassen. Diese Frau, Paul, würde in meinem Land verhungern, und ich werde in diesem hier todunglücklich sein.« Dann hielt sie inne, und eine Minute lang herrschte völliges Schweigen. »Du fandest meinen Brief wohl sehr kurz?«
»Er sagte vermutlich alles, was Sie sagen wollten.«
»Ganz im Gegenteil. Ich hatte sehr viel mehr zu sagen. Das war der dritte Brief, den ich geschrieben habe. Jetzt sollst du die anderen beiden sehen. Ich hatte drei geschrieben und musste mich entscheiden, welchen ich dir schicken wollte. Ich könnte mir denken, dass deiner an mich sich leichter geschrieben hat als meine drei. Du warst dir nämlich nicht im Zweifel. Ich hatte viele Zweifel. Ich konnte nicht alle drei Briefe zusammen losschicken. Aber jetzt darfst du sie alle sehen. Hier ist einer davon. Vielleicht liest du ihn als ersten. Als ich ihn geschrieben habe, war ich entschlossen, ihn abzuschicken.« Darauf reichte sie ihm den Brief, in dem sie ihm Folter androhte.
»Ich bin froh, dass Sie ihn nicht abgeschickt haben«, sagte er.
»Es war mir ernst damit.«
»Aber Sie haben Ihre Meinung geändert?«
»Steht irgendetwas darin, das dir übertrieben vorkommt? Heraus mit der Sprache.«
»Ich dachte dabei eher an Sie als an mich.«
»Denken wir also an mich. Steht hier irgendetwas, das nicht gerechtfertigt ist durch die Behandlung, die ich zu ertragen hatte?«
»Sie stellen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube jedoch nicht, dass eine Frau, wie sehr sie auch provoziert wurde, zu Folter greifen sollte.«
»Natürlich ist es bequemer für Gentlemen, die sich ihrem Vergnügen hingeben, wenn Frauen dieser Ansicht sind. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Solange es Männer gibt, die für Frauen kämpfen, mag es angehen, das Kämpfen den Männern zu überlassen. Aber wenn eine Frau niemanden hat, der ihr hilft, soll sie dann alles hinnehmen, ohne sich gegen die zur Wehr zu setzen, die ihr übel mitspielen? Soll einer Frau bei lebendigem Leib die Haut abgezogen werden, nur weil es unweiblich ist, wenn sie sich ihrer Haut wehrt? Worin liegt der Sinn, sich typisch weiblich zu verhalten, wie du es formulierst? Hast du dich das gefragt? Ich würde sagen, der Sinn liegt darin, auf Männer anziehend zu wirken. Aber wenn eine Frau feststellt, dass die Männer ihre vorgebliche Schwäche nur ausnutzen, sollte sie sie dann nicht ablegen? Wenn sie schon als Beute eines Raubtiers behandelt wird, sollte sie dann nicht auch kämpfen wie ein Raubtier? Aber nein doch – es ist ja so unweiblich! Ich hatte auch daran gedacht, Paul. Der Charme weiblicher Schwäche hat sich mir in einem schwachen Moment aufgedrängt – und dann habe ich diesen anderen Brief geschrieben. Du kannst sie gern alle sehen.« Und damit reichte sie ihm das Blatt, auf dem sie ihre Notiz in Lowestoft aufgeschrieben hatte, und er las es.
Er konnte es kaum bis zum Ende lesen, weil ihm die Tränen in die Augen schossen. Als er schließlich den Inhalt richtig zur Kenntnis genommen hatte, ging er zu ihr und warf sich ihr zu Füßen auf die Knie und schluchzte. »Ich habe es aber nicht abgeschickt«, sagte sie. »Ich zeige es dir jetzt nur, damit du siehst, was in meinem Kopf vorgegangen ist.«
»Es verletzt mich mehr als der andere Brief«, antwortete er.
»Aber nein, ich wollte dich nicht verletzen – nicht in diesem Augenblick damals. Manchmal könnte ich dich in Stücke reißen, so groß ist meine Enttäuschung, so unbeherrschbar meine Wut! Warum – warum soll ich in dieser Weise zum Opfer werden? Warum sollte mein Leben völlig leer und sinnlos sein, während du alles vor dir hast? Also, jetzt hast du alle Briefe gelesen. Für welchen entscheidest du dich?«
»Ich kann diesen anderen nun nicht mehr als echten Ausdruck Ihrer Meinung werten.«
»Aber das wird er sein, wenn du mich verlassen hast, und er war es, als du mit mir am Meer gewesen bist. Und so waren meine Gefühle, als ich in San Francisco deinen ersten Brief erhalten habe. Warum kniest du hier vor mir? Du liebst mich nicht. Ein Mann sollte aus Liebe vor einer Frau knien, nicht um ihre Vergebung zu erflehen.« Trotz dieser Worte legte sie ihre Hand auf seine Stirn, strich ihm die Haare aus dem Gesicht und blickte ihm in die Augen. »Ich frage mich, ob diese andere Frau dich wohl liebt? Ich will keine Antwort darauf, Paul. Es ist wohl am besten, wenn du jetzt gehst.« Sie nahm seine Hand und drückte sie an ihr Herz. »Noch eine letzte Sache. Als du von – Entschädigung gesprochen hast, meintest du da – Geld?«
»Nein, wirklich nicht.«
»Das hoffe ich – ich hoffe, dass es das nicht war. Also – geh deines Wegs. Winifred Hurtle wird dich nicht mehr belästigen.« Sie nahm den Brief mit der Androhung der Folter und zerriss ihn in kleine Fetzen.
»Darf ich den anderen behalten?« fragte er.
»Nein. Für welchen Zweck würdest du ihn behalten wollen? Als Beweis meiner Schwäche? Auch er soll vernichtet werden.« Aber sie nahm ihn und steckte ihn in ihre Tasche zurück.«
»Leben Sie wohl, liebe Freundin«, sagte er.
»Nein! Diese Trennung verträgt kein Lebewohl. Geh, und zwar ohne ein weiteres Wort.« Und also ging er.
Sobald sich die Haustür hinter ihm geschlossen hatte, läutete sie und ließ Ruby Mrs. Pipkin bitten, zu ihr zu kommen. »Mrs. Pipkin«, sagte sie, sobald die Frau das Zimmer betreten hatte, »zwischen mir und Mr. Montague ist alles aus.« Sie stand aufrecht in der Mitte des Zimmers, und auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln, als sie diese Worte sprach.
»Du lieber Himmel«, sagte Mrs. Pipkin und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich ihn heiraten würde, und daher halte es für angebracht, Ihnen jetzt zu sagen, dass ich ihn nicht heiraten werde.«
»Und warum nicht? – Wo er doch so ein netter junger Mann ist – und auch so ruhig.«
»Was den Grund angeht, so glaube ich nicht, dass ich darüber reden möchte. Aber es ist so. Ich war mit ihm verlobt.«
»Das weiß ich, Mrs. Hurtle.«
»Und jetzt bin ich nicht mehr mit ihm verlobt. Das ist alles.«
»Du liebe Zeit! Wo Sie doch mit ihm nach Lowestoft gefahren sind, und das alles.« Es ging über Mrs. Pipkins Kräfte, nicht noch mehr über solch eine interessante Geschichte zu hören.
»Wir sind in der Tat zusammen nach Lowestoft gefahren und wir sind beide zurückgefahren – aber nicht zusammen. Und so ist es nun einmal.«
»Ich bin sicher, es lag nicht an Ihnen, Mrs. Hurtle. Wenn geheiratet werden soll und dann kommt es nicht dazu, dann liegt es niemals an der Dame.«
»So ist es nun einmal, Mrs. Pipkin. Wenn wir jetzt bitte nicht mehr darüber reden.«
»Und werden Sie jetzt ausziehen, Madam?« fragte Mrs. Pipkin, bereit, sich blitzschnell die Augen mit der Schürze zu wischen. Wo sollte sie einen Logiergast hernehmen wie Mrs. Hurtle – eine Dame, die nicht nur die Qualität des Essens nie in Frage stellte, sondern sogar ständig vorschlug, die Kinder sollten doch einmal auf ihre Kosten ein Dessert zu sich nehmen oder den Rest einer Pastete aufessen, und die seit ihrer Ankunft im Haus nie einen Posten auf einer Rechnung beanstandet hatte.
»Das ist noch kein Thema, Mrs. Pipkin.« Darauf äußerte Mrs. Pipkin in einem Ausmaß ihr Mitgefühl und ihre Hilfsbereitschaft, dass es beinahe den Anschein hatte, sie sei bereit, ihrem Logiergast einen anderen Verehrer an der Stelle des jetzt abgelegten zu verschaffen.
KAPITEL LII
Liebe, Wein und was darauf folgt
An jenem unheilvollen Donnerstag war Sir Felix Carbury um zwei, drei, vier und sogar noch um fünf Uhr im Bett anzutreffen. Mehrmals schlich sich seine Mutter in sein Zimmer, aber jedes Mal stellte er sich schlafend und reagierte nicht, als sie ihn sanft ansprach. Sein Zustand war jedoch derart beschaffen, dass er nur für Augenblicke in oberflächlichen Schlummer fiel. Ihm war schlecht, er fühlte sich von Kopf bis Fuß krank und wund und fand keine bequeme Lage. Als einziger Trost blieb ihm, im Bett liegenzubleiben, durch konsequentes Stillhalten zu versuchen, seine quälenden Kopfschmerzen zu lindern, und daran zu denken, dass er vor einem Angriff der Außenwelt geschützt war, solange er hier lag. Lady Carbury schickte den Hausdiener zu ihm hinauf, und vom Hausdiener ließ er sich wecken. Der junge Mann brachte ihm Tee. Er bat um Brandy Soda, aber das gab es nicht, und in seiner derzeitigen Verfassung wagte er es nicht, seine Umgebung so lange zu schikanieren, bis er für ihn besorgt würde.
Für ihn hielt die Welt nun nichts mehr bereit. Er hatte Vorbereitungen getroffen, mit der großen Erbin des Tages durchzubrennen, und letzten Endes zugelassen, dass die junge Dame ohne ihn durchbrannte. Der Plan hatte vorgesehen, dass die junge Dame zwangsläufig ihre lange Reise über den Atlantik antreten musste, bevor sie herausfinden konnte, dass er seine Verabredung nicht eingehalten hatte. Melmottes Feindschaft hatte er durch den Versuch auf sich gezogen, mit der Dame durchzubrennen, die der Dame durch das Versäumnis der Verabredung. Zudem hatte er sein ganzes Geld verspielt – und ihres dazu. Er hatte seine mittellose Mutter dazu gebracht, ihm bei der Beschaffung von Geld behilflich zu sein, und selbst dieses Geld war weg. Er war so verunsichert, dass er sich sogar vor seiner Mutter fürchtete. Zudem konnte er sich an einen Streit im Klub erinnern, allerdings nur vage – aber dennoch mit dem sicheren Gefühl, dass der Streit von ihm ausgegangen war. Ach – wann würde er wieder genügend Mut aufbringen, den Klub zu betreten? Wann würde er sich irgendwo wieder zeigen können? Alle Welt würde wissen, dass Marie Melmotte versucht hatte, mit ihm durchzubrennen, und dass er sie im letzten Augenblick im Stich gelassen hatte. Welche Lüge konnte er sich ausdenken, um seine Schandtat zu verheimlichen? Und seine Kleidung! Alle seine Sachen waren im Klub, jedenfalls vermutete er es, er war allerdings nicht ganz sicher, ob er nicht einen Versuch unternommen hatte, sie zum Bahnhof zu bringen. Er wusste, dass Menschen sich umbrachten. Sollte es jemals angebracht gewesen sein, dass jemand sich die Kehle durchschnitt, dann wäre dies für ihn der absolut richtige Zeitpunkt. Als diese Vorstellung vor seinem geistigen Auge auftauchte, wickelte er sich allerdings wieder in die Bettdecke ein und versuchte zu schlafen. Für ihn würde Catos Tod wohl kaum überzeugenden Reiz ausüben.
Zwischen fünf und sechs Uhr kam seine Mutter erneut in sein Zimmer, und da er zu schlafen schien, blieb sie bei ihm stehen und legte ihre Hand auf seine Schulter. So ging es nicht weiter. Man musste wenigstens dafür sorgen, dass er etwas zu sich nahm. Sie, die arme Frau, hatte den ganzen Tag dagesessen – und daran gedacht. Was ihren Sohn betraf, so gab sein Zustand mit hinreichender Genauigkeit Aufschluss über das Vorgefallene. Was das Schicksal des Mädchens sein mochte, danach zu fragen konnte sie sich nicht aufraffen. Sie hatte nicht alle Details des Vorhabens mitbekommen, jedoch von Felix’ Plan erfahren, am Mittwochabend in Liverpool zu sein und am Donnerstag mit der jungen Dame nach New York aufzubrechen; und da sie ihn bei seinem Vorhaben unterstützen wollte, hatte sie ihm finanziell ausgeholfen. Sie hatte Kleidung für ihn gekauft und war zusammen mit Hetta zwei Tage lang mit Vorbereitungen für seine große Reise beschäftigt gewesen – und hatte dabei ihre eigene Tochter angelogen, was die Ursache der von ihrem Bruder geplanten Reise anging. Er war aber nicht abgereist, sondern betrunken und in heruntergekommenem Zustand in ihr Haus zurückgekehrt. Sie hatte seine Taschen mit weniger Skrupeln durchsucht, als sie sie jemals empfunden hatte, und seinen Fahrschein für die Passage und die wenigen Münzen gefunden, die ihm noch geblieben waren. Das Rätsel, das ihn umgab, konnte sie ohne Weiteres lösen. Er war in seinem Klub gewesen, bis er betrunken war, und hatte sein ganzes Geld verspielt. Als sie ihn zu Gesicht bekam, hatte sie sich gefragt, welche Lüge sie ihrer Tochter jetzt schon wieder auftischen sollte. Beim Frühstück ergab sich sogleich die Notwendigkeit für eine Lügengeschichte. »Mary sagt, dass Felix heute früh zurückgekommen ist und sich gar nicht auf den Weg gemacht hat«, rief Hetta aus. Die arme Frau konnte es nicht übers Herz bringen, die Laster ihres Sohnes gegenüber ihrer Tochter zu offenbaren. Sie konnte ihr nicht sagen, dass er um sechs Uhr betrunken ins Haus getorkelt war. Ohne Zweifel dachte Hetta sich ihr Teil. »Ja, er ist zurückgekommen«, sagte Lady Carbury, untröstlich angesichts ihrer Sorgen. »Ich glaube, es hatte etwas mit der mexikanischen Eisenbahnlinie zu tun, und das hat sich zerschlagen. Er ist sehr unglücklich, und es geht ihm nicht gut. Ich kümmere mich um ihn.« Danach hatte Hetta den ganzen Tag über nichts mehr gesagt. Und jetzt, etwa eine Stunde vor dem Abendessen, stand Lady Carbury am Bett ihres Sohnes und war entschlossen, ihn zum Reden zu bringen.
»Felix«, sagte sie, »rede mit mir, Felix. Ich weiß, dass du wach bist.« Er stöhnte, wandte sich von ihr ab und vergrub sich noch tiefer in seine Bettdecke. »Du musst zum Essen aufstehen. Es ist fast sechs Uhr.«
»In Ordnung«, sagte er schließlich.
»Was hat das zu bedeuten, Felix? Du musst es mir sagen. Früher oder später muss ich es erfahren. Ich weiß, dass du unglücklich bist. Du solltest dich deiner Mutter anvertrauen.«
»Mir ist so übel, Mutter.«
»Es wird dir besser gehen, wenn du aufstehst. Was hast du gestern Abend gemacht? Was ist bei alledem herausgekommen? Wo sind deine Sachen?«
»Im Klub. – Du solltest mich jetzt am besten allein lassen und mir Sam schicken.« Sam war der Hausdiener.
»Ich gehe sofort, Felix, aber du musst mir alles erzählen. Was ist geschehen?«
»Es hat nicht geklappt.«
»Aber warum hat es nicht geklappt?«
»Ich bin nicht losgekommen. Was sollen diese Fragen bezwecken?«
»Bei deiner Heimkehr heute früh hast du gesagt, Mr. Melmotte habe alles entdeckt.«
»Habe ich das? Dann hat er das wohl getan. Ach, Mutter, am liebsten wäre ich tot. Ich sehe keinerlei Sinn mehr in irgendetwas. Ich stehe nicht zum Essen auf. Ich bleibe lieber hier.«
»Du musst etwas zu dir nehmen, Felix.«
»Sam kann mir etwas bringen. Lass ihn doch etwas Brandy Soda bringen. Ich fühle mich so schwach und krank, dass ich es kaum ertrage. Ich kann jetzt nicht reden. Wenn er mir eine Flasche Sodawasser und etwas Brandy bringt, dann werde ich dir alles erzählen.«
»Wo ist das Geld, Felix?«
»Damit habe ich die Fahrkarte bezahlt«, sagte er und hielt sich den Kopf mit beiden Händen.
Darauf verließ ihn seine Mutter wieder; es war abgemacht, dass er bis zum nächsten Morgen im Bett bleiben durfte, ihr jedoch weitere Erklärungen geben werde, sobald er sich nach seinem eigenen Rezept erfrischt und gestärkt hatte. Der Diener besorgte Sodawasser und Brandy für ihn, man brachte ihm eine Platte mit Fleisch, und dann gelang es ihm, für eine Weile im Schlaf sein Elend zu vergessen.
»Ist er krank, Mama?« fragte Hetta.
»Ja, mein Liebes.«
»Wäre es nicht besser, wenn du nach einem Arzt schickst?«
»Nein, mein Liebes. Morgen wird es ihm besser gehen.«
»Mama, ich glaube, es würde dir besser gehen, wenn du mir alles sagst.«
»Das kann ich nicht«, sagte Lady Carbury und brach in Tränen aus. »Frag nicht. Was sollen diese Fragen bezwecken? Alles ist so furchtbar. Es gibt nichts zu sagen – außer dass ich vor dem Ruin stehe.«
»Hat er etwas angestellt, Mama?«
»Nein. Was sollte er angestellt haben? Wie soll ich wissen, was er anstellt? Er sagt mir nichts. Kein Wort mehr darüber. O mein Gott – ich wünschte, ich hätte keine Kinder!«
»Oh, Mama, meinst du mich damit?« fragte Hetta, eilte zu ihrer Mutter hinüber und warf sich neben sie aufs Sofa. »Mama, sag, dass du nicht mich damit meinst.«
»Es betrifft dich ebenso wie mich und ihn. Ich wünschte, ich hätte keine Kinder.«
»Oh, Mama, sei nicht so grausam zu mir! Bin ich etwa nicht gut zu dir? Versuche ich etwa nicht, ein Trost für dich zu sein?«
»Dann heirate deinen Vetter, Roger Carbury, er ist ein guter Mann und kann dir Sicherheit bieten. Zumindest könntest du durch ihn ein Zuhause für dich und einen Freund für uns alle finden. Du bist anders als Felix. Du betrinkst dich nicht und du spielst nicht – denn du bist eine Frau. Aber du bist halsstarrig und willst mir in meiner schwierigen Lage keine Hilfe sein.«
»Mama – soll ich ihn heiraten, ohne ihn zu lieben?«
»Lieben! Konnte ich etwa jemanden lieben? Siehst du in deinem Umkreis viel von dem, was du als Liebe bezeichnest? Warum solltest du ihn nicht lieben? Er ist ein Gentleman und ein guter Mensch – mit einem weichen Herzen, von angenehmem Wesen, dessen ganzer Lebensinhalt darin bestehen würde, dir ein glückliches Leben zu bescheren. Du hältst Felix für einen sehr schlechten Menschen.«
»Das habe ich nie gesagt.«
»Frag dich doch einmal, ob du nicht genauso viel Unheil anrichtest; du siehst doch, was du für uns tun könntest, wenn du nur wolltest. Aber es kommt dir nie in den Sinn, dass du zugunsten anderer ein Opfer bringen könntest, und das nur wegen einer Fantasterei.«
Hetta erhob sich vom Sofa, und als ihre Mutter wieder nach oben ging, dachte sie über alles noch einmal nach. Konnte es richtig sein, einen Mann zu heiraten, wo sie doch einen anderen liebte? Konnte es richtig sein, überhaupt zu heiraten, nur um ihrer Familie einen Gefallen zu tun? Dieser Mann, den sie heiraten könnte, wenn sie es denn wollte, der ihr zu Füßen lag, war, wie sie sehr wohl wusste, genau so, wie ihre Mutter ihn beschrieben hatte. Und mehr noch. Ihre Mutter hatte sein weiches Herz und sein angenehmes Wesen erwähnt. Hetta kannte ihn jedoch auch als einen Mann von hohem Ehrbegriff und uneigennützigem Mut. In ihrer jetzigen Lage war er genau der Freund, den sie um Rat gebeten hätte – wäre er eben nicht ausgerechnet der Verehrer gewesen, der sie unbedingt zur Frau haben wollte. Hettas Gefühl sagte ihr, dass sie für ihre Mutter große Opfer bringen konnte. Geld, falls sie welches hätte, könnte sie ihr geben, selbst wenn sie dadurch keinen Penny mehr hätte. Ihre Zeit, alles was ihr wichtig war, ihr Herz und, so dachte sie, sogar ihr Leben konnte sie hergeben. Sie konnte sich für ihre Mutter zu Armut und Einsamkeit und quälendem Bedauern über Entgangenes verurteilen. Sie sah jedoch keinen Weg, wie sie sich in die Arme eines Mannes begeben konnte, den sie nicht liebte.
»Ich wüsste nicht, was es hier zu erklären gibt«, sagte Felix zu seiner Mutter. Sie hatte ihn gefragt, warum er nicht nach Liverpool gefahren sei, ob er von Melmotte persönlich aufgehalten worden sei, ob er von Marie gehört habe, dass sie von der Reise abgehalten worden sei, oder ob Marie – was ja denkbar wäre – selbst ihre Meinung geändert habe. Doch konnte er sich nicht dazu durchringen, die Wahrheit zu sagen oder auch nur eine Geschichte, die der Wahrheit nahe kam. »Es hat eben nicht geklappt«, sagte er, »und das hat mir natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und: ja. Ich habe tatsächlich etwas Sekt getrunken, als ich herausgefunden habe, wie die Dinge standen. So etwas nimmt einen ja mit. Ich habe übrigens im Klub gehört, dass die ganze Sache vom Tisch sei. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann war ich so wütend, dass ich nicht mehr sagen kann, was mich geritten hat. Den Fahrschein habe ich gekauft. Hier ist er. Das zeigt, dass ich es ernst gemeint habe. Die 30 Pfund habe ich dafür ausgegeben. Das Wechselgeld ist wohl noch da. Nimm es mir nicht weg, ich habe nämlich keinen einzigen Shilling mehr.« Selbstverständlich sagte er nichts über Maries Geld oder über das Geld, das er selbst von Melmotte erhalten hatte. Und da seine Mutter nichts von diesem Geld wusste, konnte sie ihm nicht widersprechen. Sie bekam keine weitere Information aus ihm heraus, war sich jedoch sicher, dass da etwas war, das ihr früher oder später zu Ohren kommen würde.
Ungefähr um 9 Uhr an diesem Abend sprach Mr. Broune in der Welbeck Street vor. Er tat das in letzter Zeit sehr häufig, kam in einer Droschke, blieb auf eine Tasse Tee und fuhr mit derselben Droschke zurück in sein Büro bei der Zeitung. Seit Lady Carbury so ausgesprochen rücksichtsvoll Abstand davon genommen hatte, seinen Heiratsantrag anzunehmen, war Mr. Broune ihr nun so gut wie aufrichtig zugetan. Inzwischen bestand zwischen den beiden eine vertrauensvollere und tiefergehende Freundschaft als in früheren Zeiten. Er sprach offenherziger über seine eigenen Angelegenheiten zu ihr, und sogar sie war bereit zu versuchen, ihm gegenüber bei der Wahrheit zu bleiben. Jetzt gab es zwischen ihnen nicht den Hauch eines Liebeswerbens. Weder blickte sie ihm tief in die Augen, noch hielt er ihr die Hand. Was das Küssen anging – er dachte genauso wenig daran, sie zu küssen, wie er das Dienstmädchen geküsst hätte. Allerdings sprach er zu ihr über die Dinge, über die er sich Sorgen machte – die unvernünftigen Forderungen der Eigentümer der Zeitung und den fahrlässigen Mangel an Genauigkeit bei den Korrespondenten. Er schilderte ihr die übergroße Last, die auf seinen Schultern ruhte und unter der selbst ein Atlas zusammengebrochen wäre. Und er erzählte ihr auch von seinen Triumphen – wie er den einen als Strafe für eine unlogische Formulierung abgekanzelt und den anderen abgeschossen hatte, weil dieser es gewagt hatte zu opponieren. Und er ließ sich aus über seine Tugenden, seine Gerechtigkeit und seine Milde. Ach – wenn Männer und Frauen doch nur um seinen guten Charakter und seinen Patriotismus wüssten – wie er in dem einen Fall von Bestrafung abgesehen habe, wie in dem anderen Fall jemand durch ihn zum gemachten Mann wurde, wie er dem Land Millionen an Ausgaben erspart habe durch sein Insistieren auf Wahrheit in einer überaus wichtigen Sache! An alledem fand Lady Carbury großen Gefallen und lohnte es ihm mit Schmeicheleien und kleinen Vertraulichkeiten ihrerseits. Unter seinem Einfluss hatte sie so gut wie beschlossen, Mr. Alf fallenzulassen. Von nichts war Mr. Broune mehr überzeugt, als dass Mr. Alf sich in Bezug auf die Wahl für den Bezirk Westminster und die Attacken auf Melmotte zum Narren mache. »Die Londoner Gesellschaft weiß normalerweise, was sie tut«, sagte Mr. Broune, »und die Londoner Gesellschaft hält Mr. Melmotte für solide. Ich will nicht behaupten, dass er nie etwas getan hat, das er eigentlich nicht hätte tun sollen. Ich kümmere mich nicht um sein Vorleben. Aber er ist ein Mann mit Vermögen, Macht und Einfallsreichtum, und Alf wird es noch bereuen.« Unter derartigem Einfluss sah sich Lady Carbury genötigt, Mr. Alf fallenzulassen.
Gelegentlich saßen sie zu dritt im Salon, mit Hetta, der Mr. Broune neuerdings ebenfalls zugetan war; manchmal jedoch war Lady Carbury auch in ihrem Allerheiligsten. An diesem Abend empfing sie ihn dort und schüttete sogleich ihr Herz aus über all ihre Sorgen in Bezug auf Felix. Bei dieser Gelegenheit erzählte sie ihm alles und erzählte es ihm nahezu wahrheitsgemäß. Er hatte von der Geschichte schon gehört. »Die junge Dame fuhr nach Liverpool, und Sir Felix war nicht dort.«
»Er hätte nicht dort sein können. Er war den ganzen Tag hier im Bett. Ist sie denn gefahren?«
»So wurde es mir gesagt – und am Bahnhof wurde sie von einem ranghohen Beamten der Polizei in Liverpool empfangen, der sie gar nicht erst zum Hafen gehen ließ, sondern sie direkt nach London zurückbrachte. Sie muss davon ausgegangen sein, dass ihr Verehrer an Bord war – sie geht wahrscheinlich jetzt noch davon aus. Sie tut mir leid.«
»Noch viel schlimmer wäre es gewesen, wenn sie die Fahrt womöglich angetreten hätte«, sagte Lady Carbury.
»Ja, das wäre schlimm gewesen. Sie hätte eine deprimierende Reise nach New York unternommen, und eine noch deprimierendere zurück. Hat Ihr Sohn Ihnen gegenüber von Geld gesprochen?«
»Von welchem Geld?«
»Es heißt, die junge Frau habe ihm eine hohe Summe anvertraut, die eigentlich ihrem Vater gehörte. Wenn das stimmt, sollte er ja keine Zeit verlieren, es zurückzugeben. Ein Freund könnte das übernehmen. Ich würde es übrigens gern übernehmen. Wenn es stimmt, so sollte das Geld umgehend zurückgeschickt werden – um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Das wird für ihn sprechen.« Mr. Broune sagte das in einem Ton, der vermittelte, wie sehr er von seinem Rat überzeugt war.
Für Lady Carbury war das alles schrecklich. Sie hatte kein Geld, das sie zurückgeben konnte, noch hatte ihr Sohn welches, wie sie genau wusste. Sie habe nichts von Geld gehört. Was meine Mr. Broune wohl mit einer hohen Summe? »Das wäre schrecklich«, sagte sie.
»Sollten Sie ihn nicht besser danach fragen?«
Lady Carbury war wieder in Tränen aufgelöst. Sie wusste, dass sie bei ihrem Sohn nicht auf ein einziges wahres Wort hoffen konnte. »Was meinen Sie mit einer hohen Summe?«
»Ungefähr zwei- oder dreihundert Pfund.«
»Ich habe keinen einzigen Shilling, Mr. Broune, nichts.«
Dann brach alles aus ihr heraus – die ganze Geschichte über ihre Armut, wie sie durch die Fehltritte ihres Sohnes zustande gekommen war. Sie schilderte ihm ihre finanzielle Lage in jeder Einzelheit, und zwar vom Tod ihres Mannes und seinem Testament bis hin zum jetzigen Augenblick.
»Er verschlingt Sie mit Haut und Haar, Lady Carbury.« Lady Carbury hatte das Gefühl, dass sie praktisch schon verschlungen worden war, sagte jedoch nichts. »Sie müssen dem Einhalt gebieten.«
»Aber wie?«
»Sie müssen sich von ihm lossagen. Es klingt schrecklich, aber es muss sein. Sie dürfen nicht zulassen, dass Ihre Tochter verarmt. Finden Sie heraus, wie viel er von Miss Melmotte bekommen hat, und ich werde mich darum kümmern, dass es zurückgezahlt wird. Das muss sein – und dann versuchen wir, ihn dazu zu bewegen, dass er ins Ausland geht. Nein – widersprechen Sie mir nicht. Wir können bei anderer Gelegenheit über das Geld reden. Ich muss jetzt gehen, ich war ohnehin schon zu lange hier. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Bringen Sie ihn dazu, Ihnen alles zu erzählen, und schicken Sie mir eine Nachricht ins Büro. Wenn Sie es morgen früh fertigbrächten, wäre es das Beste. Gott segne Sie.« Und damit machte er sich eilends auf den Weg.
Früh am nächsten Morgen bekam Mr. Broune einen Brief von Lady Carbury überreicht, in dem sie ihn über die Geldangelegenheit informierte, so weit sie sie Sir Felix hatte abringen können. Sir Felix hatte erklärt, Mr. Melmotte habe ihm 600 Pfund geschuldet und er habe eine Anzahlung von 250 Pfund dafür von Miss Melmotte erhalten, sodass ihm immer noch ein großer Restbetrag zustehe. Lady Carbury schrieb außerdem, ihr Sohn habe schließlich zugegeben, dieses Geld verspielt zu haben. Die Geschichte entsprach im Großen und Ganzen der Wahrheit; Lady Carbury gestand in ihrem Brief jedoch ein, sie habe keinen stichhaltigen Grund, der Geschichte Glauben zu schenken, da sie ja von ihrem Sohn stamme.
KAPITEL LIII
Ein Tag in der City
Melmotte hatte seine Tochter zurückbekommen und war fast geneigt, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Das hätte er wahrscheinlich auch getan, wäre ihm nicht bewusst gewesen, dass allen in seinem Haus klar war, dass sie mit Sir Felix Carbury verabredet gewesen war, und wenn ihm nicht gewisse Freunde in der City ihr Mitgefühl ausgesprochen hätten. Offenbar wusste ab etwa zwei Uhr nachmittags die ganze Welt davon. Natürlich würde Lord Nidderdale davon hören, und dann wäre die ganze Mühe, die er in dieser Richtung auf sich genommen hatte, vergeblich gewesen. Wie dumm von dem Mädchen, die Chance – nein, mehr noch, die sichere Aussicht auf eine glanzvolle Zukunft auf diese Weise zu untergraben! Seine Wut auf Sir Felix war jedoch ungleich größer als seine Wut auf seine Tochter. Dieser Mann hatte fest versprochen, von jeglichem Schritt in diese Richtung Abstand zu nehmen – hatte es sogar schriftlich versprochen – hatte sogar unterschrieben, er gebe seine Absicht auf, Marie zu heiraten! Melmotte hatte natürlich alle Einzelheiten den Scheck über 250 Pfund betreffend erfahren – dass das Geld von der Bank an Didon ausgezahlt worden war und Didon es an Sir Felix weitergegeben hatte. Marie selbst hatte bestätigt, dass Sir Felix das Geld erhalten hatte. Wenn es möglich wäre, würde er den Baronet verklagen, weil dieser ihm Geld gestohlen hatte.
Wäre Melmotte wirklich klug gewesen, so hätte er sich wahrscheinlich damit begnügt, seine Tochter zurückzubekommen, und das Geld abgeschrieben, ohne sich darum zu verkämpfen. Zwar besaß Bargeld zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere einen hohen Stellenwert für ihn, aber seine Sorgen waren von einer Größenordnung, in der 250 Pfund nur einen geringfügigen Unterschied machten. Jedoch hatte dieser Mann während der letzten Monate Arroganz entwickelt, sich ein großes Selbstbewusstsein zugelegt, das die Verehrung anderer für ihn geweckt hatte, was wiederum seinen Verstand trübte und ihm viel von der Fähigkeit zu präziser Abwägung nahm, die er von Natur aus unzweifelhaft besaß. Er erinnerte sich genau an seine diversen Transaktionen mit Sir Felix. Es war sogar eine seiner besonderen Fähigkeiten, alle finanziellen Transaktionen, seien sie bedeutend oder weniger bedeutend, genauestens im Gedächtnis zu bewahren und ein Kassenbuch im Hinterkopf zu haben, in dem immer alles erfasst und exakt bilanziert war. Er kannte den aktuellen Stand seiner Verhältnisse genau, ob es um den Straßenkehrer an der Kreuzung ging, dem er am vergangenen Dienstag einen Penny gegeben hatte, oder um die Longestaffes, Vater und Sohn, denen er noch keine Anzahlung für den Erwerb von Pickering geleistet hatte. Sir Felix’ Geld jedoch war ihm für den Kauf von Aktien anvertraut worden – und dieser Auftrag gab Sir Felix nicht das Recht, einen anderen Betrag aus den Händen seiner Tochter an sich zu nehmen. In einer solchen Angelegenheit, so dachte er, wären ein englischer Richter und englische Geschworene eindeutig auf seiner Seite – zumal er Augustus Melmotte war, der Mann, der kurz davor stand, für den Bezirk Westminster gewählt zu werden, der Mann, der demnächst den Kaiser von China als Gast empfangen würde!
Der folgende Tag war ein Freitag – der Tag, an dem sich immer der Vorstand der Eisenbahngesellschaft versammelte. Frühmorgens schickte er Lord Nidderdale eine Mitteilung:
Mein lieber Nidderdale – bitte kommen Sie heute zur Vorstandssitzung – oder wenigstens zu mir in die City. Ich möchte unbedingt mit Ihnen sprechen.
Herzlichst, A.M.
Dies schrieb er, nachdem er klugerweise beschlossen hatte, seinem Schwiegersohn in spe reinen Wein einzuschenken. Sollte es noch eine Chance geben, den jungen Lord bei der Stange zu halten, so wäre dieser Chance durch rückhaltlose Aufrichtigkeit seinerseits am besten gedient. Der junge Lord würde selbstverständlich wissen, was Marie getan hatte. Doch der junge Lord bekam seit einigen Wochen mit, dass es da ein Problem wegen Sir Felix Carbury gab, und hatte dennoch in seinem Werben um Marie nicht nachgelassen. Möglicherweise konnte man den jungen Lord davon überzeugen, dass seine Aussichten sich insgesamt eher verbessert als verschlechtert hätten, nachdem die junge Dame inzwischen versucht hatte durchzubrennen und dieser Versuch erfolglos geblieben war.
An diesem Vormittag hatte Mr. Melmotte zahlreiche Besucher, und unter ihnen war Mr. Longestaffe einer der ersten und unglücklichsten. In den Büros in der Abchurch Lane war inzwischen ein doppeltes Eingangs- und Ausgangssystem eingeführt worden – Einlass und Auslass via Vordertreppe und Hintertreppe, wie es bei hochgestellten Persönlichkeiten immer erforderlich ist –, wobei Ehre und Würde jeweils nach Kriterien zugemessen wurden, die in krassem Gegensatz zu dem standen, was sonst in der Gesellschaft gilt: Die Vordertreppe war für jedermann gedacht und das Fortkommen auf ihr war langsam und unsicher, während die Hintertreppe der schnelle und sichere Weg war und bevorzugten Besuchern vorbehalten blieb. Miles Grendall war der Herr der Treppen und hatte bereits festgestellt, dass er gut damit ausgelastet war, die Leute auf der richtigen Route nach oben zu halten. Mr. Longestaffe kam vor eins in die Abchurch Lane – nachdem es ihm nicht gelungen war, auch nur einen Moment lang ein Gespräch mit dem großen Mann unter vier Augen zu führen, als er am Freitag zuvor später eingetroffen war. Prompt fiel er Miles in die Hände und wurde mit viel demonstrativer Höflichkeit über die Vordertreppe in das Wartezimmer für die Nutzer der Vordertreppe geleitet. Miles Grendall war sehr redselig. Ob Mr. Longestaffe Mr. Melmotte sprechen wolle? Oh – Mr. Longestaffe wolle Mr. Melmotte möglichst umgehend sprechen! Selbstverständlich werde Mr. Longestaffe Mr. Melmotte sprechen. Er, Miles, wisse, dass Mr. Melmotte Mr. Longestaffe ausgesprochen dringend sprechen wolle. Mr. Melmotte habe Mr. Longestaffes Namen in den vergangenen drei Tagen gleich zweimal erwähnt. Würde Mr. Longestaffe für einige Minuten Platz nehmen? Ob Mr. Longestaffe wohl schon den Morning Breakfast Table gelesen habe? Mr. Melmotte sei zweifellos außerordentlich beschäftigt. In eben diesem Augenblick befinde sich eine Abordnung der kanadischen Regierung bei ihm – und Sir Gregory Gribe warte auf eine kurze Unterredung mit ihm im Büro. Aber, so Miles’ Vermutung, die kanadische Regierung werde nicht viel Zeit benötigen – und was Sir Gregory angehe, so vertrage seine Angelegenheit möglicherweise Aufschub. Miles werde sein Allerbestes versuchen, einen Termin für Mr. Longestaffe zu organisieren, umso mehr, als Mr. Melmotte selbst seinen Freund so ausgesprochen dringend sprechen wolle. Es war erstaunlich, dass jemand wie Miles Grendall seine Aufgabe so gut verinnerlicht hatte und sich derart nützlich machte! Wir überlassen Mr. Longestaffe sich selbst, im vorderen Wartezimmer und mit dem Morning Breakfast Table in der Hand, und halten lediglich fest, dass er dort etwas über zwei Stunden lang verblieb.
Während dieser Zeit trafen sowohl Mr. Broune als auch Lord Nidderdale im Büro ein, und beide wurden ohne Wartezeit empfangen. Mr. Broune kam als erster. Miles wusste, wer er war, und unternahm keinen Versuch, ihn im selben Wartezimmer wie Mr. Longestaffe unterzubringen. »Ich schreibe ihm nur kurz eine Mitteilung«, sagte Mr. Broune und kritzelte am Büroeingang ein paar Worte auf einen Zettel. »Ich bin beauftragt, Ihnen zugunsten von Miss Melmotte einen Geldbetrag auszuzahlen.« Dies waren seine Worte, und sie verschafften ihm sogleich Eintritt ins Allerheiligste. Die kanadische Delegation musste sich bereits verabschiedet haben, und Sir Gregory konnte schlechterdings noch nicht eingetroffen sein. Lord Nidderdale, der fast in demselben Augenblick wie der Herausgeber vorstellig geworden war, wurde in einen kleinen Privatraum geleitet – der eigentlich Miles Grendalls persönliches Refugium war. »Was ist los mit dem alten Herrn?« fragte der junge Lord.
»Meinen Sie etwas Besonderes?« fragte Miles. »Hier ist immer viel los.«
»Er hat nach mir geschickt.«
»Ja – Sie können sehr bald hineingehen. Dieser Mann, der den Breakfast Table macht, ist bei ihm. Keine Ahnung, weshalb der gekommen ist. Sie wissen, warum er nach Ihnen geschickt hat?«
Lord Nidderdale beantwortete diese Frage durch eine weitere. »Ich vermute, dass die Geschichte mit Miss Melmotte zutrifft?«
»Sie hat sich gestern Morgen tatsächlich aufgemacht«, flüsterte Miles.
»Aber Carbury war nicht bei ihr.«
»Wohl nicht – glaube ich jedenfalls. Er scheint es vergeigt zu haben. Er ist so verd– grobschlächtig – der setzt doch alles in den Sand, was er anpackt.«
»Sie mögen ihn natürlich nicht, Miles. Ich habe übrigens auch keinen Grund, ihn ins Herz zu schließen. Er hätte ja auch gar nicht fahren können. Er ist gestern Morgen um vier sternhagelvoll aus dem Klub getorkelt. Er hat eine Menge Geld verspielt und in der letzten halben Stunde einen Krach Ihretwegen losgetreten.«
»Grobschlächtig, sage ich doch«, rief Miles in ehrlicher Empörung.
»Das ist er wohl. Er konnte zwar einen Streit vom Zaun brechen, aber ich bin sicher, er hätte es nicht nach Liverpool geschafft. Außerdem habe ich sein ganzes Gepäck spät abends im Foyer des Klubs herumliegen sehen – unzählige große Koffer und Reisetaschen, genau das, was man nach New York mitnehmen würde. Donnerwetter! Das muss man sich mal vorstellen – ein Mädchen nach New York zu entführen! Das war kühn.«
»Die ganze Sache ging von ihr aus«, sagte Miles, der selbstverständlich mit Mr. Melmottes ganzem Umkreis bestens vertraut war und daher über Möglichkeiten verfügte, die Wahrheit zu erfahren.
»Was für ein Desaster!« sagte der junge Lord. »Was der alte Knabe mir wohl darüber sagen will?« Dann hörte man deutlich das Klingeln eines silbernen Glöckchens und Miles teilte Lord Nidderdale mit, er sei an der Reihe.
Mr. Broune hatte Mr. Melmotte in den zurückliegenden Wochen wertvolle Dienste geleistet, und Mr. Melmotte war entsprechend liebenswürdig. Als er des Herausgebers ansichtig wurde, setzte er sogleich zur einer Rede an, um ihm für die Unterstützung seiner Kandidatur durch den Breakfast Table zu danken. Doch Mr. Broune unterbrach ihn. »Ich spreche nie über den Breakfast Table«, sagte er. »Wir bemühen uns, so gut wie möglich das Richtige zu tun, und je weniger Worte man darüber verliert, desto weniger Probleme gibt es.« Melmotte verbeugte sich. »Ich bin in einer ganz anderen Angelegenheit hergekommen, und vielleicht gilt auch hier: je weniger Worte, desto weniger Probleme. Sir Felix Carbury wurde vor kurzem seitens Ihrer Tochter Geld anvertraut. Umständehalber wurde es nicht für den geplanten Zweck verwendet, und daher bin ich als ein Freund von Sir Felix hier, um Ihnen das Geld zurückzugeben.« Mr. Broune bezeichnete sich nur ungern als Freund von Sir Felix, doch sogar das nahm er für die Dame in Kauf, die ihm den Gefallen getan hatte, ihn nicht zu heiraten.
»Oh, tatsächlich«, sagte Mr. Melmotte mit einem mürrischen Blick, den er eigentlich gern unterdrückt hätte.
»Zweifellos wissen Sie über alles Bescheid.«
»O ja, ich weiß Bescheid. Dieser verd– Schuft!«
»Wir wollen das nicht vertiefen, Mr. Melmotte. Ich habe den Scheck selbst ausgestellt, er ist von Ihnen einlösbar – um die Sache in Ordnung zu bringen. Die Summe belief sich auf 250 Pfund, soviel ich weiß.« Und Mr. Broune legte einen Scheck über diesen Betrag auf den Tisch.
»Das ist dann wohl in Ordnung«, sagte Mr. Melmotte. »Aber denken Sie daran, ich finde nicht, dass ihn das von aller Schuld freispricht. Er ist und bleibt ein Schuft.«
»Jedenfalls hat er das Geld, das ihm der Zufall in die Hände gespielt hat, dem einzigen Menschen zurückgezahlt, der berechtigt ist, es im Namen der jungen Dame in Empfang zu nehmen. Einen schönen Tag.« Immerhin reichte Mr. Melmotte ihm zum Zeichen der Verbundenheit die Hand. Dann ging Mr. Broune, und Melmotte läutete. Als Nidderdale eingelassen wurde, knüllte er den Scheck zusammen und steckte ihn in seine Tasche. Er war klug genug, sofort zu erkennen, dass er jeden Gedanken daran, Sir Felix vor Gericht zu bringen, aufgeben musste. »Nun, Mylord, wie geht es Ihnen?« sagte er mit seinem freundlichsten Lächeln. Nidderdale erklärte, er sei munter wie ein Fisch im Wasser. »Sie wirken wirklich nicht niedergeschlagen, Mylord.«
Lord Nidderdale, der zweifellos das Gefühl hatte, es sei angebracht, vor seinem ehemaligen Schwiegervater in spe gute Miene zu bösem Spiel zu machen, zitierte darauf den Refrain eines alten Liedes, den meine Leser ganz gewiss in Erinnerung haben:
Nur Mut, Sam,
kein Grund traurig zu sein –
In die Stadt kommen ständig Mädchen herein,
die nur darauf aus sind bei dir zu sein.
»Hahaha«, lachte Melmotte, »sehr gelungen. Kein Zweifel, es gibt welche – sogar viele. Aber Sie werden doch nicht zulassen, dass dieser dumme Unsinn zwischen Ihnen und Marie steht.«
»Du meine Güte, Sir, da bin ich mir nicht sicher. Miss Melmotte hat ausgesprochen überzeugend deutlich gemacht, dass sie einen anderen Gentleman vorzieht und sich nichts aus mir macht.«
»Ein törichtes Miststück! Ein albernes kleines Miststück mit Flausen im Kopf! Sie hat so viele Romane gelesen, dass sie auf den Gedanken verfallen ist, sie könne nicht eher ruhen, als bis sie mit jemandem durchgebrannt ist.«
»Sie scheint dieses Mal keinen Erfolg gehabt zu haben, Mr. Melmotte.«
»Nein – natürlich haben wir sie aus Liverpool zurückgeholt.«
»Aber es heißt, sie sei immerhin weiter gekommen als der Gentleman.«
»Er ist ein verlogener Trunkenbold und ein Schurke. Mein Mädchen weiß inzwischen sehr genau, wie er ist. Sie wird so etwas nie wieder machen. Natürlich tut es mir außerordentlich leid, Mylord. Sie wissen, dass ich immer ehrlich zu Ihnen war. Sie ist mein einziges Kind, und früher oder später erhält sie zwangsläufig alles, was ich besitze. Was sie sofort erhält, wird jeden Mann reich machen – falls sie mit meiner Einwilligung heiratet; und ich gehe davon aus, dass ich in einem Jahr oder in zwei Jahren doppelt soviel wie jetzt für sie aufbringen kann, ohne mein Kapital anzutasten. Bestimmt verstehen Sie, dass ich mir einen hohen gesellschaftlichen Rang für sie wünsche. In diesem Land ist das, glaube ich, ein würdiges Ziel für den Ehrgeiz eines Mannes. Hätte sie diesen dahergelaufenen Nichtsnutz geheiratet – es hätte mir das Herz gebrochen. Jetzt, Mylord, hätte ich gern von Ihnen gehört, dass das alles für Sie nichts ändert. Ich bin ganz offen zu Ihnen. Ich versuche nichts zu verheimlichen. Natürlich war das alles sehr unglücklich. Junge Frauen haben nun einmal Flausen im Kopf. Aber Sie können davon ausgehen, dass dieses kleine Missgeschick Ihren Absichten eher zugute kommt als schadet. Nach alledem wird sie von Sir Felix Carbury nicht mehr sonderlich viel halten.«
»Wohl nicht. Obwohl junge Frauen sehr wohl imstande sind, alles zu verzeihen, egal was.«
»Sie wird ihm nicht verzeihen. Bei Gott nicht. Sie wird die ganze Geschichte erfahren. Und Sie kommen einfach und besuchen sie so wie immer!«
»Da bin ich mir nicht sicher, Mr. Melmotte.«
»Warum nicht? Sie sind doch kein Schwächling und geben all Ihre Pläne auf wegen einer solchen Torheit! Er hat sie seitdem noch nicht einmal mehr gesehen.«
»An ihr lag es nicht.«
»Das Geld wird in vollem Umfang zur Verfügung stehen, Lord Nidderdale.«
»Mit dem Geld stimmt alles, ohne Zweifel. Und es gibt niemanden in London, der eine Existenz mit einem gesicherten Einkommen so gern hätte wie ich. Aber, Herrgott nochmal, es ist reichlich viel verlangt, wenn eine junge Frau gerade mit einem anderen Mann durchbrennen wollte. Alle wissen Bescheid.«
»In drei Monaten wird niemand mehr daran denken.«
»Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Sir, Miss Melmotte hat, so glaube ich, einen stärkeren Willen, als Sie ihn ihr zutrauen. Sie hat mich nie im mindesten ermutigt. Vor ewigen Zeiten, ungefähr an Weihnachten, hat sie einmal gesagt, sie werde tun, was Sie ihr sagen. Aber seitdem hat sie sich sehr verändert. Die Sache war für mich damit erledigt.«
»Das war aber nicht ihre Schuld.«
»Nein – aber sie hat das für sich genutzt, und ich habe kein Recht, mich zu beschweren.«
»Kommen Sie einfach zu uns nach Hause und machen Sie ihr morgen noch einmal einen Antrag. Oder kommen Sie am Sonntagvormittag. Lassen Sie nicht zu, dass alle unsere Abmachungen durch die Torheit eines nichtsnutzigen Mädchens zunichte werden. Kommen Sie am Sonntag etwa um die Mittagszeit?« Lord Nidderdale überdachte seine Lage einige Augenblicke lang und antwortete dann, er werde vielleicht am Sonntagvormittag kommen. Darauf schlug Melmotte vor, sie beide sollten in einem Klub der Konservativen in der City »einen Happen zu sich nehmen«. Es sei noch genügend Zeit bis zur Sitzung des Vorstands der Eisenbahngesellschaft. Nidderdale hatte nichts gegen das Mittagessen, äußerte jedoch entschieden seine Meinung, die Sitzung sei »ein Blödsinn«. »Das ist alles schön und gut für Sie, junger Mann«, sagte der Vorsitzende, »aber ich muss daran teilnehmen, damit Sie in den Genuss eines sehr großen Vermögens kommen können.« Dann tippte er dem jungen Mann auf die Schulter und hielt ihn zurück, als dieser den Ausgang über die Vordertreppe nehmen wollte. »Kommen Sie hier entlang, Nidderdale – hier entlang. Ich muss das Haus verlassen, ohne gesehen zu werden. Es warten dort Leute auf mich, die annehmen, dass man sich von morgens bis abends um die Geschäfte kümmern kann, ohne auch nur einen Bissen zu sich zu nehmen.« Und daher flohen sie über die Hintertreppe aus dem Haus.