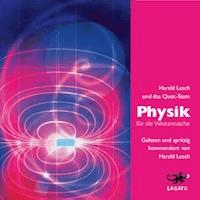Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Gibt es eine perfekte Gesellschaft? Nein. Aber in welcher Gesellschaft wollen wir leben – vor allem, wenn es schwierig wird? Helfen da Physik, Mathematik oder die Wirtschaft? Harald Lesch und Thomas Schwartz analysieren mit Scharfsinn und Witz, welche Missstände und Fehlentwicklungen uns beschäftigen. Viel wichtiger aber: Sie begnügen sich nicht mit Krisen-Gejammer, sie wollen mehr. Ihre Schlüsse sind wissenschaftlich präzise, sie entlarven Verschwörungstheorien und Vorurteile, und stellen konkrete Forderungen, an Politik, Wirtschaft und jeden einzelnen. Pointiert und vor allem kreativ erklären Lesch und Schwartz, weshalb das Dorf-Prinzip hilft, singen das Lob der Grenze und lassen eine Freiheit fühlen, die Dialekt spricht und Raum gibt. Ein faszinierendes und bahnbrechendes Buch – ein Buch so unberechenbar wie das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald LeschThomas Schwartz
UNBERECHENBAR
Das Leben ist mehr als eine Gleichung
Unter Mitarbeit von Simon Biallowons
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-451-39385-3
ISBN E-Book 978-3-451-82209-4
Inhalt
Auftakt bei Goethe: Mit allem haben wir gerechnet – aber damit?
Stabile Seitenlage und Puls auf 60: Raus aus der Karussellgesellschaft!
Ja, was will sie denn? Ja, was hat er denn?
Karussellgesellschaft vs. Biergartengesellschaft
Einfache Atome und komplizierte Beziehungen – oder: Warum Komplexität etwas Tolles ist
Wer hat hier eigentlich das Sagen?
Das wahre Unfehlbarkeitsdogma der Neuzeit
Wegstoßen und Heranziehen: Ein uraltes Pärchen, das die Welt regiert
Ohne Ressourcen und Reserven: Wir bleiben auf der Strecke – und der Zaubersatz dagegen
Das Ende der Vorratskammer als großes Problem
Ein Zaubersatz und die Kultur der Abschreibung
Franklins Ursünde: Was Nadolny besser wusste
Die Schönheit der Geschwindigkeit und die Maschinisierung der Welt
Der andere Franklin oder: Die Entdeckung der Langsamkeit
Quality Time: Rituale der Langsamkeit
Irgendwann muss es auch mal gut sein: Lob der Grenze
Grenzen und Grenzerfahrungen
Die Grenzen des Planeten schützen
Grenzen und Tabus mutig anerkennen
Das Dorf und eine neue Nachbarschaft
Kurze Wege können lange halten
Du-Kultur und zwei Jungs in der Großstadt
Grappa, Bundesliga und Global Neighborhood
Stabil muss es sein
Schiller und Stepi: Manchmal muss man spekulieren
Probieren – und studieren
Weshalb Spekulation und Risiko so wichtig sind
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Schlüsselwort unserer Zeit und eine gefährliche Sucht
Excelisierung des Lebens und befreiende Kartenspiele
Über die Autoren
Auftakt bei Goethe: Mit allem haben wir gerechnet – aber damit?
Weimar liegt ruhig da, eigentlich wie immer. Es ist Mitte März, und noch scheinen die Entwicklungen der folgenden Tage und Wochen in weiter Ferne. Als Ahnung allerdings, eine Ahnung, die stärker und stärker wird und mit jeder Radiomeldung und jedem News-Feed an Brisanz gewinnt, sind sie auch hier schon längst angekommen. Da dräut etwas, da braut sich etwas über unseren Köpfen zusammen. Und diese Ahnung fährt mit, die paar Hundert Kilometer aus Bayern, sie begleitet uns auf den Autobahnen und in den Zugabteilen, die einem leerer vorkommen – und die immer noch proppenvoll sind im Vergleich zu dem, wie es in wenigen Tagen aussehen wird. Sie spaziert mit, diese Ahnung, durch die wunderbare Altstadt Weimars.
Hier gibt es keine langen Wege, nur wenige Meter liegen zwischen dem Haus Schillers und Goethes Domizil am Frauenplan, und alles erscheint so wunderbar idyllisch. Die Häuser sind herausgeputzt, herausgeputzt sind die Straßen und Cafés, und auch der Marktplatz präsentiert sich bestens gepflegt – man wähnt sich fast im Disneyland der deutschen Klassik. Wir kommen entlang der Belvederer Allee, die zu Beginn ihrem Namen zu trotzen scheint und gar keinen schönen Ausblick bietet. Dann aber führt sie am Park an der Ilm vorbei, und es sind nur wenige Schritte hinein ins Naturidyll und zum Fluss hinab. Dort gegenüber liegt das Gartenhaus, sein Gartenhaus. Es könnte so schön sein, doch die Ahnung schlendert mit, begleitet uns den kleinen Anstieg hoch, am Liszt-Haus vorbei, immer geradeaus, jetzt durch die Marienstraße schnurstracks in Richtung von Goethes Wohnhaus. Ob wohl der alte Olympier in solch einer Situation mehr geahnt oder gar etwas gewusst hätte? Kopfsteinpflaster und von knotigen Wurzeln aufgeworfener Asphalt – man könnte glauben, die Straßen wollten die vielen Fragen nachbilden, die sich in unseren Köpfen und in unseren Gesprächen anhäufen. Nur eine knappe Visite im Zentrum der Goethe-Stadt, diesem Juwel, so viel Zeit muss sein. Kurz das Flair des Klassizismus einsaugen und die Kulturluft schnuppern, selbstverständlich auch den Duft der Thüringer Bratwurst, die ebenfalls zur Kultur gehört. Dann geht es wieder ins Hotel, morgen kommen wir sicher zurück, jetzt aber erst einmal ran ans Thema des Buches.
Ein erstes Gespräch in der Lobby, Einfrotzeln und Abtasten, es läuft. Thesen werden aufgeworfen, kleine Provokationen fliegen hin und her – herrlich, es läuft immer besser! Dann mal ran an … aber an was eigentlich? In diesen wenigen Stunden der Anreise und des Schlenderns durch Weimar gerinnt die Ahnung immer mehr zur Gewissheit, und das Thema des Buches verändert sich. Der ursprüngliche Kern steckt immer noch drin und liegt ihm zugrunde. Doch in erster Linie geht es jetzt um etwas ganz anderes. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft man leben möchte, wenn die Krise zuschlägt. Ob es sich um die Corona-Krise handelt, wie jetzt, oder um andere Formen von Krisen. Wie muss eine Gesellschaft aussehen, wie muss sie verfasst, strukturiert und organisiert sein? Oder neudeutsch: Welches Mindset muss sie haben – möge der Herr Geheimrat den Ausdruck verzeihen –, damit man nachher behaupten kann, die Gesellschaft als Ganze und möglichst viele ihrer Einzelteile seien »gut« durch diese Krise gekommen?
Die Anrufe häufen sich und werden immer länger, erste Unruhe kommt auf. Die Familie, Kollegen, das ZDF in Mainz und die Uni in Augsburg melden sich. Was tun? Bleiben? Abreisen? Und irgendwann platzt es aus einem heraus: »Mensch, damit habe ich nicht gerechnet – du vielleicht?«
Nein, damit hat niemand von uns gerechnet. Gleichungen, Prognosen und Bilanzen, das gehört zu unserem Alltag. Rechnen ist Teil unseres Jobs, ohne Zahlen geht es nicht. Aber aus der zur Gewissheit werdenden Ahnung heraus hätte keiner von uns diese Entwicklungen hinter das Ist-Zeichen geschrieben. Wie auch? Und damit verbinden sich die Fragen nach der besten aller Krisengesellschaften mit einer weiteren, mindestens ebenso zentralen Frage: Wie berechenbar ist das Leben?
Seit Jahren schon geistert in den Diskussionen um Solidarität und Subsidiarität, um Chancengleichheit oder -ungleichheit, um Partizipation und Integration der umgangssprachliche Begriff der »Vollkaskomentalität« herum. Er kann aber auch auf eine existenzielle Ebene übertragen werden: Wie viel Unsicherheit, wie viel Unberechenbarkeit ertragen wir Menschen? Können wir diese Unsicherheit ausschalten? Wie können wir das Leben berechenbar machen, uns versichern und absichern? Gibt es die große Lebensversicherung – vielleicht sogar mit einer Rückversicherung? Und: Was passiert mit uns, was passiert mit der Welt, wenn wir alles zu berechnen versuchen?
Diese Fragen stellen sich seit Jahren, und sie müssen gestellt werden. Nicht erst Corona hat sie neu aufgeworfen. Schon oft haben wir über sie diskutiert, leidenschaftlich, kontrovers, mit unterschiedlichen Ausgangspunkten und anderen Blickwinkeln. Zugleich aber treibt uns die gemeinsame Suche an, das Gefühl, dass manche Dinge nicht mehr passen, dass bestimmte Sachen pervertiert wurden – und dass sich diese Sachen ändern müssen. Wir denken und diskutieren darüber vor dem Hintergrund unserer Fachgebiete, der Astronomie und der Physik, der Wirtschaft und der Ethik. Uns leitet der Wunsch, eine Antwort auf die oben aufgeworfenen Fragen und auf die existenzielle Frage nach der Berechenbarkeit des Lebens überhaupt zu finden – und der Wunsch treibt uns auch in diesen Tagen bei Goethe und den vielen Tagen danach an. In unseren Notizen findet sich eine bezeichnende Bemerkung: »12. März 2020, Deutschland in Zeiten des Corona-Virus. Mein Name ist Harald Lesch, und meine Utopie wäre, dass ein Land genau dann ökonomisch, sozial, ökologisch und was man sich auch immer für Eigenschaften einfallen lassen könnte, richtig funktioniert, wenn alle von alleine das Richtige tun.« Dann, einige Zeilen weiter: »Die Haltung einer gesunden, souveränen Gesellschaft, die mit sich im Reinen ist, wäre diejenige, ruhig zu bleiben, sich anzuschauen, was der Fall ist, cool zu bleiben, auch dann, wenn die Krise länger dauert, und mutig zu werden, wenn es notwendig sein sollte, vielleicht ganz neue Schritte zu gehen. Es wäre eine perfekte Gesellschaft, weil sie offen wäre, weil sie Möglichkeiten hätte, sich weiterzuentwickeln, und nicht abgeschlossen ist, eine Gesellschaft, die Risiken eingeht, aber auch Risiken berechnet und abschätzt – zum Wohle aller.«
Darum ging es in unseren Gesprächen in Weimar, darum ging es in unseren Diskussionen und Debatten vorher und nachher: um das Wohl aller in der Gesellschaft und das Wohl der Gesellschaft als Ganzer. Aber auch um das Wohl des Einzelnen, ganz konkret, alltagstauglich und lebensnah. Aus unserer Sicht, aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers und eines Wirtschaftlers. Wirtschaft und Ethik, okay, das hat sicherlich etwas mit dem konkreten Leben zu tun. Hier geht es um Einkommen, Wohlstand, auch um Moral. Aber Naturwissenschaft? Physik? Noch dazu Astrophysik? – Was bitte soll das denn mit unserem Alltag zu tun haben? Sehr viel, denn die Astronomen waren es, die den Himmel berechnet und ins Kalkül gezogen haben. Die Mechanik des Himmels ist nichts weniger als das Paradies für Vorausberechner. Da klappt das alles perfekt, aber bei uns hier unten auf der Erde auch? Und außerdem lässt sich aus den Prinzipien, die der Physik und der Mathematik zugrunde liegen, so einiges an Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch an Unterschieden ableiten. Und gerade die Unterschiede, die Abweichungen sind wichtig und spannend.
Manche Thesen und Überzeugungen werden provozieren, hoffentlich. Wenn die Thesen zutreffen und die Argumente stimmen, wenn sie sogar »wahr« sind, dann soll das auch so sein, ganz so, wie es Carl Friedrich von Weizsäcker einmal formuliert hat: »Das demokratische System, zu dem unser Staat sich bekennt, beruht auf der Überzeugung, dass man den Menschen die Wahrheit sagen kann.« Wahr, zutreffend, nicht nur in Bezug auf Antworten. Dieses Buch wird Antworten schuldig bleiben und Probleme aufgeworfen und angesprochen haben, vor denen wir auch suchend und mit einer gewissen Ratlosigkeit stehen. Die Suche treibt uns an, nicht die Hybris, alles beantworten zu wollen. Jene Hybris, die so oft und so fatal in unseren Disziplinen, egal ob der Naturwissenschaft oder der Wirtschaft und erst recht in der Philosophie und Theologie, für Ereignisse und Entwicklungen gesorgt hat, die die Welt und unser Zusammenleben für immer verändert haben, meist nicht zum Besseren. Ohne Hybris also, sondern auch hier mit einer Einsicht von Carl Friedrich von Weizsäcker unterwegs: »Die großen Fortschritte in der Wissenschaft beruhen oft, vielleicht stets, darauf, dass man eine zuvor nicht gestellte Frage doch, und zwar mit Erfolg, stellt.« Oder, um noch einmal auf Weimar, auf die Frage nach Berechenbarkeit und Goethe zu kommen: »Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr!« (Faust II). Ein schlauer Mann, der Alte in Weimar, sehr schlau!
Stabile Seitenlage und Puls auf 60: Raus aus der Karussellgesellschaft!
Besuch beim Arzt, die Prozedur kennt man nur zu gut: Na, wo zwickt’s denn? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Sind die vielleicht familiär bedingt? Versuchen Sie sich doch zu erinnern! Ach, und wann waren Sie denn zum letzten Mal beim Arzt? Nur keine Scheu! – Das alles kann routinemäßig und völlig problemlos ablaufen; eine solche Befragung kann aber auch ziemlich anstrengend und unangenehm werden, für beide Seiten. Und doch ist sie fast immer unverzichtbar, diese im Fachjargon Anamnese genannte Befragung, denn sie bahnt den Weg zu einer im besten Fall präzisen Diagnose, die schließlich in eine Therapie mündet.
Die Anamnese wird aber nicht nur von Ärzten bei ihren Patienten angewandt. Sie stellt auch eine beliebte Methode dar, wenn es darum geht, menschliche, soziale Systeme zu analysieren. Auch hier wird nach Symptomen geforscht, auch hier werden Vorbedingungen abgeklopft, und es werden Prozesse und Entwicklungen auf Herz und Nieren untersucht. Ganz ohne Zweifel, das ist zweckmäßig. Und doch möchten wir anders vorgehen, wenn wir uns fragen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Denn die unterschwellige Prämisse der Anamnese lautet, dass der Patient eben ein Patient ist, also krank. Dass er Symptome aufweist und eine Behandlung braucht. Zwar sind wir auch der Meinung, dass unsere Weltgemeinschaft, dass unsere deutsche Gesellschaft und schließlich viele einzelne Existenzen Hilfe oder gar Behandlung brauchen. Nur drängt es sich bei der Methode der Anamnese auf, ausschließlich und exakt zwischen krank und gesund zu unterscheiden. Doch solch eine klare Unterscheidung existiert nicht, wenn wir die Gesellschaft in den Blick nehmen. Tagtäglich sehen wir Symptome, die wir vielleicht als »ungesund« erkennen und erklären können. Aber eine gesunde Gesellschaft im Sinne einer perfekten Gesellschaft hat nie existiert und wird nie existieren. Das Leben – ob wir damit nun das Leben auf unserem Planeten insgesamt meinen oder jenes in unserer Gesellschaft, ob wir das Leben unseres Nachbarn ins Auge fassen oder unser eigenes – ist nie so eindeutig. Es ist weder schwarz noch weiß, sondern oft bunt und manchmal grau. Deswegen können wir es eben auch nicht einfach als gesund oder krank charakterisieren.
Ja, was will sie denn? Ja, was hat er denn?
In den folgenden Kapiteln werden wir auf Dinge zu sprechen kommen – und es werden gar nicht so wenige sein –, die wir harsch kritisieren. Es wird um den sogenannten Turbokapitalismus gehen und um die völlige Ökonomisierung unserer Welt. Wir werden uns mit der Reduktion des Menschen auf sein Funktionieren beschäftigen, als wäre er nichts weiter als eine Maschine, wie Charlie Chaplin das in seinem Film Moderne Zeiten vor Jahrzehnten bereits so wunderbar und weitsichtig karikiert hat. Wir werden einen Blick werfen auf etwas, das wir Streckengeschäftsmentalität nennen, und unseren ausufernden Technikwahn hinterfragen. Und schlussendlich werden wir uns einer bestimmten Betrachtung der Welt widmen, die wir als Excelisierung unseres Lebens bezeichnen möchten, und einer falsch verstandenen Auffassung von Naturwissenschaft. – Was passiert, wenn mathematische Gleichungen auf menschliches Zusammenleben angewandt werden? Was ist das Risiko, wenn physikalische Gesetze zu Handlungsmaximen erhoben werden? Das sind Paradigmen, die von enormer Bedeutung sind und die unser Leben mehr prägen, als uns oft bewusst ist.
Wir kritisieren indes solche Entwicklungen nicht nur, sondern zeigen konkrete Lösungen und alternative Wege auf. Diese Lösungen und Vorschläge könnte man als Therapieschritte oder Medikamente auffassen, doch das wäre aus unserer Sicht anmaßend. Unsere Vorschläge sind nichts anderes als eben Vorschläge, es sind Ideen, keine erprobten Rezepte und schon gar keine Patentrezepte. Und insofern ist es, wenn wir doch an mancher Stelle den Vergleich zu einem Patienten, einem Arzt oder Krankenhaus ziehen, immer unter der Prämisse zu verstehen, dass wir nicht davon ausgehen, unsere Welt sei einfach »krank« und müsse wieder »gesund« werden.
Bei einem Patienten, der zum Arzt kommt und im Anamnesegespräch sitzt, dreht sich zunächst einmal alles um den Einzelverlauf. Bei diesem Einzelverlauf bleiben dem Patienten kaum Alternativen. Er muss sich so verhalten, wie ein Mensch, der krank ist – oder er sträubt sich dagegen und tut so, als wäre er gesund. Ein Kranker, der durch sein Verhalten seine Krankheit leugnet, wird in den meisten Fällen krank bleiben, wenn nicht gar Schlimmeres passiert (wir reden natürlich von ernsteren Fällen mit schweren Verläufen). Betrachten wir die Gesellschaft, sieht das ganz anders aus. Sie ist nicht krank oder gesund, sondern sie besteht aus Gesunden und Kranken, und denken wir an die Corona-Krise, dann besteht sie auch aus gefährdenden Elementen und nicht gefährdenden. Der Satz »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile« greift hier zu kurz. Denn das Ganze ist noch viel mehr ganz, als dass es einfach nur die Summe seiner Teile ist. In unserem Fall stellt sich die Frage: Welches Ganze wollen wir, welche Teile wollen wir – und was gibt es zusätzlich zu der Summe dieser Teile? Was macht das Mehr des Ganzen aus?
Oft war in letzter Zeit von der erschöpften Gesellschaft die Rede. Wenn man abends in der U-Bahn sitzt oder morgens im Bus, dann kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass diese Diagnose auf viele einzelne »Teile« des Ganzen, also der Gesellschaft, zutrifft. Aber ist die Gesellschaft, wenn die Mehrzahl ihrer Teile platt ist, auch platt und erschöpft?
Bleibt man bei unserem Eingangsbild, dann kann man sich unsere Gesellschaft leicht als einen Patienten vorstellen, der die letzten Monate und Jahre immer gearbeitet hat, und zwar full speed. Immer schneller, immer mehr, immer weniger Pausen, am besten immer weniger oder sogar keinen Urlaub und wenn Urlaub, dann eben auch immer full speed. Die Frage nach dem Tempo unseres Lebens wird später noch ausführlich thematisiert werden. Stellen wir uns weiter vor: Dieser Patient wird mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Er wacht auf, und man sagt ihm: »Also, wir haben Sie so weit stabilisiert, aber Sie müssen sich schon im Klaren darüber sein, dass Sie Ihr Leben so nicht weiterführen können. Sie müssen mehr auf sich achten. Sie müssen sich mehr schonen, Sie müssen Pausen machen.«
Ja, was heißt das jetzt genau? Her mit den Medikamenten, und bitte konkret werden!
»Sie werden jetzt erst einmal Betablocker kriegen, damit ihr Herzschlag und Ihr Blutdruck ein bisschen runterkommen. Dann werden Sie natürlich einen Blutverdünner nehmen müssen. Deswegen müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht verletzen.«
Puh, ist das nicht übertrieben?
»Ach, und es wäre gut, wenn Sie so Achtsamkeitsgeschichten machen, Sie wissen schon. Qigong-Training oder irgend so etwas.«
Auch das noch!
Manche Patienten reagieren auf eine solche Situation mit einem entschiedenen: »Pfeif drauf!« Sie klettern wieder rauf auf ihr existenzielles Motorrad und geben weiter Vollgas, als wäre nichts gewesen. Sind wir als Gesellschaft diese Art Patient? Es dürfte bereits angeklungen sein, dass wir eine Gesellschaft für wünschenswert halten, die das Ganze und die einzelnen Teile anders in den Blick nimmt. Eine Gesellschaft, die nicht einfach, wie in der Corona-Krise geschehen, zwischen Gesunden und Nicht-Risikogruppen auf der einen und Kranken und Risikogruppen auf der anderen Seite unterscheidet, auch im übertragenen Sinne. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, die sich dessen bewusst ist, dass auch die anfangs als Nicht-Risikogruppe Eingestuften Schutz, Hilfe, Veränderung brauchen. Die aber andererseits auch nicht die eigenen Fehler leugnet und jene Misstöne nicht überhört, die ganz real sind. Dazu gehört gerade die Full-Speed-Mentalität, ganz unabhängig davon, ob die Gesellschaft nun als Ganzes erschöpft ist oder nicht. Die Symptome, die nicht unbedingt auf eine Erkrankung, aber auf krank machende Fehlentwicklungen hinweisen, sollen nicht ignoriert werden. Der Patient soll nicht sofort wieder aufs Motorrad steigen, sondern sich kurz Zeit nehmen, vielleicht sogar eine Auszeit, um achtsam dafür zu werden, was diese Symptome sind und wofür sie stehen.
Karussellgesellschaft vs. Biergartengesellschaft
Das, was jeder Einzelne braucht, wenn etwas passiert ist, und das, was unsere Gesellschaft gerade jetzt braucht, lässt sich in eine schlichte Formel zusammenfassen: stabile Seitenlage, den Puls auf 60, kein Blutverlust – und danach erst einmal den Ball flach halten. Was hinter dieser Formel steckt, hat einen Namen: Souveränität. Um eine erste Antwort auf die in Weimar so überraschend aufgetauchte Frage, in welcher Gesellschaft wir leben möchten, zu geben und von dort aus unsere Überlegungen weiterzuentwickeln, meinen wir: Eine Gesellschaft, in der wir leben möchten, im Alltag wie auch in der Krise, in guten wie in schlechten Zeiten, eine solche Gesellschaft soll souverän sein. Souverän auch im Sinne einer Unabhängigkeit, was das politische System, die staatlichen Organe und den Einzelnen angeht. Darum soll es aber hier gar nicht in erster Linie gehen, das überlassen wir den Staatsrechtlern. Wenn wir von Souveränität sprechen, dann mehr im Sinne von Gelassenheit – wir müssen selbstverständlich auf Krisen entschlossen, zügig und trotzdem wohlüberlegt reagieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden dabei Fehler passieren, es werden Irrtümer entstehen, das ist menschlich. Wichtig ist es aber – und das gehört zur Gelassenheit und Souveränität –, diese Fehler und Irrtümer angstfrei und offen benennen zu können und zu dürfen. Einen Wissenschaftler, der sich nie irrt, gibt es nicht. Das ist eigentlich fast zu banal, um es hier zu erwähnen, in Zeiten weitverbreiteter Allwissensfantasien ist es jedoch ausnahmsweise angebracht, diese Banalität noch einmal ins Bewusstsein zu heben. Gelassenheit und Souveränität bedeuten, dass Fehler passieren können und dass sie passieren werden, dass aber zugleich vorausschauend agiert wird, dass man mit der Unberechenbarkeit von Fehlern rechnet. Was das im Einzelnen bedeutet, soll in den folgenden Kapiteln diskutiert werden.
Eine souverän-gelassene Gesellschaft, wie wir sie hier anzudenken versuchen, kann vor allem eines: stabile Seitenlage, Puls auf 60, den Ball auch einmal flach halten. Sie ist keine Karussellgesellschaft, in der ständig gebrüllt wird: Wer will noch eine Runde, wer will noch schneller, will noch höher? Und in der diejenigen, die aussteigen, als Feiglinge und Außenseiter stigmatisiert werden, ganz egal, ob sich drinnen alle übergeben, die Fliehkräfte immer größer werden und sich irgendwann die Schrauben lockern und das Karussell auseinanderfliegt. Die Fliehkräfte einer Karussellgesellschaft sind das genaue Gegenteil der Kraft der Gelassenheit und Souveränität.