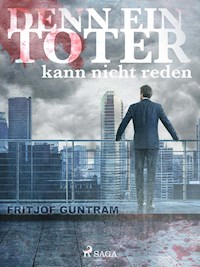Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Peter Dixon seine Reise an die Riviera antrat, wollte er zweierlei: Urlaub machen und an einer Wiederentdeckung eines Gemäldes des spanischen Malers Goya teilnehmen, das auf mysteriöse Weise verschwunden war. Schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft erleben er und sein Freund Michel Blanchard eine peinliche Überraschung: Ein Freund von Michel, ein bekannter Maler, wird tot aufgefunden, und prompt werden die beiden Urlauber verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Ehe Peter sich versieht, ist er in einen der größten Kriminalfälle in der Geschichte der Riviera verwickelt. Wer ist der gnadenlose Unbekannte, der sich mit mathematischer Präzision ein Opfer nach dem anderen aussucht? Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen eiskalten Verbrechen und dem Goya-Gemälde? Fast scheint es so, als habe der Mörder einen Fehler gemacht ... doch Peter erlebt erneut sein blaues Wunder!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritjof Guntram
Und der Tod lacht dazu
Saga
Und der Tod lacht dazuCopyright © 1960, 2019 Fritjof Guntram und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711583074
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1. Kapitel
Es scheint, als wäre der rätselhafte Tod einiger Mitglieder der Künstlerkolonie von Nizza nie aufgeklärt worden, wenn sich nicht zu der Zeit zufällig Peter Dixon, der junge Kunststudent aus London, dort aufgehalten hätte. Und noch heute schwört Peter darauf, daß es weniger sein kriminalistisches Talent war, das ihm half, die Sache aufzudecken, als seine kunsthistorischen Kenntnisse, die ihm gerade mit dem Abschlußdiplom der Akademie bescheinigt worden waren. Die aber, so meint er, hätten allein wohl kaum ausgereicht, um hinter die komplizierte Affäre zu kommen, und es ist auch Tatsache, daß den Ruhm hinterher ein ganz anderer einheimste. In diesem Zusammenhang sei nicht verschwiegen, daß Peter Dixon bei der Entdeckung des Mörders jener französischen Maler einen bemerkenswerten kriminalistischen Spürsinn aufwies, der es zumindest zeitweise zweifelhaft machte, ob der Beruf als Maler für ihn wirklich das richtige war. Wer ihn kennt, der weiß, daß er stets mit einer Bescheidenheit von seiner Rolle bei jenem Fall zu sprechen pflegt, die seiner wahren Bedeutung dabei gar nicht gerecht wird. Aber um dies deutlich werden zu lassen, ist es notwendig, den Fall ganz von vorn zu erzählen.
Es begann mit einem Brief. Peter Dixon hatte gerade sein Abschlußexamen in London bestanden und war zu seiner Familie aufs Land gefahren, als ihn ein Schreiben seines französischen Freundes Michel Blanchard erreichte. Michel war vor etwa einem Jahr in London gewesen und hatte ihn besucht, nachdem sie sich anläßlich eines früheren Aufenthaltes Peters auf dem Kontinent kennengelernt hatten. Dabei hatte er Peter erzählt, er habe in Nizza einen älteren Kunsthändler kennengelernt, der ihn in sein Geschäft aufnehmen wolle. Seitdem war fast ein Jahr verstrichen, ohne daß er von Michel etwas gehört hatte, und nachdem ein paar Briefe unbeantwortet geblieben waren, hatte Peter es aufgegeben, zu schreiben. Nun meldete Michel sich überraschend wieder. Das Schreiben war in Nizza aufgegeben worden und verriet immer noch dieselbe unbekümmerte Art, die Dinge zu sehen, die Michel schon seit jeher ausgezeichnet hatte.
„Mon cher Peter!
Meinen Glückwunsch zum Examen. Ich hätte nie geglaubt, daß Du es noch jemals schaffen wirst. Jetzt bin ich richtig stolz auf Dich. Trotzdem muß ich Dir mein Mißfallen darüber aussprechen, daß Du entschlossen bist, Dein Leben im englischen Nebel und Regen mit dem Anfertigen von ein paar trüben Bildern zu verbringen, denn etwas anderes wirst du bei Eurem Klima wohl kaum hinbringen. Wenn ich Dir dagegen sage, daß heute der vierundzwanzigste Tag ist, an dem hier in Nizza ununterbrochen die Sonne scheint, dann wirst Du mir folgen, wenn ich Dir den Befehl gebe, mit einem Handkoffer, Zahnbürste, Deinem alten Bentley-Sportwagen und einem Scheck Deiner allerhöchsten Herrschaften sofort zu mir zu kommen.
Im Ernst, der Grund ist natürlich ein anderer. Wie ich Dir schon früher mitteilte, kenne ich hier in Nizza einen Kunsthändler, der immer noch mit dem Gedanken spielt, mich zu seinem Teilhaber zu machen, damit ich in ein paar Jahren, wenn er sich zurückzieht, den ganzen Laden übernehmen kann. Ich habe bis heute nicht zugesagt, aber erst recht nicht abgesagt. Wahrscheinlich werde ich es einmal machen, aber für den Moment will ich mir meine Freiheit bewahren. Das versteht der alte Mollet — so heißt der Mann — durchaus, und er versucht nur, mich durch alle möglichen Attraktionen, die er mir in seinem Laden zeigt, für seinen Beruf zu begeistern. Dabei ist ihm nun gestern wirklich ein toller Fisch ins Netz gegangen. Ein alter, etwas verschrobener Notar, schleppte ihm ein verstaubtes Oelgemälde ins Haus und bat ihn, es auf seihen Wert zu prüfen. Mollet löste den Rahmen, und was entdeckt er? Die Signatur Goyas. Das Bild ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein echter Goya. Für heute hat sich Mollet einen Kollegen bestellt, der nachprüfen soll, ob das stimmt. Aber er — und übrigens auch ich — wir sind bereits fest davon überzeugt, daß das Bild echt ist. Das dürfte eine kunstgeschichtliche Sensation ersten Ranges sein, und um Dich daran teilnehmen zu lassen, habe ich Dir geschrieben. Das wäre außerdem die beste Gelegenheit für Dich, den schon länge versprochenen Besuch bei mir abzustatten. Wenn ich Dir etwas Zeit zum Packen und Abschiednehmen lasse, erwarte ich Dich in einer Woche in Nizza. Alles Weitere dann mündlich.
Gute Fahrt, bien amicalement
Michel.“
P. S. Uebrigens habe ich hier ein paar Maler kennengelernt. Alles Typen, die Dir gefallen werden, wenn sie auch bis auf einen, Antoine, nichts vom Malen verstehen.“
Michel.
Da es zu der Zeit, als Peter Dixon diesen Brief erhielt, draußen wirklich regnete, da andererseits die Aussicht, bei der Wiederentdeckung eines echten Goya dabeisein zu können, ihn lockte, setzte sich Peter hin und kabelte an Michel:
„Ankomme voraussichtlich Ende der Woche.
Gruß Peter.“
Danach packte er seinen Koffer, überprüfte an seinem Bentley-Sportwagen Zündkerzen, Ventile, Batterie, Reifen und Bremsen, lockte seinem besorgten Familienrat einen ansehnlichen Reisescheck heraus und befand sich zwei Tage später bereits auf dem Schiff, welches den Kanal in Richtung Calais überquerte. Nachdem er sich an den auf dem Kontinent herrschenden Rechtsverkehr gewöhnt hatte, brauste er in rascher Fahrt durch den Westteil Frankreichs hinunter an die Cote d’Azur.
Genau zu dem ausgemachten Zeitpunkt hielt sein staubbedecktes, in seinem englisch-altmodischen Aeußeren leicht antiquiertes Gefährt vor der Behausung Michels in Nizza. Michel kam, durch den Motorenlärm alarmiert, herausgestürmt, und die beiden führten zur Begrüßung einen wilden Indianertanz auf offener Straße auf, der von einigen älteren Damen mißbilligend betrachtet wurde.
Nachdem sich der erste Sturm der Begeisterung gelegt hatte, führte Michel Peter ins Haus, wobei er mit großen Gesten alles erklärte.
„Voilà, mon appartement“, sagte er und wies auf die altmodische Villa, „erschrick nicht, wenn dir alles sehr feudal vorkommt. So ist nur die Fassade. Die Villa steht seit Jahren leer, weil kein Mensch Lust hat, die hohe Miete zu bezahlen. Ich habe auch nur die Mansarde gemietet, die als Atelier eingerichtet ist. Gib mir deinen Koffer jetzt.“ Sie stiegen die breite Freitreppe empor und betraten die große Eingangshalle. Sie war ehemals sehr vornehm eingerichtet, jetzt aber waren alle Möbel bis auf einen riesenhaften Spiegel entfernt, der vom Fußboden bis zur Decke ging.
„Mein Rasierspiegel“, sagte Michiel mit eleganter Handbewegung. Sie stiegen weiter und kamen im ersten Stock durch eine weitere, etwas kleinere Halle, ebenfalls mit einem großen Spiegel. „Hier kämme ich mich, wenn mir danach zumute ist“, erklärte Michel wiederum und wies dann auf zwei helle Flecken auf der nachgedunkelten Tapete.
„Hier hing Madame, und dort Monsieur. Die Bilder wurden entfernt, als Madame in die Schweiz ging — mit dem Vermögen —, weil man Monsieur mit einer Tänzerin in Paris gesehen hatte. Jaja, so grausam ist das Leben.“ Michel deutete mit der Hand nach oben. „Dort ist mein Atelier.“
Ueber eine schmale Wendeltreppe erreichten sie einen verhältnismäßig großen Raum mit schrägen Wänden, in welche große Glasfenster eingelassen waren.
„Hier ist mein Reich“, erklärte Michel und breitete die Arme aus. „Herzlich willkommen im oberen Drittel von Nizza. Du kannst deine Sachen dort in den Schrank hängen. Daneben ist die Wasserleitung, auf dem Tisch steht der Kaffeekocher, Zigarettenasche kommt auf den Boden.“ Er warf sich in einen Sessel und forderte Peter mit einer einladenden Bewegung auf, das gleiche zu tun.
Peter entdeckte sofort die Staffelei mit einem darauf stehenden, angefangenen Porträt. Es zeigte ein junges Mädchen mit langen, blonden Haaren. Auf seinen fragenden Blick hin erklärte Michel:
„Eine junge Amerikanerin. Das Original zeige ich dir später. Aber wahrscheinlich wird dich erst einmal der alte Goya interessieren.“
„Ganz recht“, sagte Peter, „das heißt, mich interessiert beides. Aber schieß erst einmal los, Michel.“
„Der Goya“, sagte Michel zerstreut und sah sich um, bis er die Wermutflasche entdeckt hatte, „ist echt. Mollet hat ein Gutachten erhalten, demzufolge das Bild tatsächlich von Franzisco Goya stammt und wahrscheinlich um das Jahr 1795 gemalt wurde. Es stellt eine Parklandschaft dar. Du weißt ja, daß Goya damals Kammermaler des spanischen Königs war. Man vermutet, daß es sich um den Park eines spanischen Schlosses handelt. Jedenfalls stellt das Bild einen ganz schönen Wert dar.“
„Und der Eigentümer ist ein Notar?“
„Ja, ein Notar. Uebrigens der größte Sonderling, den man sich denken kann. Ein alter, schrulliger Junggeselle, mürrisch, unverträglich und geizig. Ich glaube, es gibt keinen Menschen hier in Nizza, der ihn näher kennt. Ich habe ihn schon oft auf der Promenade des Anglais gesehen, stets mit einer weißen Leinenjacke, abgetragenen blauen Hosen, einem Schlapphut und einem riesigen Schnauzbart. Manchmal taucht er auch in Villefranche auf, mit einer Staffelei und Leinwand und malt. Er ist ein richtiger Sonntagsmaler, malt furchtbar altmodisch, sehr seelenvoll. Man lächelt über ihn. Aber er besitzt eines der schönsten Häuser von Nizza.“
„Und einen echten Goya.“
„Er sagte Mollet, er habe eines Tages in seinem Dachboden Ordnung gemacht. Dabei fiel ihm das Bild auf, das mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Er nahm es herunter, säuberte es, und weil es ihm gefiel, schleppte er es zu Mollet, damit dieser ihm mitteilte, was es wert sei.“
„Vermutlich hängt es jetzt in seiner Eingangshalle und ist sein ganzer Stolz“, meinte Peter.
„Nein, überraschenderweise nicht. Ich war wie vor den Kopf geschlagen, als ich von Mollet erfuhr, er sei beauftragt, das Bild zu verkaufen.“
„Verkaufen?“ entfuhr es ungläubig Peter.
„An einen Amerikaner“, erklärte Michel. „Deswegen hat Mollet dem Notar versprochen, keinem Menschen weiter von seiner Entdeckung zu berichten. Nach einem in Frankreich gültigen Gesetz ist nämlich der Verkauf von alten Kunstwerken ins Ausland so ohne weiteres nicht gestattet. Außerdem will der Notar nicht, daß die Sache bekannt wird. Deswegen soll Mollet das Bild unter der Hand an einen Amerikaner verkaufen, und ich Unglücklicher bin dazu ausersehen, die Verbindung mit dem Amerikaner herzustellen.“
„Gegen eine Provision?“ mutmaßte Peter Dixon anzüglich.
Michel spreizte die Finger der rechten Hand und hob die Schultern. „Nichts geht umsonst auf dieser Welt. Aber sei beruhigt, ich bin nicht sehr teuer. Und da ich das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden weiß, habe ich mich an die Tochter des von uns ausersehenen Amerikaners herangemacht. Du siehst sie dort im Bilde auf der Staffelei.“
Peter erhob sich und trat vor die Staffelei. Nachdenklich musterte er den Mädchenkopf. Das Bild war gespachtelt. In der Regel werden die Konturen dadurch härter als bei einem gemalten Bild, hier aber schien gerade das Gegenteil der Fall zu sein.
„Sie scheint sehr hübsch zu sein“, erklärte Peter.
„Was heißt ‚scheint‘“, begehrte Michel auf. „Sie ist es. Das Bild trifft sie gar nicht richtig. In Wirklichkeit ist sie viel hübscher. Aber warte nur ab, bis du sie kennenlernst. Sie heißt Diana Hamilton, und ihr Papa ist ein ganz reicher Bursche.“
„Doch nicht etwa der Papier-Hamilton?“ mutmaßte Peter überrascht.
„Ganz recht, der ist es: Hamilton-Papierfabriken, Hamilton-Zellulose, Hamilton-Sägewerke — ein Begriff in fünf Kontinenten. Der kann sein Geld überhaupt nicht zählen.“
„Und den kennst du?“ verwunderte sich Peter aufs neue.
„Nein, aber ich möchte ihn kennenlernen. Komm, setz dich noch einmal. Die Geschichte ist interessant. Ich schrieb dir doch, daß ich hier ein paar Maler näher kennengelernt habe. Es sind insgesamt vier Burschen, Franzosen. Sie haben sich alle vier klingende Namen zugelegt. Basse-le-Bas ist der älteste. Etwa vierzig Jahre, Vollbart wie ich, schwarzes Haar, klein, wendig. Kann alles, nur nicht malen. Der nächste heißt Claude-le-Petit, malt und dichtet, letzteres besser als das erste. Trägt die Haare extrem lang und ist Kettenraucher. Dann kommt Antoine, meiner Ansicht nach ein erstklassiger Maler. Er wird auch der intelligenteste von den vieren sein. Ein hageres, ausdrucksvolles Gesicht, straffe Bewegungen. Er war früher Offizier, noch früher Schauspieler. Ein Gespräch mit ihm ist das Interessanteste, was ich mir vorstellen kann. Nur schade, daß er kaum ein Bild verkauft. Der letzte ist Rhodendron, der jüngste in der Gruppe. Mitte Zwanzig, typischer Beau. Kleiner, eleganter Bart, geht immer hervorragend gekleidet in weißen Anzügen, hat von Haus aus etwas Vermögen. Rhodendron war es, der Diana Hamilton am Strand aufgetrieben hat. Sie war begeistert, einen richtigen französischen Maler kennengelernt zu haben. Er bat sie, sich portraitieren zu lassen. Nun, sie sagte zu und kam in das große Atelier der vier. Jetzt wird sie nicht nur von Rhodendron gemalt, sondern auch von Claude-le-Petit und Basse-le-Bas. Und von mir.“
„Was sagt ihr Vater dazu?“ wollte Peter wissen.
„Der weiß es nicht. Gott sei Dank. Denn sie hat Rhodendron ernsthaft versichert, wenn ihr Vater erfährt, daß er sie malt, bringt er ihn um.“
„So wild?“ lachte Peter.
„Ihr Vater soll ein richtiger Selfmademan aus dem wilden Westen sein“, erklärte Michel. „Wir taten der Kleinen selbstverständlich den Gefallen und nahmen ihre Warnung ernst. Rhodendron allerdings hat die Absicht, sein Bild dem Vater zuzuschicken. Vielleicht bezahlt er etwas dafür.“ Er sah auf seine Uhr. „Uebrigens bin ich mit Rhodendron verabredet, das heißt, ich sagte, ich käme eventuell vorbei. Hast du Lust, mitzukommen? Wenn wir uns etwas beeilen, dann treffen wir Diana Hamilton noch.“
Selbstverständlich hatte Peter Dixon bei dieser Aussicht Lust, und die beiden Freunde machten sich auf den Weg. Das Atelier der vier Maler lag unweit der Behausung Michels in der Nähe des Strandes. Es befand sich im obersten Geschoß eines geräumigen Wohnhauses.
„Die anderen sind heute am Strand und arbeiten, das heißt, sie werden in der Sonne liegen“, sagte Michel aufgeräumt. „Außer Rhodendron und Diana Hamilton wird niemand zu Hause sein.“
Sie stiegen die Treppen hoch.
„Rhodendron rechnet sich große Chancen aus bei Diana“, sagte Michel, „aber meiner Meinung nach ist das Mädchen kalt wie ein Fisch. Freilich, bei soviel Schönheit hat sie das nötig. Und dann ist sie ja Amerikanerin.“
Sie standen jetzt vor der Tür, und Michel klopfte.
„Rhodendron wird nicht sehr viel erreichen“, erklärte Michel und klopfte noch einmal. „Merkwürdig, es scheint niemand dazusein.“ Er lauschte eine Weile, dann klopfte er noch einmal und rief. Als sich nichts rührte, drückte er die Türklinke herunter. Seltsamerweise war nicht abgeschlossen; die Tür ließ sich leicht öffnen und schwang mit einem Aechzen in den rostigen Türangeln nach innen.
„Hallo, Rhodendron!“ rief Michel und sah sich um. Das Atelier sah unaufgeräumt aus. Leinwände, Pinsel, Büchsen mit Terpentin standen herum. Eine Staffelei war umgefallen und lag auf dem Boden. Unter dem Fenster stand ein verschlissenes Sofa, auf dem eine große geblümte Decke lag.
Michel machte ein paar Schritte in den Raum hinein und sah sich um. Auf dem Fensterbrett stand eine kleine Kaffeemaschine mit einem Spirituskocher, auf dem eine kleine Flamme züngelte. Der Kaffee kochte.
Michel wollte gerade etwas sagen, als er zurückprallte. Auf dem Boden lag neben der Couch eine regungslose Gestalt. Es war Rhodendron. Er war tot.
Michel beugte sich über die Leiche und entdeckte eine Wunde im Nacken, aus der etwas Blut gesickert war. Es war offensichtlich, daß sie von einem Einstich stammte. Von einem Messer oder einem ähnlichen Mordinstrument war nirgendwo etwas zu sehen. Er richtete sich auf. „Ich geh’und sage dem Hausmeister, er soll die Polizei holen“, brachte er mit belegter Stimme hervor. „Rühr nichts an, ich bin gleich wieder da.“
Während der zwei Minuten, die Peter allein war, stand er da und versuchte immer wieder, seine Gedanken zu ordnen. Eine Stunde in Nizza, dachte er, und schon ein Mord, ein offensichtlicher Mord. In was bist du da hineingeraten? Der Maler war durch einen Stich in den Hals getötet worden. Er hatte wohl gerade Kaffee getrunken, denn neben den gespreizten Fingern der linken Hand lag noch ein Kaffeelöffel. Seltsam, dachte er, ob er wohl Linkshänder gewesen war?
Draußen ertönten Schritte, und gleich darauf betrat Michel Blanchard den Raum, gefolgt von dem asthmatisch schnaufenden Hausmeister. „Mon Dieu“, erregte er sich sofort, als er die Leiche gewahr wurde, „ein Mord in meinem Haus. Welch ein Unglück, Monsieur, welch ein Unglück! Man wird immer sagen, daß es in meinem Haus geschah. Wie geschah das, Monsieur? Waren Sie dabei?“
Ohne eine Antwort abzuwarten, beugte er sich über die Leiche des Malers. „Ah, dieser Rhodendron, immer hatte er Geschichten mit Weibern. Stets habe ich ihm gesagt: „Rhodendron, laß die Weiber und arbeite lieber.‘ Ich habe mein Leben lang gearbeitet, Monsieur, bin ich vielleicht tot?“
Jetzt erst entdeckte er den immer noch brennenden Kaffeekocher. „Quel malheur“, räsonnierte er wieder, „welches Unglück in meinem Haus!“
Michel sah ungeduldig auf seine goldene Armbanduhr.
„Die Polizei muß gleich dasein“, sagte er.
„Hast du eine Erklärung hierfür?“ wollte Peter wissen.
Michel zuckte die Schultern.
„Keine. Es muß etwas mit Rhodendron und Diana Hamilton geschehen sein. Sie war heute nachmittag bei ihm. Aber was, das weiß ich nicht.“
Draußen ertönten Schritte, und gleich darauf ging die Tür auf. Ein Kriminalkommissar mit zwei Beamten in Zivil und einem Polizisten betrat den Raum. Der Kommissar war ein Mann von etwa vierzig Jahren, mit dichtem, blauschwarzem Haar und einem vollen, massigen Gesicht. Alles in allem, der typische Südfranzose, der trotz seines kompakten Körperbaus über die Leichtigkeit der Bewegungen und das Temperament verfügte, die den Südländer auszeichnen. Er hatte einen wachsamen und intelligenten Ausdruck in den Augen.
Nachdem er den toten Rhodendron kurz untersucht hatte, wandte er sich sofort an Michel Blanchard, während die Beamten in Zivil begannen, das Zimmer zu durchsuchen. „Sie fanden den Toten?“ begann er. „Können Sie mir sagen, wie er heißt?“
„Rhodendron, jedenfalls nannte er sich so. Er war Maler von Beruf.“
„Er lebte doch nicht allein hier?“ Der Kommissar sah sich prüfend in dem geräumigen Atelier um.
„Nein, außer ihm wohnen hier noch drei Maler.“ Michel gab ihm die Namen, und der Kommissar notierte sich alles auf einen alten Briefumschlag, den er aus der Tasche zog. Dann fragte er:
„Wer sind Sie, wenn ich fragen darf?“
„Mein Name ist Michel Blanchard, das dort ist mein Freund Peter Dixon, vor einer Stunde aus England angekommen,“
„Mein Name ist Villon“, stellte sich nun der Kommissar seinerseits vor. „Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie, Monsieur Blanchard. Zunächst, woher kennen Sie diesen Rhodendron?“
„Ich habe ihn vor etwa einem Jahr in einem Café kennengelernt, das heißt, eigentlich nicht ihn, sondern Antoine. Antoine ist ebenfalls Maler und arbeitet auch in diesem Atelier. Wir kamen ins Gespräch, und er lud mich ein, ihn zu besuchen. Das tat ich, und so lernte ich die anderen hier auch kennen.“
„Warum kamen Sie heute hierher?“
„Ich wollte meinen Freund mit Diana Hamilton bekannt machen.“
„Wer ist das?“
„Eine junge Amerikanerin, die zur Zeit von Rhodendron gemalt wird — oder besser — wurde“, sagte er rasch und betrachtete scheu den toten Rhodendron, über den gerade einer der Beamten die geblümte Decke vom Sofa breitete.
„Sie erwarteten, diese Amerikanerin jetzt hier zu finden?“
„Ja!“
„Statt dessen fanden Sie Rhodendron tot auf!“
„Ja.“
Der Kommissar wandte sich an den Hausmeister:
„Haben Sie diese Amerikanerin kommen sehen?“
„Ja, vor ungefähr zwei Stunden ging sie unten an mir vorbei.“
Villon sah auf seine Armbanduhr und sagte:
„Jetzt ist es vier Uhr. Die junge Dame erschien also gegen zwei. Und wann verließ sie das Haus?“
„Nach etwa zwanzig Minuten. Das heißt, sie ging nicht allein.“
„Nicht?“
„Nein, sie wurde von ihrem Vater abgeholt.“
„Woher wissen Sie, daß es Ihr Vater war?“ forschte Villion.
Der Hausmeister wurde sichtlich unruhig.
„Das habe ich sofort gesehen.“
„Woran?“
„Am Gesicht . . . am Aussehen eben.“
„Schön, sie wurde also von ihrem Vater abgeholt. War er sehr erregt, als er sie holte?“
„O ja, ich glaube sogar, daß es einen ziemlichen Streit gegeben hatte. Als sie gingen, machten beide sehr böse Gesichter, und vorher gab es hier oben Streit. Ich habe die Stimmen gehört, aber nichts verstanden.“
„Wo waren Sie zu der Zeit?“
„Unten, im Glaskasten,“
Der Glaskasten war der Raum der concierge, der Hausmeisterin. Es war ein wenige Quadratmeter großer Verschlag, der in den Winkel hineingebaut war, den die Treppe mit der Rückwand bildete. Villon machte ein ungläubiges Gesicht.
„Von dort unten aus wollen Sie Stimmen gehört haben, hier oben im fünften Stock?“
„Es war aber so, Herr Kommissar“, sagte der Hausmeister, und seine Weißen Schnurrbartspitzen zitterten erregt.
Jetzt kam ein großer Mensch mit rotem Gesicht und einer Ledertasche. Peter sah sofort, daß es der Polizeiarzt war. Er begrüßte den Kommissar mit einem kurzen Kopfnicken und machte sich dann an die Untersuchung der Leiche. Schon nach wenigen Minuten packte er seine Sachen wieder zusammen und richtete sich auf.
„Der Tod ist mindestens schon vor einer halben Stunde eingetreten“, sagte er abschließend. „Alles Weitere ergibt sich erst aus der Untersuchung im Institut.“ Er trug sein forsches „Es-wird-schon-wieder-werden-Lächeln“ leicht umflort zur Schau.
Villon wandte sich an Michel Blanchard:
„Wissen Sie, in welchem Hotel diese junge Amerikanerin mit ihrem Vater wohnt?“
„Im Palace Hotel“, erwiderte Michel. Peter Dixon mischte sich ins Gespräch:
„Meinen Sie nicht, daß es gut wäre, jetzt erst einmal die anderen drei Maler zu informieren?“
„Gerade das wollte ich eben sagen“, erklärte Villon verbindlich. „Haben Sie zufällig eine Ahnung, wo die drei Künstler jetzt sind?“
„Ich nehme an am Strand“, sagte Michel zögernd. „Wenn es Ihnen recht ist, werden wir beide sie suchen. Ich nehme sicher an, daß ich sie finde.“
„Damit täten Sie mir allerdings einen Gefallen“, rief Villon erfreut aus. „Ich möchte mir nur vorher noch Ihre Adresse notieren, denn ich werde Sie in den nächsten Tagen aufs Polizeipräsidium bitten müssen.“
Michel gab ihm seine Wohnung an, und dann verließen die beiden das Haus. Peter war froh, als sie draußen in der warmen Nachmittagssonne waren.
„Sag mal“, begann er, während sie die belebte Straße hinunterschritten, „hast du irgendeine Ahnung davon gehabt, daß du Rhodendron tot auffinden würdest?“
„Um Himmels willen, nein“, protestierte Michel.
„Hast du gar keine Vorstellung, was das Motiv für diese scheußliche Tat sein könnte?“
„Wenn du jetzt an Diana Hamilton denkst“, sagte Michel und streifte Peter mit einem raschen Blick, „dann kann ich dir versichern, daß sie bestimmt nichts mit der Sache zu tun hat.“
„Aber ihr Vater“, begann Peter und spann den Gedankengang nicht weiter aus.
„Ich glaube nicht, daß der etwas damit zu tun hat. Himmel!“ rief er plötzlich und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. „Daß mir das erst jetzt einfällt!“
„Was?“ fragte Peter gespannt.
„Antoine ist heute mit dem Auto nach Villefranche hinausgefahren. Er wollte dort draußen malen. Und Basse-le-Bas ist gestern mit dem Schiff nach Korsika hinübergefahren. Daß mir das erst jetzt einfällt!“
„Und der dritte Maler?“ fragte Peter.
„Claude-le-Petit! Der wird an der Promenade des Anglais sein. Dort arbeitet er am liebsten, weil er dort immer von einem Schwarm Ausländer umgeben ist. Er hofft, daß ihm einer einmal ein Bild abkauft.“
Sie schritten eilig voran. Die Straßen von Nizza waren um diese Zeit besonders belebt. Elegante Frauen der großen Welt, ältere Engländer in stockkonservativen grauen Anzügen und Regenschirmen, reiche Amerikaner in farbenfroher Kleidung mit umgehängten Fotoapparaten und Jugendgruppen, die mit neugierigen Augen durch die Stadt streiften.
Die Promenade des Anglais ist der Treffpunkt von Nizza. Wer sehen will und gesehen werden will, geht dorthin. Die Straße zieht sich in sanftem Bogen zwischen dem Meer und den Luxushotels dahin. Auf den Grünstreifen stehen Palmen mit ihren fächerartig ausgebreiteten Blättern.
Schon aus der Ferne sahen Peter und Michel den Maler Claude-le-Petit mit seinem Arbeitsgerät. Er hatte sich nicht weit vom Eingang des Palace Hotels postiert und war von einem Schwarm von Fremden umgeben, die seiner Arbeit neugierig zusahen.
Beim Näherkommen sahen sie, daß Claude-le-Petit mit einer elegant gekleideten Dame sprach, die vierzig bis fünfzig Jahre alt sein mochte. Es war offensichtlich, daß sie Amerikanerin war.
Michel ging hin und mischte sich in die Unterhaltung:
„Pardon, Claude, ich muß dich einen Augenblick sprechen.“
Der kleine Maler sah ihn unwillig an. „Du siehst doch, daß ich beschäftigt bin.“
„Trotzdem“, er sah ihn drängend an. „Es handelt sich um eine Angelegenheit von größter Bedeutung.“
„Also gut!“ Der kleine Maler machte eine entschuldigende Geste der Dame gegenüber und ließ sich von Michel auf die Seite nehmen.
Peter war Michel gefolgt und sah sich nun plötzlich der Dame gegenüber. Einen Moment sahen sie sich verwirrt in die Augen und waren beide unschlüssig darüber, was sie tun sollten. Es war eine jener peinlichen Situationen, in denen man auch bei der besten Erziehung auf Anhieb nicht weiß, was man tun soll. Schließlich deutete Peter eine leichte Verbeugung an und stellte sich vor: „Dixon.“
Die Dame lächelte ihn an und war sich offenbar nicht ganz im klaren darüber, ob das sein Name war. Dann fragte sie:
„Sie sind mit dem Herrn eben gekommen, nicht wahr? Was ist denn so Wichtiges geschehen?“
Sie sprach Französisch, aber mit einem deutlichen Akzent. Peter beeilte sich deshalb, ihr auf englisch zu antworten:
„Es handelt sich um ein Bild, soweit ich unterrichtet bin.“
Er hatte keine Lust, ihr von dem Mord an Rhodendron zu erzählen. Deshalb war er wie vor den Kopf geschlagen, als sie sagte:
„Er malt nicht schlecht, dieser Claude. Aber besser finde ich seinen Kollegen, diesen lustigen, kleinen Franzosen. Rhodendron heißt er, glaube ich.“
„Woher kennen Sie Rhodendron?“
„Oh, man merkt, daß Sie noch nicht lange hier in Nizza stand. Rhodendron war jeden Tag auf der Strandpromenade hier und hat gemalt. Er sieht sehr gut aus, finde ich.“
„O ja, o ja“, sagte Peter verwirrt. Sie fuhr fort:
„Es macht mir immer großen Spaß, zu beobachten, wie er sich an die jungen Mädchen heranmacht. Eine Frau in meinem Alter sieht so etwas gern, verstehen Sie.“
„Jaja, gewiß“, sagte Peter.
„Dabei werden auch bei mir gewisse Erinnerungen wach. Wir Amerikaner sind zwar nicht sentimental, aber wir lieben die Erinnerung. Das kommt wohl daher, weil sie bei uns meistens eine schöne Erinnerung ist.“
„Das ist richtig“, stimmte Peter zu und beobachtete aus dem Augenwinkel Michel, der mit Claude sprach.