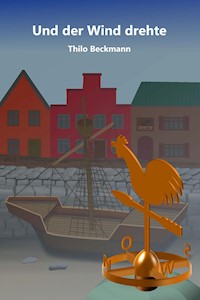
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Heinrich wächst in einer Hafenkneipe auf. Fasziniert lauscht er den Erzählungen der Seeleute. Mit der Zeit kennt er sie alle: die Geschichten von Stürmen, Ungeheuern, gesunkenen Schiffen, verschollenen Mannschaften und vor allen Dingen die Mythen um das sagenumwobene Piratenschiff "Godmund". Und was er weiß, das verkauft er an die Bürger der Stadt. Dabei beginnt Heinrich immer mehr, die Macht seiner Informationshoheit zu missbrauchen. Er lenkt die Geschicke der Stadt aus dem Verborgenen. Als er jedoch die "Godmund" mit der Dänischen Krone in Verbindung bringt, eskalieren die Ereignisse und entgleiten seiner Kontrolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thilo Beckmann
Und der Wind drehte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Und der Wind drehte
Geschichten für Geschäfte
Godmund
Geschichtenkaufmann
Grünland
Geschichten für die Stadt
Echte Kerle
Blutlampen
Freibeuternest
Piraten oder Freibeuter?
Protestanten
Lüstling
Johanna
Geheime Pläne
Feuer und Wasser
Piratenprozess
Gerüchte
Blaukrautsud
Witwenringe
Luise
Kompensation
Herrenringe
Meeressteuer
Hafendirne
Außenstelle Dänemark
Abreise
Lügengeschichten
Spion
Knast
Freiheit
Dem Himmel ganz nah
Zu Hause
Gute Zuhörerin
Die Dänen kommen
Liebe ohne Worte
Piratenfluch
Trockener Fluss
Alle sind weg
Durchs Feuer hindurch
Impressum neobooks
Und der Wind drehte
Es war alles ruhig, der Hafen still, die Straßen verlassen, der Markt leer, der Handel tot. Es gab nichts zu kaufen. Die Händler verließen die Stadt schon am frühen Nachmittag. Die Kasse meiner Mutter war ebenfalls leer auch hier: Ebbe, Flaute. Sie und die ganze Stadt warteten und das Warten dauerte nun schon sehr lange. Es war so, als wäre alles Leben vom Warten müde geworden und irgendwann eingeschlafen.
Aber am Sonntag nach dem Gottesdienst passierte es - endlich: Der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze bewegte sich. Ich beobachtete ihn schon seit Tagen - so wie alle Bewohner der Stadt. Zuerst wackelte er nur etwas hin und her, aber dann drehte er sich. Langsam bewegt er sich weiter und immer weiter, bis er nach Westen zeigte.
„Der Wind hat gedreht – auf Westen!“ rief ich zu meiner Mutter ins Haus hinein. Es war ein gutes Zeichen, denn das Warten schien ein Ende zu haben. Meine Mutter wurde aufgeregt, denn sie wusste, dass sich seit Tagen Schiffe in der Bucht sammelten und auch sie warteten. Nur bei Westwind konnten sie gegen die Strömung des Flusses ansegeln und bis zu unserer Stadt hinauffahren. Ohne Westwind keine Schiffe im Hafen, ohne Schiffe keine Ware, ohne Ware kein Handel, ohne Handel kein Geld in der Stadt und Geld brauchte die Stadt verzweifelt. Auch wir brauchten dringend Geld. Ich würde nicht sagen, dass wir arm waren. Wir hatten bloß kein Geld, nichts zu essen und keine Rücklagen. In unserer kleinen Wirtschaft am Hafen waren alle Vorräte aufgebraucht. Unsere Kunden waren Seeleute. Wir hatten schon ewig keine mehr bewirtet und durch die lange Zeit ohne Einnahmen hatten wir alles selber aufgebraucht. Es war nichts mehr da.
Unsere Stadt lag mehrere Flussmeilen von der Mündung entfernt im Landesinneren. Sie hatte einen großen Hafen und dieser befand sich gut geschützt innerhalb der Stadtmauern. Der Fluss führte nämlich durch die Stadt hindurch. Dort, wo er in die Stadt hineinfloss, war eine Öffnung in der Stadtmauer. Zwei Türme standen an dieser Stelle, einer am linken und einer am rechten Ufer. Wir nannte diese Stelle das „Kleine Flusstor“ auch wenn es kein eigentliches Tor mit Torbogen und -flügeln war. Es gab noch zwei weitere Türme, und zwar dort wo der Fluss wieder aus der Stadt hinaustrat. Dieses war das „Große Flusstor“, denn hier war die Öffnung in der Stadtmauer um einiges breiter. Zwischen den Türmen konnte man ein Kettennetz spannen und so die Stadt abriegeln. Dann waren der Hafen und die Stadt vor feindlichen Schiffen sicher. Die Seeschiffe kamen durch das „Große Flusstor“ in die Stadt.
Doch nun war es endlich soweit. Der Wind hatte gedreht. Endlich Westwind! Nur noch wenige Tage, dann würden die Schiffe aus der Bucht in den Fluss einlaufen und mit der Hilfe des Westwindes von der Flussmündung hinauf zu unserer Stadt segeln. Sobald sie den Hafen erreichten, würden die Seeleute kommen – zuerst ausgezehrt, müde, schwach, oft krank und ohne Geld. Nach einigen Tagen aber würde es ihnen besser gehen. Die Schiffsladung war verkauft. Ihre Heuer würde dann ausgezahlt sein. Sie wären mit dem Notwendigsten versorgt, satt und kräftiger. Nach satt kommt durstig und danach lebenslustig und es bleibt ihnen nur sehr wenig Zeit zum Feiern, denn es sind nur wenigen Tage bis zum nächsten Auslaufen zur nächsten Seereise. Einige wenige Tage nur und die galt es auszukosten, denn auf See hat Geld keinen Wert.
Wir musste vorbereitet sein. Die Wirtschaft meiner Mutter lag direkt am Hafen. Man konnte sie von jedem Schiff aus sehen, welches über den Fluss in die Stadt hineinfuhr. Das war unser großer Vorteil. Wir brauchten keinen guten Ruf und keine Empfehlungen. Unsere Kneipe war der Ort, zu dem man als Seemann hinging - direkt vom Schiff auf die andere Straßenseite, schon war man da. Herzlich willkommen!
Aber jetzt blieb uns wenig Zeit. Der Wind hatte gedreht. Der Westwind war da. Wir brauchten Fleisch, Bier, Rüben, Brot, Kartoffeln. Der Markt war leer, denn die Stadttore waren geschlossen. Heute war Sonntag. Morgen, wenn die Stadt wieder offen sein wird, werden vielleicht einige Bauern mit ihren Waren kommen, solange würden die Seeleute nicht warten wollen und Geld zum Einkaufen hatten wir ja auch nicht. Wir brauchten vorher schon kräftiges Essen.
Ich wurde losgeschickt zur Brauerei. Wir hatten ein kleines Ruderboot. Es lag etwas entfernt vom Hafen flussaufwärts an einem Steg, und zwar an einer Stelle, an der es keine Hafenmauer mehr gab. An der Hafenmauer durften nur die Seeschiffe festmachten. Schnell ging ich dorthin und versuchte, unterwegs weder nach rechts oder links zu blicken. Hoffentlich sah Emilia mich nicht. Ich kletterte ins Boot und beeilte mich abzulegen. Im Boot hatte sich jede Menge Regenwasser gesammelt. Ich nahm mir nicht die Zeit, es auszuschöpfen. Das würde ich später machen, wenn ich weiter vom Flussufer weg wäre. Beim Rudern schwappte das Wasser im Boot hin und her und durchnässte meine Schuhe und meine Hosenbeine. Als ich schon etwas weiter vom Ufer entfernt war, sah ich Emilia wie sie mir hinterherwinkte und rief: „Heinrich, Heinrich!“. Ich tat so, als würde ich sie nicht hören und ruderte weiter den Fluss hinauf. Das ging ja gerade nochmal gut! Ich kam zur Brauerei. Der Braumeister kannte mich schon länger. Er gab mir ein kleines Fass Bier. Bezahlen brauchte ich nicht. Wir hatten Westwind und er wusste Bescheid. Ich würde das leere Fass mit dem Geld in zwei Tagen zurückbringen. Dann würde ich bezahlen. Ich ruderte auch bei der Wassermühle vorbei. Eigentlich konnte man dort kein Mehl kaufen. Die Bauern ließen ihr Getreide dort nur mahlen und nahmen dann das Mehl wieder mit, um es für sich selbst zu nutzen oder es an die Bäcker der Stadt zu verkaufen. Aber der Müller war wie immer durstig. Ich gab ihm etwas von dem gerade abgeholten Bier und durfte die Mühlsteine und die Schütten ausfegen. Das Mehl würde bis Montag reichen und dann war auf dem Markt auch schon wieder reges Treiben. Ich kam wieder in die Stadt mit Mehl und Bier. Emilia hatte die ganze Zeit an meiner Anlegestelle gewartet. Ich machte das Boot fest und warf Mehlsack und Bierfass ans Ufer. Sofort öffnete sie den Mehlsack und schaute herein. „Mehl? Was soll ich mit Mehl? Und Bier? Ich mag kein Bier! Kann ich mich denn überhaupt nicht mehr auf dich verlassen? Nach all‘ dem, was du mit deiner Mutter auf dem Kerbholz hast, solltet du ruhig mal etwas vorsichtiger sein und darauf achten, wie du mit anderen Leuten umgehst. Ich sorge sonst dafür, dass alles herauskommt. Mit Mehl kann ich nichts anfangen. Ich brauche Brot. Oder denkst du, dass ich mich hinstelle und es selber backe? Heute Abend will ich Brot von dir haben!“
Ich antwortete nicht. Ich nahm das Mehl und das Bier und ging schnell nach Hause. Emilia rief mir nochmal hinterher: „Heute Abend will ich Brot von dir haben!“
Ich ging nach Hause. Wie sehr mir Emilia auf die Nerven ging!
Wir brauchten Fleisch. Ich hätte angeln können, aber an Land essen Seeleute keinen Fisch. Wenn doch nur Montag wäre und die Kontore und der Markt geöffnet hätten, dann hätte man Fleisch kaufen können - zumindest theoretisch, wenn man Geld gehabt hätte. Aber meine Mutter wusste sich zu helfen.
Die Häuser der Stadt lagen eng beieinander. Wand an Wand waren sie gebaut und es gab fast keine Zwischenräume. Die einzigen wenigen Lücken in den Häuserzeilen gab es, wenn eine kleine Gasse oder Straße die geschlossenen Reihen unterbrach. Selbst zu den Hinterhäusern und Höfen gelangte man nur durch kleine Gänge, die ebenfalls überbaut waren. Das lag daran, dass die Stadt in den letzten Jahren stark gewachsen war. Durch die Stadtmauer war aber kein Ausbreiten in die Fläche möglich. So wuchs die Stadt in die Höhe und jeder freie Platz wurde zugebaut. Dementsprechend eng und verwinkelt waren die Dächer mit ihren vielen Gauben und nachträglichen An- und Erweiterungsbauten. Dort ging meine Mutter auf die Jagd. Die Taubennester waren überall. Sie benutzte ein Blasrohr. Mein Vater hatte es von einer Seereise mitgebracht. Und da Seeleute sich zwar mit Fischen auskannten, aber nicht mit Vögeln, interessierte es auch keinen, woher sie das Fleisch für ihre delikate Hühnersuppe erhielt. Es war auch bei Nicht-Seeleuten ein Geheimtipp in unserer Stadt, dass, selbst wenn es auf dem Markt schon lange keine Hühner mehr zu kaufen gab, bei meiner Mutter immer eine reichhaltige Hühnersuppe zu haben war. Als sie durch die Dachluke wieder zurückkam, hatte sie fünf Tauben dabei. Sie arbeitete bis in den späten Abend, backte Brot, bereitete die Tauben vor, kochte Suppe und verarbeitete alles, was sie sonst noch an Lebensmittelresten im Haus finden konnte. Bevor sie erschöpft ins Bett fiel, gab sie mir noch ein Stück von dem frischen Brot als Abendbrot. Ich wartete noch einen Augenblick bis sie eingeschlafen war, dann nahm ich das Stück Brot, schlich mich zur Rückseite des Hauses und verließ es leise durch eines der kleinen Fenster. Ich traute mich nicht, die Eingangstür zu benutzten, weil diese so fürchterlich laut quietschte. Ich stahl mich davon. Ich musste das Brot zu Emilia bringen. Es war dunkel. Der Nachtwächter hatte seine erste Runde schon gemacht. Trotzdem war ich vorsichtig. Durch die leeren Straßen ging ich schnell am Hafen entlang zu den Reeperbahnen. Emilia wohnte bei ihrem Onkel und der war Reepschläger. Die Reepschläger brauchten viel Platz, damit sie ihre Reepen auslegen und dann zu den fertigen Hanfseilen zusammendrehen konnten. Deshalb hatte sie ihre Betriebe nicht am Hafen, sondern dort, wo nicht so viel Gedränge und Betrieb war. Ich erreichte Emilias Haus und legte das Stück Brot von außen auf die Fensterbank ihres Zimmers im Hochparterre. Dazu musste ich auf einen kleinen Apfelbaum steigen, der neben ihrem Fenster stand. Wie schon so oft vorher, klopfte ich ans Fenster und verschwand sofort wieder. Ich ging wieder nach Hause, schlich mich durch das Fenster ins Haus hinein. Müde und hungrig schlief ich ein.
Der nächste Morgen kam. Das erste Schiff, das im Hafen festmachte, war eine dänische Kogge. Sie hatte Holz geladen. Danach kam ein heimisches Schiff von einer Seereise aus Russland zurück. Dann folgten Fischerboote, später ein schwedisches Schiff und dann immer mehr große und kleine Schiffe von überall her. Der Hafen füllte sich mit Leben. Die Arbeiter kamen, um die Schiffe zu entladen, Lastenträger brachten die Säcke von den Schiffen in die Speicher, Kaufleute begutachteten ihre Waren, Fuhrwerke holten Kisten direkt von den Schiffen. Es herrschte dichtes Gedränge und es war laut.
Die ersten drei Gäste kamen gemeinsam. Alle drei waren wettergegerbte, langjährige Seeleute. Der älteste von ihnen hatte die anderen beiden mitgebracht. Meine Mutter erkannte ihn und das war gut. Wenn er wiederkam, hatte er beim letzten Besuch bezahlt. Wer nicht zahlen konnte, kam nicht wieder, dafür sorgte meine Mutter. Er war ziemlich dünn und hatte wenige, zerzauste, weiße Haare. Sie schauten wie Stroh unter seinem Kopftuch hervor. Sein Bart war zottelig, sein Gesicht braun und furchig, wie das von allen Seeleuten. Einige Zähne fehlten, die Fingernägel waren rissig, teilweise abgebrochen. So wie er aussah, schätzte ich, dass er mindestens sechs Wochen auf See gewesen war. Der zweite war scheinbar etwas jünger. Auch er war von der Statur dünn, doch hatte er einen aufgeblähten Bauch. Das Weiß in seinen Augen war gelblich und man roch, dass sein Magen schon lange nicht viel mehr als Seeluft zur Verdauung bekommen hatte und diese ließ er sporadisch immer wieder ausströmen. Er hatte deutlich mehr Haare, trug kein Kopftuch, sondern hatte die Haare am Hinterkopf zusammengebunden. Sein Mundgeruch war grauenhaft. Zum Glück redete er nur wenig. Der dritte von ihnen machte noch den gesündesten Eindruck. Obwohl er auch nicht viel jünger war, als seine Kollegen wirkte er fast jugendlich. Ich fand ihn auf den ersten Blick sympathisch. Er war etwas größer als ich, war von der Sonne braungebrannt und hatte blonde Haare. So einen Kerl hätte ich mir immer als großen Bruder gewünscht. Alle drei trugen ihr Seemannsmesser am Gürtel. Sie sprachen nur wenig und schaufelten das Essen, das meine Mutter ihnen vorsetzte, in sich rein. Der Mundgeruch wurde weniger, die Verdauungsgerüche mehr.
Der Ältere biss kräftig vom frischen Brot ab und verlor dabei einen Zahn – den letzten aus der oberen Reihe. Er fluchte kurz, spuckte den Zahn auf den Tisch und aß dann weiter. Der Aufgeblähte, der ihm gegenübersaß, lachte und sagte: „Nicht jammern, Zähne zusammenbeißen!“
Ich fand es lustig, der Alte nicht. Ohne aufzublicken nahm er den Zahn, schnippte ihn in die Suppe seines grinsenden Gegenübers und aß weiter. Zwischen braunen Linsen versank ein brauner Zahn. Etwas irritiert und hilflos suchte der Aufgeblähte mit seinem Löffel in der Suppe herum, konnte aber den Zahn nicht finden. Dabei wurde er immer ärgerlicher.
„Meine schöne Suppe! Kannst du deine gammeligen Zähne nicht in deiner dämlichen Fresse behalten? Ich habe keine Lust, mir von dir den Appetit verderben zu lassen. Diese Suppe zahlst du! Ich bestell‘ mir eine neue. Hier, der Rest ist für dich – und deinen Zahn kannst du auch behalten.“
Entrüstet schob er seinen Teller von sich weg, stieß dabei aber gegen den des Alten. Sein Teller ragte bereits über die Tischkante und fiel nun mit einer Drehung direkt auf den Schoß des Alten. Inhalt nach unten, versteht sich. Seine Suppe lief über die Knie an seinen Beinen hinunter auf den Fußboden. Schade um die schöne Suppe! Jetzt war der Spaß vorbei. Der Alte griff über den Tisch, packte den Aufgeblähten mit der linken Hand am Halstuch, holte aus und versetzt ihm einen Schlag in Richtung Kinnlade. Geschickt wich der Aufgeblähte zurück und wehrte den Schlag mit seinem Unterarm ab. Auch er hatte seinen Kontrahenten jetzt am Halstuch gepackt und mit dem Tisch zwischen den beiden zerrten sie sich gegenseitig hin und her. Der dritte Seemann, der jüngste und braungebrannte, nahm schnell die Teller und brachte das Essen und sich in einiger Entfernung in Sicherheit. Gerade noch rechtzeitig, denn jetzt gelang es dem Alten, den Aufgeblähten über den Tisch zu zerren. Dabei wurde alles vom Tisch geräumt, was sich darauf befand. Mit lautem Krachen fielen beide zwischen Bank und Tisch auf den Boden. Dort wälzten sie sich ineinander verkrallt unter Tischen und Bänken hindurch. Immer wenn sich einer von den beiden aufrichten wollte, um zum Schlag auszuholen, stieß er mit dem Hinterkopf gegen Bank oder Tisch, je nachdem worunter sich die beiden gerade befanden. Meine Mutter schritt nicht ein. Zum einen, weil inzwischen neue Gäste gekommen waren und ihre Bestellung aufgeben wollten und zum anderen, weil die beiden Streithähne noch schwach von der Seereise waren. Es konnte nichts Schlimmes passieren. Für die Gäste war dies außerdem ein interessantes Spektakel, welches für Abwechslung sorgte, solange sie auf das Essen warteten. In der Regel beendeten sich solche Auseinandersetzung nach kurzer Zeit von selbst, weil die Kräfte nachließen. Dann wurde nochmal bestellt, oft auch etwas von dem guten, teuren Schnaps.
Meine Mutter bediente die weiteren Kunden. Inzwischen rollten der Alte und der Aufgeblähte in Richtung Tresen. Meine Mutter stieg mit zwei Tellern Suppe über sie hinweg und bediente die neu eingetroffenen Seeleute. Diese wetteten auf Sieg für den Alten, wegen der größeren Erfahrung und weil er die Initiative ergriffen hatte. Noch mehr Seeleute trafen ein. Der Braungebrannte, der sich an einen anderen Tisch gesetzt hatte, fing plötzliche an zu husten und zu keuchen. Er hatte sich die Suppe des Aufgeblähten geholt und angefangen sie zu essen. Offensichtlich hatte er den Zahn gefunden. Er würgte und würgte und seine Augen quollen ihm aus dem Kopf. Das sah gefährlich aus. Schnell lief ich zu ihm herüber, sprang über seine beiden Kollegen, die wieder in Richtung Raummitte rollten, und boxte ihm mit der linken Hand in den Bauch, während ich gleichzeitig mit der rechten zwischen seine Schulterblätter schlug. Da war er wieder: der Zahn. In hohem Bogen flog er auf den Tisch.
„Danke“, sagte der Braungebrannte, „Ich dachte schon, das wäre meine letzte Suppe gewesen.“ Er legte den Zahn ordentlich auf den Tellerrand und während er weiteraß, fragte er mich: „Mit welchem Schiff bist du denn gekommen?“
„Mit gar keinem. Ich wohne hier.“
„Gibt’s ja gar nicht, in der Kneipe wohnen - Das ist ja wie im Paradies“, sagte der Braungebrannte und grinste. Ich fragte ihn, wie er heiße.
„Klaus“, sagte er „Ich fahre jetzt schon zwei Jahre zur See und wusste nicht, dass man in Kneipen auch wohnen kann. Wie heißt denn du?“
„Heinrich“, antwortete ich, „Meiner Mutter gehört die Kneipe. Ursprünglich hatte sie meinem Vater gehört. Der ist auch lange zur See gefahren. Meine Mutter hat mir erzählt, dass, während sie mit mir schwanger war, mein Vater eine Zeit lang sehr viel Geld von seinen Seereisen mitbrachte. In dieser Zeit haben sie das Haus mit der Kneipe gekauft. Er versprach ihr, dass er nach meiner Geburt mit der Seefahrerei aufhören würde und mit ihr diese Kneipe betreiben wollte. Aber dazu kam es nicht. Noch vor meiner Geburt blieb er auf See. Meine Mutter meinte, sein Schiff wäre bei einem Sturm gesunken.“
„Meinen Vater habe ich auch nie kennen gelernt“, sagte Klaus “vielleicht ja doch, aber dann ohne es zu merken.“
„Wie geht das denn?“ fragte ich.
„Meine Mutter hat ihr Geld auch mit Seemännern verdient. Sie brauchte aber keine dunkle Kneipe wie diese hier. Das dunkle Loch war sie selber“, lachte Klaus. „Na ja du weißt schon. Auf jeden Fall wusste sie auch nicht, wer mein Vater war. Da gab es viele Kandidaten. Was sie allerdings nicht daran gehindert hat, mich jedem als ihren Sohn vorzustellen. Also eigentlich hatte ich ganz viele Väter. Die haben dann alle immer eine Zeit lang Geld dagelassen und für meinen Unterhalt bezahlt. Ich hielt es dann irgendwann zu Hause nicht mehr aus. Das ständige Geschrei und Gemeckere meiner Mutter, die dauernd müde und fertig war, die Schläge, die ich bekam - nur weil ich auch mal bei ihr sein wollte. Irgendwann hält man das nicht mehr aus. Nett war sie nur zu ihren Kunden, die schließlich viel dafür bezahlten. Gebraucht hat sie mich aber schon, wegen der Unterhaltszahlungen. Es ging immer nur ums Geld. Du hast es gut, weil deine Mutter bei dir ist und du mit ihr Zeit verbringen kannst. Das war bei mir nie so. Es ging immer nur ums Geld. Es ging sogar so weit, dass ich meiner Mutter Geld gab, damit sie Zeit für mich hatte und sich nicht wieder mit einem Seemann einschloss. Geld war das einzige, mit dem man sie beeindrucken konnte. Und die Seeleute hatten Geld, viel Geld. Seeleute mit Geld gab es ohne Ende. Irgendwann wollte ich nur noch weg und bin mit einem „meiner Väter“ fortgegangen. Ich habe einfach auf dem gleichen Schiff angeheuert und bin auch Seemann geworden.“
Ich war beeindruckt von Klaus. Irgendwie wirkte er viel erwachsener als ich. Sicher hatte er auch schon viele gefährliche Abenteuer erlebt und viel von der Welt gesehen. Meine Welt dagegen bestand aus einer kleinen Kneipe am Hafen.
Aber er tat mir auch etwas Leid wegen seiner Mutter. Ein bisschen konnte ich ihn verstehen. Wir hatten auch einen Puff in der Stadt. Ich war noch nie dort gewesen, aber die Seeleute erzählten viel davon. So wusste ich genau Bescheid, was dort passierte, oder besser, was die Seeleute behaupteten, was dort so ablaufen würde. Offiziell war es eine Herberge mit dem Namen „Aphrodites Töchter“. Sie lag nicht direkt am Hafen so wie die Kneipe meiner Mutter, sondern in einer kleinen Seitenstraße. Begonnen hatte es damit, dass ein Bauer seine Frau anschaffen schickte, während er in der Stadt Gemüse verkaufte. Weil aber seine Frau viel mehr Geld verdiente, als er mit seinem Gemüse, zog er irgendwann in die Stadt und verkaufte seine Frau. Natürlich wurde sie häufig schwanger. Unter anderem bekam sie zweimal nacheinander Zwillinge, alles Töchter, so dass er diese dann auch verkaufte. Schon bald war für jeden Kunden in diesem Haus was dabei – in allen Altersklassen und nach jedem Geschmack. Meine Mutter verachtete diese Familie abgrundtief. Wir bekamen ja alles mit, was dort passierte. Ein Seemann erzählte, dass er für eine Heuer den jüngsten Sohn einen Tag lang gebrauchen durfte, wie er wollte. Als er zum Schluss kam, war der Junge tot. Er musste Entschädigung bezahlen und die Leiche verschwinden lassen. Wahrscheinlich wurde sie in einem Sack irgendwo von einem Schiff ins Meer geworfen. Es hätte auch niemand erfahren, wenn sich der Seemann nicht im betrunkenen Zustand meiner Mutter anvertraut hätte, als keine Gäste mehr in der Kneipe waren. Meine Mutter entschloss, mit ihren Mitteln gegen „Aphrodites Töchter“ und ihre „Schwestern“ vorzugehen. Nutten kamen bei uns nicht in die Gaststube. Außerdem wurde jeder Seemann, der bei „Aphrodites Töchtern“ war und danach bei uns auftauchte, nicht bedient. Das war nicht schlimm, sie hatten dann sowieso kein Geld mehr. Viel half das nicht, aber die Seeleute besuchten zumindest immer als erstes uns und „Aphrodites Töchter“ bekamen nur noch das Geld, das wir den Seeleuten nicht „abwirtschaften“ konnten.
Die beiden Streithähne hatten sich inzwischen beruhigt und saßen wieder am Tisch. Der Alte hatte sein Ziel erreicht und bei seinem Kollegen einen kräftigen Kinnhaken landen können. Damit war die Sache geklärt. Nun saßen sie wieder beisammen und bestellten noch eine Suppe und einen Schnaps. Klaus hatte wohl gemerkt, dass ich zu ihm aufschaute und hörte nicht mehr auf zu reden.
Er erzählte mir, was er auf See alles erlebt hätte, von Stürmen und Schiffen, die gesunken waren, von Riesenfischen, die größer als Schiffe waren und Wasser aus dem Rücken spucken konnten, von Piraten und von Krankheiten, bei denen man lebendig verfaulte und Nase, Ohren und Finger abfielen, bevor man starb. Ich kannte die meisten Geschichten von anderen Seeleuten. Ich wusste nie so richtig, ob man sie glauben sollte oder nicht. Aber irgendetwas musste ja dran sein, wenn von so vielen Seeleuten das gleiche erzählt wurde. Und interessant war es auf jeden Fall. Offensichtlich gefiel es den Seeleuten, wenn man sie ungläubig anstarrte und sie für das bewunderte, was sie alles erlebt hatten. Auf der einen Seite wollte ich auch gerne solche Abenteuer erleben und dass andere mich ungläubig anstarrten. Aber andererseits hatte ich keine Lust, mich vom Seewasser durchnässen zu lassen, stinkendes Wasser zu trinken, verfaultes Brot zu essen und wenn es dann in irgendeiner Kneipe etwas Anständiges zu essen gibt, fielen einem die Zähne aus. Aber ich liebte es, diese Geschichten weiterzuerzählen. Und das tat ich auch - bei jeder Gelegenheit. Ich wurde dann auch etwas ungläubig angestarrt und man bewundert mich, zwar nicht für das, was ich erlebt hatte, aber zumindest für das, was ich so alles wusste. Ich konnte sogar manchmal bei den Gesprächen der Seeleute mitreden und wenn sie sich gegenseitig mit Geschichten überboten, konnte ich sogar noch etwas drauflegen. Ich kannte immer noch eine Geschichte, die grausiger oder spektakulärer war. Die Seeleute fanden das lustig und manchmal luden sie mich zum Essen ein. Meine Mutter fand das gut. Sie machte mir mein Abendbrot und die Seeleute bezahlten dafür. Deshalb ermunterte sie mich auch, fleißig zu erzählen. Für eine gute Geschichte blieb man auch gerne etwas länger und trank noch ein Bier mehr. Auch das fand meine Mutter gut. Was ich in dieser Zeit lernte, sollte mich mein Leben lang begleiten: Mit guten Geschichten kann man Geld verdienen, auch wenn es nicht die eigenen sind.
Der Tag war inzwischen vorüber und unser ganzes Essen verspeist. Wir hatten soweit alle satt bekommen. Die Seeleute gingen wieder. Geld war genug reingekommen. Meine Mutter war zufrieden. Ein erfolgreicher Tag ging zu Ende. Ich dachte abends noch an Klaus. „Ein netter Kerl“, dachte ich, „Hoffentlich kommt er mal wieder bei uns vorbei.“ Ich dachte noch lange über unser Gespräch nach. „In der Kneipe wohnen - Das ist ja wie im Paradies“, hatte er gesagt. Das war es bestimmt nicht! Was meinte er eigentlich mit Paradies? Wahrscheinlich war Essen, Bier und Geselligkeit alles, was er zum glücklich sein brauchte. Für mich dagegen fühlte sich die Kneipe überhaupt nicht wie „Paradies“ an. Für mich war es eher ein Gefängnis. Na ja, vielleicht ist Gefängnis das falsche Wort. Vielleicht wäre das Bild eines Ankers passend, der sich im Felsen auf dem Meeresgrund verkeilt hat und an deren Kette man sich in einem kleinen Kreis bewegen kann aber doch nicht auf das weite Meer hinauskommt. Ich sehnte mich danach, wie die Seeleute ungebunden zu sein, mit einem Schiff überall hinfahren zu können, draußen zu sein bei Sonne und Wind, herauszukommen aus unserer Stadt. Jeden Tag hörte ich die Geschichten der Seeleute, die so vieles erlebten und andere Länder und Städte gesehen hatten. Sie hatten Abenteuer erlebt. Ich aber saß hier bei meiner Mutter in der Kellerkneipe und kam nicht weg. Ich liebte meine Mutter aber auf der anderen Seite brauchte sie mich und ich fühlte mich verantwortlich für sie, weil sie sonst alleine wäre. Und das band mich an sie. Aber ich konnte doch nicht mein Leben lang hier in dieser Kellerkneipe vor mich hinleben. Ich wollte raus, frei sein, mein eigener Herr sein, raus aufs Meer, die Weite spüren, unter Sternen schlafen. Ich würde all das niemals selber erleben können. Ich wollte auch mit anderen Kerlen Abenteuer erleben, gemeinsam Gefahren meistern, Freundschaften schließen, wie sie nur zwischen Männern möglich sind. Ich hatte keine Geschwister. Ich hätte mir einen Bruder gewünscht, der mich versteht, weil er in der gleichen Lebenssituation wie ich steht und weil er ein Vertrauter auf Augenhöhe hätte sein können. Ich glaube, Seeleute müssten in ihrer Mannschaft so wie Brüder untereinander sein. Ein Schiff voller Brüder. Ich dagegen war Muttersohn, durch fürsorgliche Liebe gebunden und mit der Verantwortung belastet, meine Mutter nicht im Stich lassen zu dürfen. Ein Paradies war das nicht.
Am nächsten Morgen konnten wir auf dem Markt einkaufen. Geld hatten wir nun genug. Ich bezahlte die Brauerei. Wir waren gut gerüstet für die nächsten Abende. Mit dem frischen Geld erweiterten wir unser Angebot entsprechend den Bedürfnissen der Seeleute. Auch ich ging nun abends nicht mehr hungrig ins Bett. Während am Anfang des Landaufenthalts der Hunger das zentrale Thema war und nahrhaftes Essen gewünscht wurde, ging es gegen Ende des Landaufenthalts eher um das Feiern. Wir besorgten mehr Bier, Wein und Schnaps. Das war auch der Zeitpunkt, an dem die besten Geschichten erzählt wurden. Ich freute mich schon auf den dritten oder vierten Tag. Dies war in der Regel der Höhepunkt. Dann wurde besonders viel geredet und beim Zuhören der Erzählungen formten sich Bilder in meinen Gedanken. Es war dann fast so, als würden mich die Seeleute durch ihre Geschichten mit auf ihre Reisen nehmen. Ab dem fünften Tag dann, waren die Schiffe mit neuer Fracht beladen und verließen den Hafen und es wurde wieder ruhig.
Der nächste Tag verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. Wir verdienten gutes Geld. Die Tage darauf wurden lebhafter. Es kamen auch mehr Seeleute. Offensichtlich hatten sich das gute Essen und das gute Bier herumgesprochen. Klaus war auch wieder da. Wir versuchten ins Gespräch zu kommen, was gar nicht so einfach war. Der Laden war voll. Ich musste helfen, Essen und Getränke zu servieren. Außerdem war es laut. Die Seeleute grölten und sangen, einige spielten Karten oder würfelten. Es wurde gelacht, geflucht, geschrien. Die Stimmung kochte. Klaus wollte mich etwas fragen. Es war wohl wichtig, denn er versuchte es mehrmals, aber ich musste arbeiten und konnte ihn sowieso nicht verstehen. Meine Mutter und ich hatten viel zu tun. Beim Hin- und Herlaufen zwischen den Tischen bekam ich einige Gesprächsfetzen mit. Eine Gruppe Seeleute, die ich noch nicht kannte, war wohl bei „Aphrodites Töchtern“ gewesen. Meine Mutter hatte das nicht mitbekommen. Einer von ihnen hatte nicht genug Geld dabei. Deshalb durfte er nur zugucken. Ich lernte bei der Gelegenheit etwas darüber, wie das Geschäft bei „Aphrodites Töchtern“ funktionierte. Wer viel Geld hatte, durfte ein Zimmer mit Tochter mieten. Wer weniger Geld hatte, bekam eine Tochter ohne Zimmer und musste zusammen mit den anderen Kunden und Töchtern in den Stall. Wer nur sehr wenig Geld hatte, durfte lediglich durch ein Fenster in den Stall gucken. Und genau einem aus der Gruppe erging es so. Er war auch der Einzige, der nicht nach Hühnermist roch. Jetzt war er frustriert, weil seine Kumpel von ihren Stallabenteuern erzählten und er sich nur über die Preise bei „Aphrodites Töchtern“ aufregen konnte.
Meine Mutter hatte inzwischen den Topf mit dem langen Stiel aufs Feuer gestellt und den Feuerhaken bis fast zum Griff in die Glut des Ofens gesteckt. Dieser hatte einen Holzgriff, so dass man ihn gut anfassen konnte, auch wenn er heiß war. Ich wusste Bescheid und war entsprechend wachsam. In dem Topf befand sich immer kochendes Wasser. Wir ließen es die ganze Zeit auf dem Herd kochen, bis wir nachts die Kneipe schlossen.
Dann passierte es. Einer der Seeleute, es war der, der nicht nach Hühnermist roch, umklammerte vor allen anderen Seeleuten johlend meine Mutter von hinten, begrabschte und befummelte sie mit beiden Händen. Es gelang ihr nicht, sich seinem Griff zu entwinden. Die anderen Seeleute lachten und grölten. Wird jetzt nicht gehandelt, würde alles außer Kontrolle geraten. Noch mehr Seeleute würden sich an meiner Mutter zu schaffen machen. Und dann wäre der Damm gebrochen. Sie blickte zu mir hinüber, aber das war gar nicht nötig. Ich war sowieso schon alarmiert. Ich warf meinen Teller auf den nächstbesten Tisch und rannte zum Herd, ergriff den Topf mit dem langen Stiel und schleuderte das kochende Wasser aus der Körperdrehung heraus gegen die Beine des Seemanns. So hatte ich es gelernt. Seeleute trugen halblange Hosen, damit diese bei Seegang nicht so nass wurden. Die Waden waren frei. Meine Mutter trug wie immer ihren langen Rock aus grobem Stoff. Er hielt das heiße Wasser von ihren Beinen ab. Aber der Seemann schrie wie am Spieß und bückte sich, um mit den Händen, seine verbrühten Waden zu umfassen. Der Topf mit dem langen Stiel kam erneut zum Einsatz. Mit der flachen Unterseite traf ich seinen Hinterkopf. Er ging zu Boden, aber nur kurz. Ich zog mich zurück. Er rappelt sich auf und stürzte hinter mir her. Ich lief von meiner Mutter weg zum anderen Ende des Raumes. Er hinter mir her, nicht besonders schnell, weil er zwischendurch immer wieder an seine geröteten Waden fasste. Dies gab meiner Mutter Zeit, um zum Herd zu kommen. Ich lief eine Runde durch den Gastraum, der Seemann immer noch hinter mir her. Die Menge johlte. Mir war nicht zum Lachen zu Mute. Mein Herz raste. Mein Magen schnürte sich zusammen. Ich hatte Angst, trotzdem war mein Kopf klar und fokussiert. Ich hielt mich an den Plan und er funktionierte. Meine Mutter hatte es inzwischen bis zum Herd geschafft. Ich lief an ihr vorbei und als der Seemann ebenfalls vorbei wollte, zog sie den Feuerhaken aus der Glut des Herdes. Sie schlug zu. Den ersten Schlag wehrte er ab, indem er reflexartig nach dem Haken griff und versuchte, ihn festzuhalten – der Haken glühte. Er schrie auf, ließ den Haken wieder los. Der nächste Schlag traf seinen Kopf, dann Schulter, nochmal Kopf, Hals, Oberarm, er fiel zu Boden, dann noch ein Treffer auf Rücken, nochmal Kopf und - vorbei.
Er blieb liegen und stöhnte. In der Kneipe war es jetzt ganz still. Meine Mutter schob den Feuerhaken wieder zurück in die Glut. Es herrschte eine ehrfurchtsvolle, irgendwie andächtige Atmosphäre. Ich zitterte und als sich meine Anspannung begann zu lösen, übergab ich mich. Ich kotzte auf den am Boden liegenden Seemann. Ich musste immer erbrechen, wenn es eine heftige Schlägerei oder Messerstecherei gab. Alle starrten den vollgekotzten Seemann auf dem Kneipenboden an. Meine Mutter wusste die beklemmende Atmosphäre zu nutzen und bat zwei sichtlich irritierte Seemänner, ob sie ihren Kollegen bitte vor der Tür ablegen könnten. Sie taten dies etwas widerwillig und angeekelt aber sie konnten auch ihr Mitgefühl nicht unterdrücken, wussten sie doch, was auf ihren Kollegen noch zukam. Mit Brandblasen an den Händen war es schwer, Seile zu ziehen und wenn Salzwasser über das Deck schwappte, sollte man nicht mit verbrühten Waden darin stehen. Er war jetzt von der Sorte Kunden, die nicht wiederkamen.
Mir ging es inzwischen wieder besser. Ich holte Eimer und Lappen und wischte die Reste meines Erbrochenen weg. Während ich den Fußboden schrubbte, schwor ich mir: „Ich muss hier raus! Wenn ich groß bin, werde ich niemals eine Kneipe betreiben und eine Seemannskneipe schon gar nicht!“ Ich bewunderte auf der einen Seite die Seeleute wegen ihrer Stärke und Zähigkeit und wegen der vielen gefährlichen Abenteuer, die sie überstanden hatten, aber auf der anderen Seite wusste ich, dass ich nicht zu diesem derben Schlag Menschen gehörte. Ich war zu schwach und vielleicht fehlte mir auch das Selbstbewusstsein, mich unter ihnen behaupten zu können.
Nachdem ich mit dem Fußboden fertig war, ging ich zu Klaus, der mir ja irgendetwas sagen wollte. Er war noch ein wenig verunsichert und brauchte einen kleinen Moment Zeit, bevor er seine Redseligkeit wiederfand. Er räusperte sich und meinte dann, ich würde ja viel von Seeleuten hören und was so auf den Meeren passierte. Er hätte einen Freund Peter, der auf der „Godmund“ fuhr. Die „Godmund“ war eine besondere Kogge. Sie war mit Kanonen bestückt und so groß, dass eigens einige Soldaten zusätzlich zu den Seeleuten auf ihr mitfuhren, um die Kanonen zu bedienen und so das Schiff gegen Piraten zu verteidigen. Gab es etwas besonders Wertvolles zu transportieren, wurde von den Kaufleuten die „Godmund“ dafür beauftragt. Sie galt auch aufgrund ihrer Größe als besonders sicher und sturmfest. Eigentlich fuhr die „Godmund“ häufig unseren Hafen an und ich kannte auch einige Seeleute, die auf ihr gefahren sind. Diese tauchten gelegentlich in unserer Kneipe auf. Klaus vermisste Peter. Er schuldete ihm noch Geld und eigentlich wollten sich die beiden in unserer Kneipe treffen, um die Sache zu regeln. Peter aber tauchte nicht auf und das schon seit mehreren Westwinden. Früher war er fast immer in unserer Kneipe gewesen. Klaus beschrieb ihn mir. Er war schon etwas älter, nicht sehr groß und eigentlich unauffällig. Woran man ihn aber zweifelsfrei erkennen konnte war, dass sein linkes Ohr fehlte und er keine Haare auf der linken Kopfhälfte hatte. Das kam daher, dass jemand versucht hatte, ihm mit einem Säbel auf den Kopf zu schlagen. Er konnte dem Schlag ausweichen. Trotzdem wurden ihm auf der linken Kopfhälfte Haut und Ohr abgetrennt. Aber Peter überlebte. Klaus fragte mich, ob ich ihn kennen würde. Tat ich aber nicht. Jetzt, da Klaus die „Godmund“ erwähnte, fiel mir auch auf, dass ich sie schon lange nicht mehr im Hafen gesehen hatte. Klaus war sich nicht sicher, ob Peter eventuell etwas zugestoßen wäre oder ob er inzwischen auf einem anderen Schiff fuhr oder ob er ihm bewusst aus dem Weg ginge. Klaus schlug mir ein Geschäft vor.
„Heinrich“, sagte er, „Hier kommen ja alle vorbei. Wenn du herausfindest, was mit der „Godmund“ los ist und wo Peter steckt und wir ihn dazu bringen können, mir mein Geld zurück zu zahlen, beteilige ich dich mit 10%. Ist das ein Geschäft?“
„Abgemacht“, sagte ich.
Abends, nachdem der letzte Seemann gegangen war, kam meine Mutter zu mir und bedankte sich, dass ich ihr mit dem Seemann geholfen hatte. Darüber freute ich mich. Sanft wuschelte sie mir durch die Haare und meinte: „Mein lieber Heini. Aus dir wird nochmal ein richtig guter Wirt, vielleicht sogar von einem schönen Gasthaus am Markt, wo die reichen Bürger und Ratsleute einkehren und wo man seine Gäste nicht verprügeln muss. Das wäre schön.“
In meinen Gedanken tauchte das Bild von einem Gasthaus auf mit einem großen Schild: „Zum lieben Heini“. Ich versuchte schnell, an etwas anderes zu denken. Es war lieb gemeint, aber genau das wollte ich bestimmt nicht. Ich wollte raus. Ich wollte nicht in einer Kneipe geboren werden und dann dort wieder sterben. Ich wollte weg von der Abhängigkeit irgendwelcher Kneipenkunden, die man bedienen musste und für deren Geld man alles tat. Ich mochte es auch nicht, wenn meine Mutter mich „Heini“ nannte. Schließlich hatte ich den Seemann mit dem Kochtopf niedergestreckt. Ich musste zwar wieder kotzen aber trotzdem war ich doch kein kleiner Junge mehr. Meine Mutter brauchte mich. Ich sah mich eher als Partner, ohne den meine Mutter ihre Kneipe nicht betreiben konnte und dafür könnte sie mich ruhig ein bisschen mehr respektieren! Ich musste hier raus, mein eigenes Leben leben und etwas Eigenes aufbauen!
Am nächsten Morgen ging ich am Hafen entlang. Ich schaute mir die Schiffe an, denn ich wollte wissen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gab - neue Schiffe zum Beispiel mit neuer Fracht. Es war noch sehr früh. Über dem Wasser stand der Morgennebel. Alles war ruhig und still, selbst die Möwen machten noch kein Geschrei. Meine Mutter war auch schon wach und machte irgendwas im Haushalt. Später wollte sie noch zum Markt. Um diese Zeit war dort aber noch nichts los. Deshalb hatten wir Zeit. Während ich mir das eine oder andere Schiff ansah, stellte ich mir vor, wie es durch die Wellen des Meeres pflügte und mit geblähten Segeln und schneller Fahrt seinen Weg zu fernen Orten nahm. Ein Gefühl von Fernweh erfasste mich. In Gedanken war ich schon ganz weit weg.
„Heinrich, glaubst du mit einem kleinen Stück Brot kannst du mich abspeisen? Wie kannst du nur so egoistisch sein. Lebst selber wie die Made im Speck und für andere hast du nichts übrig. Lange ertrage ich das nicht mehr mit dir. So kann es nicht weitergehen. Ich will, dass du mich endlich mal ernst nimmst und einsiehst, was für ein mieses Stück Dreck du bist. Heute will ich etwas Anständiges von dir. Bring mir Fleisch!“ Emilia stand neben mir und mit in die Hüften gestemmten Händen meckerte sie mich an. Eigentlich hatte sie keine Hüften, denn sie war fett und trotzdem immer hungrig. Ich hatte sie nicht kommen sehen, weil ich herumgeträumt hatte und ärgerte mich, dass ich nicht aufgepasst hatte. Jetzt musste ich auch noch irgendwie Fleisch besorgen.
„Lass mich in Ruhe“, antworte ich, „Ich besorge dir ja Fleisch. Ich muss jetzt arbeiten“, sagte ich, drehte mich um und ging weg. „Mein Gott, wie sehr geht mir diese Frau auf die Nerven!“
Abends dann stahl ich mich wieder aus dem Haus. Ich hatte den Tag über Fleischreste von den Tellern der Seeleute gesammelt, sofern diese etwas übriggelassen hatten. Auch von den Küchenabfällen meiner Mutter kratze ich Fleischreste ab. Dies alles hatte ich in das Ende eines aufgeschnittenen Brotleibs gesteckt und diesen mit einer Brotscheibe verschlossen. Wie immer erreichte ich Emilias Haus zwischen den Runden des Nachtwächters. Ich kletterte auf den Apfelbaum, legte das gefüllte Brot auf die Fensterbank, klopfte und verschwand wieder. Zuhause legte ich mich in mein Bett, ohne das meine Mutter irgendetwas bemerkt hatte.
Geschichten für Geschäfte
Die 10% von Klaus wollte ich mir nicht entgehen lassen. Fortan hörte ich bei den Geschichten der Seeleute noch genauer hin. Nicht nur wegen der Faszination, die sie auf mich ausübten, sondern nun auch, weil ich ein wirtschaftliches Interesse hatte. Ich merkte mit der Zeit, dass es viele Schiffe gab, die nicht wiederkehrten. Ich versuchte ihre Namen herauszubekommen und versuchte zu behalten, welche Geschichten über sie erzählt wurden. Ich merkte mir, welche Seeleute von den Ereignissen erzählten und auf welchen Schiffen sie fuhren. Das war nicht einfach, denn was die Seeleute erzählten, war selten chronologisch oder strukturiert. Sie erzählten von Stürmen, Havarien, Überfällen durch Seeräuber und von vielen anderen Dingen einfach, um sich gegenseitig zu beeindrucken. Viele Geschichten ähnelten sich und man wusste nicht, ob sie neu waren oder alt oder in Variationen immer wieder erzählt wurden. Man wusste nicht, ob der Erzähler sie selbst erlebt hatte oder nur wiederholte, was er von jemand anderem gehört hatte. Wenn sich die Gelegenheit bot, fragte ich nach und versuchte Fakten, wie Schiffsnamen, Orte und Zeiten zu erfahren. Resultat war, dass ich meist die ausgelassene Stimmung zerstörte, weil ich den Redefluss unterbrach. Deshalb hielt ich mich dann doch lieber zurück. Ich wollte nicht den Anschein erwecken, als ob ich durch das Nachfragen nach Fakten die Glaubwürdigkeit des Erzählers anzweifeln wollte. Stattdessen drückte ich meine Bewunderung und meine Anerkennung für den Erzähler aus und versuchte so, ihn noch mehr zum Erzählen anzuregen. So bekam ich zwar eine Vielzahl an Informationen, konnte sie aber nicht zuordnen. Es war auch einfach viel zu viel, um sich alles merken zu können.
In meinem Kopf herrschte ein riesiges Gewirr an Geschichten. Ich begann Dinge zu verwechseln und vergaß auch viele interessante Details. Das war schade. Alle Geschichten waren interessant. Außerdem hatte ich ja auch einen Auftrag, nämlich herauszufinden, was mit der „Godmund“ geschah und wo Peter steckte. Ich musste etwas ändern und ich beschloss deshalb, dass ich schreiben lernen musste. Ich wollte mir die Geschichten aufschreiben. Ich wollte mir für jedes Schiff eine Sammlung an Informationen zulegen, was an Bord geschah, wer auf dem Schiff mitfuhr und von wem ich die Geschichte hatte. Dies war insbesondere für die Schiffe interessant, die nicht wiederkehrten. Nicht nur Klaus würde jemanden vermissen und sich dafür interessieren, was mit seinen Kameraden geschehen ist. Auch andere Seeleute würden sich dafür interessieren und vielleicht auch Reeder, die nichts über den Verbleib ihrer Schiffe wussten oder Kaufleute, deren Ware nie ankam. Diese Leute würden sich nie mit Seeleuten unterhalten. Außerdem verschwand mit dem Schiff ja auch die jeweilige Mannschaft. Die einzige Chance etwas über den Verbleib eines Schiffes zu erfahren, waren andere Seeleute, die mit ihren verschwundenen Kameraden vorher in irgendeinem Hafen Kontakt gehabt hatten. Es gibt in anderen Häfen bestimmt ähnliche Kneipen, wie die von meiner Mutter. Wenn Klaus bereit ist, Geld für Informationen über ein Schiff und über einen Seemann zu bezahlen, dann waren es Kaufleute oder Reeder bestimmt auch. Bei ihnen geht es ja noch um viel mehr Geld als bei Klaus. Hier ging es um den Verlust ganzer Schiffsladungen oder dem Verbleib der Schiffe selbst. Ich war überzeugt, damit konnte man Geld verdienen.
Ich musste unbedingt schreiben lernen. Ich wusste, dass es in unserer Stadt Menschen gab, die schreiben konnten. Das waren die Mönche. Ich wusste auch, dass sie Schreibstuben hatten und dort nichts anders taten, als Bücher abzuschreiben. Wenn meine Mutter und ich sonntags in die Kirche gingen, sah ich die Mönche immer in einem Seitenflügel des Domes sitzen. Sie saßen da im Gottesdienst und sangen. Wenn sie das taten, bekam ich immer eine Gänsehaut, denn obwohl es so viele waren, klangen ihre vielen Stimmen wie eine einzige. Wenn dann noch die Orgel einsetzte, wurde man von der Musik förmlich durchflutet. Man hörte sie nicht nur mit den Ohren, sondern spürte sie am ganzen Körper. Ich mochte die Gottesdienste. Ich mochte auch den Dom. Er war so riesig, dass ohne weiteres ein paar Schiffe hineinpassen würden. Außerdem sah sein Deckengewölbe ein bisschen so aus, als würde man unter einem umgedrehten Bootskörper sitzen. Ich fragte mich manchmal, ob sich das Heulen eines Sturmes auf See ähnlich majestätisch anhörte, wie die Orgel und ob man sich dann auf See auch so klein fühlte.
Am nächsten Sonntag gingen wir in den Gottesdienst. Auf dem Weg dorthin sagte ich meiner Mutter, dass ich mit den Mönchen reden müsste. Meine Mutter war erstaunt. Ich fragte sie, ob sie einen von ihnen kennen würde. Meine Mutter kannte sich ja sonst auch mit seltsamen Männern aus. Schließlich waren Seeleuten eine ähnlich eingeschworene Männerrunde, genauso wie die Mönche. So sah ich das auf jeden Fall. Sie lachte und meinte: „Nee, mein Lieber, Mönche sind ganz besondere Menschen. Die würden nie zu uns in die Kneipe kommen, und als Frau darf man sie auch nicht im Kloster besuchen. Ich kenne keinen von ihnen.“
Das machte die Sache geheimnisvoll.
„Komm wir reden nachher mit ihnen. Ich will sie kennen lernen“, sagte ich. Aber meine Mutter wollte nicht. Sie machte einen etwas verlegenen Eindruck, also ging ich nach dem Gottesdienst alleine zu dem Ausgang der Kirche, den die Mönche immer benutzten.
Jetzt war ich mir doch etwas unsicher. Sprachen die Mönche überhaupt deutsch? Ich hatte mal gehört, dass sie immer nur Latein sprechen oder Altgriechisch. Vielleicht redeten sie auch gar nicht, sondern kommunizierten über liturgische Gesänge miteinander? Ich stellte mich also an den Ausgang und versuchte zu hören, ob irgendeiner etwas sagte. Die meisten gingen schweigend aus der Kirche, aber zum Schluss kamen zwei, die sich unterhielten. Ich verstand die Worte „Bier“ und „Kessel“, welche offensichtlich Deutsch waren, und so beschloss ich, sie anzusprechen. Beide waren recht jung und trugen Bärte. Der eine hatte sogar einen roten Bart. Ihn sprach ich an: „Kannst du schreiben?“
„Klar“, sagte er und schaute mich etwas überrascht an. „Warum fragst du? Soll ich dir helfen, einen Brief zu schreiben?“
„Nein“, antwortete ich, „Ich möchte schreiben lernen und lesen natürlich auch.“
„Wenn du keinen Brief schreiben willst, warum willst du dann lesen und schreiben lernen?“, fragte er mich.
„Ich möchte mir Sachen über Schiffe aufschreiben, über jedes Schiff, das in unseren Hafen kommt“.
Der Mönch schaute mich erstaunt an. „Das ist aber interessant“, sagte er „Über Schiffe habe wir wenig Bücher. Wir haben was über Astronomie. Ein Bruder von mir forscht auf diesem Gebiet. Das kann man für die Navigation auf See gebrauchen und zur Berechnung von Ebbe und Flut. Aber über Schiffe als solche haben wir nichts.“
„Das macht nichts“, sagte ich, „Ich will nur schreiben lernen.“
„Wenn du willst, kannst du ja morgen mal bei uns im Kloster vorbeikommen, dann zeige dir ein paar Buchstaben und wie man damit Worte schreibt. Ich bin übrigens Bruder Markus. Frag einfach nach mir.“ Ich war begeistert. Das ging alles viel einfacher als gedacht. Ich bedankte mich und lief zu meiner Mutter zurück. Freudig verkündigte ich ihr: „Morgen gehe ich ins Kloster!“ Fragend schaute sie mich an. Ich konnte es kaum erwarten.
Am nächsten Tag ging ich gleich nach dem Frühstück los. In unserer Wirtschaft war nicht viel los. Wir warteten wieder auf Westwind. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um Schreiben zu lernen. Das Kloster lag innerhalb der Stadtmauer und war selbst noch einmal von einer hohen Klostermauer umgeben. Es lag direkt neben dem Dom, in den wir sonntags immer in den Gottesdienst gingen. Es gab aber auch noch eine kleine Kirche dabei, in die nur die Mönche gingen und die Kranken. Das Kloster nahm nämlich auch Kranke auf. Gab es jemanden, um den sich keiner kümmerte, waren es häufig die Mönche, die ihn aufnahmen und pflegten.
Ich klopfte an die schwere Tür des Klosters. Ein alter Mönch öffnete und lächelte mich an: „Was kann ich für dich tun, junger Mann?“
„Ich möchte Bruder Markus besuchen“, sagte ich.
„Na, dann komm mal rein“, antwortete er und zog die schwere Tür so weit auf, dass ich eintreten konnte. Wir gingen einen überdachten Weg entlang, vorbei an Gärten mit verschiedensten Arten von Kräutern, mit Gemüsebeeten und auch mit Obstbäumen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mitten in der Stadt so etwas gibt. Die Stadt mit ihren Straßen war eng und dreckig. Pferdemist lag auf dem Pflaster. Der Wind wehte kalt durch die Gassen. Nur mittags, wenn die Sonne auf ihrem höchsten Stand war, konnte sie kurz in die engen Gassen hineinscheinen. Die Häuser standen so eng, dass man meistens im Schatten ging. Hier im Kloster war alles anders, keine Häuser dicht an dicht gedrängt, sondern Gärten, Bäume, sogar Vögel konnte man hören. Schön war es hier. Ich ging langsamer, weil ich mir alles anschauen wollte. Warm war es auch, denn die Sonne schien über die Klostermauer in den Garten. Alles war irgendwie weiter, heller und wärmer.
„Kommst du?“, fragte mich der alte Mönch, „Bruder Markus müsste drüben in der Schreibstube sein.“
Das klang genau richtig. Am Weg standen mehrere Körbe. Im Vorbeigehen griff der alte Mönch in einen hinein und gab mir eine Handvoll Kirschen. „Hier für dich!“, sagte er. Kirschen gab es zu Hause nie. Meine Mutter kaufte sie nicht, weil sich daraus kein Seemannsessen machen ließ. Außerdem waren sie teuer. Die Mönche waren offensichtlich anders als die Seeleute!
Als wir bei der Schreibstube ankamen, hatte ich die Kirschen schon aufgegessen. Wir gingen hinein und ich sah viele große Tische, auf denen dicke Bücher lagen. Mönche saßen an ihnen und schrieben. Es war ganz still. Jeder arbeitete konzentriert. Ich schaute mir an, wie die Mönche Buchstaben für Buchstaben in die Bücher malten. Manche waren dabei, die Seiten zu verzieren. Sie zeichneten Menschen, Pflanzen und Tiere in die Bücher. Ich war fasziniert. Wir fanden Bruder Markus. Er war auch dabei, ein riesiges Buch zu beschreiben.
„Da ist ja unser Schiffshistoriker“, begrüßte er mich. „Wie heißt du eigentlich? Ich hatte gestern vergessen, dich zu fragen.“
„Heinrich“, sagte ich. Bruder Markus fragte, wie es mir ginge und zeigte mir, war er gerade machte. Er erklärte mir, dass er eine Bibel kopierte. Wort für Wort schrieb er sie von einer anderen Bibel ab. Er würde noch ungefähr sechs Jahre brauchen, bis er fertig wäre. Meine Güte, was für eine Arbeit! Ich sah, wie vorsichtig die Mönche schrieben und wie ehrfurchtsvoll sie die Bücher behandelten. Für mich wurde der Wunsch, schreiben zu lernen dadurch noch viel größer und ich konnte es gar nicht erwarten anzufangen. Schreiben zu können, war in meinen Augen nicht nur nützlich, sondern erschien mir auf einmal auch etwas Bedeutendes, Wichtiges zu sein.
„Welche Wörter willst du zuerst schreiben?“, fragte mich Bruder Markus. Ich überlegte kurz und sagte dann: „Mutter, Kneipe, Schiff“. Bruder Markus lächelte, nahm ein Stück Papier, welches zur Hälfte beschrieben, aber durch einen Tintenklecks unbrauchbar geworden war und schrieb mir die drei Wörter hintereinander darauf. Ich machte mich gleich an die Arbeit und malte die Wörter ab. Ich schrieb sie jeweils unter das Wort, welches ich als Vorlage hatte. Zuerst musste Bruder Markus mir noch zeigen, wie man mit der Feder und dem Tintenfass umging. Aber das lernte ich schnell. Als nächstes ließ er mich Worte schreiben, die ähnlich klangen wie zum Beispiel: Tier, Gier, Bier oder Haus, Maus, Laus. Schnell erkannte ich den Unterschied zwischen den Wörtern und lernte so beim Schreiben die unterschiedliche Bedeutung der Buchstaben kennen. Ich ging fast jeden Tag ins Kloster und jeden Abend kam ich mit einem Fetzen Papier nach Hause, der vollkommen vollgeschrieben war. Ich überlegte mir, welche Wörter ich brauchte und fragte Bruder Markus, wie man sie schrieb. Viele konnte ich mir auch bald schon selber zusammenstellen. Bruder Markus hatte immer Zeit. Das kannte ich nicht. Zuhause gab es so viel zu tun, dass ich manchmal das Gefühl hatte, meine Mutter gar nicht zu kennen. Müsste ich ihren Charakter beschreiben oder ihre Interessen, Sehnsüchte und Wünsche, wüsste ich nicht, was ich sagen könnte. Wir sprachen darüber nicht. Bei Bruder Markus war das anders. Bevor wir uns an die Schreibarbeit machten fragte er mich immer, wie es mir ginge, was ich den Tag über getan hätte und ob ich zufrieden damit wäre. Zuerst wusste ich nicht so richtig damit umzugehen, aber dann gewöhnte ich mich daran und fand es schön, dass sich jemand für mich interessierte. Es schien mir so, als ob man immer vor dem Schreiben ersteinmal sicherstellen müsste, dass alles in Ordnung wäre und man sich wohl fühlt. Danach fingen wir an zu schreiben. Manchmal standen wir einfach schweigend nebeneinander an dem Schreibpult von Markus und während er seine Bibel weiter kopierte, konzentrierte ich mich auf meine Schreibübungen. Das schien alles völlig normal zu sein. Auch die anderen Mönche in der Schreibstube behandelten mich so, als ob ich schon immer mit Bruder Markus zusammen an seinem Pult gestanden hätte und mit ihm schreiben würde. Ich fühlte mich so wie einer von ihnen. Bruder Markus erklärte mir das Schreiben genauso, wie sich auch die Mönche untereinander Dinge erklärten. Sie brachten sich ständig gegenseitig irgendwelche Dinge bei. Mir tat das gut. Ich fühlte mich erwachsen.
Ich war oft im Kloster und erzählte meiner Mutter gelegentlich, was ich schon gelernt hatte. Meine Mutter meinte, ich würde noch ein richtig gebildeter Herr werden. Ich glaube, das war etwas Gutes. Auf jeden Fall machte mir das Schreiben Spaß und ich fing an, mir die Sachen aufzuschreiben, die ich über die Schiffe hörte. Ich notierte mir zuerst den Schiffsnamen, danach die Namen der Seeleute, die auf diesen Schiffen fuhren. Dann machte ich mir Stichworte zu den Dingen, die die Seeleute erzählten. Kannte ich den Namen des Seemannes, kannte ich auch das Schiff und konnte die Erzählungen zuordnen. Wurde von einem anderen Schiff erzählt, wusste ich, welche Seeleute darauf fuhren und wusste, wer mir aus erster Hand berichten konnte. Durch eine Nummerierung versuchte ich die Geschichten in eine logische Reihenfolge zu bringen. Ich war überzeugt, dass das System funktionierte.





























