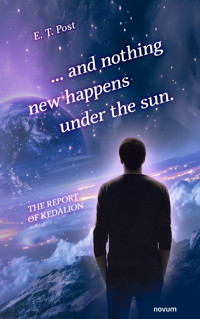17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marcos Kedalion weiß Erstaunliches, berichtet, was er als Poserichs Freund erfuhr und erlebte, berichtet vom Einfluss unbekannter Mächte auf Menschenschicksale, von Grenzen des menschlichen Willens, von der Wandlung der Erde, einem geheimnisvollen Volk, von urzeitlichen Dramen und Tragödien, von Geheimnissen in der Wildnis Sibiriens, blutigen Kriegen, aber auch von Liebe und Glück bis hin zu einem Angebot, zeitlich unbegrenzt bei den Sternen zu leben. Und zeigt, wie sich alles, bis heute, immer wiederholt, wenn auch mit Nuancen durch die allgegenwärtige Macht der Zeit. Doch im Wesentlichen geschieht nichts Neues unter der Sonne …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-623-8
ISBN e-book: 978-3-99130-624-5
Lektorat: Mag. Eva Reisinger
Umschlagfotos: Worawee Meepian, Yulia Ryabokon | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
meinem Sohn Benedikt, dem stillen Diener des Herrn
... und geschieht nichts Neues unter der Sonne
Nun, da ich, Marcos Kedalion, alt und gebrechlich zum Ende meines Weges komme, will ich die Bitten eines wissbegierigen Freundes erfüllen und aufschreiben, was ich von einem geheimnisvollen, mythischen Schicksal erfuhr und zum Teil miterlebte. Von dem Schicksal eines Jägers und bisweilen auch Gejagten, dem Schicksal meines Freundes Poserich Ohrionn. Es ist Erstaunliches, bisher nie Gehörtes. Ich spürte den Einfluss der Vorsehung, erkannte die stete Wiederholung bereits Geschehenen über alle Epochen der Menschheit und die erbarmungslose Macht der Zeit. Steht doch schon in einem Buch, geschrieben nach der Entstehung der Welt: „Das Wesen, das keinen Anfang und kein Ende hat, das immer war und immer sein wird, das alles schuf, maß allem und jedem seine Zeit.“ Die Menschen spürten bald ihre erbarmungslose Unbezwingbarkeit und riefen flehend: „Muss das wirklich sein?“ Aus den unendlichen Tiefen des Alls kam die Antwort: „Ja, es muss!“ Und in einem anderen alten Buch steht: „Ein jegliches hat seine Zeit und alles hat seine Stunde “ Das wird wohl so sein. Also schreibe ich, bevor meine letzte Stunde naht, schreibe, damit überlebt, was ich weiß.
Poserich stammte aus einer alten Jägersippe und Jagen war unser beider Passion. In einem kleinen Freundeskreis war sie ein unerschöpfliches Reservoir für leidenschaftliche Diskussionen und faszinierende Erzählungen. Saß ich aber mit ihm allein in seinem gemütlichen Heim, erzählte er mir von seinem Leben und seiner Familie. Es waren diese Abende, die mich mit seinem Schicksal verwoben. Nun sitze ich an seinem Schreibtisch und schreibe meine Erlebnisse und Erinnerungen. Es begann alles weit zurück in der Zeit vor der Zeit. Doch ich will mit Poserichs Geburt beginnen.
Sein Vater musste im zweiten großen europäischen Krieg Soldat werden, kämpfte in Frankreich, wurde verwundet und kam zur Genesung heim. Als bekannter Jäger wurde er, nachdem es ihm etwas besser ging, von den örtlichen Parteifunktionäre zur Jagd verpflichtet. Sein Lohn war das kleine „Jagdrecht“, die Innereien. Meist nahm er unbemerkt noch Träger, Bauchlappen, Rippen und manchmal sogar die Lenden mit, wertvolle Nahrungsmittel für seine Familie in der damaligen Hungerzeit.
An einem grauen Novembertag hatten ihm die örtlichen Machthaber wieder befohlen, ein Reh zu schießen. Mit seinem alten, „ausgemusterten“ Auto fuhr er zu einem Hochsitz an einer Waldwiese, sah aber schon von weitem einen Mann dort sitzen, grummelte „Wilderer, die Leute haben Hunger“, bog ab und fuhr tief in den Wald zu einer überdachten Leiter an einem Kahlschlag. Mit schmerzender Wunde erklomm er mühsam den Sitz, richtete sich ein und wartete auf Wild. Der Wind frischte auf, Kälte kroch in die Kleider. Fröstelnd suchte er immer wieder die Brache ab, sah aber außer einem missmutig herumschnürenden Fuchs nichts. Die Zeit verstrich, nichts rührte sich, bis plötzlich eine Amsel neben ihm zeternd aus einer Dickung flog und laut protestierend die Brachfläche überquerte. „Ein Zeichen für Wild?“ Tatsächlich schob sich aus den Fichten neben ihm eine Ricke, sicherte lange und zog dann gemächlich auf der Fläche zu Brombeersträuchern. Er wollte sicher sein, dass sie kein Kitz führte, wartete mit dem Schuss. Es wurde langsam dunkel. Im letzten Büchsenlicht kam aus dem gegenüberliegenden Wald noch ein Reh. Ein Kitz, wohl das der Ricke. Als es breit stand, schoss er. Es war weg, wie vom Erdboden verschluckt. Die Ricke machte ein paar Fluchten, verhoffte, sicherte, näherte sich hin und her ziehend dem Anschuss. Atterich wusste, das Kitz liegt, und er hat die Chance auf viel Fleisch, wenn er auch die Ricke schießt, doch nur das Kitz abliefert. Er schoss! Das Reh brach zusammen. Er zog es in die Dickung, brach es auf, zerwirkte es grob und versteckte das Fleisch im Kofferraum unter dem Kitz. Bei der Rückfahrt sah er den Wilderer sich über einen Sack ducken, nickte: „Schon gut, lass dich nur nicht erwischen!“ In der Parteizentrale lieferte er wortkarg das Kitz ab und fuhr zufrieden lächelnd nach Hause.
Im Hausflur hörte er Babygeschrei, stellte hastig Waffe und Rucksack in einen Schrank, lief ins Schlafzimmer, sah seine Frau. Sie hielt blass aber mit einem zufriedenen Lächeln einen schreienden Säugling im Arm. Neben ihr standen sein Sohn und eine dicke Frau mit einer blutbefleckten Schürze. Sie deutete auf das Kind: „Ein Knabe!“ Er schob sie zur Seite, küsste seine Frau, nahm freudestrahlend das Baby und drückte es vorsichtig an sein stoppelbärtiges Gesicht. Das Kind verstummte, tastete nach seinem nassen, verwitterten Mantel. Seine Großmutter hatte erzählt, er habe sich gegenüber seinem Vater und sein Vater sich gegenüber dem Großvater ebenso verhalten. Sein Erstgeborener hatte weiter geschrien. Während er das Kind in die Arme seiner Frau zurücklegte, verkündete er stolz: „Das wird ein großer Jäger!“ Die Mutter seufzte: „Ich ahnte es.“ Lange blickte er auf den Knaben. Dann entschied er: „Poserich – ja, Poserich –, so soll er heißen.“ Seine Frau wusste, solche Entscheidungen sind endgültig, der Name wohl Teil seiner Familienlegende.
Nachdem die Hebamme gegangen war, weckte Atterich das Rehfleisch ein. Weit nach Mitternacht verbarg er das Fleisch im Keller und staunte über die Wintervorräte seiner Frau: Eingemachtes Obst, Marmeladentöpfe und Gläser mit Zuckerrübensirup standen in einem Regal. Kartoffel lagen in einer Ecke auf gestampfter Erde neben einem mit Erde bedeckten kleinen Haufen Möhren. In Kisten waren Weißkohl-Köpfe gestapelt, an Fäden hingen getrocknete Pilzscheiben. Überall standen noch große tönerne Töpfe, gut verschlossen, und natürlich Mausefallen. Was fehlte, war ein ausreichender Holzvorrat. Zurück in der Küche briet er die Lenden und brachte sie mit Brot ins Schlafzimmer. Der Säugling schlief ruhig in der alten bemalten Holzwiege, in der auch schon sein Vater und er gelegen hatten. Er schob seiner Frau ein Kissen unter den Rücken, gab ihr den Teller. Erst zögernd, dann hungrig, aß sie, während er, über die Wiege gebeugt, vorsichtig die kleine Hand des Säuglings streichelte. Als das Kind seinen Finger fasste, murmelte er gerührt: „Gott schütze dich! Viel ist dir in die Wiege gelegt.“
Atterich konnte seiner Frau noch zwei Wochen helfen und auch den Holzvorrat „organisieren“. Dann musste er wieder zu seiner Einheit. Einer Eingebung folgend, sandte er vorher noch das von seinem Vater geerbte, wertvolle Jagdgewehr zu Verwandten in den Westen. Bei dem Regiment erhielt er eine Auszeichnung und wurde an die Ostfront verlegt. Der folgende Winter wurde bitterkalt. Seine Familie kam einigermaßen gut durch, fror und hungerte kaum. Für sie war es ein „guter“ Kriegswinter; für Atterich nicht.
Die Heeresgruppe, zu der Atterichs Regiment gehörte, war weit in russisches Land vorgedrungen, musste sich wieder zurückziehen, sollte dabei aber nachrückende russische Verbände aufhalten und grub sich in einer endlos erscheinenden Steppe ein. Ungenügend gegen den bitterkalten russischen Winter gerüstet, erkrankte Atterich. Die Erkältung wurde zur Lungenentzündung. Sein Leben schwand. Ein hoher Sanitätsoffizier, der in ihre Stellung verschlagen wurde, versuchte, ihm zu helfen, blieb aber ohne adäquate Medikation und Unterbringung erfolglos. Als der Arzt vor seiner Weiterfahrt den Kranken noch einmal besuchte, phantasierte Atterich im Fieber von einer Jagd in Masuren, seiner Heimat. Der Offizier, ebenfalls Jäger, hatte dort auch viel und erfolgreich gejagt, fühlte sich mit dem kranken Jäger verbunden, befahl kraft seines Ranges die Verlegung in ein Lazarett und nahm ihn warm eingepackt in seinem Wagen mit. Sie kamen glücklich aus dem umkämpften Gebiet, Atterich in ein Lazarett und nach seiner Genesung wieder an die Front.
Im nächsten Jahr wurden die deutschen Armeen weiter zurückgedrängt. Bei den verlustreichen Rückzugsgefechten kämpfte Atterich an vorderster Front, kämpfte jetzt um seine Heimat. An einen Sieg glaubten er und die meisten Kameraden nicht mehr. Trotzdem leisteten sie, stark dezimiert, verzweifelt Widerstand. Bei einem nächtlichen Gegenangriff wurde Atterich von seinem Trupp getrennt, musste auf dem Rückweg an einem sowjetischen Posten vorbei, der wie schlafend an einem Ufer saß. Als er in der Nähe des Mannes war, riss der, hellwach, Atterich zu Boden und versuchte, ihn mit dem Bajonett zu töten. Poserichs Vater wehrte sich verzweifelt. Dabei rutschte aus seinem Hemd ein uraltes Amulett seiner Ahnen. Der Mann hielt spontan inne, starrte auf den stilisierten Skorpion, ließ Atterich los und das Bajonett fallen. Beide verharrten sekundenlang bewegungslos. Vorsichtig zeigte der Soldat auf das Amulett: „Du Yamai, verschwinden, schnell!“ Der Jäger huschte davon.
Im folgenden Winter hungerten und froren die deutschen Soldaten erbärmlich. Die Frontlinien brachen ein. Die Armeen wurden zerschlagen und zurückgeworfen. Der Krieg war verloren. Das Regime meldete trotzdem weiter Erfolge und Fanatiker Durchhalteparolen. Atterich kam mit den Resten der ehemaligen Invasionsarmee in seine Heimat, krank, erschöpft, zerlumpt, hoffnungslos. Er wollte zu seiner Familie, wollte noch einmal den kleinen „großen Jäger“ im Arm halten. Wegen seiner Auszeichnungen wurden ihm ein paar Stunden gewährt. Poserich sah seinen Vater mit einem Holzpferdchen an einer Schnur durch den Flur kommen. Es stand auf einem Brett mit Rädern, war weiß-schwarz gefleckt und hatte einen Schweif aus Hanffasern. Der Vater gab ihm die Schnur, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sich. Den Geruch, den Poserich damals spürte, vergaß er nie. Er roch Schnee, Eisen und einen dumpfen, süßlichen Geruch, dem er später als Ministrant in den Sterbezimmern bei letzten Ölungen wieder begegnete. Das geliebte Holzpferdchen blieb bei der Flucht zurück. Später sah er ein ähnliches Spielzeug in einem „alternativen“ Laden, kaufte es. „Es ist ein Geschenk“, sagte er etwas verlegen, war aber für ihn.
Am Ende des kurzen Besuchs beschwor Atterich seine Frau: „Die Russen werden kommen. Sie sind erbarmungslos! Ihr müsst fliehen! Flieht! Flieht, so schnell wie möglich, flieht nach Westen!“ Poserichs Mutter wollte sofort los, hatte von einem Schiff gehört, das Frauen und Kinder in Sicherheit bringen soll. Doch sie wusste nicht, wie sie mit ihren kleinen Kindern zu dem weit entfernten Hafen kommt. Ihr war nur ein Fahrrad geblieben. Atterichs altes Auto war doch noch „eingezogen“ worden und Straßenbahnen oder Busse fuhren schon lange nicht mehr. Fliehen? Ja, aber wie? Trotzdem packte sie den großen, schweinsledernen Koffer ihres Mannes, legte warme Kleidung, etwas Proviant, ihren Schmuck und Atterichs Jagdpistole hinein. Er hatte ihr geraten, sich zu erschießen, bevor Russen sie in ihre Gewalt brachten. Zuletzt holte sie noch ein dickes, altes Buch. An ihrem Hochzeitstag hatte Atterich mit großem Ernst verlangt: „Dieses Buch darf nie verloren gehen! Nie! Es gehört nicht mir und auch nicht meiner Familie. Es wurde uns vor vielen hundert Jahren anvertraut und wird irgendwann zurückverlangt.“ Atterich behütete das Buch wie ein Heiligtum und hatte, als Poserich ein Jahr alt war, verlangt: „Nach meinem Tod soll der kleine Jäger das Buch bekommen und es hüten, wie ich es tat. Was auch passiert, bewahre es für ihn.“ Mit zitternden Händen verschloss sie den Koffer, band ihn auf das Fahrrad, nahm die Kinder und lief überall hin, wo andere Frauen auch hinliefen. Doch es gab keine Fluchtmöglichkeit. Das Schiff war unerreichbar und einen Marsch über das zugefrorene Meer würden die Kinder nicht überstehen. Verstört, erschöpft und hoffnungslos kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Tage verstrichen. Der Holzvorrat war verbraucht. Kälte breitete sich aus. Verzweifelt saß sie nachts neben ihren schlafenden Kindern. Dann stand plötzlich ihr Mann im Zimmer, zog die Vorhänge zu und flüsterte: „Ich habe mich weggeschlichen. Merkt man es, werde ich erschossen.“ Er schloss sie in die Arme: „Ich weiß von einer Fluchtmöglichkeit, wohl der letzten. Morgen Früh, um drei Uhr, fährt ein Zug nach Westen, der letzte, für alle viel zu klein. Am Hauptbahnhof wird es einen brachialen Kampf beim Einsteigen geben. Dort hast du mit den Kindern keine Chance, aber am Güterbahnhof. Dort wird der Zug zusammengestellt, dort musst du heute Nacht spätestens um zwei sein. Frag nach Fritz Mutat. Er ist Rangierer und mein Freund. Er wird dich in den Zug setzen.“ Er verlangte noch: „Verlasst auf keinen Fall im Zug euren Platz, bevor ihr nicht hinter den feindlichen Linien seid.“ Atterich küsste seine Frau und verschwand. Nachts, gegen eins, ging sie los. Den Jüngeren hatte sie auf den Koffer gesetzt, der auf den Gepäckträger geschnallt war, den Älteren auf den Sattel. Vor Kälte und Angst zitternd schob sie das Fahrrad durch knöchelhohen Pulverschnee zum Güterbahnhof. Nach einem Blick auf die Kinder ließen die Wachen sie passieren und an einem Stellwerkhäuschen fand sie Fritz Mutat. Einen langen, hageren Mann mit Schnauzbart und warmen, gütigen Augen. Ihm fehlte der rechte Arm. Mutat brachte sie in ein Abteil. Es war eiskalt, doch sie waren aus dem scharfen Wind. Den Koffer schob sie unter den Sitz. Poserich nahm sie auf den Schoß und seinen Bruder setzte sie zwischen sich und das Fenster. Das Fahrrad war auf einen Gepäckwagen geworfen worden. Sie glaubte nicht, es je wieder zu bekommen. Nach und nach wurden noch weitere Frauen mit Kindern und ein paar alte Leute in den Zug gebracht. Um halb drei rangierte er kurz und fuhr zum Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig, den daneben liegenden Gleisen und auch noch dahinter drängten sich in spärlicher Beleuchtung Menschenmassen. Noch bevor der Zug stand, stürmten sie die Waggons, stießen und zerrten sich gegenseitig von Trittbrettern und Türen. Männer, meist alt oder verkrüppelt, brüllten, Frauen kreischten, Kinder schrien in Panik. Poserichs Mutter starrte angstbleich durch das Fenster. Plötzlich fielen Schüsse. Einen Moment erstarrte die tobende Menge. In die Stille schrie ein Offizier: „Frauen mit Kindern zuerst, wer sich widersetzt, wird erschossen.“ Kommandos ertönten. Soldaten bahnten sich mit Gewehrkolben einen Weg durch die Menschenmassen und stellten sich neben die Waggontüren. Das zeigte Wirkung, doch nicht lange und das Gezerre und Gedränge begann erneut. Als auch Gänge und Plattformen des Zuges überfüllt waren, zogen die Soldaten die Menschen gewaltsam von den Trittbrettern und verriegelten die Türen. Der Zug fuhr jedoch nicht sofort ab. Die Soldaten blieben an den Türen oder patrouillierten am Zug entlang. Die Zurückgebliebenen resignierten nach und nach. In dem überfüllten Abteil hielt die Frau ihre Kinder fest an sich gedrückt. Als sie unwillkürlich aus dem Fenster blickte, sah sie in die Augen ihres Mannes. Er stand dicht am Zug, versuchte zu lächeln, drückte eine Handfläche an das Zugfenster und deutete auf Poserich. Sie hob ihn ans Fenster, er stemmte seine kleinen Fäuste dagegen und lachte hell auf. Nun lächelte auch sein Vater. Als Poserich nicht mehr lachte, war ihr Mann verschwunden. Sie drückte ihr Gesicht gegen die Scheibe, suchte nach ihm, sah jedoch nur fremde Gesichter, ängstlich, zornig, apathisch. Der Zug setzte sich stoßend und quietschend in Bewegung. Die Gesichter zogen immer schneller vorbei, wurden weniger und der Bahnsteig war zu Ende. Sie hatte ihren Mann und Poserich seinen Vater zum letzten Mal gesehen. Die Scheiben vereisten in dem ungeheizten Zug. In beklemmender Dunkelheit verharrten die Menschen still und bewegungslos. Angst herrschte, Angst vor Artillerie und Flugzeugen; Angst vor dem Tod. Doch sie kamen davon; Atterich nicht.
Poserichs Vater lag am Rande der Stadt – tot. Eisiger Wind wehte Schnee über seinen zerfetzten Körper. Seine Entfernung von der Truppe war verraten worden. Ein Standgericht hatte die sofortige Erschießung angeordnet. Sein Kompanieführer suchte es zu verhindern, kommandierte ihn unmittelbar nach dem Urteil zu einer Meldefahrt ab. Das war eine winzige, aber die einzige Chance. Alle wussten es, auch Atterich. Nach dem Krieg erzählte der Leutnant Poserichs Mutter: „Ich beobachtete Ihren Mann bei der Fahrt an den feindlichen Linien entlang. Er wurde beschossen, wohl auch verletzt. Dann schlug eine Granate neben ihm ein, riss ihn vom Motorrad und schleuderte ihn auf die Straße. Nachts versuchte ich, seinen Leichnam zu bergen. Als ich ihn wegziehen wollte, spürte ich etwas in seiner Hand, sein Amulett. Ich wusste, wie wertvoll es für ihn war. Im selben Moment wurde ich beschossen, musste fliehen.“ Der Leutnant meinte tröstend: „Er ist verblutet; da hat man kaum Schmerzen.“ Poserichs Mutter flüsterte in sich gekehrt: „Er sah in einem Traum seinen Tod so voraus, wie Sie ihn schildern. Nur das Ende war anders. Da war er von der Straße aufgestanden und zum Ufer eines Sees in seiner Heimat gegangen. Im Sternenlicht kam ein großer Hirsch aus dem Wasser, verwandelte sich in einen mächtigen Skorpion, sagte: ‚Komm, du wirst mitgenommen. Ich bringe dich zu den Deinen.‘ Er stieg auf den Rücken des Tieres und glitt mit ihm zu den Sternen.“ Der Leutnant murmelte: „So ein Tier sah ich auch, als Ihr Mann starb. Damals glaubte ich, ich sehe Gespenster.“ Er holte das Amulett aus der Manteltasche, legte es auf den Tisch, drückte ihr lange die Hand und ging.
Als Poserich 16 war, gab ihm die Mutter das Amulett: „Für deinen Vater hatte dieses kleine Gebilde große Bedeutung, war neben dem alten Buch sein wertvollster Besitz. Jäger seiner Sippe verwahren es schon seit Hunderten von Jahren und Jäger der Sippe sollen es weiter verwahren. So sei es bestimmt, sagte er. Er war überzeugt, du wirst ein Jäger, und vermachte das Amulett dir, wie schon das alte Buch. Er glaubte, dass es für dich so wertvoll sein wird wie für ihn.“Sie reichte ihm den kleinen „Glücksbringer“ und versank in Gedanken. Nach einer Weile sah sie ihn so ernst und forschend an, dass er erschrak: „Du wirst doch ein Jäger, hütest das Amulett, wie er es tat, und gibst es auch am Ende deines Weges deinem Sohn – dem, der Jäger wird. Versprich es!“ Er versprach es.
Unsere kleine Jagdgemeinschaft traf sich regelmäßig, verabredete Jagden, tauschte Neuigkeiten und Erlebnisse. Poserich war unter uns nicht nur der erfolgreichste Jäger, sondern auch der brillanteste Erzähler. Seine Berichte wurden in unseren Köpfen zu Filmen. Wir animierten ihn oft, von seinen Erlebnissen zu berichten. Tat er es, bannte er uns mit bildgewaltigen Schilderungen und versetzte uns in jagdliches Geschehen, als seien wir unmittelbar dabei. Ich glaubte ihm – fast – alles. Bei manchen allzu abenteuerlichen oder ungewöhnlichen Erlebnissen meinte ich dann doch, es blitze Schalk in seinen Augen oder ein verschmitztes Lächeln husche über sein Gesicht. Ein bisschen „Jäger-Latein“? Vielleicht? War er doch voller Phantasie, lebensfroh, meist heiter, zum Scherzen bereit, doch stets auch empfindsam und empathisch. All das stand in einem verblüffenden Kontrast zu einem anderen, eher beängstigenden Wesenszug. Er konnte in eine unbeherrschbare Leidenschaft gleiten. Deren harmloserer Teil war eine überbordende Begeisterung, die sich aber in Verbindung mit seinem zeitweise aufschäumenden Temperament zu einem „taumelnden Verlangen mit unendlicher Sehnsucht“ wandeln konnte. So beschrieb er den Überschwang seiner Gefühle trefflich selbst und sprach ironisch von seiner ekstatischen Seele. Staunend erlebten wir diese Zustände. Sie verschwanden meist schnell, immer harmlos, ohne Folgen. Doch dann war es anders. Plötzlich war er von einem fernen Land gebannt, von Taiga und Tundra zwischen Ochotskischem Meer und Laptewsee, von den dort lebenden Menschen, dem Wild, den Bergen, Seen und Flüssen. Er sprach bei jeder Gelegenheit davon. Mir erzählte er einmal fast ängstlich, er wisse nicht, wie dieses Verlangen in ihm entstand. Es habe plötzlich von ihm Besitz ergriffen. Ihm schien dieser Zustand noch unheimlicher als uns. Er sträubte sich dagegen. Aber ein unwiderstehlicher Zwang zog ihn nach dort. „Dort“ bedeutete, wie er auf einmal lokalisierte, das ostsibirische Bergland, etwa das Werchojansker Gebirge oder was dahinter liegt. Sein ganzes Denken und Trachten waren nun dort. Er hatte nicht einmal mehr Interesse an der Jagd. Wir waren konsterniert und beschlossen, er müsse von dieser Obsession befreit werden, legten zusammen und kauften ein Flugticket nach Jakutsk. Das schenkten wir ihm im Juni. Damit hatten wir für ihn gehandelt. Er musste sich nicht mehr entscheiden. Wir hatten abrupt herbeigeführt, was sowieso geschehen wäre. Er wurde wieder ausgeglichen, sogar fröhlich. Im Sommer reiste er ab und kam erst nach fast zwei Jahren zurück. Doch es war nicht mehr „unser“ Poserich, nicht mehr der, den wir kannten.
Vor der Reise war er eine beeindruckende Erscheinung, schlank und drahtig, lebhaft und flink, leichtfüßig, mit gleitenden Bewegungen. Bewegungen, die manchmal an die Zeitlupengänge des Steinwilds oder an die Schleichschritte der Großkatzen erinnerten – faszinierend! Bei Treffen, ob in der Stadt oder im Wald, hatte er mich oft durch seine plötzliche Anwesenheit erschreckt. Auf einmal war er da, wie und wo er herkam? Keine Ahnung! Beunruhigend war, dass ich nie wusste, wie lange er schon hinter oder neben mir gestanden hat. Beruhigend war, dass es anderen genau so ging. Fühlte ich mich beobachtet, blickte ich oft in sein gelangweiltes Gesicht. Ein Gesicht mit einer gleichmäßig bräunlichen Farbe, hohen, etwas breitstehenden Wangenknochen, einer Adlernase und schmalen, beinahe schwarzen, meist fröhlichen Augen. Bei so einer Begegnung schimpfte einer von uns halb verärgert, halb bewundernd: „Der ist wie eine Katz.“ Das wurde sein Spitzname. Er war fortan: „Die Katz“.
„Die Katz“ war nicht „reich“, hatte aber ein kleines Vermögen, das ihm ein angenehmes, unabhängiges Leben erlaubte. Nebenbei verdiente er als studierter Mineraloge noch regelmäßig hinzu. Bei seinen überschaubaren Bedürfnissen und seiner wenig aufwändigen Lebensführung konnte er sich eigentlich alles leisten. Und wenn er wieder „flüssige Mittel“ angesammelt hatte, gönnte er sich auch mal richtig viel. Aus meiner von einem stressigen Beruf mitgeprägten Sicht führte er ein bequemes, meist glückliches Leben. Doch nur meist. Denn ich spürte auch, manchmal fehlte ihm nicht etwas, sondern jemand. Jemand, der mehr als Bequemlichkeit und Ordnung schafft, wie seine fröhliche Hauswirtschafterin. Es fehlte ihm eine Partnerin, eine Geliebte – eine Frau, die ihm in einer engen menschlichen Beziehung Wärme und Liebe bringt, Emotionen weckt. Jemand, dem er vertraut, dem er seine intimen Gefühle und Leidenschaften zeigen kann. Eine Frau, die ihn „verssteht“. Doch eine so tiefe Bindung wollte er nicht mehr. In früher Jugend war er in zarter, scheuer, kindlicher Liebe einem gleichaltrigen Mädchen zugetan. Das war wohl seine einzige glückliche Beziehung zum anderen Geschlecht. Als junger Mann lebte er im Gebirge, war leidenschaftlich in ein einheimisches Mädchen verliebt, die kurz vor der Hochzeit in einer Lawine starb. Danach vereinsamte er. Viele Jahre später erlitt er eine tiefgehende Enttäuschung, eine brutale Ernüchterung, die sein künftiges Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht prägte. Er war in einer romantisch verklärten, hingebungsvollen Liebe einer älteren, temperamentvollen Schauspielerin verfallen. Sie nutzte ihn aus, verschleuderte sein Geld, stellte ihn dann in der Öffentlichkeit als Narr hin und amüsierte sich, wenn er verspottet wurde. Tief enttäuscht mied er seitdem, fast ängstlich, jede emotionale Bindung zu Frauen. Er begegnete denen, die sich mehr als nur kameradschaftlich für ihn interessierten, zurückhaltend, ja unnahbar. Er war und blieb allein. Seine Mutter war vor Jahren gestorben, der Bruder ebenfalls tot. Sonstige Verwandte hatte er nicht. Doch er hatte uns. Bei uns war er ein fröhlicher, manchmal spitzbübischer und scharfzüngiger, aber stets treuer, hilfsbereiter und großzügiger Kamerad. Bisweilen, wenn seine ekstatische Seele durchbrach, konnte er auch richtig verschwenderisch werden. Wir mussten ihn dann in seiner Freigiebigkeit bremsen, schon weil wir nicht wussten, wie wir uns revanchieren sollten – was er zwar nicht erwartete und auch nicht wollte, uns aber bedrückte. Sicher hätte er sich auch das Flugticket selbst leisten können, wenn er denn gewollt hätte. Aber dieses „Wollen“ war damals noch nicht da. Zu größeren Unternehmungen, wie eine Sibirien-Reise, hatte er eigentlich keine Lust. Das war ihm zu „aufwändig“, wie er es formulierte. Seine Jagdreisen erstreckten sich nicht über Europa hinaus. Er wollte keinem Dolmetscher, Reiseleiter, Jagdführer oder irgendwelchen Zeitplänen ausgeliefert sein. Ich glaube, er vermied alles, was ihn auch nur kurz abhängig machte. Mit unserem Geschenk beschleunigten wir dann das ohnehin Unvermeidliche und überwanden den Zwiespalt seiner Gefühle. Glücklich machte uns das nicht.
In einem stadtnahen kleinen Dorf hatte er ein schmuckes Häuschen mit Bauerngarten und Jägerzaun, in dem ein geräumiges, verträumtes Zimmer der häusliche Mittelpunkt war. Durch ein breites Fenster blickte man an einem alten Kirschbaum vorbei auf eine große Wiese vor einem Nadelwald. Abends traten dort Rehe aus, ästen, schufen ein friedliches, romantisches Bild heiler Natur. In der Mitte des Zimmers standen an einem Couchtisch zwei bequeme Sessel, in einer Ecke unter einer Bogenlampe ein gemütlicher, feinlederner Ohrensessel und neben einem Tischchen ein zierlicher Schaukelstuhl. Zum Fenster hin stand sein massiver Schreibtisch mit einem abgewetzten „Chefsessel“. Auf den leise knarrenden Dielen lagen dicke Teppiche, an den Wänden standen Regale, gefüllt mit einer erlesenen, wertvollen Büchersammlung. Hinter den Büchern verwahrte er in einem kleinen Tresor seinen wertvollsten Besitz, das alte Buch und das Amulett seines Vaters. Als er sie mir einmal zeigte, erzählte er, wie sie zu ihm kamen.Das Buch war faszinierend, dick und schwer mit einem abgegriffenen, ledernen Einband. Die Blätter waren aus Büttenpapier, Pergament, Papyrus und Materialien, die ich nicht kannte. Einige Seiten waren mit steinzeitlichen Zeichnungen bedeckt, andere mit kappadokischer oder altassyrischer Keilschrift, wieder andere mit hethitischen, luwischen oder ägyptischen Hieroglyphen. Auch Runen, altgriechische oder kyrillische Schriftzeichen waren zu sehen. Neuere Aufzeichnungen waren in Latein und Althochdeutsch geschrieben. Nur die gemalten oder geschriebenen Zeichen ließen eine chronologische Ordnung erkennen. Bei den anderen Blättern war eine dominante inhaltliche oder zeitliche Zuordnung nicht möglich. Zum Teil wurden sie wohl schon öfter auf neue Trägermaterialien kopiert und dann irgendwo eingefügt. Poserich hatte, als er mir das Buch reichte, tiefernst, beinahe andächtig gesagt: „Das soll die Chronik meiner Sippe sein und mein Schicksal soll auch in ihr stehen. Doch ich kann leider nur wenig entziffern. Das müssen irgendwann Gelehrte für mich tun.“ Nicht nur diese Chronik, die gesamte Bibliothek war für mich eine faszinierende Fundgrube, stets ein Grund, bei ihm „vorbeizuschauen“. Meine spontanen Besuche dauerten dann oft von nachmittags bis nach Mitternacht. Wir diskutierten bei so mancher Flasche Rotwein über „Gott und die Welt“, Geschichte und Gegenwart, wälzten tiefgründige Probleme, tauschten heitere Begebenheiten und Erlebnisse. Es war eine Zeit voller Nachdenklichkeit und Esprit, eine Zeit der Bücher und des Weins. Damals erfuhr ich viel aus seinem Leben.
Nach seiner Rückkehr aus Sibirien veränderte sich Poserich. Er wurde schwammig, bekam einen Bauch. Sein früher schwarzes, dichtes Haar ergraute, fiel aus. Was blieb, waren die Bewegungen, denen er seinen Spitznamen verdankte, und manchmal ging er auch noch mit uns jagen – ohne Passion. Vor seiner Reise war er ein großartiger Jäger. Der beste und waidgerechteste, den ich kannte, geduldig und ausdauernd. Er konnte einem bestimmten Stück Wild tagelang in schweißtreibender Pirsch und durchfrorenen Nächten folgen. Hatte er dann das Stück endlich vor der Büchse, konnte er es doch verschonen, wenn es vielleicht zu jung war oder noch einen Fortpflanzungszyklus durchlaufen sollte oder weil der heimliche Spießer schon ein paar Zentimeter „zu hoch auf hatte“. Er freute sich trotzdem. „Die Jagd“, sagte er dann, „die Jagd und nicht die Beute zählt.“ Seine Schilderungen des Geschehens, bis hin zum beutelosen Schluss, wurden dann wieder eine seiner spannenden und lebhaft diskutierten Geschichten mit „wenn“ und „aber“, dem Einbringen eigener Erfahrungen und dem von anderen Gehörten. Nach solchen Abenden waren wir manchmal so erschöpft, als wären wir selbst erst von langer Jagd heimgekehrt.
Dann kam sein „Halali“ – Jagd vorbei. Der große Jäger Poserich wurde nicht „dahingestreckt von wildem Keilers Zahn“. Nein, sein Tod war undramatisch – aber geheimnisvoll. In Erinnerungen versunken, seines Daseins müde, verschwand er aus unserer Welt. Wir hatten es kommen sehen, wollten es verhindern, schleppten ihn mal zu einem Essen, mal zum Stammtisch oder auch zu einer Jagd. Wenn er denn mitging, was immer seltener vorkam, war es uns zuliebe. Eigentlich wollte er nur noch ungestört bei seinen Erinnerungen und Träumen sein. Ich wusste das. Mir hatte er erzählt, was er erlebte. Ich mochte es zunächst nicht glauben, vermutete eine seiner nicht ganz so wahren Geschichten. Es war so mysteriös. Doch ihm war tatsächlich in zwei langen Wintern und einem Sommer im wilden Nordosten Russlands etwas widerfahren, was ihn unnachgiebig festhielt, nicht mehr losließ. Die Leidenschaft, die ihn in diese menschenferne Gegend gezogen hatte, schenkte ihm viel, von dem er annahm, es nie mehr zu bekommen: Liebe, Hingabe, Zärtlichkeit, Augenblicke tiefster Zufriedenheit und umfassenden Glücks. Doch trafen ihn dort auch qualvolles Unheil und grausames Leid. Von all dem erzählte er mir, während seine Zeit sich dem Ende zuneigte:
Bis Jakutsk kam ich mit eurem Ticket, fuhr dann mit einem alten Versorgungsschiff gemächlich die Lena hinab nach Zhigansk. Dort sollte ich meinen Guide treffen, den mir ein alter Jakute, der wie bestellt bei befreundeten Russlanddeutschen auftauchte, vermittelt hatte. Der Mann sollte mich im Hotel abholen. Diese Unterkunft war ein schlichter Holzbau mit einfacher Ausstattung und einer akzeptablen Gaststätte. Ich wartete drei Tage auf ihn. Als er schließlich erschien und ich ihn auf seine Verspätung hinwies, erklärte er etwas grimmig, Termine wären ihm lästig. Er habe keine Uhr und wolle auch keine. Die würde ihm nur „Zeit klauen“. Dass er den Kalender kannte, glaube ich schon, dass er sich daran orientierte, glaube ich nicht. Er meinte, es sei doch ziemlich egal, ob wir heute oder in einer Woche aufbrechen. Ankommen würden wir schon.
Mein künftiger Begleiter war ein besonderer, etwas sonderbarer Mann. Er sah aus wie eine Mischung aus Sioux und Inuit mit leicht mongolischem Einschlag, hatte schmale, nachtdunkle Augen, war von mittlerer Statur, schlank, sehnig. Sein schwarzes, glattes Haar war in der Mitte gescheitelt und hing in Zöpfen hinter den Ohren herunter. Der dünne Oberlippenbart reichte bis übers Kinn. Bekleidet war er mit einer derben Stoffhose, einem verwaschenen Hemd und einer weichen Lederjacke. Als eine Art Mantel trug er ein langes, fast haarloses Fell-Cape. Die Füße steckten in gefütterten Gummistiefeln und in der Hand hielt er eine Mütze aus Otterfell, ähnlich einem Helm. Meine Hightech-Bekleidung, von den Stiefeln bis zur Mütze mit Membranen bewehrt und mit Fleece gefüttert, erschien mir dagegen ziemlich übertrieben. Doch ich war kein Sibirier, war „nur“ ein Mitteleuropäer, der in der kältesten Ecke der nördlichen Erdkugel überwintern wollte.
Der Mann sprach Deutsch; ein sonderbares Deutsch, mit einem gewöhnungsbedürftigen Satzbau und einer mal schwäbischen, mal ostpreußischen Aussprache. Deutsch habe er von „armen“ Leuten gelernt, die im großen Krieg nach Sibirien gebracht wurden. Als ich ihn auf seine Kleidung ansprach, erzählte er, er sei ein Volganlar. Seine Vorfahren seien Nomaden gewesen. Sein Vater und die ganze Sippe seien es geblieben, trotz aller „Bekehrungsversuche“ der Russen. Die hätten sie nie „fangen“ können. Schließlich habe sich seine Familie weit nach Nordosten abgesetzt. Seine Mutter sei keine Volganlar. Sie gehöre zu einem anderen Volk. Auf meine Frage, was das für ein Volk sei, schwieg er erst, meinte dann, ich würde es doch nicht verstehen, sprach jedoch von Lukagiren. Die meisten von ihnen würden weit im Osten hinter den großen Flüssen leben. Flüsternd, als dürfe es niemand erfahren, erzählte er noch, eine Gruppe von ihnen wohne jedoch oft näher, jenseits des Werchojansker Gebirges, auch jetzt wieder. Bei der könnte seine Mutter sein. Ich sah ihn staunend an, denn ich verstand wirklich nichts. Er schüttelte den Kopf, versuchte es nochmal. Die Mutter wäre schon auch bei denen, aber eben nicht richtig. Man wisse nie genau, wo sie gerade ist, auch jetzt nicht, und ob sie überhaupt noch lebt. Sie sei eines Tages in das Lager seines Vaters gekommen, habe seine Kriegsverletzungen geheilt und war bei ihm geblieben; bis „er“ da war. Ich fragte neugierig: „Wer?“ „Ja ich, ich“, antwortete er. Seinem Vater habe die Mutter gesagt, der Junge würde „gebraucht“. Der Vater habe ihm erzählt, seine Mutter sei eine Schamanin und „Chefin“. Bevor ich wieder fragen konnte, erklärte er: „Mutter ist – war – Oberst bei ihrem Volk.“ Von diesem Volk wüssten Volganlar und Lukagiren schon seit vielen Generationen, doch keiner habe es jemals gesehen. Jetzt staunte ich nur noch. Er blickte stolz, doch auch etwas irritiert, um sich: „Ich nicht wissen, warum ich alles erzählen dir.“ Seine Leute sagen, die Mutter sei bald nach seiner Geburt verschwunden. Er schüttelte wieder den Kopf: „Das alles Schamanen. Mutter große ,Heilerin‘ und Schwester, halbe Schwester, auch.“ „Warum halbe Schwester?“, fragte ich. „Weil anderer Vater“, kam die Antwort. „Schwester mächtig große Zauberin, mehr als Mutter“, murmelte er ehrfürchtig und schüttelte sich, als wolle er damit nichts zu tun haben.
Wir schwiegen eine Weile. Dann kam er „zum Geschäft“, wollte wissen, was ich vorhabe und wohin ich wolle. Das fragte ich mich auch schon seit Monaten, wusste aber immer noch nicht, was ich im Osten Sibiriens eigentlich suchte. Mein Zögern irritierte ihn. Einer Eingebung folgend, sagte ich deshalb schnell: „Ins Werchojansker Gebirge und weiter zur Jana oder zur Quelle der Kolyma.“ Er sprang auf: „Wir gleich gehen; wenig Zeit.“ Dann setzte er sich wieder, lächelte etwas verlegen, glaubte wohl, ich habe ihn auf den Arm nehmen wollen. „Wohin du wollen?“, fragte er noch einmal, diesmal sehr ernst. Ich verstand. Um ausreichend Proviant und eine entsprechende Ausrüstung zu besorgen, brauchte er ein konkretes Ziel. Obwohl ich keins hatte, versuchte ich wenigstens, etwas konkreter zu werden. Viel kam nicht raus, eigentlich nur, dass ich bis zum nächsten Sommer in Sibirien, im Ostsibirischen Bergland, bleiben wollte. Er betrachtete mich abschätzend, stützte dann nachdenklich das Gesicht in die Hände und verharrte so. Als er mich wieder ansah, dachte ich: „Der hält dich für verrückt und geht einfach wieder.“ Doch er nickte. Ich sah ihn fragend an.
„Wir gehen zu Schwester, sie nur helfen kann.“